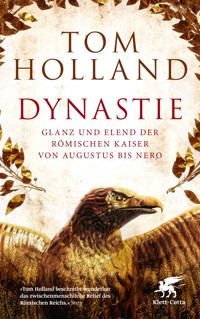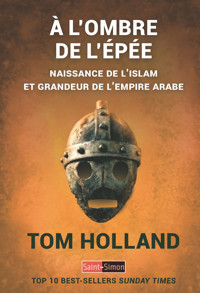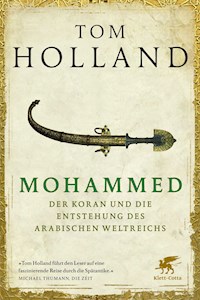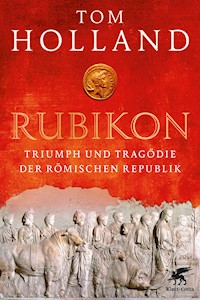
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aufstieg und Untergang der Römischen Republik: Mit stilistischer Brillanz und historischem Scharfsinn erzählt Tom Holland die römische Geschichte von ihren etruskischen Anfängen bis zur Ermordung Caesars. »Erzählte Geschichte vom Feinsten. Ein Buch, das mich wirklich gefesselt hat.« Ian McEwan »Eine atemberaubende und glänzend geschriebene Gesamtschau der Machtkämpfe im Rom von Caesar und Cicero.« Uwe Walter »Eine packende, spannende und ungemein unterhaltsame Darstellung der römischen Republik.« Books of the Year, Sunday Times »Tom Holland erzählt den Untergang der römischen Republik neu: ein geistreiches Werk. Hochaktuell.« Independent on Sunday
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
TOM HOLLAND
TRIUMPH UND TRAGÖDIEDER RÖMISCHEN REPUBLIK
Aus dem Englischenvon Andreas Wittenburg
Mit einem Nachwort von Uwe Walter
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Rubicon. The Triumph and Tragedy of the Roman Republic« im Verlag Little, Brown, London 2003
© 2003 by Tom Holland
Für die deutsche Ausgabe
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Umschlag: Rothfos und Gabler, Hamburg
Unter Verwendung folgender Fotos: Ausschnitt aus dem Altarfries vom Neptuntempel, Rom: © Louvre, Paris / Bridgeman Images und Münzbildnis Caesars, 44 v.Chr.: © akg-images
Die Karten im Innenteil sind aus der Originalausgabe übernommen, bearbeitet nach: Barrington Atlas of the Greek and Roman World (Princeton University Press, 2000), The Cambridge Ancient History Volume IX (Zweite Auflage) (Cambridge University Press, 1999) und The Times Atlas of World History (Times Books Limited, 1979).
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94924-7
E-Book: ISBN 978-3-608-10818-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Eliza.
Willkommen auf der Welt.
INHALT
Vorwort zur deutschen Neuausgabe
Vorwort
1 DIE WIDERSPRÜCHLICHE REPUBLIK
Stimmen der Vorfahren
Hauptstadt der Welt
Blut im Labyrinth
2 DER FLUCH DER SIBYLLE
Die Ausplünderung von Städten
Die Gefahr, an Gold zu ersticken
Die Posaunen des Himmels
3 GLÜCK BEI DEN FRAUEN
Die Rivalen
Das Undenkbare denken
Ein schlechter Witz
4 RÜCKKEHR DES EINGEBORENEN
Sulla Redux
Sulla Felix
Der Diktator Sulla
5 DER DRANG ZUM RUHM
Der Erfolg eines Patriziers
Runden auf der Rennbahn
Der Bulle und der Jüngling
Der Schatten des Gladiators
6 EIN FEST FÜR DIE AASGEIER
Der Prokonsul und die Könige
Der Krieg gegen den Terror
Der neue Alexander
7 DER FLUCH DES WOHLLEBENS
Schatten im Fischteich
Die Partygesellschaft
Die Verschwörung des Caelius
Der Skandal
8 DAS TRIUMVIRAT
Catos gewagtes Spiel
Clodius erhöht den Einsatz
Caesars Gewinnsträhne
Pompeius spielt wieder mit
9 DIE SCHWINGEN DES IKARUS
Crassus verliert seinen Kopf
Ad Astra
Die Trauer um Elefanten
Die sichere gegenseitige Vernichtung
10 DER WELTKRIEG
Blitzkrieg
Das Siegesfest des Pompeius
Die Königin einer Weltstadt
Der Anti-Cato
11 DER TOD DER REPUBLIK
Der letzte Widerstand
Der Gewinner nimmt sich alles
Die Wiederherstellung der Republik
Danksagung
Nachwort von Uwe Walter
Anmerkungen
Verzeichnis der Karten im Text
Zeittafel
Bibliografie
Register
VORWORTZUR DEUTSCHEN NEUAUSGABE
Alle Geschichte«, hat der italienische Philosoph Benedetto Croce einmal geschrieben, »ist Zeitgeschichte.« Er meint damit, dass Historiker nicht anders können, als bei ihrem Verständnis der Vergangenheit von den Vorurteilen und Sorgen ihrer eigenen Zeit beeinflusst zu sein, und dass ein jeder, der über längst untergegangene Völker schreibt, sich dessen bewusst sein sollte. Seit der Zeit, in der ich dieses Buch zu Ende geschrieben habe, sind die Römer mir fremder geworden. Die Bekehrung ihres Reichs zum Christentum steht wie eine Wasserscheide zwischen uns und der vorchristlichen Welt. Ich habe mich inzwischen fast ein ganzes Jahrzehnt damit beschäftigt, den Prozess zu erforschen und zu beschreiben, durch den verschiedene monotheistische Religionen in den Jahrhunderten nach der Bekehrung Konstantins zu Staatsreligionen wurden. Die Folge dieser Vorgänge war, wie mir scheint, eine so radikale Veränderung moralischer Werte und Empfindungen, dass auf lange Sicht dadurch das Ende der Antike eingeleitet wurde. Heute erscheint mir die Welt Caesars und Ciceros fremder als zu der Zeit, als ich dieses Buch schrieb.
Aber das ist noch nicht alles. Im 21. Jahrhundert ist die Gewohnheit, bei der Betrachtung der Klassischen Welt nach Parallelen zur Gegenwart zu suchen, noch wesentlich deutlicher ausgeprägt als am Ende des 20. Jahrhunderts. In den späten 90er Jahren, als ich erstmals erwog, über den Untergang des Römischen Reichs zu schreiben, wurden noch sehr wenige Darstellungen der Römischen Geschichte veröffentlicht, die sich an das allgemeine Publikum wandten. Obwohl der Fall der Berliner Mauer, der das Ende der Nachkriegsordnung bedeutete, schon ein ganzes Jahrzehnt her war, schien doch damals immer noch der Grundgedanke vorzuherrschen, dass eine ernstzunehmende Geschichtsschreibung Gedanken zu Nationalsozialismus und Sowjetherrschaft einschließen müsse. Dennoch wurde mit dem Ende des Kalten Krieges schon deutlich, dass lange unterdrückte Identitäten und Hassgefühle aus dem schmelzenden Dauerfrost hervorwuchsen. Viele Konflikte, die sich über die 90er Jahre hinzogen – auf dem Balkan, im Kaukasus, in der früheren Provinz Judäa des Römischen Reichs –, hatten sehr viel ältere Wurzeln als Hitler und Stalin. Altertumswissenschaft begann, wie es mir schien, erstaunlich aktuell zu werden.
Und diese Tendenz sollte sich noch verstärken. Damals, im Jahre 2000, als ich meine Vorstellungen über die Römische Republik entwickelte, war Globalisierung das allgegenwärtige Schlagwort. Das Bewusstsein einer kleiner werdenden Welt, das die gegensätzlichen Gefühle des Triumphs und der Besorgnis auslösten – das war doch sicher ein Aspekt der antiken Geschichte, den die Starbucks-Zeit interessant finden sollte? »Zu diesem Zeitpunkt«, schrieb Petronius über die letzte Generation der Republik, »hatte der römische Eroberer die ganze Welt in seiner Gewalt, das Meer, das Land, den Lauf der Sterne. Doch er wollte immer noch mehr.« Das war eine Beobachtung, von der ich mir vorstellen konnte, dass sie Demonstranten am 1. Mai aufnehmen könnten, und vielleicht auch Bill Gates.
Doch als ich im Sommer 2001 begann mein Buch zu schreiben, waren die Römer der Späten Republik dabei, ein noch verblüffenderes Beispiel zu werden. Da gab es insbesondere eine Herausforderung, die sich mir mehr als alle anderen stellte: Wie sollte ich vorgehen, um die gewundene Entwicklung der römischen Politik im Nahen Osten und ihren Weg von schlichter Gewaltandrohung zu brutaler Direktherrschaft für den allgemeinen Leser interessant zu machen? Als Erzählung war die Angelegenheit natürlich nicht ohne dramatische Höhepunkte: Am 11. September 2001 schrieb ich gerade über die asiatische Vesper oder Vesper von Ephesos, bei der es sich um das organisierte Massaker von 80000 römischen und italischen Kaufleuten in einer einzigen Nacht handelte. Für dieses schauerliche Verbrechen war der machtgierige vorderasiatische Despot Mithridates verantwortlich. Nachdem die Römer eine Strafexpedition gegen sein Heer unternommen hatten, gaben sie sich damit zufrieden, ihm einen drastischen Friedensvertrag zu diktieren, ließen ihn aber abgesehen davon unbehelligt. Die ganzen nächsten fünfzehn Jahre juckte es sie, diesen Fehler wiedergutzumachen. Zahlreiche Kriegsgründe wurden vorgebracht, darunter dass Mithridates die ihm auferlegten Waffenbeschränkungen überschritten und dass er Terroristen aktiv unterstützt habe. Am Ende obsiegten die Falken in Rom. Im Jahre 74 v.Chr. wurde Mithridates der Krieg erklärt, und nach ersten Misserfolgen wurde sein Regime gestürzt. Und über all das schrieb ich im Frühjahr 2002, als die ersten Sturmwolken der Irak-Krise am politischen Horizont aufzuziehen begannen.
Als ich mit meiner Erzählung fortfuhr, bekam das, was ich schrieb, immer wieder einen unheimlichen Nachgeschmack durch das, was ich in den Abendnachrichten hörte. Als die Römer Mithridates in einer dramatischen Schnitzeljagd durch die Wildnis Armeniens vor sich hertrieben, durchkämmten die amerikanischen Spezialeinheiten Afghanistan auf der Suche nach Osama bin Laden. Als das Römische Volk viele seiner traditionellen Freiheiten aussetzte, um dem Krieg gegen Terrorzellen düsterer ›Piraten‹ größere Durchschlagskraft zu verleihen, wurden gerade umfassende neue Antiterrorgesetze verabschiedet. Als der künftige Kaiser Augustus falsche Beweise gegen Antonius und Kleopatra fabrizierte, veröffentlichte die britische Regierung ihre Beweisakten gegen Saddam Hussein.
Das sind vielleicht in dieselbe Richtung weisende zufällige Parallelen, aber sie sind doch, wie ich hoffe, für einen umfassenderen Vergleich, den sie nahelegen, von Interesse. Mein Selbstvertrauen war, wenn ich das so sagen darf, dadurch gestärkt, dass ich mit dieser Sicht in die Fußstapfen des größten Historikers trete, der je in meiner Muttersprache über Rom geschrieben hat: Edward Gibbon. Im Februar 1776, kurz nach der Veröffentlichung des 1. Bandes seines Werks zu Verfall und Untergang des römischen Imperiums, zog er einen ironischen, aber doch leidvollen Vergleich zwischen den lange zurückliegenden Ereignissen des 3. Jahrhunderts n.Chr. und der schweren Krise, die sein eigenes Land bedrohte. Als die britischen Kolonien in Amerika am Rande der offenen Revolte standen, richtete Gibbon seinen Blick auf das Land jenseits des Antlantiks und wagte es, den Zusammenbruch der britischen Macht für möglich zu halten. »Der Niedergang der zwei Reiche, des Römischen und des Britischen«, schrieb er in einem Brief an einen Freund, »vollzieht sich in einem vergleichbaren Fortschreiten.«
Wenn ich mein Buch dem deutschen Leser vorlege, bin ich mir des Umstands bewusst, dass ich Erbe dieser besonderen Tradition erzählender Geschichte bin, die noch heute den deutlichen Stempel Edward Gibbons trägt. Die deutsche Altertumswissenschaft, die immer noch die hervorragendste und gelehrteste der Welt ist, und das seit den Tagen Theodor Mommsens schon immer war, ist ihrem Wesen nach anders. In England heißt es, man bringe »Kohlen nach Newcastle«, oder in der Antike »Eulen nach Athen«. Für einen fremden Autor, der über die Antike schreibt, gibt es keine größere Ehre, als auf Deutsch veröffentlicht zu werden. Mein Dank gilt all denen, die das ermöglicht haben – und Ihnen, dem Leser, dass Sie dieses Buch zur Hand genommen haben.
Ich hoffe, Sie haben Freude daran.
London, im Mai 2015Tom Holland
VORWORT
Es war am 10. Januar im siebenhundertfünften Jahr nach der Gründung Roms und im neunundvierzigsten vor Christi Geburt. Die Sonne war längst hinter dem Apennin untergegangen. In geschlossener Marschkolonne standen Soldaten der 13. Legion im Dunkeln beisammen. Die Nacht wird bitterkalt gewesen sein, aber sie waren an extreme Bedingungen gewöhnt. Acht Jahre lang waren sie dem Statthalter Galliens auf seiner blutigen Kampagne gefolgt, Schlacht auf Schlacht, durch Eis und Schnee oder die Sommerhitze, bis ans Ende der Welt.
Doch jetzt, nach ihrer Rückkehr aus der barbarischen Wildnis des Nordens, sahen sie sich mit einer ganz anderen Aufgabe konfrontiert. Vor ihnen lag ein schmaler Fluss. Auf der Seite, wo die Legionäre standen, war Gallien; auf der anderen lagen Italien und der Weg nach Rom. Überschritten sie diesen Fluss, würden die Soldaten der 13. Legion ein kapitales Verbrechen begehen. Sie würden nicht einfach die Grenze zu Italien überschreiten, sondern sich über die strengste aller Regeln des römischen Volkes hinwegsetzen. Mit ihrem Vorgehen würden sie den Bürgerkrieg auslösen – eine Katastrophe, zu der sich die Legionäre mit ihrem Vorrücken bis dorthin bereit und gestählt gezeigt hatten. Während sie gegen die Kälte anstampften, warteten sie auf das Signal der Trompeten, die zum Vormarsch blasen sollten: Schultert die Waffen, rückt vor und überschreitet den Rubikon.
Aber wann würde das Signal ertönen? Leise plätschernd konnte man den Fluss hören, der durch die Schneeschmelze in den Bergen angeschwollen war, doch die Trompeten waren noch immer nicht zu hören. Die Soldaten der 13. Legion spitzten die Ohren. Sie waren es nicht gewohnt zu warten. Normalerweise, würde eine Schlacht bevorstehen, wären sie bereits vorgerückt und hätten wie ein Blitz eingeschlagen. Ihr General, der Statthalter von Gallien, war ein Mann, den man im Allgemeinen für seinen Tatendrang, seine Überraschungstaktik und Schnelligkeit feierte. Aber dies war nicht nur eine kurze Verzögerung. Er hatte ihnen den Befehl zum Überschreiten des Rubikons bereits am Nachmittag gegeben. Warum also hatte man ihnen plötzlich den Stillstand befohlen, wo sie doch endlich an der Grenze angekommen waren? Nur wenige konnten ihren General dort in der Dunkelheit sehen, aber den Offizieren seines Stabes, die in seiner Nähe waren, schien er sich in quälender Unentschlossenheit zu befinden. Statt seine Männer vorrücken zu lassen, hatte er in die trüben Wasser des Rubikons gestarrt und kein Wort gesagt. Und seine Gedanken hatten in der Stille gearbeitet.
Bei den Römern gab es ein Wort für eine derartige Situation: Discrimen – ein Augenblick gefahrvoller und marternder Spannung, in dem die Errungenschaften eines ganzen Lebens auf dem Spiel stehen. Die Karriere Caesars war wie die eines jeden Römers, der nach persönlicher Größe strebte, eine stetige Folge solch kritischer Momente gewesen. Immer wieder hatte er seine Zukunft aufs Spiel gesetzt und immer wieder war er als Sieger hervorgegangen. In den Augen der Römer war es das, was einen echten Mann ausmachte. Doch das Dilemma, dem sich Caesar am Ufer des Rubikons gegenübersah, war auf einzigartige Weise quälend, umso mehr, als es die Konsequenz seiner vorausgegangenen Erfolge war. In weniger als zehn Jahren hatte er achthundert Städte, dreihundert Stämme und ganz Gallien unterworfen, doch übergroßer Erfolg konnte bei den Römern ebenso Anlass zu Bewunderung wie zu Besorgnis sein. Sie waren schließlich Bürger einer Republik, und keinem Einzelnen war es erlaubt, seine Mitbürger auf Dauer in den Schatten zu stellen. Caesars Gegner hatten seit langem aus Neid und Furcht alles unternommen, um ihm sein Kommando zu entziehen. Jetzt, im Winter 49 v.Chr., war es ihnen endlich gelungen, ihn in Bedrängnis zu bringen. Der Augenblick der Wahrheit war für Caesar gekommen. Er konnte entweder dem Gesetz gehorchen, sein Kommando abgeben und sich mit dem Ende seiner Karriere abfinden, oder er überschritt den Rubikon.
»Die Würfel sind gefallen.«1* Nur als Spieler und in Spielleidenschaft war Caesar schließlich in der Lage, seinen Legionären den Vormarsch zu befehlen. Für ein rationales Kalkül war das Wagnis zu hoch und der Ausgang zu ungewiss. Caesar wusste, dass er einen Weltkrieg riskierte, wenn er in Italien einmarschierte, denn das hatte er seinen Weggefährten gegenüber zugegeben, und ihm hatte bei der Aussicht geschaudert. Doch so hellsichtig er auch war, selbst er konnte die volle Konsequenz seiner Entscheidung nicht voraussehen. Außer »Wendepunkt« hatte discrimen noch eine andere Bedeutung: Trennlinie. Und als solche sollte sich der Rubikon in jeder Hinsicht erweisen. Mit seiner Überschreitung stürzte Caesar tatsächlich die Welt in den Krieg, aber er trug auch zur Zerstörung der althergebrachten Freiheiten Roms bei und zur darauf folgenden Errichtung einer Monarchie. All das waren entscheidende Ereignisse für die Geschichte des Okzidents. Lange nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches sollten die durch den Rubikon geteilten Gegensätze – Freiheit und Despotismus, Ordnung und Anarchie, Republik und Gewaltherrschaft – die Vorstellungen der Erben Roms beherrschen. Der Fluss war so schmal und unbedeutend, dass man am Ende sogar vergessen hatte, wo er überhaupt lag, aber sein Name ist bis heute in Erinnerung geblieben. Das ist nicht verwunderlich. Caesars Überschreiten des Rubikons war so schicksalhaft, dass es für jeden schicksalhaften Schritt steht, den man seither unternommen hat.
Mit Caesars Befehl ging eine Epoche der Geschichte zu Ende. Einst hatte es freie Städte gegeben, die sich über den gesamten Mittelmeerraum verteilten. In der griechischen Welt und auch in Italien wurden diese Städte von Menschen bewohnt, die sich nicht als Untertanen eines Pharaos oder eines Königs der Könige verstanden, sondern als Bürger. Menschen, die sich stolz auf jene Werte beriefen, die sie von Sklaven unterschieden: Redefreiheit, Privatbesitz, Zugang zum Rechtsweg. Doch mit dem Aufstieg neuer Reiche, zuerst dem Alexanderreich und denen seiner Nachfolger und dann dem Römischen Reich, war die Unabhängigkeit dieser Bürger überall unterdrückt worden. Im 1. Jahrhundert v.Chr. war nur noch eine einzige freie Stadt übrig – Rom. Und dann überschritt Caesar den Rubikon, die Republik fiel in sich zusammen und es gab gar keine mehr.
Das Ergebnis war, dass tausend Jahre bürgerlicher Selbstverwaltung ihr Ende fanden, und für weitere tausend Jahre oder mehr sollte diese Regierungsform nicht von neuem Realität werden. Seit der Renaissance hat es viele Versuche gegeben, den Rubikon wieder in anderer Richtung zu überschreiten, zu seinem anderen fernen Ufer zu gelangen und die Gewaltherrschaft hinter sich zu lassen. Die englische, amerikanische und Französische Revolution beriefen sich ausdrücklich auf das Vorbild der Römischen Republik. »Was die Rebellionen gegen die Monarchie im Besonderen betrifft, so ist eine ihrer häufigsten Ursachen die Lektüre der politischen und historischen Schriften der alten Griechen und Römer«, beklagte sich Thomas Hobbes.1 Natürlich war der Wunsch nach einer freien Republik nicht die einzige Lehre, die man aus den dramatischen Ereignissen der Geschichte der Römischen Republik ziehen konnte. Es war schließlich kein geringerer als Napoleon, der sich erst Konsul und dann Kaiser nannte, und die am meisten verwendete Bezeichnung für das bonapartistische Regime war im ganzen 19. Jahrhundert der »Cäsarismus«. In den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, als die Republiken überall zusammenzubrechen schienen, waren alle, die über ihr Ende jubelten, schnell bereit, auf die Parallelen zum Todeskampf des antiken Vorbilds hinzuweisen. Im Jahr 1922 ließ Mussolini gezielt den Mythos eines heroischen und dem Vorgehen Caesars vergleichbaren Marsches auf Rom verbreiten. Und er war nicht der Einzige, der tatsächlich glaubte, dass ein neuer Rubikon überschritten worden war. »Das Braunhemd wäre vielleicht nicht entstanden ohne das Schwarzhemd«, räumte Hitler später ein. »Der Marsch auf Rom 1922 war einer der Wendepunkte der Geschichte.«2
Mit dem Faschismus erreichte eine lange Tradition abendländischer Politik ihren abstoßenden Höhepunkt und fand dann ihr Ende. Mussolini war der letzte führende Politiker, der sich auf das Beispiel des antiken Roms berief. Die Faschisten schlug Roms Grausamkeit, sein prahlerischer Stolz und sein Waffengeklirr in den Bann, aber heute sind selbst Roms höchste Ideale wie die aktive Bürgerbeteiligung, die Thomas Jefferson einst so begeisterte, aus der Mode gekommen. Sie sind zu streng und zu ernsthaft. Kaum etwas in unserer militant postmodernen Welt könnte stärkeres Missfallen erregen als das Beispiel des klassischen Roms. Die Römer als Helden zu verehren ist völlig veraltet und gehört ins 19. Jahrhundert. Wir haben uns, wie John Updike vor einigen Jahren sagte, »von der Unterdrückung durch all diese alten römischen Werte« befreit.3 Sie werden nicht mehr wie in den vorangegangenen Jahrhunderten als wichtigste Quelle unserer modernen Bürgerrechte angesehen. Nur wenige stellen sich heute noch die Frage, weshalb eigentlich auf einem den Römern unbekannten Kontinent ein zweiter Senat auf einem zweiten Kapitol tagt. Der Parthenon mag in unserer Vorstellung noch hell leuchten, doch das Forum zeigt allenfalls einen schwachen Glanz.
Und dennoch machen wir uns etwas vor in den westlichen Demokratien, wenn wir unsere Wurzeln allein auf Athen zurückführen. Im Guten wie im Bösen sind wir gleichermaßen Erben der Römischen Republik. Wäre der Titel nicht bereits vergeben, hätte ich dieses Buch Bürger genannt, denn sie sind die Hauptdarsteller, und der Zusammenbruch der Römischen Republik ist ihre Tragödie. Auch das römische Volk war am Ende seiner alten Tugenden müde und zog es vor, fortan die Bequemlichkeiten der Sklaverei und des Friedens zu genießen. Man wollte lieber Brot und Spiele, als sich in endlosen Kriegen gegenseitig umzubringen. Wie die Römer selbst erkannten, trug ihre Freiheit die Saat ihres eigenen Untergangs in sich, und dieser Gedanke gab hinreichenden Anlass zu manch trüben moralisierenden Gedanken unter der Herrschaft Neros und Domitians. Und in den nachfolgenden Jahrhunderten hat diese Art von Überlegungen niemals ihre beunruhigende Wirkung verloren.
Wenn man behauptet, dass römische Freiheit einst mehr war als nur ein hochtrabender Schwindel, so soll das natürlich nicht heißen, dass die Römische Republik je ein Paradies sozialer Demokratie und Gerechtigkeit gewesen sei. Das war sie sicher nicht. Freiheit und Gleichheit waren für die Römer verschiedene Dinge. Nur unter aneinander geketteten Sklaven gab es echte Gleichheit. Für einen Bürger stellte der Wettbewerb sein Lebenselixier dar; Reichtum und Wählerstimmen waren der Maßstab für Erfolg. Im Übrigen war die Republik natürlich eine Supermacht mit einer Reichweite und Überlegenheit, die in der Geschichte des Okzidents neu waren. Tatsachen, die die Bedeutung der Republik für unsere heutige Zeit entscheidend prägen.
In der Zeit, seit ich begonnen habe, dieses Buch zu schreiben, ist der Vergleich zwischen Rom und den Vereinigten Staaten von Amerika eine Art Klischee geworden. Die Erfahrung, vom Zeitgeschehen überholt zu werden, ist für den Historiker alltäglicher, als man meinen sollte. Es kommt häufig vor, dass Epochen, die zunächst fremd und fern erscheinen, plötzlich und in Besorgnis erregender Weise in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Die Welt der klassischen Antike, die unserer Epoche zugleich so ähnlich und so völlig anders erscheint, hat zu allen Zeiten diese Qualität eines Kaleidoskops gehabt. Vor vielen Jahrzehnten, am Ende der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts, sah der große Ronald Syme, Historiker in Oxford, im Aufstieg der Caesaren eine »Römische Revolution« und ein Modell für das Zeitalter der faschistischen und kommunistischen Diktatoren. Rom ist immer wieder in derartiger Weise im Licht der weltgeschichtlichen Erschütterungen verstanden und neu interpretiert worden. Syme war der Erbe einer langen und ruhmreichen Tradition: Sie reicht zurück bis auf Machiavelli, der aus der Geschichte der Römischen Republik Lehren für seine Heimatstadt Florenz zog, und auch im Hinblick auf Cesare Borgia, jenen Namensvetter des Totengräbers der Republik. »Nicht unüberlegt noch ohne Grund pflegen kluge Männer zu sagen, dass um vorauszusehen, was sein wird, man betrachten müsse, was gewesen ist; denn alle Begebenheiten sind jederzeit nur die Gegenstücke zu irgendeinem Ereignis der Vergangenheit.«4 Es gibt wohl Zeiten, denen diese Sicht der Dinge fern liegen mag, und andere, denen sie zutreffend erscheint, und unsere heutige gehört sicher zu letzteren. Rom war die erste und bis vor kurzem einzige Republik, die zur Stellung einer Weltmacht gelangte, und es ist in der Tat schwierig, eine andere Episode der Geschichte zu finden, die unserer eigenen Zeit fesselnder einen Spiegel vorhält. Es sind nicht allein die groben geopolitischen Umrisse oder die Globalisierung und die Pax Americana, die man, wenn auch in schwachen und verzerrten Konturen, in diesem Spiegel erblicken kann. Auch unsere eigenen Marotten und fixen Ideen, von den japanischen Zierkarpfen über den Jargon künstlicher Vulgärsprache bis zu den Meisterköchen, werden dem Historiker der Römischen Republik zu einer Art Déjà vu.
Aber Parallelen zu ziehen kann trügerisch sein. Es versteht sich von selbst, dass die Römer unter physischen, emotionalen und intellektuellen Bedingungen lebten, die sich grundlegend von den unseren unterscheiden. Nicht immer sind die Aspekte ihrer Zivilisation mit unseren vergleichbar. Und tatsächlich können die Römer uns dann am fernsten stehen, wenn sie uns am vertrautesten erscheinen. Ein antiker Dichter, der die Grausamkeit seiner Geliebten beklagt, oder ein römischer Vater, der seine Tochter betrauert, sprechen uns heute direkt an und scheinen ewig dauernde menschliche Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Wie völlig fremd erscheinen uns demgegenüber die Ansichten eines Römers über sexuelle Beziehungen oder das Familienleben! Dasselbe gilt für die Ideale, welche die Republik erfüllten, und für die Wünsche der Bürger oder die Rituale und Regeln ihres täglichen Lebens. Wenn wir diese Aspekte begreifen, kann vieles, was uns an den Taten der Römer abschreckt und in unseren Augen ganz offensichtliche Verbrechen darstellt, zwar nicht vergeben, aber doch besser verstanden werden. Das Blutvergießen in der Arena, die Vernichtung einer großen Stadt, die Eroberung der Welt – all diese Taten können in den Augen der Römer als rühmliche Erfolge gelten. Nur wenn wir ihre Gründe dafür begreifen, können wir hoffen, die Republik selbst zu verstehen.
In die Gedankengänge einer längst vergangenen Epoche einzudringen, ist natürlich ein gewagtes und verzweifeltes Unternehmen. Nun sind die letzten zwanzig Jahre der Republik die am besten überlieferte Epoche der römischen Geschichte mit einem wahren Schatz an Quellen für den Althistoriker – Reden, Memoiren und sogar Privatkorrespondenz. Doch selbst diese Vielzahl an Quellen ist nur ein schwach schimmernder Reichtum in immenser Dunkelheit. Eines Tages, wenn die Quellen für das 20. Jahrhundert so lückenhaft geworden sind wie die des antiken Roms, wird man vielleicht eine Geschichte des Zweiten Weltkriegs schreiben, die nur auf den Rundfunkansprachen Hitlers und den Memoiren Churchills beruht. Diese Geschichte wird dann von allen Erfahrungsebenen abgeschnitten sein: keine Briefe von der Front, keine Tagebücher der Soldaten. Das Schweigen ist etwas, mit dem der Historiker der Antike nur allzu vertraut ist, denn, um die Worte Fluellens in Shakespeares König Heinrich der Fünfte hier in negativem Sinn aufzufassen, man kann sagen, »dass im Lager des Pompeius kein Schnickschnack und kein Wischewasche ist«.5 Und auch aus der Bauernkate ist nichts zu hören, ebenso wenig aus der Hütte im Armenviertel oder der Baracke der Sklaven, die auf dem Feld arbeiteten. Zwar kann man die Stimmen der Frauen gelegentlich vernehmen, aber nur die der ganz vornehmen, und auch das immer nur dann, wenn sie von Männern zitiert oder falsch wiedergegeben werden. Wenn man in der römischen Geschichte nach Einzelheiten über Menschen außerhalb der regierenden Oberschicht sucht, fühlt man sich wie ein Goldgräber.
Selbst die Berichte über große Ereignisse und herausragende Männer, so großartig sie auch erscheinen mögen, sind in Wahrheit verstümmelte Fragmente, vergleichbar einem Aquädukt in der römischen Campagna: weit gespannte Bögen und daneben plötzlich ein leeres Stoppelfeld. Die Römer selbst hatten immer befürchtet, dass sie eben dieses Schicksal ereilen würde. Sallust, ihr erster großer Historiker, sagte dazu: »Aber wirklich, in allem herrscht das Glück; alle Dinge macht es berühmt oder verdunkelt es mehr nach Willkür als aus Gerechtigkeit.«6 Ironischerweise sollte das Schicksal seiner eigenen Werke diese bittere Feststellung untermauern. Sallust war Gefolgsmann Caesars und schrieb eine Geschichte der Jahre unmittelbar vor der Machtergreifung seines Gönners. Das Werk wurde von seinen Lesern einstimmig als gültige Darstellung gefeiert. Wäre es erhalten geblieben, besäßen wir einen zeitgenössischen Bericht über das Jahrzehnt von 78 bis 67 v.Chr., das reich an entscheidenden und dramatischen Ereignissen war. Aber leider sind von seinem Meisterwerk nur wenige verstreute Fragmente tradiert. Aus ihnen und aus anderen bruchstückhaften Informationen kann man noch heute einen Bericht rekonstruieren, der Rest ist wohl für immer verloren.
Es ist kein Wunder, dass Althistoriker zu der Befürchtung neigen, sie könnten allzu dogmatisch wirken. Schreibt man auch nur einen einzigen Satz über die Antike, läuft man schon Gefahr, eine Bewertung vorzunehmen. Selbst wenn ausführliche Quellen vorliegen, tauchen überall Unsicherheiten und Widersprüche auf. Nehmen Sie zum Beispiel die Überschreitung des Rubikons. Dass diese so stattgefunden hat, wie ich es anfangs beschrieben habe, ist wahrscheinlich, aber keineswegs sicher. Eine Quelle berichtet uns, dass der Fluss nach Sonnenaufgang überschritten wurde. Andere sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als Caesar am Flussufer ankam, eine Vorhut bereits nach Italien vorgedrungen war. Selbst das genaue Datum kann nur anhand anderer Ereignisse erschlossen werden. In der Forschung hat man sich auf den 10. Januar 49 v.Chr. geeinigt, aber es wurden auch alle folgenden Tage bis zum 14. Januar als Datum vertreten, und im Übrigen ist das, was die Römer Januar nannten, – dank der Launen des vorjulianischen Kalenders – nach unserer Zeitrechnung November.
Kurz gesagt sollte der Leser dieses Buches sich an die Faustregel halten, dass vielen der dargelegten Tatsachen mit gutem Grund durch eine gegensätzliche Interpretation widersprochen werden könnte. Aber ich will doch unmittelbar hinzufügen, dass das keine Aufforderung sein soll, die Flinte ins Korn zu werfen. Es handelt sich vielmehr um eine notwendige Vorbemerkung zu einem Bericht, der aus den Scherben der Überlieferung zusammengesetzt ist und versucht, einige der auffälligeren Bruchstellen und Löcher zu überdecken. Dass es überhaupt möglich ist, das zu tun, und dass man tatsächlich aus den Ereignissen am Ende der Republik eine zusammenhängende Erzählung formen kann, war immer einer der großen Reize dieser Epoche für den Althistoriker. Ich sehe nicht den geringsten Grund, mich für mein Vorgehen entschuldigen zu müssen.
Nach einer langen Periode der Ungnade ist das Erzählen von Geschichte heute wieder groß in Mode gekommen. Selbst wenn die Erzählung, wie viele betont haben, nur möglich ist, wenn man den verstreuten Ereignissen der Vergangenheit ein erfundenes Muster aufdrückt, muss das an sich noch keinen Nachteil bedeuten. Sie kann vielmehr helfen, uns das Denken der Römer näher zu bringen. Es kam nämlich selten vor, dass ein Bürger sich nicht als Held seiner eigenen Geschichte sah. Das war zwar eine Einstellung, die viel dazu beitrug, Rom ins Verderben zu stürzen, aber sie verlieh dem Epos vom Untergang der Republik auch sein leuchtendes und heroisches Kolorit. Gerade mal eine Generation danach schüttelte man bereits verwundert den Kopf und war erstaunt, dass es eine solche Zeit und solche Giganten überhaupt gegeben haben konnte. Ein halbes Jahrhundert später ließ Velleius Paterculus, der den Kaiser Tiberius rühmte, sich dazu hinreißen auszurufen, es möge »fast überflüssig erscheinen, an die Zeiten so außerordentlicher Männer zu erinnern«7 – und anschließend tat er genau das. Er wusste wie alle Römer, dass sich das Genie ihres Volkes am rühmlichsten durch große Taten und bemerkenswerte Leistungen entfaltet hatte. Deshalb war es die Erzählung, die dieses Genie am besten verständlich machte.
Mehr als zwei Jahrtausende nach dem Zusammenbruch der Republik erregt der »außerordentliche Charakter« der Männer (und Frauen), die in diesem Drama eine Rolle spielten, noch immer Erstaunen. Aber das gilt auch für die Römische Republik selbst, die zwar der Allgemeinheit weniger gut bekannt ist als ein Caesar, ein Cicero oder eine Kleopatra, die aber doch bemerkenswerter ist als jede dieser Persönlichkeiten. Obgleich es vieles an ihr gibt, was wir niemals in Erfahrung bringen werden, gibt es doch anderes, was wieder lebendig werden kann. Ihre Bürger kommen hinter dem antiken Marmor zum Vorschein, die Gesichter durch einen Hintergrund von Gold und Feuer erleuchtet – der Glanz einer fremden und manchmal doch beklemmend vertrauten Welt.
Alle Menschen lieben von Natur aus die Freiheitund hassen die Sklaverei.
Caesar, Gallischer Krieg 3, 10, 3
Denn nur wenige Menschen wollen die Freiheit,ein großer Teil aber gerechte Herren.
Sallust, Historien (Brief des Mithridates 18)
1DIE WIDERSPRÜCHLICHE REPUBLIK
Stimmen der Vorfahren
Anfangs, vor Beginn der Republik, wurde Rom von Königen regiert. Über einen dieser Könige, den anmaßenden Tyrannen Tarquinius, erzählte man folgende düstere Geschichte: Eines Tages ist eine alte Frau zu ihm in seinen Palast gekommen. Sie hatte neun Bücher bei sich. Als sie sie Tarquinius zum Kauf anbot, lachte der sie aus, weil der geforderte Preis so exorbitant sei. Die alte Frau machte nicht den geringsten Versuch, mit ihm zu handeln, sondern drehte sich um und ging. Sie verbrannte drei der Bücher, erschien dann von neuem vor dem König und bot ihm die sechs übrig gebliebenen Bücher zum selben Preis an. Der König war zwar inzwischen unsicher geworden, lehnte das Angebot aber ein zweites Mal ab, und die alte Frau kehrte ihm wieder den Rücken und ging. Tarquinius war jetzt unruhig geworden, weil er nicht wusste, was er abgelehnt hatte, und als das geheimnisvolle alte Weib noch einmal auftauchte und diesmal nur drei Bücher bei sich hatte, kaufte er sie sofort, obwohl er den Preis zahlen musste, den sie zu Beginn für alle neun gefordert hatte. Die alte Frau nahm ihr Geld und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Wer war sie? Ihre Bücher enthielten Weissagungen von solcher Kraft, dass die Römer bald erkannten, dass nur eine sie verfasst haben konnte: die Sibylle. Doch aus dieser Feststellung ergaben sich nur weitere Fragen, denn die Geschichten, die man über die Sibylle erzählte, waren sonderbar und verwirrend. Man ging davon aus, dass sie den Trojanischen Krieg vorausgesagt hatte, und diskutierte darüber, ob sich hinter ihrem Namen zehn Wahrsagerinnen verbargen oder ob sie unsterblich sei oder tausend Jahre lebe. Einige weniger Gutgläubige fragten sich sogar, ob es sie überhaupt gegeben habe. In der Tat konnte man nur zwei Dinge wirklich mit gutem Gewissen sagen: dass ihre unbeholfen und in altertümlichem Griechisch geschriebenen Bücher tatsächlich existierten und dass man aus ihnen die Umrisse zukünftiger Ereignisse herauslesen konnte. Durch Tarquinius’ Glückskauf fanden sich die Römer im Besitz eines Fensters, durch das sie die Zukunft der Welt erblicken konnten. Allerdings hat dies Tarquinius auch nicht viel geholfen: Im Jahr 509 v.Chr. fiel er einer Palastverschwörung zum Opfer. Über zweihundert Jahre lang, seit der Gründung der Stadt, hatten Könige über Rom geherrscht, und Tarquinius, der siebte König, sollte der letzte sein.2* Mit seiner Vertreibung wurde auch die Monarchie beseitigt und an ihrer Stelle eine freie Republik errichtet. Von diesem Zeitpunkt an war der Königstitel bei den Römern mit fast krankhaftem Hass belegt. Freiheit war die Parole bei der Verschwörung gegen Tarquinius gewesen, und Freiheit, das heißt die Freiheit einer Stadt, die keinen Herren hatte, wurde fortan zum angestammten Recht und Maßstab für jeden Bürger. Um diese Freiheit vor den Ambitionen aller zukünftigen Tyrannenanwärter zu schützen, einigten sich die Gründerväter der Republik auf eine bemerkenswerte Formel. Mit Bedacht teilten sie die Macht des vertriebenen Tarquiniers unter zwei Beamten auf, die beide durch Wahl bestimmt wurden und von denen keiner länger als ein Jahr im Amt bleiben durfte. Das waren die Konsuln.3* Ihre Stellung an der Spitze ihrer Mitbürger und die Wachsamkeit des einen gegen die Ambitionen des anderen waren aktiver Ausdruck des Grundprinzips der Republik: Nie wieder sollte es einem einzelnen Mann erlaubt sein, an höchster Stelle und allein in Rom zu regieren. So frappant die Neuartigkeit des Amtes der Konsuln auch erscheinen mag, der Bruch war nicht so radikal, dass die Römer gänzlich von ihrer Tradition abgeschnitten worden wären. Zwar war die Monarchie abgeschafft, aber sonst änderte sich sehr wenig. Die Wurzeln der neuen Republik reichten weit in die Vergangenheit zurück – häufig sogar sehr weit. Die Konsuln selbst trugen als Zeichen ihres Amtes eine Toga mit einem purpurnen Rand – die Farbe der Könige. Wenn sie die Vogelschau vornahmen, taten sie das nach einem Ritual, das noch aus der Zeit vor der Gründung Roms stammte. Und dann gab es als größtes Wunder die Bücher, die der vertriebene Tarquinius zurückgelassen hatte; jene drei geheimnisvollen Buchrollen mit Weissagungen, die Schriften der aus ältester Zeit stammenden oder wahrscheinlich zeitlosen Sibylle. Die Erkenntnisse, die diese Bücher vermittelten, waren von derartiger Bedeutung, dass der Zugang streng geregelt war. Sie stellten ein Staatsgeheimnis dar. Bürger, die man dabei ertappte, dass sie sie abschrieben, wurden in einen Sack genäht und ins Meer geworfen. Nur unter ganz kritischen Umständen, wenn Furcht erregende Vorzeichen die Republik vor einer nahenden Katastrophe warnten, durften die Bücher überhaupt konsultiert werden. In diesen Fällen, wenn alle anderen Quellen ausgeschöpft waren, wurden besonders dazu berufene Beamte beauftragt, zum Tempel des Jupiter hinaufzugehen, wo die Bücher unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt wurden. Man öffnete die Rollen und folgte den verblassten Zeilen des griechischen Textes. Weissagungen wurden entziffert und man suchte Rat, wie die erzürnten Götter am besten zu besänftigen seien. Und man fand immer Rat.
Die Römer waren ein Volk von ebenso großer praktischer Veranlagung wie Frömmigkeit und hatten keinen Hang zu Duldsamkeit und Fatalismus. Sie waren nur so weit an der Voraussage der Zukunft interessiert, wie sie glaubten, sie so besser meistern zu können. Roter Blutregen, Feuer speiende Krater oder Mäuse, die an Gold nagten, waren Furcht erregende Vorzeichen und galten als eine Art letzter Mahnung an das römische Volk, dass es mit seiner Schuld an die Götter im Rückstand war. Um wieder ein Guthaben aufzubauen, konnte es notwendig sein, einen neuen Kult für eine bisher unbekannte Gottheit in der Stadt einzuführen. Häufiger konnte eine solche Situation dazu führen, dass man sich abwartend verschanzte, während die Beamten verzweifelt herauszufinden versuchten, welche Traditionen man wohl vernachlässigt haben könnte. Hatte man die Vergangenheit und ihre Verhältnisse so wiederhergestellt, wie sie immer gewesen waren, war die Sicherheit der Republik gerettet. Das war ein tief in jedem Römer verankerter Glaube.
Im Jahrhundert nach ihrer Gründung wurde die Republik mehrmals durch soziale Auseinandersetzungen erschüttert, durch die Forderung der großen Unterschicht nach mehr Bürgerrechten und durch fortlaufende Verfassungsreformen. Und doch ließ das römische Volk diese ganze turbulente Zeit hindurch nicht von seiner festen Abneigung gegenüber der Veränderung ab. Neuerungen hatten für die Bürger der Republik eine unheilvolle Bedeutung. Pragmatisch, wie sie waren, mochten sie sie akzeptieren, wenn sie als Wille der Götter oder alter Brauch hingestellt wurden; aber nicht, wenn sie um der Neuerung selbst willen geschahen. Gleichermaßen konservativ und flexibel hielten die Römer an dem fest, was funktionierte; passten an, was versagt hatte; und bewahrten als ehrwürdiges Gerümpel, was überflüssig geworden war. Die Republik war Baustelle und Rumpelkammer in einem. Ihre Zukunft wurde mitten im Ramsch der Vergangenheit errichtet. Die Römer sahen in diesem Umstand durchaus keinen Widerspruch, sondern fanden das normal. Wie konnten sie sich anders für ihre Stadt engagieren als durch das Festhalten an den Bräuchen ihrer Vorfahren? Fremde Beobachter, die dazu neigten, die römische Frömmigkeit (pietas) für Aberglauben (superstitio) anzusehen,1 und das Ganze als ein Mittel zum Zweck betrachteten, den eine zynische Führungsschicht gegenüber den Massen einsetzte, missverstanden ihr Wesen. Die Republik war nicht wie andere Staaten. Während die Städte der Griechen regelmäßig von Bürgerkriegen und Umstürzen erschüttert wurden, erwies sich Rom als gefeit gegen solche Katastrophen. Trotz aller sozialen Unruhen innerhalb der Republik im Verlauf des ersten Jahrhunderts ihrer Existenz war das Blut ihrer Bürger kein einziges Mal in ihren Straßen geflossen. Wie typisch war es doch für die Griechen, das Ideal des gemeinsamen Bürgerrechts zu einer sophistischen Spitzfindigkeit herabzuwürdigen! Für einen Römer gab es nichts Heiligeres und Kostbareres. Es war schließlich das, was ihn ausmachte. Und das öffentliche Interesse – res publica – war es, das der Republik ihren Namen gab. Nur wenn sich sein Ansehen im Blick seiner Mitbürger spiegelte, konnte ein Römer sich als wahrer Mann fühlen. Und wenn er hörte, dass sein Name in aller Munde war.
Ein guter Bürger war in der Republik der Bürger, der für gut angesehen wurde. Für die Römer gab es keinen erkennbaren Unterschied zwischen moralischer Qualität und Ruf, und für beides hatten sie dasselbe Wort: honestas.Die Zustimmung der gesamten Stadt war der höchste und einzige Beweis des eigenen Wertes. Aus diesem Grund war auch das Einzige, was protestierende Bürger auf die Straße gehen ließ, die Forderung nach Zugang zu noch mehr Ehren und Ruhm. Bürgerunruhen führten unausweichlich zur Schaffung neuer Ämter: das der Ädilen und Volkstribunen im Jahr 494 v.Chr., das der Quästoren 447 v.Chr. oder der Prätoren 367 v.Chr. Je mehr Posten es gab, umso breiter wurde der Bereich der Verantwortlichkeiten, und je breiter der Bereich der Verantwortlichkeiten, desto zahlreicher die Gelegenheiten, sich durch Leistungen auszuzeichnen und Anerkennung zu finden. Ruhm war das, was jeder Bürger am meisten ersehnte, so wie öffentliche Schande seine größte Befürchtung war. Es waren nicht Gesetze, sondern das Bewusstsein, ständig beobachtet zu werden, das verhinderte, dass der Konkurrenzwille eines Römers zu eigensüchtiger Ambition verkam. So heiß und unerbittlich der Kampf um Ruhm auch stets war, es war darin kein Platz für undisziplinierten Ehrgeiz. Persönlichen Ruhm über das Gemeinwohl der Bürger zu stellen war das Verhalten eines Barbaren oder – schlimmer noch – eines Königs. Im Verkehr miteinander waren die Bürger der Republik es also gewohnt, ihren Konkurrenzinstinkt im Interesse des Gemeinwohls zu zügeln. In ihren auswärtigen Beziehungen hingegen behinderten sie keine derartigen Skrupel: »Ihr habt immer mehr als alle anderen Nationen nach Ruhm gestrebt und wart gierig auf lobende Anerkennung«, sagte Cicero.2 Dieses große Verlangen nach Ruhm hatte immer wieder verheerende Folgen für Roms Nachbarn. Die Kombination von Schlagkraft und Rücksichtslosigkeit der Legionen war ein Umstand, auf den nur wenige Gegner vorbereitet waren. Wenn die Römer bei hartnäckigem Widerstand gezwungen waren, eine Stadt im Sturm zu nehmen, war es ihr Brauch, jedes lebende Wesen, das sie fanden, abzuschlachten. Von den Legionären zurückgelassenen Schutt konnte man immer daran erkennen, dass abgeschlagene Köpfe von Hunden oder abgetrennte Glieder von Vieh verstreut zwischen Menschenleichen herumlagen.3 Die Römer töteten, um Furcht zu verbreiten, aber nicht in einem wilden Blutrausch, sondern als disziplinierte Soldaten einer Kampfmaschine. Der Mut der Legionäre war durch den Stolz auf ihre Stadt und den Glauben an ihre Zukunft gestählt, und das war ein Gefühl, das zu teilen jeder Bürger erzogen war. Eine tödliche und für die Römer ruhmreiche Spur markierte den Weg ihrer Kriege.
Trotz allem verging Zeit, bis die übrigen Völker Italiens der rücksichtslosen Natur des Räubers in ihrer Mitte gewahr wurden. In den ersten hundert Jahren der Republik hatten die Römer hart zu kämpfen, um ihre Herrschaft über Städte zu errichten, die kaum zehn Meilen vor ihren Toren lagen. Selbst das tödlichste Raubtier muss seine Kindheitstage durchleben, und während die Römer Vieh stahlen und mit obskuren Bergstämmen Scharmützel ausfochten, entwickelten sie ihren Instinkt für Herrschaft und Mord. In den 360er Jahren v.Chr. hatten sie Rom zur Herrin Mittelitaliens gemacht. In den darauf folgenden Jahrzehnten rückten sie weiter nach Norden und Süden vor und erstickten jeden Widerstand, auf den sie stießen. Um 260 v.Chr. hatten die Römer mit erstaunlicher Geschwindigkeit die gesamte Halbinsel unterworfen. Ihre Ehre hatte freilich nichts Geringeres gefordert. Den Staaten, die ihre Überlegenheit unterwürfig anerkannten, gewährten die Römer Vergünstigungen, wie sie ein Herr und Patron seinen Gefolgsleuten und Klienten zu gewähren beliebte, aber denen, die sie herausforderten, erwuchs daraus nur unentwegter Kampf. Kein Römer konnte die Aussicht ertragen, dass seine Stadt ihr Gesicht verlor. Er hätte eher jedes Maß an Leid ertragen und jede Anstrengung unternommen, als das zuzulassen.
Bald sollte die Zeit kommen, in der die Republik das in einem Kampf auf Leben und Tod unter Beweis stellen musste: Die Kriege gegen Karthago waren die furchtbarsten, die Rom je auszufechten hatte. Karthago war eine Stadt mit einer semitischen Bevölkerung, die sich an der nordafrikanischen Küste niedergelassen hatte und die Handelswege des westlichen Mittelmeers beherrschte. Die Stadt verfügte daher über fast ebenso große Mittel wie Rom. Obwohl Karthago in erster Linie Seemacht war, war es über Jahrhunderte in gelegentliche Kämpfe mit den Griechenstädten Siziliens verwickelt. Die Römer, die nun jenseits der Straße von Messina lauerten, stellten einen bedrohlichen, wenn auch interessanten neuen Faktor im militärischen Gleichgewicht Siziliens dar. Wie vorauszusehen war, konnten die Griechen auf Sizilien nicht der Versuchung widerstehen, die Republik in ihre ewigen Scharmützel mit Karthago zu verwickeln. Und ebenso vorauszusehen war, dass die Römer sich nicht an die Spielregeln halten würden, sobald sie einmal auf den Plan gerufen waren.
Im Jahr 264 v.Chr. machte Rom aus einem geringfügigen Streit um die Auslegung eines Vertrags einen totalen Krieg. Trotz jeden Mangels an Erfahrung in der Seekriegführung und dem Verlust einer Flotte nach der anderen durch feindliche Angriffe oder Sturm überdauerten die Römer zwei Jahrzehnte furchtbarer Niederlagen, um ihren Feind schließlich zu besiegen. Nach den Bestimmungen des Friedensvertrags, der ihnen aufgezwungen wurde, zogen sich die Karthager vollständig aus Sizilien zurück. Ohne jede ursprüngliche Absicht verfügte Rom plötzlich über den Kern eines auswärtigen Reiches. Im Jahr 227 v.Chr. wurde Sizilien als erste römische Provinz eingerichtet. Der Schauplatz der republikanischen Kriegführung sollte sich bald noch mehr ausweiten. Karthago war besiegt, aber noch nicht vernichtet. Nach dem Verlust Siziliens wandte es seine nächsten Herrschaftsambitionen Spanien zu. Die Karthager trotzten den mörderischen Stämmen überall in den Bergen des Landes und begannen die Suche nach Edelmetallen. Der Strom der reichen Erträge aus den Minen versetzte sie bald in die Lage, die Kampfhandlungen mit Rom wieder aufzunehmen. Die besten Feldherren Karthagos machten sich inzwischen keinerlei Illusionen mehr über den Feind, dem sie sich gegenübersahen. Der totale Krieg musste mit gleicher Münze heimgezahlt werden, und der Sieg war nicht erreicht, bevor die römische Macht nicht vollständig zerstört war. Mit diesem Ziel führte Hannibal im Jahr 218 v.Chr. ein karthagisches Heer von Spanien aus durch das südliche Gallien und über die Alpen nach Italien. Seine meisterhafte Strategie und Taktik übertrafen die seiner Gegner bei weitem und er fügte drei römischen Heeren spektakuläre Niederlagen zu. Bei seinem dritten Sieg bei Cannae vernichtete Hannibal acht Legionen – die schlimmste militärische Katastrophe in der Geschichte der Republik. Nach allen Regeln und Erwartungen damaliger Kriegführung hätte Rom die Konsequenzen ziehen müssen, indem es Hannibals Triumph anerkannte und um Frieden nachsuchte. Aber im Angesicht der Katastrophe zeigte es nur gesteigerten Widerstandswillen.
In einem solchen Augenblick suchten die Römer naturgemäß Rat bei den Weissagungen der Sibylle. Die Bücher schrieben vor, dass man zwei Gallier und zwei Griechen lebendig auf dem Forum der Stadt begraben solle. Die Beamten befolgten diese Anweisungen aufs Genaueste. Mit diesem grausamen Akt von Barbarei stellte das römische Volk unter Beweis, dass es nichts gab, was es nicht unternehmen würde, um die Freiheit seiner Stadt zu bewahren. Es blieb, wie es immer gewesen war: Die einzige Alternative zur Freiheit war der Tod. Und mit zusammengebissenen Zähnen schleppte sich die Republik von Jahr zu Jahr weiter vom Abgrund fort. Zusätzliche Heere wurden ausgehoben; Sizilien konnte gehalten werden; die Legionen eroberten das karthagische Reich in Spanien. Eineinhalb Jahrzehnte nach Cannae sah sich Hannibal wieder einem römischen Heer gegenüber, aber diesmal auf afrikanischem Boden. Er wurde geschlagen. Karthago verfügte nicht mehr über genügend Soldaten, um den Kampf fortzusetzen, und als der Sieger seine Bedingungen übermittelte, riet Hannibal seinen Landsleuten, sie anzunehmen. Im Gegensatz zu Rom zog er es vor, die Vernichtung seiner Stadt nicht zu riskieren. Trotzdem vergaßen die Römer nie, dass sie im Ausmaß seiner Anstrengungen und im Ziel seines Ehrgeizes mit Hannibal den Feind gefunden hatten, der ihnen am ähnlichsten war. Noch Jahrhunderte später waren Statuen von ihm in Rom zu sehen. Und selbst nachdem sie Karthago zu einem machtlosen Rumpfstaat gemacht und seine Provinzen, seine Flotte und seine gefeierten Kriegselefanten konfisziert hatten, fürchteten die Römer noch immer einen Wiederaufstieg der Punier. Derartiger Hass war das größte Kompliment, das sie einem fremden Staat machen konnten. Man konnte Karthago auch nach seiner Unterwerfung nicht trauen. Die Römer blickten in ihre eigenen Herzen und schrieben ihrem größten Gegner dieselbe Unnachgiebigkeit zu, die sie dort fanden. Niemals wieder sollten die Römer die Existenz einer Macht dulden, die ihr eigenes Überleben bedrohen konnte. Bevor sie das riskierten, fühlten sie sich voll und ganz berechtigt, gegen jeden, der sich zur Bedrohung auswuchs, einen Präventivschlag zu führen. Solche Gegner fand man leicht – allzu leicht. Selbst vor dem Krieg gegen Hannibal hatte die Republik es sich zur Gewohnheit werden lassen, gelegentlich Truppen auf den Balkan zu schicken, wo ihre Beamten dann Kurzweil hatten, lokale Fürsten einzuschüchtern und Grenzen neu zu ziehen. Wie die Bewohner Italiens bestätigen konnten, hatten die Römer eine eingefleischte Vorliebe für diese Art der Einflussnahme, weil sie ein klares Zeichen für die allseits bekannte Entschlossenheit der Republik setzte, mangelnden Respekt nicht zu dulden. Die unzuverlässigen und zwanghaft zänkischen Staaten Griechenlands lernten diese Lektion nur mit einiger Mühe. Ihre Verwirrung war verständlich, denn in den frühen Jahren ihrer Begegnung mit Rom hatte sich die Republik keineswegs wie ein »normaler« Eroberer verhalten. Die Legionen schlugen wie ein Blitz aus heiterem Himmel mit vernichtender Kraft zu und verschwanden dann ebenso schnell wieder von der Bildfläche. So gewalttätig diese unregelmäßigen Angriffe auch waren, zwischen ihnen lagen doch lange Zeiträume, in denen Rom jedes Interesse an den Angelegenheiten in Griechenland verloren zu haben schien. Selbst wenn Rom intervenierte, wurden diese Überfälle jenseits der Adria stets als friedensbewahrende Aktionen hingestellt. Diese hatten noch nicht die Eroberung des Territoriums zum Ziel, sondern sollten Macht und Geltung der Republik deutlich machen und alle anmaßenden lokalen Kräfte entmutigen.
In den frühen Jahren des römischen Engagements auf dem Balkan hatte sich dieses Vorgehen hauptsächlich gegen Makedonien gerichtet. Das Königreich im Norden Griechenlands hatte die Halbinsel zweihundert Jahre lang beherrscht. Als Erbe Alexanders des Großen hatte der König des Landes immer geglaubt, dass er so anmaßend sein könne, wie er wolle. Trotz wiederholter Strafexpeditionen der römischen Heere ging dieser Glaube niemals ganz verloren, und im Jahr 168 v.Chr. war die Geduld der Römer schließlich zu Ende. Rom schaffte die Monarchie vollends ab und unterteilte Makedonien zunächst in vier Marionettenrepubliken, um dann im Jahr 148 v.Chr. den Übergang von der Friedensaktion zur Besatzung zu vollenden und seine direkte Herrschaft zu errichten. Wie in Italien, wo Straßen die Landschaft mit einem dichten Netz überzogen, besiegelte kühne Bautätigkeit, was als militärische Eroberung begonnen hatte. Die Via Egnatia, eine gewaltige Schneise aus Stein und Kies, wurde durch die Wildnis des Balkans vorangetrieben. Diese Überlandstraße, die von der Adria bis an die Ägäis führte, wurde zur lebenswichtigen Ader der engen Verzahnung zwischen Griechenland und Rom. Sie eröffnete auch den Zugang zu Horizonten jenseits der blauen Ägäis, wo in Gold und Marmor glänzende und vor Kunstwerken strotzende Städte mit dekadenten Speisezetteln die strenge Aufmerksamkeit der Republik geradezu einzuladen schienen. Bereits im Jahr 190 v.Chr. war ein römisches Heer in Asien eingefallen, hatte die Kriegsmaschinerie des lokalen Herrschers völlig vernichtet und ihn vor den Augen des gesamten Vorderen Orients gedemütigt. Sowohl Syrien als auch Ägypten, die beiden Großmächte der Region, schluckten ihren Stolz schnell herunter, lernten, die Einmischung römischer Gesandter zu ertragen, und erkannten die Vorherrschaft der Republik unterwürfig an.
Verwaltungsmäßig war das Römische Reich noch klein und beschränkte sich im Wesentlichen auf Makedonien, Sizilien und Teile Spaniens, aber sein Einfluss reichte gegen 140 v.Chr. bis in ferne Länder, von denen zu Hause in Rom nur wenige auch nur gehört hatten. Das Ausmaß und die Schnelligkeit dieses Aufstiegs zur Macht war so erstaunlich, dass niemand – und die Römer selbst als Letzte – glauben konnte, dass er Realität war. Auch wenn der Erfolg ihres Landes sie begeisterte, fühlten doch viele Bürger ein Unbehagen. Moralprediger, die taten, was römische Moralisten immer getan hatten, und einen negativen Vergleich der Gegenwart mit der Vergangenheit anstellten, brauchten nicht lange nach Beweisen für die verderblichen Auswirkungen der Herrschaft zu suchen. Die alten Sitten wurden durch den Überfluss an Gold offensichtlich verdorben. Mit der Beute kamen auch fremde Bräuche und philosophische Gedanken. Die Präsentation der Schätze aus dem Orient auf den öffentlichen Plätzen Roms und das Schnattern fremder Zungen in den Straßen der Stadt riefen sowohl Beunruhigung wie Stolz hervor. Nie erschienen die harten bäuerlichen Werte, mit denen die Römer ihre Herrschaft errungen hatten, bewundernswerter als zu jenen Zeiten, zu denen sie am empfindlichsten ignoriert wurden. »Sitte und Männer von alter Art bauen römische Macht auf«,4 hatte man nach dem Sieg über Hannibal triumphierend ausgerufen. Aber was sollte werden, wenn diese Grundfesten zu bröckeln begannen? Würde die Republik straucheln und fallen? Die Schwindel erregende Entwicklung ihrer Stadt von einem Provinznest zur Weltmacht versetzte die Römer in Verwirrung und ließ sie den Neid der Götter befürchten. In beunruhigender Widersprüchlichkeit schien ihr Eintritt in die Weltgeschichte das Maß sowohl ihres Erfolgs wie ihres Niedergangs zu sein. Denn so bedeutend Rom auch geworden war, es fehlte nicht an schlimmen Anzeichen für seinen zukünftigen Niedergang. Monströse Missgeburten und Unheil verkündender Vogelflug oder ähnlich erstaunliche Dinge beunruhigten das römische Volk fortwährend und erforderten, wenn die Vorzeichen besonders drohend erschienen, die Konsultation der Sibyllinischen Bücher mit ihren Prophezeiungen. Wie immer wurden prompt Vorschriften gefunden und Heilmittel angewendet. Die seit alter Zeit geltenden Verhaltensregeln, die Sitten und Gebräuche der Vorfahren, wurden wiederhergestellt oder bekräftigt. Die Katastrophe war abgewendet. Die Republik blieb erhalten. Aber die Welt drehte sich doch schneller und veränderte sich, und mit ihr auch die Republik. Einige Zeichen der Krise widerstanden aller Macht der alten Rituale, die sie heilen sollten. So gewaltige Veränderungen, wie sie das römische Volk ausgelöst hatte, konnten nicht leicht aufgehalten werden, noch nicht einmal mit den Ratschlägen der Sibylle. Um das zu erkennen, brauchte man keine Vorzeichen, sondern man musste nur durch die Stadt spazieren: In den brodelnden Straßen stand nicht alles zum Besten.
Hauptstadt der Welt
Eine Stadt, das heißt eine freie Stadt, war der Ort, wo ein Mann sich am meisten als solcher fühlen konnte. Für die Römer war das eine Grundvoraussetzung. Das Bürgerrecht – civitas – zu besitzen, hieß zivilisiert zu sein, und das ist eine Vorstellung, die sich noch heute in unserem Sprachgebrauch niederschlägt. Ohne jenen Rahmen, den nur eine unabhängige Stadt geben konnte, hatte das Leben keinen Wert. Ein Bürger definierte sich über die Gemeinsamkeit mit seinen Mitbürgern, mit denen er Freud und Leid, Hoffnungen und Befürchtungen, Feste, Wahlen und Kriegsdisziplin teilte. Wie ein Schrein durch die Gegenwart eines Gottes mit Leben erfüllt war, so wurde das Gewebe einer Stadt durch das Leben der Bürgergemeinde geheiligt, das sich in ihren Mauern abspielte. Eine Stadtlandschaft war daher für die Bürger etwas Heiliges. Sie legte Zeugnis ab von dem Erbe, das die Bevölkerung zu dem gemacht hatte, was sie war. Sie machte den Geist eines Staates sichtbar. Wenn fremde Mächte zum ersten Mal mit Rom in Verbindung traten, fühlten sie sich angesichts solcher Überlegungen oft sicherer. Im Vergleich mit den prachtvollen Städten der griechischen Welt machte Rom eher den Eindruck eines rückständigen und baufälligen Ortes.
Die Männer bei Hofe in Makedonien kicherten jedes Mal überheblich, wenn sie eine Beschreibung der Stadt hörten.5 Sie sollten sich noch wundern. Aber selbst als die Welt gelernt hatte, ihren Kotau vor der Republik zu machen, blieb ein Hauch von Provinzialität an Rom haften. Man unternahm gelegentlich Versuche, es herauszuputzen, aber das nützte nicht viel. Sogar die Römer selbst, denen die ordentlichen und wohlgeplanten Städte der Griechen allmählich vertraut wurden, dürften sich manchmal ein wenig geschämt haben. »Rom ist auf Hügeln und in engen Tälern erbaut, die Stockwerke streben und drängen dort in die Höhe, die Straßen sind nicht gut, die Gassen äußerst schmal; die Capuaner werden unsere Stadt verhöhnen und verachten, wenn sie auf ihr Capua blicken, das sich auf einer gänzlich ebenen Fläche ausbreitet und herrlich gelegen ist.«6 Solche Sorgen wurden gelegentlich geäußert. Dennoch war Rom am Ende, als man Bilanz ziehen konnte, noch immer eine freie Stadt – und Capua nicht. Natürlich vergaß das kein Römer auch nur einen Moment. Er konnte manchmal über seine Stadt stöhnen, aber er blieb doch unbeirrbar in seinem Stolz auf sie. Es erschien ihm überdeutlich, dass Rom, die Herrin der Welt, von den Göttern gesegnet und zur Herrschaft vorbestimmt war. Gelehrte wiesen mit ausführlichen Argumenten darauf hin, dass die Lage der Stadt keine übertriebene Hitze zuließ, die den Verstand beeinträchtigte, und auch keine allzu große Kälte, die das Hirn gefrieren ließ; es war daher nach Auffassung Vitruvs schlicht eine geografische Tatsache, dass Rom der beste Platz zum Leben sei, wo »das vollkommenste Mischungsverhältnis« bestehe, und »innerhalb des gesamten Erdkreises und seiner Länder besitzt das römische Volk sein ursprüngliches Gebiet in der Mitte der Welt«.7 Nicht dass ein gemäßigtes Klima der einzige Vorteil war, den die Götter dem römischen Volk rücksichtsvollerweise geschenkt hatten. Es lag auch auf Hügeln, die leicht verteidigt werden konnten; es gab einen Fluss, der Zugang zum Meer bot; und Quellen und frische Winde, die die Täler zu gesunden Orten machten. Wenn man römische Autoren liest, die ihre Stadt preisen,8 würde man nie darauf kommen, dass ihre Errichtung auf sieben Hügeln ganz im Widerspruch zu Roms eigenen Grundsätzen der Stadtplanung stand, dass der Tiber dazu neigte, gefährlich über die Ufer zu treten, und dass in den Niederungen der Stadt die Malaria grassierte.9 Die Liebe, die die Römer ihrer Stadt entgegenbrachten, war die eines Liebhabers, der auch in den offenkundigen Fehlern der Geliebten noch eine Tugend sah. Diese idealisierende Sicht der Stadt verdeckte die armselige Realität immer wieder. Sie half, ein verblüffendes Gemisch aus Widersprüchen und Ansprüchen zu schaffen, in dem nichts je wirklich so war, wie es schien. Trotz »Qualm und Getümmel und Pracht«10 in ihrer Stadt ließen die Römer niemals davon ab, von jenem schlichten Idyll zu schwärmen, das sie sich so gern vorstellten.
Während Rom unter den Anstrengungen seiner Ausbreitung ächzte und stöhnte, konnte man hinter der zu engen modernen Metropole, manchmal nur schwach und dann wieder deutlicher, das blanke Skelett eines alten Stadtstaats hervorleuchten sehen. In Rom spielte die Erinnerung eine große Rolle. Die Gegenwart befand sich in einem ständigen Dialog mit der Vergangenheit, die rastlose Veränderung mit der Ehrfurcht vor Tradition und die Nüchternheit mit dem Glauben an den Mythos. Je überfüllter und dekadenter die Stadt wurde, desto mehr verspürten ihre Bürger ein Verlangen nach der Versicherung, dass Rom noch immer Rom war. Aus diesem Grund stieg der Rauch der Opfer für die Götter weiter über den sieben Hügeln auf wie in jenen fernen Zeiten, als Bäume jeder Art einen der Hügel, den Aventin, noch vollständig bedeckt hatten.11 Wälder gab es schon lange nicht mehr in Rom, und kräuselnder Rauch stieg nicht nur von den Altären zum Himmel auf, sondern auch von einer Unzahl von Herdfeuern, Brennöfen und Werkstätten. Schon lange bevor man die Stadt sehen konnte, sollte eine braune Kappe den Reisenden aus der Ferne vorwarnen, dass er sich ihr näherte. Und der Smog war nicht das einzige Zeichen. Nahe bei Rom gelegene Städte mit berühmten Namen, die in der archaischen Vorzeit Rivalen der Republik gewesen waren, standen nun verlassen da und waren auf wenige verstreute Gasthäuser zusammengeschrumpft, denn Roms Anziehungskraft hatte sie völlig geleert. Sobald der Reisende auf seinem Weg fortfuhr, sollte er neuere Siedlungen am Wegesrand finden. Da es nicht in der Lage war, eine stetig wachsende Bevölkerung aufzunehmen, begann Rom an den Rändern aufzuplatzen. Barackenstädte bildeten sich entlang aller großen Zugangsstraßen. Hier waren auch die Toten begraben; und die Nekropolen, die sich gegen die Küste und entlang der großen Via Appia nach Süden hin erstreckten, waren der Wegelagerer und billigen Huren wegen berüchtigt. Doch nicht jedes Grab war dem Verfall preisgegeben. Während sich der Reisende den Toren Roms näherte, konnte er gelegentlich wahrnehmen, dass der üble von der Stadt kommende Geruch durch Myrrhe und Weihrauch gelindert wurde, das Parfüm des Todes, das der Wind ihm von einem von Zypressen überschatteten Grab herübertrug. Ein solcher Moment mit seinem Gefühl der Vereinigung von Gegenwart und Vergangenheit war typisch für Rom. Aber ganz so wie die Stille eines Friedhofs Gewalt und Prostitution verbarg, waren selbst die heiligsten und der Ewigkeit bestimmten Plätze nicht vor Entweihung sicher. An den Gräbern wurden mahnende Schilder mit dem Verbot von Wahlpropaganda angebracht, aber trotzdem fand man überall Graffiti. In Rom, dem Sitz der Republik, war die Politik wie eine ansteckende Krankheit. Nur in unterworfenen Städten hatten Wahlen keine Bedeutung. Nachdem Rom das politische Leben in anderen Gesellschaften erstickt hatte, war es nun die letzte Arena der Welt für den Kampf um Ehrgeiz und Träume. Aber selbst die mit Graffiti beschmierten Gräber konnten den Reisenden nicht hinreichend auf das Tollhaus vorbereiten, das er hinter den Stadttoren vorfand. Die Straßen Roms waren niemals dem geringsten Zwang zur Planung unterworfen worden. Dazu hätte es der Absicht und der gezielten Vorstellungen eines Despoten bedurft, und die römischen Beamten blieben doch selten mehr als ein Jahr im Amt. Infolgedessen war das Wachstum der Stadt chaotisch verlaufen und den Launen unkontrollierbarer Triebe und Bedürfnisse gefolgt.
Sobald er von einer der beiden großen Durchgangsstraßen Roms abbog, der Via Sacra oder der Via Nova, trug der Fremde bald zu der hoffnungslosen Verstopfung bei. »In rücksichtsloser Hast kommt ein Bauführer und hetzt seine Maultiere und Träger; ein Kran windet bald Blöcke, bald Riesenbalken in die Höhe; düstere Leichenzüge verwickeln sich mit Lastfuhrwerken; hier flüchtet ein tollwütiger Hund, dort rennt ein Kot spritzendes Schwein.«12 Von diesem Strudel erfasst, verirrte sich ein Reisender fast mit Sicherheit hoffnungslos. Selbst Bürger fanden ihre Stadt verwirrend. Der einzige Weg, sich zurechtzufinden, war, sich besondere Orientierungspunkte einzuprägen: einen Feigenbaum vielleicht oder den Säulengang eines Marktes oder am besten einen Tempel, der groß genug war, dass er sich über das Labyrinth der engen Straßen erhob. Glücklicherweise war Rom eine fromme Stadt und es gab viele Tempel. Die Verehrung der Römer für die Vergangenheit bedeutete auch, dass alte Gebäude fast nie abgerissen wurden, selbst dann nicht, wenn die freien Plätze, auf denen sie einst gestanden hatten, längst verschwunden und von Bauten überflutet waren. Tempel ragten über Elendsquartieren oder Fleischmärkten auf, beherbergten verhüllte Statuen, deren Identität man völlig vergessen hatte, und doch war man niemals auf den Gedanken gekommen, sie zu zerstören. Diese steinernen Fragmente einer archaischen Vergangenheit, Fossilien aus den frühesten Tagen der Stadt, gaben den Römern ein dringend benötigtes Gefühl der Orientierung. Ewig wie die Götter, deren Geist sie durchdrang, waren die archaischen Reste wie ein Anker im Sturm. Gleichzeitig wurde die Stadt mitten im dröhnenden Gehämmer, dem Rumpeln der Wagenräder und dem Krachen einstürzender Gebäude überall und unaufhörlich wiederaufgebaut, abgerissen und von neuem wiederaufgebaut. Bauunternehmer suchten nach immer weiteren Möglichkeiten, in der Enge noch mehr Platz und noch mehr Profit zu finden. Baracken sprossen wie Unkraut empor, wo Brände Trümmerflächen hinterlassen hatten. Trotz aller Anstrengungen verantwortungsbewusster Beamten, die Straßen frei zu halten, wurden sie immer wieder durch Marktbuden oder die Schuppen Obdachloser verstopft. Den größten Gewinn machten die Bauunternehmer in einer Stadt, die lange Zeit durch ihre alten Stadtmauern eingeengt wurde, als sie begannen, in die Höhe zu streben. Überall schossen Wohnblocks auf. Im ganzen zweiten und ersten Jahrhundert v.Chr. sollten Hausbesitzer miteinander wetteifern, immer höhere Gebäude zu errichten. Diese Entwicklung war dem Gesetzgeber ein Dorn im Auge, denn die Mietshäuser waren als unsolide gebaute Bruchbuden berüchtigt. Im Allgemeinen wurde die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften jedoch zu wenig kontrolliert, um die großartigen Möglichkeiten zu übermäßigem Gewinn behindern zu können, die ein Slum mit mehrstöckigen Mietshäusern bot. Auf sechs Etagen oder mehr konnten die Mieter in kleinen, dünnwandigen Zimmern zusammengepfercht werden, bis das Gebäude unausweichlich einstürzte, um nur noch höher wiederaufgebaut zu werden. Auf Lateinisch hießen diese Wohnblocks insulae, Inseln – das ist eine suggestive Bezeichnung, denn sie bringt zum Ausdruck, wie sie in dem Meer des sich unten abspielenden Lebens wie Inseln dastanden. Hier empfand man die durch die immense Größe der Stadt hervorgerufene Entfremdung am schlimmsten. Für die, die in den insulae