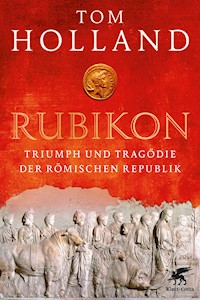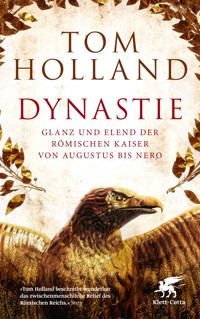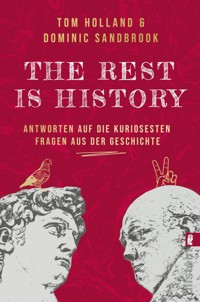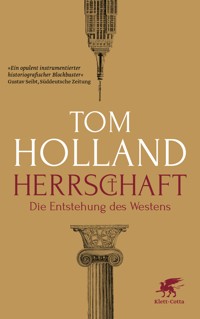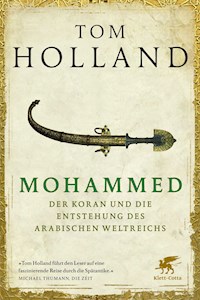25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
»Eine großartige Darstellung des römischen Reiches«Peter Frankopan Mit erzählerischer Brillanz erweckt der internationale Bestseller-Autor Tom Holland das Goldene Zeitalter Roms zum Leben: Spannend wie in einem Historienroman schildert er die große Politik in der Hauptstadt, das Leben der einfachen Menschen in den Provinzen und die großen militärischen Konflikte an den Grenzen des Imperiums: ein grandioses und stets fesselndes Porträt der ultimativen antiken Weltreichs auf dem Höhepunkt seiner Macht. Beginnend im Krisenjahr 69 n. Chr. mit vier aufeinanderfolgenden Kaisern (Galba, Otho, Vitellius, Vespasian) und endend rund sieben Jahrzehnte später mit dem Tod Hadrians präsentiert Tom Holland eine nie dagewesene Epoche des römischen Friedens: das Goldene Zeitalter Roms. Auf seinem Höhepunkt erstreckte sich das römische Reich von Schottland bis Arabien, es war der wohlhabendste und mächtigste Staat, den die antike Welt kannte. Von der vergoldeten Hauptstadt bis zu den Reichen jenseits der Grenze erweist sich das römische Reich in all seiner raubtierhaften Pracht und zivilisatorischen Leistungskraft: die Zerstörung Jerusalems und Pompejis, der Bau des Kolosseums und des Hadrianswalls, die Eroberungen Trajans. Lebendig und hautnah skizziert Holland das Leben der Sklaven wie der Kaiser (u.a. Titus, Domitian,Trajan) und zeigt schonungslos auf, wie der römische Frieden aus beispielloser militärischer Gewalt hervorging. Ein packendes Porträt Roms: Dies ist die epische Geschichte der Pax Romana für unsere Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Ähnliche
TOM HOLLAND
PAX
Krieg und Frieden im Goldenen Zeitalter Roms
Aus dem Englischen von Susanne Held
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Pax. War and Peace in Rome’s Golden Age« im Verlag Abacus, An Imprint of Little, Brown Group, London
© 2023 by Tom Holland
Für die deutsche Ausgabe
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © arcangel/Stephen Mulcahey
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98758-4
E-Book ISBN 978-3-608-12232-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
TEIL I
KRIEG
I
Die traurigen Götter der Unterwelt
II
Vier Kaiser
III
Eine Welt im Krieg
TEIL II
FRIEDEN
IV
Schlafende Riesen
V
Die weltumspannende Spinne
VI
Der Beste aller Kaiser
VII
Ein Garten nur für uns
Tafelteil 1
Tafelteil 2
Anhang
Zeittafel
Dramatis Personae
Danksagungen
Bibliographie
Liste der Karten
Register
Anmerkungen
Für Bill Heald: Ohne ihn wäre das Verfassen dieses Buches eine sehr viel größere Herausforderung gewesen.
Vorwort
Im Jahr 122 n. Chr. traf der mächtigste Mann der Welt an den Ufern des Tyne(1) ein. Der Fluss, der durch die heutige englische Stadt Newcastle(1) fließt, war der nördlichste Punkt, der jemals von einem römischen Kaiser besucht worden war. Diesseits des Flusses lag das britische Tiefland, die fruchtbare Südhälfte der Insel, die im Laufe der vorangegangenen achtzig Jahre von den Legionen erobert, befriedet und gezähmt worden war. Jenseits lagen die wilden Gebiete des Nordens, die zu wild und zu arm waren, um einer Eroberung würdig zu sein – so jedenfalls lautete das Urteil des besuchenden Caesaren. Publius Aelius Hadrianus – Hadrian(1) – war ein Mann, der bestens dafür qualifiziert war, zwischen Zivilisation und Barbarei zu unterscheiden. Er hatte bei Philosophen studiert und war gegen Kopfjäger in den Krieg gezogen; er hatte sowohl in Athen(1) als auch auf einer Insel in der Donau(1) gelebt. Vor seinem Eintreffen in Britannien(1) hatte er eine Besichtigungstour entlang der Militärstützpunkte am Rhein(1) unternommen und den Bau einer großen Palisade jenseits des Ostufers des Flusses angeordnet. Und nun, da er an den grauen Wassern des Tyne stand, hatte Hadrian Pläne für ein noch gewaltigeres Wunderwerk der Technik.
Die Kühnheit des Vorhabens wurde allein schon durch die Anwesenheit des Caesaren in Britannien(2) offenbar. Nicht nur seine Legionen mussten vorbereitet werden. Dasselbe galt auch für die Götter. Opfer waren darzubringen – sowohl dem Ozean, dieser gewaltigen, furchterregenden Wasserfläche, in der Britannien lag, als auch dem Fluss Tyne(2). Hadrian(2), ein Mann, der im Umgang mit dem Übernatürlichen keine Nachlässigkeit kannte, wäre nicht im Traum darauf gekommen, eine Brücke in Auftrag zu geben, ohne den in jedem Fluss manifesten göttlichen Geist zu beschwichtigen. Das Bauwerk erhielt den Namen Pons Aelius(1): Hadriansbrücke. Für einen obskuren Ort am Rand der Welt war das eine besondere Ehre. Normalerweise wurden nur Brücken in Rom(1) nach Kaisern benannt. Als Hadrian ein Jahrzehnt später ein riesiges Mausoleum(1) für seine eigene Person auf der anderen Seite des Tibers in Auftrag gab und einen bequemen Zugang von der Hauptstadt aus schaffen wollte, war Pons Aelius der offensichtliche, der einzig mögliche Name für das neue Bauwerk. Mit dessen Fertigstellung gab es nun zwei völlig unterschiedliche Brücken, die der ausdrücklichen Auszeichnung mit der Gunst Hadrians(3) gewürdigt worden waren. Infolgedessen wurde dem entfernten Außenposten in Britannien(3) eine noch feierlichere Würde verliehen.
Nicht nur die Brücke über den Tyne(3) trug den Namen Pons Aelius(2), sondern auch das am Nordufer des Flusses errichtete Kastell. Dieses Kastell war wiederum nur eines von mehreren Militärlagern, die in einer direkten Linie das eine Ufer des Ozeans mit dem anderen verbanden. Ihrerseits waren sie durch eine größtenteils aus Stein errichtete Mauer(1) verbunden, einen Wall, der sich über 118 Kilometer erstreckte. Hinter dem Wall verlief eine gepflasterte Straße. Hinter der Straße verlief ein Graben, der so tief ausgehoben war, dass man ihn nur mit Leitern überwinden konnte. Eine Infrastruktur dieser Art und dieses Ausmaßes war ein ebenso beeindruckendes Denkmal für Hadrian(4) wie alles, was er in Rom(2) gestiftet hatte. Sie zeugte von einem Maß an militärischem Aufwand und einer Fähigkeit zur Einschüchterung, die ihresgleichen suchten. Der Besuch des Kaisers am Tyne war nur ein flüchtiger Zwischenstopp gewesen, aber er hatte den unverkennbaren Stempel einer Supermacht hinterlassen.
Gesehen haben den Wall(2) nur die wenigsten Römer. Er war so weit entfernt von allem, was eine Zivilisation ausmachte – »Handel, Seefahrt, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, sämtliche Handwerke, die es gibt oder je gegeben hat, alles, was hergestellt wird oder aus der Erde wächst«[1] –, dass er ihnen bestenfalls als Gerücht diente. Mit der Zeit vergaß man sogar, dass es Hadrian(5) gewesen war, der ihn erbaut hatte. Mehr als ein Jahrtausend nach dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft in Britannien(1) wurde sein Bau einem anderen, späteren Caesar zugeschrieben, und erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde endgültig bewiesen, dass der Wall das Werk Hadrians war. Seitdem hat sich unser Wissen darüber, wie und von wem er gebaut wurde, dank der Arbeit von Generationen von Archäologen, Epigraphikern und Historikern unermesslich verbessert. Die Erforschung des Hadrianswalls ist heute »mit den Knochen verworfener Hypothesen übersät«.[2] Mittlerweile werden entlang des atemberaubend eindrucksvollen Mittelteils – einem Abschnitt, der im Jahr 1600 dermaßen von Banditen heimgesucht wurde, dass der Antiquar William Camden(1) sich gezwungen sah, ihn ganz aus seiner Reiseroute zu streichen – die Besucher von Hinweisschildern, Souvenirläden und sanitären Anlagen begrüßt.
Aber selbst all dem ist es nicht gelungen, eine Aura des Geheimnisvollen vom Hadrianswall(3) zu vertreiben. Im Frühwinter des Jahres 1981, als ein amerikanischer Tourist namens George R. R. Martin(1) ihn besuchte, brach gerade die Dämmerung herein. Als die Sonne unterging und der Wind über die Felsen strich, hatte er den Ort ganz für sich allein. Wie wäre es wohl gewesen, so fragte sich Martin, hier zu Hadrians(6) Zeiten zu stehen, ein Soldat aus Afrika oder dem Nahen Osten zu sein, der an die Grenzen der Zivilisation geschickt wurde, um in die Dunkelheit zu blicken, mit einem geheimen Grauen davor, was dort lauern könnte? Die Erinnerung verblasste nicht. Ein Jahrzehnt später, als er sich an die Arbeit an einem Fantasy-Roman mit dem Titel A Game of Thrones(1) machte, sollte sich sein Besuch am Hadrianswall(4) als eine besonders lang nachhallende Erinnerung erweisen: die Erinnerung an einen Wall, wie er ihn später beschreiben sollte, »der die Zivilisation gegen unbekannte Bedrohungen verteidigt«.[3]
In Martins(2) fiktiver Welt Westeros sind die »unbekannten Bedrohungen« die Anderen, bleiche Dämonen aus Schnee und Kälte, die sich die Toten zu Sklaven machen. Das römische Grenzsystem wird in seinen Romanen als eine zweihundert Meter hohe Mauer aus Eis dargestellt, die achttausend Jahre alt und fast fünfhundert Kilometer lang ist. Uralte Zaubersprüche sind in sie eingemeißelt. Hin und wieder wird sie von Mammuts angegriffen. Martins Version des Hadrianswalls(5) hat dank des durchschlagenden Erfolgs seiner Romane und der daraus adaptierten TV-Serie das Original etwas in den Schatten gestellt. Aber sie zeigt vielleicht auch, wie fest ein bestimmtes Verständnis des römischen Reichs in unserer kollektiven Vorstellung verankert ist. In A Game of Thrones(2) wird nie in Frage gestellt, dass unsere Sympathien der Nachtwache gelten, den Soldaten, die die Mauer bewachen, und nicht den Anderen. Immerhin hatte sich auch Martin, als er an der nördlichsten Grenze des römischen Reichs stand und in die Dämmerung hinausblickte, als Römer und nicht als Brite gefühlt. Menschen, die den Hadrianswall(6) besuchen, identifizieren sich nur selten mit den Eingeborenen. Romane und Filme, in denen der Hadrianswall(7) vorkommt, nehmen ausnahmslos die Perspektive der Besatzer ein. Wer sich über die Grenzen der römischen Zivilisation hinauswagt, sei es mit einer dem Untergang geweihten Legion oder auf der Suche nach einem verlorenen Adler, begibt sich in ein Herz der Finsternis. Rudyard Kipling(1), der herausragende Lobredner des britischen Empire, stellte den Wall selbst als ein Denkmal der Zivilisation dar. »Gerade wenn man glaubt, am Ende der Welt zu sein, sieht man einen Rauch von Ost nach West ziehen, soweit das Auge reicht, und dann darunter, ebenfalls soweit man blicken kann, Häuser und Tempel, Läden und Theater, Kasernen und Getreidespeicher, die wie Würfel aufgereiht sind hinter – immer hinter – einer langen, niedrigen, aufsteigenden und abfallenden und sich abwechselnd verbergenden und zeigenden Kette von Türmen. Und das ist der Wall!«[4]
Selbst heute noch, in einem Zeitalter, das dem Imperialismus(1) sehr viel weniger gewogen ist, als es 1906 der Fall war, als Kipling(2) seine Geschichten über das römische Britannien(4) veröffentlichte, kann man die Anwesenheit von Soldaten aus Marokko oder Syrien am Hadrianswall(8) als einen Anlass zur Freude darstellen. Um diesen Aspekt des Walls zu betonen, veränderte die BBC in einem kürzlich für Kinder gedrehten Film über Britannien zur Zeit Hadrians die Chronologie dergestalt, dass der damalige Provinzstatthalter als Afrikaner dargestellt wurde.1 Dasselbe römische Reich, das entlang seiner barbarischsten Grenze einen Wall baute und über möglicherweise 30 Prozent der Weltbevölkerung herrschte, ist auch heute noch das, als was es seit dem späten 18. Jahrhundert gesehen wurde: ein Spiegel – und wenn wir darin unser eigenes Bild erblicken, dann fühlen wir uns geschmeichelt.2
Edward Gibbon(1) stellte im Jahr 1776 das 2. Jahrhundert n. Chr. als das goldenste aller goldenen Zeitalter dar. Im ersten Band von Verfall und Untergang des römischen Imperiums bezeichnete er die Regierungszeit Hadrians(10) und seiner unmittelbaren Vorgänger und Nachfolger als »jene Epoche in der Weltgeschichte …, in der die Lage des Menschengeschlechts am glücklichsten und gedeihlichsten war«. Überall vom Tyne(4) bis zur Sahara, vom Atlantik bis nach Arabien(1) herrschte Frieden. Länder, die früher einmal, vor der Errichtung der römischen Herrschaft, von internen Konflikten – Königreich gegen Königreich, Stadt gegen Stadt, Stamm gegen Stamm – erschüttert gewesen waren, wurden nun »mit Tugend und Weisheit regiert«.[5] Wohl war dieses Lob mit diversen Vorbehalten verbunden. Der feinsinnige und scharfzüngige Gibbon war viel zu gebildet, um sich vorstellen zu können, dass irgendeine Periode der Geschichte wirklich das Paradies gewesen sein könnte. Er war sich des autokratischen Charakters der Herrschaft der Caesaren bewusst – und er wusste natürlich besser als jeder andere, was noch bevorstand. Dennoch erschien einem Mann seiner Veranlagung – kultiviert, tolerant, voller Hochachtung für Bildung und Handel – die von Hadrian(11) regierte Welt unendlich viel besser als die Barbarei und der Aberglaube, die er mit dem Mittelalter(1) identifizierte. »Die alte Glorie und disziplinierte Tapferkeit schützten die Grenzen dieser weiträumigen Monarchie. Der sanfte, aber wirksame Einfluss der Gesetze und Sitten hatte die Einheit der Provinzen allmählich gefestigt. Ihre friedfertigen Bewohner genossen und missbrauchten die Vorteile von Reichtum und Luxus.«[6] Der sanft ironische Ton, in den Gibbon diesen Bericht über den Wohlstand des Imperiums fasste, bedeutete keine Verachtung für die Leistung der Römer. Ordnung war besser als Chaos, und die Ordnung, welche die Caesaren für »die schönsten Gebiete der Erde und den kultiviertesten Teil des Menschengeschlechts« brachten, war in der Tat ein Wunder. Gibbon wusste das, weil es für die Römer selbst ein Wunder gewesen war. Sie hatten gestaunt über das Schauspiel, dass ihre einstigen Feinde die Waffen niederlegten und sich stattdessen den Künsten widmeten, so dass die Städte überall in Schönheit erstrahlten und das Umland wie ein Garten aussah. Sie waren begeistert von der Größe der Schiffe, welche die Meere bevölkerten und Schätze aus so fernen Ländern wie Indien(1) brachten. Sie waren bewegt von dem Gedanken, dass die Opferflammen, die zuvor nur an isolierten Punkten gebrannt hatten, nun etwas Unauslöschliches waren, das unaufhörlich von Volk zu Volk weitergegeben wurde und immer an irgendeiner Stelle der Welt erstrahlte. Für einen Menschen aus der Provinz, der im Imperium des Hadrian aufgewachsen war, waren dies die Früchte des römischen Friedens, der Pax Romana.
Seit Gibbon(2) hat sich das Wissen darüber, wie dieser Frieden funktionierte und aufrechterhalten wurde, in Quantensprüngen weiterentwickelt. Archäologische Stätten wurden ausgegraben, Inschriften tabellarisch erfasst und ausgewertet, Papyri und Schrifttäfelchen aus Abfallhaufen ausgegraben und penibel transkribiert, und die immense Masse an Zeugnissen wurde in einer Breite zusammengefügt, die Gibbon verblüfft und beglückt hätte. Der Glaube der westlichen Wissenschaftler, dass das von Hadrian(12) regierte Imperium tatsächlich den schönsten Teil der Erde umfasste, wurde schon vor langer Zeit durch die Erkenntnis relativiert, dass es nicht die einzige Großmacht auf der eurasischen Landmasse war. Heute sind vergleichende Studien des römischen(1) und des chinesischen Imperialismus(1) ein hochaktuelles Forschungsgebiet der Alten Geschichte. Dennoch bleiben Ausmaß und Dauer des Friedens, der dem westlichen Rand Eurasiens während des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. beschieden war – einem Zeitraum, in dem ein großer Teil davon zum ersten Mal eine einzige politische Einheit bildete –, beispiellos. Wie in den 1770er Jahren kann auch heute gesagt werden: Niemand kann das von sich behaupten, was die Caesaren stolz für sich in Anspruch nahmen: dass der Mittelmeerraum ausschließlich ihnen gehörte.
Selbst der Wohlstand der römischen Welt – der den Verbrauchern des 21. Jahrhunderts weitaus weniger überwältigend erscheinen dürfte als Gibbon(3) – vermag Wirtschaftswissenschaftler nach wie vor zu beeindrucken. Der emeritierte Gray-Professor für Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology hat errechnet, dass »die Lebensbedingungen im früheren römischen Reich besser waren als irgendwo und zu irgendeiner Zeit sonst vor der Industriellen Revolution«.[7] Es ist aufgrund fehlender präziser Daten unvermeidlich, dass Größe und Effizienz der römischen Wirtschaft in den ersten beiden Jahrhunderten n. Chr. Gegenstand heftiger Debatten bleiben; trotzdem sind die Ressourcen, die den Städten im gesamten Imperium zur Verfügung standen, nicht nur den mit der Epoche befassten Wissenschaftlern, sondern auch zahllosen Touristen vertraut. Selbst der flüchtigste Besucher von Ephesos(1) oder Pompeji(1) kann von den Sehenswürdigkeiten nicht unbeeindruckt bleiben. Tempel und Theater, Bäder und Bibliotheken, Pflastersteine und Zentralheizungen – all das sind unübersehbare Zeichen der Pax Romana. Bis heute dienen sie in Filmen, Zeichentrickfilmen oder Computerspielen als Kürzel nicht nur für die Blütezeit des Römischen Reichs, sondern für Zivilisation an sich.
Aber was haben die Römer eigentlich für uns getan? Die Antwort lautet: Abwasserentsorgung, Medizin, Schulwesen, Wein, öffentliche Ordnung, Bewässerung, Straßen, Trinkwasserversorgung und öffentliches Gesundheitswesen. Eine solche Aufzählung schmeichelt zwar der Pax Romana, aber sie ist natürlich nicht vollständig. Wenn es Licht gab, dann gab es auch Dunkelheit. Das berühmteste aller römischen Baudenkmäler, das von der italienischen Tourismusindustrie ebenso geliebt wird wie von Hollywood, war eine Bühne für das Vergießen von Blut. Das Kreuz, das einst in der Mitte des Kolosseums(1) stand, mag schon lange verschwunden sein, da es in den 1870er Jahren von Archäologen entfernt wurde, aber die mörderischen Darbietungen im Amphitheater – auch wenn es keine stichhaltigen Beweise dafür gibt, dass dort jemals Christen(1) an Löwen(1) verfüttert wurden – steht heute noch ebenso im Brennpunkt moralischer Missbilligung wie zu der Zeit, als der Ort eine Kapelle und einen Kreuzweg beherbergte. Niemand, der sich den Film Gladiator(1) anschaut, identifiziert sich mit dem Kaiser. In unserer instinktiven Sympathie für die Opfer des römischen Blutsports erweisen wir uns als Erben nicht der Caesaren, sondern der frühen Kirche.
»Und ich sah das Weib trunken vom Blute der Heiligen und vom Blute der Zeugen Jesu.«[8] So schrieb der Evangelist Johannes in der Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testaments, gegen Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. Die Vision des Johannes wird als Apokalypse bezeichnet, als ein Öffnen des Vorhangs, der die kommenden Ereignisse vor den Augen der Sterblichen verborgen hatte; doch sie ist auch der anschaulichste, aufwühlendste und einflussreichste Angriff auf den Imperialismus(2), der je verfasst wurde. Die Frau, die Johannes erblickte, war eine in Purpur gekleidete Hure, behängt mit prunkvollem Schmuck und sitzend auf einem scharlachroten Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Babylon(1) war ihr Name, und sie war die Mutter sämtlicher Lasterhaftigkeiten und Abscheulichkeiten der Welt. Ein Engel, der zum Erzähler spricht, enthüllt die wahre Identität dieser monströsen Prostituierten: »die große Stadt, welche die Herrschaft hat über die Könige der Erde«.[9]
In der Offenbarung dienen die Macht und der Reichtum der Welthauptstadt nur dazu, das Glücksgefühl zu steigern, das Johannes beim Anblick ihres Untergangs empfindet. Eine Stimme aus dem Himmel teilt ihm mit, dass die Könige der Erde weinen und wehklagen werden, wenn sie sie brennen sehen, und die Händler werden trauern:
Wehe! wehe! die große Stadt,
die gekleidet war in feine Leinwand, Purpur und Scharlach,
und mit Gold, Edelsteinen und Perlen bedeckt war,
dass in einer Stunde ihr so großer Reichtum
dahingeschwunden ist![10]
Hier, im Herzen des römischen Reichs, entstand die Prophezeiung seines Untergangs, die immer der Schatten der Erinnerung an seine Größe bleiben sollte. So wie es das Zeitalter Hadrians(13) und seines Nachfolgers Antoninus Pius(1) war, das Gibbon(4) als die schönste Aussicht auf universellen Frieden für die Welt pries, so war es der Anblick barfüßiger Mönche, die in einem heidnischen Tempel im Herzen Roms die Vesper sangen, welcher ihn zum ersten Mal dazu veranlasste, über den Niedergang und Fall des römischen Reichs nachzusinnen. Nicht nur die alten Götter wurden von Christus gedemütigt. Auch die Caesaren, die das Imperium in seiner größten Ausdehnung regiert hatten, wurden erniedrigt. Heute erinnern in Rom weder das Mausoleum des Hadrian(2) noch der Pons Aelius(3) an den Mann, der sie errichtet hat. Stattdessen zeugen sie, auf der Spitze des Mausoleums, von der Erscheinung des Erzengels Michael, der, wie in der Offenbarung beschrieben, den Satan zu Fall brachte. Und auf der Triumphsäule(1), die von Trajan(1) errichtet wurde, dem Vorgänger Hadrians und am meisten bejubelten aller römischen Kaiser, steht nicht mehr etwa Trajan selbst, sondern der Apostel Petrus(1), ein bescheidener Fischer. Christus hatte das alles vorhergesagt: »Die Letzten werden die Ersten sein, und die Ersten die Letzten.«[11]
Der Gedanke, dass dies als etwas Positives, als ein aufs Innigste zu wünschendes Ziel zu betrachten sei, wäre Trajan(2) verschlossen geblieben. Für die römische Elite dieser Zeit waren der Glaube und die Lehren der Christen(2) nur am Rande ein Thema. Die Christen waren eine schwache und nur gelegentlich beachtete Größe im städtischen Gefüge des Imperiums, so ähnlich wie mesozoische Säugetiere in einem von Dinosauriern beherrschten Ökosystem. Doch so wie die Säugetiere dazu bestimmt waren, auf lange Sicht die Erde zu erben, so waren es auch die Christen. In der Tat war die Revolution der Werte, die durch ihren Triumph ausgelöst wurde, so umfassend, und wir im Westen sehen diese mittlerweile als so selbstverständlich an, dass es uns heute schwerfällt zu erkennen, wie tiefgreifend viele unserer Grundannahmen noch immer von ihnen beeinflusst sind. Zwar haben Europäer und Amerikaner schon immer mit Bewunderung auf Rom zurückgeblickt, doch war diese Bewunderung – selbst während der Blütezeit des westlichen Imperialismus(1) – immer auch mit Misstrauen verbunden. Wenn Christen das Land anderer Völker annektierten, dann taten sie dies als Anhänger eines Mannes aus der Provinz, der auf Befehl eines kaiserlichen Verwalters zu Tode gefoltert worden war. In die Rolle des Pontius Pilatus(1) zu schlüpfen dürfte ihnen also nicht unbedingt leichtgefallen sein. Enthusiasmus für Entkolonialisierung ist ein sehr westliches Phänomen.
Die Römer waren in ihrer Darstellung kolonialer Gewaltanwendung unschuldiger. Für sie diente das Kreuz nicht wie für die Christen(3) als Symbol für den Triumph des Gefolterten über den Folterer, sondern eher für das Gegenteil: für das Recht, das sie für sich beanspruchten, einen Aufstand so brutal und kompromisslos zu unterdrücken, wie es ihnen beliebte. Ihre Gefühllosigkeit war durch keinerlei Schuldgefühle angekränkelt. Diese wurden erst vom Christentum eingeführt. Auch wenn der Kirchenbesuch im Westen heute nicht mehr das ist, was er früher einmal war, so bleibt unsere Gesellschaft doch nach wie vor vom Erbe der Feindschaft der frühen Christen gegen die Hure Babylon(2) geprägt. Historiker des klassischen Altertums sind davon nicht weniger beeinflusst als alle anderen. Sicherlich ist enthusiastische Begeisterung für das Imperium kein Merkmal zeitgenössischer Fakultäten für Alte Geschichte. Die von den Römern hochgeschätzten kriegerischen Qualitäten, die es ihnen ermöglichten, ihr riesiges Imperium zu erobern und zu verteidigen, ergiebige Sklavenernten einzufahren und Blutsport begeistert als Unterhaltung zu genießen, sind heute an den Universitäten nur noch selten Schwerpunkt wissenschaftlichen Interesses.
Es ist also eines der großen Paradoxa der Alten Geschichte, dass das einflussreichste Vermächtnis der Pax Romana eine Bewegung war, die so revolutionäre Auswirkungen hatte, dass es uns heute große Anstrengungen abverlangt, die Welt auch nur ansatzweise so zu verstehen, wie die Römer sie verstanden haben. Denn jetzt sehen wir sie wie durch Glas, verdunkelt. Das Christentum(4) ist jedoch nicht das Einzige, was als lebendige Tradition aus dem 1. und 2. Jahrhundert überlebt hat, und es ist auch nicht das Radikalste in seiner Feindseligkeit hinsichtlich der Erinnerung an den römischen Imperialismus(2). Im Laufe der Zeit kamen nämlich Caesaren an die Macht, die selbst Christen waren, und das Imperium, das zuvor trunken gewesen war vom Blut der Heiligen und der Märtyrer, wurde nun Christus geweiht. Auch wenn Trajan(3) letztlich gestürzt wurde, bedeutete die Ersetzung seiner Statue auf der Spitze seiner Triumphsäule(2) in Rom durch eine Statue des Apostels Petrus(2) keine Verurteilung des Andenkens an den Kaiser. So wie die Römer selbst ihn als Optimus Princeps, den besten aller Kaiser, gefeiert hatten, so bewunderten ihn die Christen des Mittelalters(2) fast als einen der ihren. Aus Sorge um das Schicksal seiner Seele wurde sogar eine bemerkenswerte Geschichte erzählt. Es hieß, ein besonders heiliger Papst, den Einzelheiten aus dem Leben Trajans tief beeindruckt hatten, sei bestürzt darüber gewesen, dass ein solcher Ausbund an Tugend nicht in den Himmel gelangen sollte, und er fühlte sich gedrängt, für seine Rettung zu flehen: »Er ging in die Peterskirche und weinte, wie es seine Gewohnheit war, Fluten von Tränen, bis er schließlich durch göttliche Offenbarung die Gewissheit erhielt, dass seine Gebete erhört wurden, da er sich nie angemaßt hatte, das für einen anderen Heiden zu erbitten.«[12] Deshalb sah Dante(1) sich befugt, in seinem großen Gedicht Die göttliche Komödie Trajan ins Paradies zu versetzen.
Doch nicht nur die Christen(5) spekulierten über das Schicksal, das Caesaren nach ihrem Tod ereilen würde, die während der Blütezeit des Imperiums geherrscht hatten. Auch die Juden taten das. Sie machten sich keine Gedanken über das Schicksal der Seelen der Kaiser. Die Rabbiner konnten kaum den Namen Hadrian(14) aussprechen, ohne ihn zu verfluchen – »Mögen seine Knochen verrotten!« –, doch es war ein früherer Caesar, der die beunruhigendsten Überlieferungen auf sich zog. Titus(1), der zwischen 79 und 81 n. Chr. kurz regierte und der zweite einer Dynastie war, die man die Flavier nennt, hatte sich durch sein Handeln eine schreckliche Strafe zugezogen. Eine Mücke, das kleinste Geschöpf Gottes, war ihm in die Nase geflogen und in sein Gehirn eingedrungen. Dort hatte sie sieben Jahre lang ununterbrochen gesummt. Als Titus dann starb und Ärzte seinen Schädel öffneten, stellten sie fest, dass die Mücke zu einem Wesen von der Größe eines Sperlings herangewachsen war, mit einem Schnabel aus Messing und Krallen aus Eisen. Doch die Leiden des Kaisers waren damit noch nicht zu Ende – und sie würden es auch nie sein: Denn in der Hölle war sein wiederhergestellter Leib dazu verdammt, täglich zu Asche verbrannt zu werden.
Was hatte Titus(2) verbrochen? Im Jahr 70 n. Chr., vier Jahre nach dem Aufstand der Juden gegen Rom, hatte ein Heer unter seinem Befehl das heiligste Gebäude der jüdischen Welt, den Tempel von Jerusalem(1), erobert und niedergebrannt. Sechs Jahrzehnte später rieb Hadrian(15) Salz in die jüdischen Wunden, indem er an dieser Stelle einen heidnischen Tempel(1) bauen ließ. Erneut erhoben sich die Juden zum Aufstand. Erneut wurden sie von den Römern vernichtend geschlagen. Dieses Mal sollte sich das Werk der Befriedung als endgültig erweisen. Jerusalem wurde als römische Stadt wieder aufgebaut. Der Name des jüdischen Heimatlandes, Judäa(1), wurde zu Palästina verändert. Ein christlicher Gelehrter bemerkte schadenfroh, dass die Juden »das einzige Volk in der Welt sind, das aus seiner eigenen Hauptstadt vertrieben wurde«.[13] Sie waren eine Nation im Exil geworden.
Die Auswirkungen dieser schicksalhaften Entwicklungen sind noch heute spürbar. Der große Felsen(1), auf dem einst der Tempel stand, ist heute ein Ort, der sowohl den Muslimen als auch den Juden heilig ist, überragt vom ersten Meisterwerk der islamischen Architektur und der drittheiligsten Moschee des Islam(1) – dem Felsendom. Er ist daher der gefährlichste Krisenherd der Welt. Israel(1) hingegen – ein jüdischer Staat, der im ehemaligen Judäa(2) gegründet wurde – hat sich stets auf die Erinnerung an die Kriege gegen Rom gestützt, um seine nationale Identität zu festigen. Masada(1), ein Berg südlich von Jerusalem(1), auf dem sich Anfang der 70er Jahre fast tausend jüdische Männer, Frauen und Kinder, so heißt es, lieber das Leben nahmen, als sich den Römern zu ergeben, ist für die Israelis zu einem Symbol für den Mut und die Entschlossenheit geworden, die auch sie als ein von Feinden umgebenes Volk an den Tag legen müssen. Ein solches Selbstverständnis beruht auf einem zentralen Grundsatz: dass Israel tatsächlich von dem jüdischen Staat abstammt, der von Rom zunächst erobert und dann ausgelöscht wurde. Als man 1960 dem israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Ben-Zvi(1) kurz zuvor entdeckte Briefe des Anführers des jüdischen Aufstands gegen Hadrian(16) zeigte, bezeichnete er sie als »vom letzten Präsidenten geschriebene oder diktierte Botschaften(2)«.[14]
Ein Scherz – und doch auch mehr als ein Scherz. Wenn man annimmt, dass die Bewohner der römischen Provinz Judäa(1) Juden in dem Sinn waren, wie wir das Wort heute verwenden, ist die Gefahr eines Anachronismus sehr groß – tatsächlich so groß, dass ich mich entschieden habe, dieses Risiko nicht einzugehen. Das Erbe der christlichen Tradition kann wie eine Nebelwand wirken, die uns die Konturen des römischen Reichs zu seiner Blütezeit verschleiert, und das gilt auch für das Erbe der jüdischen Tradition. Vieles, was das ausmacht, was wir heute als »Judentum« bezeichnen – die Rolle der Rabbiner, der Synagogen, des Talmud – ist weniger eine Bewahrung dessen, was vor den Kriegen gegen die Römer existierte, als vielmehr eine Anpassung an dessen Verlust. Vor der endgültigen Zerstörung ihrer Heimat durch Hadrian(17) waren die Ioudaioi – so nannten die Griechen die Bewohner von Judäa – ein Volk, ein ethnos, wie viele andere auch. Sie wirkten vielleicht exzentrisch, aber das galt auch für viele andere Völker. Man sah sie gewiss nicht als Angehörige einer »Religion« namens »Judentum«: Denn beide Wörter, die sich aus spezifisch christlichen theologischen Aussagen ableiten, hätten weder den Römern noch den Griechen noch auch den Juden selbst etwas bedeutet. So wie die Einwohner Athens Athener waren und Menschen aus Ägypten Ägypter, so ist es vielleicht am treffendsten, die Einwohner Judäas als Judäer(1) zu bezeichnen.
Das Römische Reich zu seiner Blütezeit war eine völlig andere Welt als die unsere, und es ist gefährlich, darüber in Sprachen wie dem Englischen oder Deutschen zu schreiben – Sprachen, die durch mehr als ein Jahrtausend christlicher Voraussetzungen geprägt und abgenutzt sind –, ohne sich darüber im Klaren zu sein, wie verräterisch dieses Medium sein kann. So wie ich versucht habe, dem Geist gerecht zu werden, in dem das Kolosseum(2) gebaut wurde, indem ich es in meiner Darstellung als das Flavische Amphitheater(3) bezeichnet habe (so lautete sein ursprünglicher Name), so habe ich auch versucht, mich vor heimtückischeren Anachronismen zu schützen: Perspektiven und Annahmen, die für die Menschen, welche die Protagonisten dieses Buches sind, unverständlich gewesen wären. Römische Einstellungen zu Dimensionen von Erfahrung, die wir als universell betrachten könnten – Dimensionen der Moral, der Sexualität oder der Identität – waren aus unserer Denkweise radikal fremd und beunruhigend. Sie sind in der Tat so beunruhigend, dass manche es vorgezogen haben, sie nicht einmal als solche zu erkennen. Mein Ziel beim Schreiben von Pax war es immer, den Bewohnern der römischen Welt den Respekt zu zollen, der allen antiken Völkern gebührt, indem ich versuche, sie nicht mit unseren, sondern mit ihren eigenen Begriffen zu verstehen, in all ihrer Ambivalenz, ihrer Komplexität und ihren Widersprüchen.
Jeder, der versucht, ein solches Ziel zu erreichen, sieht sich mit einer offensichtlichen Herausforderung konfrontiert. Als im Jahr 1960 in einer Höhle in der judäischen Wüste Briefe aus den letzten Tagen des Aufstands gegen Hadrian(18) entdeckt wurden, war die Aufregung, die sie auslösten, nicht nur auf israelischen Patriotismus zurückzuführen. Der Fund war spektakulär, denn er trug – wenn auch unvollständig – dazu bei, eine klaffende Lücke in der Geschichtsschreibung zu schließen. Der Konflikt, so folgenreich er auch gewesen sein mag, hat nur wenige schriftliche Quellen hinterlassen. Zwar lassen sich aus Inschriften, Münzen oder den viel später entstandenen – und offensichtlich tendenziösen – Texten von Rabbinern und Kirchenväter einige Details herauslesen, doch die einzigen überlieferten erzählenden Berichte sind äußerst lückenhaft. Historiker und Archäologen haben in den letzten Jahrzehnten die Trümmer des Beweismaterials mit heldenhaftem Erfolg durchforstet, und dennoch ist es trotz der jüngsten Veröffentlichung einer Reihe von Studien über den Krieg unmöglich, mehr als nur die gröbsten Umrisse seines Verlaufs zu erhalten. Die Mythen, die sich um den Todeskampf der Judäer(2) gegen Hadrian ranken, sind weitaus lebendiger als alles, was ein Historiker darüber zu schreiben vermag.
Zwar gibt es durchaus andere Konflikte, über die wir sogar noch weniger wissen. So kam es während der Regierungszeit Hadrians(19) zu einem Aufstand in Britannien(6), den ein römischer Schriftsteller ausdrücklich mit dem Krieg in Judäa(3) verglich und der vermutlich zu der Entscheidung des Kaisers beitrug, seinen berühmten Wall zu errichten; aber darüber hinaus wissen wir wenig.[15] Umgekehrt erscheint das Narrativ über den Aufstand der Judäer(3) gegen Hadrian(20) um so gespenstischer, als der ursprüngliche Aufstand der Judäer – der in der Zerstörung des Tempels(2) und der Belagerung von Masada(2) gipfelte – eine für die Verhältnisse der Alten Geschichte erstaunliche Menge an Zeugnissen hinterlassen hat. Wir haben Biographien der beiden Flavier – von Titus(3) und seinem Vater Vespasian(1) –, welche die Legionen in diesem Konflikt befehligten. Tacitus(1), der größte aller römischen Geschichtsschreiber, gibt einen abschätzigen Überblick über alles, was die Judäer von ihren Nachbarn unterschied. Wir haben Münzen, Inschriften und Friese. Vor allem aber haben wir einen detaillierten Bericht über den Aufstand und seine Ursachen, der nicht von einem Römer, sondern von einem Judäer verfasst wurde – und zwar von einem Judäer(4), der in diesem Konflikt eine wichtige Rolle spielte. Der Judäische Krieg des Josephus(1) ist eines der bedeutendsten Geschichtswerke, die aus der Antike überliefert sind; und dabei ist es bemerkenswerterweise noch nicht einmal der einzige erzählende Bericht über jene schicksalhaften Jahre. Auch Tacitus verfasste eine solche Geschichtserzählung, allerdings nicht über den Aufstand in Judäa(4), sondern über den Bürgerkrieg, der zur gleichen Zeit die römische Welt erschütterte und in dem im Jahr 69 nicht weniger als vier Caesaren nacheinander regierten.
Um die Geschichte dieser Zeit zu erzählen, muss man sich also stets der Tatsache bewusst sein, dass die Beweislage für die römische Geschichte, die manchmal hell erstrahlt und manchmal gar nicht existiert, sehr uneinheitlich geartet ist. Die in diesem Buch dargestellte Welt wird auf ähnliche Weise beleuchtet, wie eine nächtliche Küstenlinie von einer riesigen Batterie von Leuchttürmen erhellt werden könnte. Hierhin und dorthin huschen ihre Strahlen in unregelmäßigen und unzuverlässigen Mustern umher. Manchmal wird ein Stück Felsen von hellem Licht überflutet. Manchmal wird die Landschaft abrupt in Dunkelheit getaucht. Ganze Küstenabschnitte werden womöglich gar nicht beleuchtet. So verhält es sich mit den Jahrzehnten zwischen dem ersten und dem zweiten jüdischen Aufstand, zwischen dem Vierkaiserjahr und dem Amtsantritt des Antoninus Pius.
Ich betone dies nicht, um den Leser zu beunruhigen, sondern um die Balance und den Rhythmus des Buches zu erklären. Der Umfang und der Schwerpunkt meiner Darstellung, das Ausmaß, in dem sie sich von Schauplatz zu Schauplatz bewegt und hinein- und herauszoomt, wird vor allem durch die Art des verfügbaren Quellenmaterials und der archäologischen Beweise bestimmt. Es mag sein, dass uns Aufzeichnungen für ganze Jahre fehlen, aber wir können die Ereignisse eines bestimmten Jahres, des schicksalhaften Jahres 69 n. Chr., Monat für Monat und oft auch Tag für Tag rekonstruieren. Es mag sein, dass uns Geschichten fehlen, die sich mit den Taten von Stadträten, Frauen, Geschäftsleuten oder Sklaven befassen; aber wir haben die Überreste von Pompeji(2) und Herculaneum(1), in denen die Geister vieler solcher Menschen noch immer durch die Straßen spuken. Es mag sein, dass uns eine Biographie von Trajan(4) fehlt, dem am meisten bewunderten aller Caesaren; aber wir haben detaillierte Berichte darüber, was unter seiner Herrschaft in einer ganz bestimmten Provinz geschah. Dies ist eine Geschichte, die in Rom beginnt und endet, aber es geht um sehr viel mehr als Rom. Es ist eine Geschichte, welche die gesamte römische Welt umfasst – und auch die Regionen jenseits ihrer Grenzen.
Pax ist der dritte Teil in einer Reihe von Bänden über Geschichte, die jeweils für sich allein stehend verfasst wurden. Der erste, Rubikon, erzählt die Geschichte Julius Caesars(1) und seines Zeitalters; der zweite, Dynastie, diejenige von Augustus(1), dem ersten römischen Kaiser, und der Linie der Herrscher, die von ihm abzustammen beanspruchten. Pax beginnt mit einem Schlüsselmoment der Geschichte: dem Selbstmord Neros(1), des letzten männlichen Nachkommen des Augustus, im Jahr 68. Mit seinem Tod erlosch die erste Dynastie römischer Autokraten. Was sollte an ihre Stelle treten? Der Versuch, diese Frage zu beantworten, beendete ein langes Jahrhundert des bürgerlichen Friedens. Im Jahr 69 regierten vier Männer nacheinander als Kaiser. Soldaten metzelten sich in den Straßen Roms gegenseitig nieder, und der größte Tempel der Hauptstadt brannte ab. Das Vierkaiserjahr diente dem römischen Volk als brutale Erinnerung daran, dass seine ganze Größe, sein ganzer Wohlstand durch genau die Eigenschaft bedroht sein könnte, die ihm ursprünglich sein Imperium eingebracht und es in die Lage versetzt hatte, die innere Sicherheit zu gewährleisten: seine Tötungs-Kompetenz. Die Fähigkeit der Legionen, extreme Gewalt auszuüben, war die notwendige Voraussetzung für die Pax Romana. Aus diesem Grund sollte in einem Buch über die längste ununterbrochene Friedensperiode, die der Mittelmeerraum je erlebt hat, der Krieg den Rahmen bilden.
Kind aus der Zeit, als Nero Selbstmord beging, hätte gut lange genug leben können, um später den Trauerfeierlichkeiten für Hadrian(21) beiwohnen können, den Ritualen, die seinen Tod begleiteten. Die Jahrzehnte, die zwischen diesen beiden Kaisern lagen, waren von so dramatischen Ereignissen geprägt, dass ihr Ruhm bis heute anhält: die Belagerung und Zerstörung Jerusalems(2); der Ausbruch des Vesuvs(1); die Einweihung des Kolosseums(4). Auch nachdem der Großteil der römischen Welt nach dem Vierkaiserjahr wieder zur Ordnung zurückgebracht worden war, schwelten die Konflikte weiter: in Britannien(2), entlang der Donau(2), in Judäa(5). Die Legionen trugen ihre Waffen bis zum Persischen Golf(1). Die Römer blieben, was sie immer gewesen waren: die Helden eines gewaltigen Dramas unvergleichlicher Heldentaten und Prüfungen. Am folgenreichsten war jedoch ein Wandlungsprozess, der im Laufe der in diesem Buch behandelten Zeitspanne dazu diente, das, was mit dem Namen »Römer« bezeichnet wurde, für immer zu verändern. Als Hadrian starb, bezeichnete der Begriff nach den Worten eines Zeitgenossen – eines Mannes, der dem Kaiser nahe genug stand, um mit ihm poetische Witzeleien auszutauschen – »weniger ein bestimmtes Volk als vielmehr die Gesamtheit der menschlichen Rasse«.[16] Das Imperium war der reichste, der gewaltigste, der furchterregendste Staat, den es je gegeben hatte: ein Staat, der im Laufe der in Pax beschriebenen Jahrzehnte immer wieder seine Unbesiegbarkeit zur Schau stellte, so dass selbst seine Feinde zu der Überzeugung gelangten, er könne niemals besiegt werden. Ich habe versucht, die Römer in der Blütezeit ihres Imperiums zu porträtieren, nicht als unsere Zeitgenossen, nicht als Strohmänner, die man entweder nachahmen oder verdammen sollte, sondern als ein Volk, das uns vor allem deshalb fasziniert, weil es anders ist – beunruhigend, bezwingend anders.
Wahrhaftig: Es ist, als ob die Römer und die grenzenlose Majestät ihres Friedens von den Göttern geschenkt worden wären, um der Menschheit als eine zweite Sonne zu dienen.
Plinius der Ältere
Wo sie eine Wüste hinterlassen, nennen sie sie Frieden.
Tacitus
TEIL I
KRIEG
I
Die traurigen Götter der Unterwelt
Ein goldenes Zeitalter
Fünfundsechzig Jahre nach Christi Geburt wurde die berühmteste Frau Roms eine Göttin. Auf Erden wurde ein prächtiges Begräbnis inszeniert, um ihren Aufstieg in den Himmel anzuzeigen. Ihr Leichnam, gefüllt mit den teuersten Gewürzen, die für Geld zu bekommen waren, wurde in einer feierlichen Prozession den Palatin(1) hinuntergetragen, den größten und exklusivsten der berühmten sieben Hügel der Stadt. Voran schritten Chöre, die Begräbnislieder sangen, und Amtsträger, die als die Vorfahren der toten Frau maskiert und kostümiert waren; Soldaten gaben ihr das Geleit. Die Prozession ging hinunter in das Tal zwischen dem Palatin und einem zweiten, kleineren Hügel, dem Kapitol(1). Dieses Tal – das Forum(1), wie es genannt wurde – war ein Ort, der dem Anlass ausgezeichnet entsprach. Mit glänzendem Marmor gepflastert, von luxuriösen Einkaufszentren gesäumt und mit einem veritablen Wirrwarr von Statuen, Tempeln und Bögen geschmückt, bildete er das Herzstück der größten Stadt der Welt.
»Rom(3), Sitz des Imperiums, Wohnstatt der Götter, überblickt von seinen sieben Hügeln aus den gesamten Erdkreis.«[1] So hatte ein Dichter etwa fünfzig Jahre zuvor die Stadt gepriesen. Roms Herrschaft hatte sich in den dazwischen liegenden Jahrzehnten immer weiter ausgedehnt. Sogar Britannien(3), ein sumpfiges, von Milch trinkenden Barbaren bewohntes Land jenseits des Ozeans, war dazu gebracht worden, Roms Herrschaft anzuerkennen. Von Spanien(1) bis Syrien(1) gehörte das gesamte Mittelmeer zu Rom. Keine Stadt an den Ufern dieses alten Meers war so reich, so schön, so berühmt, dass sie hinter Rom nicht zurückgeblieben wäre. Als die Tote in einer düsteren Prozession zu der Ansammlung von Bauwerken vor dem Kapitol(2) getragen wurde, war diese Größe im gesamten Umkreis zu sehen. Rechts von den Trauernden, die das Forum(2) entlanggingen, befand sich eine besonders spektakuläre Ansammlung von Tempeln und Freiflächen. Der Komplex war noch kaum ein Jahrhundert alt. Er war ein Monument der Eroberung. Der erste Teil, der fertiggestellt wurde, ein Forum(1), das von einem großen Staatsmann und Kriegsherrn namens Julius Caesar(2) errichtet worden war – einem Mann von so transzendentem Leistungsvermögen, dass er am Ende ein Gott geworden war –, war mit der Kriegsbeute aus Gallien(1) gebaut worden. Der zweite Abschnitt, ein weiteres Forum(1), war ebenfalls durch Siege in der ganzen Welt finanziert worden. Der Mann, der für dieses Forum verantwortlich war, hatte mehr als jeder andere Römer zur Erweiterung der Macht seiner Stadt beigetragen. Augustus(2) – »ein Name, der bedeutet, dass er mehr war als ein Mensch«[2] – war der Großneffe und Adoptivsohn Caesars gewesen, und sein Ruhm stellte sogar den seines Vaters noch in den Schatten. Augustus hatte sich zum Herrscher über Ägypten(1) gemacht, ein Land, das unvergleichlich reich und fruchtbar war; er hatte die Befriedung Spaniens zu Ende geführt; er hatte die Wilden, die jenseits des Rheins ihr Unwesen trieben, mit herrischem Tritt niedergetrampelt. Er hatte in einem Ausmaß Beute errungen, das frühere Eroberer fassungslos gemacht hätte. Vieles davon hatte er für die Verschönerung Roms ausgegeben. »Er rühmte sich, die Stadt aus Ziegeln vorgefunden und aus Marmor hinterlassen zu haben.«[3] Passenderweise war das prächtigste der vielen von ihm gestifteten Gebäude, ein großer, mit Statuen und einem vergoldeten Dach geschmückter Tempel auf seinem Forum(1), dem Kriegsgott Mars(1) geweiht. Hinter fernen Grenzen, bewacht von der stärksten Streitmacht, welche die Geschichte je gesehen hatte, lebten die Völker der zivilisierten Welt in Frieden. Wie nicht anders zu erwarten, war Augustus(3) selbst, nachdem sein Werk vollbracht war, zu seinem Vater(3) in den Himmel aufgestiegen.
Eine Stadt, die als Hauptstadt der Welt regierte, war mehr als nur eine Stadt. Ein Jahrhundert zuvor erstreckte sich dort, wo jetzt die großen Marmorkomplexe standen, ein Labyrinth aus engen Straßen. Wohnblocks, Werkstätten, Tavernen: Alles war weggefegt worden. Ruhe war an die Stelle von Chaos getreten, Symmetrie an die Stelle von Wirrnis. Die Würde des Ortes hatte nichts anderes verlangt. Hier war nicht nur das Herz Roms, sondern auch das Herz von allem, was jenseits von Rom lag. Als die Trauernden die Tote im Schatten des Kapitols(3) auf die marmorverkleideten Rostra(1) legten, sahen sie dahinter ein Denkmal, welches das besonders deutlich machte. Seit fünfundachtzig Jahren stand dort ein riesiger, mit Gold ummantelter Meilenstein(1). Augustus(4), der Mann, der für seine Aufstellung verantwortlich gewesen war, hatte ihn in Auftrag gegeben, um den Punkt zu markieren, von dem aus die Entfernungen im gesamten Imperium gemessen werden sollten. Ob am Rande der Sahara, an den Ufern des Rheins oder an der Küste des Ozeans – überall konnte ein Römer mit Sicherheit wissen, wo er stand. Er war durch seine Entfernung zum Forum(3) definiert. Alle Wege führten nach Rom.
Doch die ferne Vergangenheit, als noch Wölfe den Palatin(2) durchstreiften und das Forum(4) ein Sumpf war, wurde nicht vergessen. Die Dichter erfreuten sich an der Vorstellung einer Zeit, in der Rinder durch die künftige Hauptstadt der Welt streiften und Schiffe auf dem Tiber im Schatten von Wäldern dahinsegelten. Aber nicht nur in der Poesie konnten die Römer Erinnerungen an die Anfänge ihrer Stadt finden. Unmittelbar vor den Rostra(2), wo die Sargträger ihre Last abgelegt hatten, war ein markantes Stück Pflaster im Boden zu sehen. Dieser Stein, der sich schwarz vom Weiß der ihn umgebenden Marmoreinfassung abhob, war der Lapis Niger(1): der »Schwarze Stein«. Die Gelehrten waren sich über seine genaue Bedeutung nicht einig – aber niemand bezweifelte, dass er sehr alt war. Einige behaupteten, er markiere die letzte Ruhestätte von Romulus(1), einem Sohn des Mars(2), der 817 Jahre zuvor Rom gegründet und der jungen Stadt seinen Namen gegeben hatte. Andere bestanden darauf, dass Romulus nicht in einem Grab vermodert, sondern in einem Gewittersturm in den Himmel aufgenommen worden sei, und der Lapis Niger erinnere an diesen Moment, in dem ein Römer zum ersten Mal vergöttlicht wurde. In jedem Fall diente der Stein als Denkmal für die ersten zwei Jahrhunderte und darüber hinaus in der Geschichte der Stadt: eine Zeit, in der die Menschen in Rom nicht als Bürger, sondern als Untertanen eines rex – eines Königs gelebt hatten.
Insgesamt sieben Männer, von Romulus(2) bis zu einem hochmütigen Tyrannen namens Tarquinius(1), hatten auf Roms Thron gesessen. Trotz des sagenhaften zeitlichen Abstandes zu diesen Königen war der Lapis Niger(2) nicht die einzige Spur, die in der Struktur der Megalopolis erhalten war, zu der Rom(4) sich inzwischen entwickelt hatte. Auf dem Palatin(3) zum Beispiel, wo Romulus, als er darüber nachdachte, ob er eine Stadt gründen sollte, nach oben geblickt und zwölf Geier über sich fliegen gesehen hatte – ein untrügliches Zeichen himmlischer Zustimmung –, konnten die Besucher seine Hütte bewundern. Wenn man dann die Straße weiterging, die südlich des Palatin zu den Stadtmauern führte, traf man auf eine weitere Sehenswürdigkeit. Neben einem Tor, der sogenannten Porta Capena(1), befand sich neben einem tropfenden Aquädukt ein Hain, in dem eine Quelle sprudelte, die dem zweiten König Roms, Numa(1) Pompilius, heilig gewesen sein soll. An ihrem Wasser war Numa, ein gelehrter Philosoph, von der Nymphe Egeria(1) in den Dingen der Götter unterwiesen worden. »Egeria liebte ihn nämlich und pflegte die Gemeinschaft mit ihm, und das verlieh ihm übermenschliche Weisheit und ein Leben, das reich an zahlreichen Segnungen war.«[4]
Nicht alle Denkmäler aus der Königszeit waren für die Blicke der Öffentlichkeit zugänglich. Einige waren buchstäblich begraben worden. Unter dem Lapis Niger(3) befand sich ein unterirdischer Schrein, in dem ein Steinblock mit einer rätselhaften lateinischen Inschrift stand. Kaum entzifferbar, mit unbeholfenen Buchstaben, die fast griechisch aussahen, zeugte er von einer Zeit, in der Könige über heilige Haine wachten und Ochsen zur Opferung trieben. Die Konservatoren, die um seine Bedeutung als Zeugnis der Vergangenheit besorgt waren, hatten den Stein zusammen mit verschiedenen anderen Artefakten unter den schwarzen Pflastersteinen eingelagert: Denn sie hatten sich davor gehütet, ihn zu zerstören. Schriften aus den Anfängen der römischen Geschichte könnten durchaus mit einer Ladung des Übernatürlichen versehen gewesen sein. Der dramatischste Beweis dafür fand sich in einem Tempel auf dem Gipfel des Palatin(4), in dem drei in altertümlichem Griechisch beschriftete Rollen mit Prophezeiungen aufbewahrt wurden. Tarquinius(2) hatte sie der Sibylle(1) abgekauft, einer alten Priesterin, die vor den Toren Neapels(1) über einen Eingang zur Unterwelt wachte. Die Schriftrollen enthielten Gegenmittel für jedes Unheil, jede furchterregende Warnung des Himmels, die das römische Volk im Laufe der Jahrhunderte heimsuchen sollte. Der Zugang zu diesem heiklen Material war streng geregelt. Jeder, der Abschriften anfertigte, wurde mit dem Tod bestraft. Sie waren zu Neros(2) Zeiten das, was sie schon immer gewesen waren: ultimative Staatsgeheimnisse.
Im Gegensatz zu den Sibyllinischen Büchern(1) war das Zeitalter der Könige längst auf dem Misthaufen der Geschichte gelandet. Im Jahr 509 v. Chr., 244 Jahre nach der Gründung Roms, war Tarquinius(3) aus der Stadt vertrieben worden. Die Monarchie war abgeschafft. Die Amtsgewalt – die Römer nannten sie imperium – lag nicht mehr in den Händen eines einzigen Mannes. Stattdessen war sie unter einer Reihe von gewählten Magistraten aufgeteilt. Die bedeutendsten von ihnen – zwei an der Zahl, damit jeder ein wachsames Auge auf den anderen haben konnte – wurden Konsuln genannt. Jährliche Wahlen zum Konsulat(1) stellten sicher, dass niemand das Amt länger als ein Jahr am Stück innehaben konnte. Das geschah ganz bewusst, um den Ehrgeiz derjenigen zu zügeln, die andernfalls in Versuchung hätten geraten können, nach der Monarchie zu streben. Das römische Volk bestand nun nicht mehr aus Untertanen eines einzigen Mannes, sondern aus cives: Bürgern. Das Wort »König« war zum schlimmsten Schimpfwort ihrer Sprache geworden.
Das bedeutete jedoch nicht, dass die Römer das Streben eines Bürgers nach Ruhm missbilligten. Ganz im Gegenteil. Ehre galt als letzter, als einziger Maßstab für den Wert eines Mannes. Die Begrenzung der Amtszeit eines Konsuls, die auch verhinderte, dass die Magistratur als Sprungbrett zur Monarchie diente, hatte in jedem ambitionierten Bürger den Traum geweckt, ebenfalls ein Konsulat(2) zu erlangen. Dieser Traum war nie verblasst. Deswegen waren auch fast sechs Jahrhunderte nach der Vertreibung von Tarquinius(4) in Rom noch Konsuln im Amt. In Erwartung des Trauerzuges saßen sie unter freiem Himmel neben den Rostra(3), vor den Augen aller Anwesenden. Neben ihnen, gewandet in schlichte Trauerkleidung, reihten sich andere Mitglieder der römischen Elite: Männer aus angesehenen Familien, von verbrieftem Reichtum oder entscheidendem Wert, der sich in einer ganzen Reihe von Magistraturen und Führungspositionen bewiesen hatte. Das waren die optimates: die Klasse der Besten. Ihre Autorität reichte bis in die Anfänge Roms zurück. Romulus(3) selbst, so hieß es, hatte die hundert führenden Männer der jungen Stadt einberufen, damit sie ihm als Ältestenrat – als »Senat« – dienten, und er hatte sie offiziell als die Väter des Staates gewürdigt. Der Sturz der Monarchie hatte sie in ihrer Autorität nur noch bestätigt. Es war der Senat, der nach der Vertreibung des Tarquinius das römische Volk in seinem Kampf um die Unabhängigkeit geleitet hatte; es war der Senat, der es in den folgenden Jahrhunderten bei seiner Eroberung der Welt angeführt hatte. Zwar waren die öffentlichen Angelegenheiten der Stadt – ihre res publica – sowohl Sache des Volkes als auch des römischen Senats, aber niemand hatte je daran gezweifelt, wer der Körper und wer das Haupt war. Senatus Populusque Romanus: SPQR, der Senat und das Volk von Rom. Das war die römische Republik.
Angefangen hatte all das mit dem Anblick eines auf dem Forum(5) aufgebahrten Leichnams einer Frau. Jeder Senator, der an jenem Sommertag, 573 Jahre nach dem Sturz der Monarchie, auf die Rostra(4) blickte, kannte die Geschichte. Lucretia(1), vornehm erzogen, vornehm verheiratet und eine Frau von untadeliger Tugend, war vom Sohn des Tarquinius(5) vergewaltigt worden. Sie rief ihren Vater und ihren Ehemann zu sich und erzählte ihnen von der Schandtat, die ihr angetan worden war, woraufhin sie sich erdolchte. Ihre Verwandten, »denen der Grund für Lucretias Selbstmord mehr Schande und Kummer bereitete als der Selbstmord als solcher«,[5] hatten ihren Leichnam geschultert und zum Forum hinuntergetragen. Dort hatte sich, angezogen von dem schockierenden Anblick, eine Menschenmenge gebildet. Die Wut darüber, dass eine frei geborene Frau wie eine Sklavin behandelt worden war, hatte sich in der ganzen Stadt entladen. Das empörte und beleidigte römische Volk hatte sich erhoben, um seine Freiheit zu verteidigen. Damit war ein klarer Präzedenzfall geschaffen worden. Ein Römer, der sich der Knechtschaft ausgesetzt sah, hatte nur zwei Möglichkeiten: entweder sich selbst das Leben zu nehmen, oder den Mann zu töten, der ihn zum Sklaven gemacht hatte.
Und nun lag an dem Ort(6), an dem Lucretias(2) Leichnam fast sechshundert Jahre zuvor der Öffentlichkeit präsentiert worden war, der Leichnam einer anderen Frau vor den Augen der versammelten Menschen. Welche Lektion lehrte dieses zweite Leichenbegängnis? Auf jeden Fall vermittelte ja der Name der toten Frau – Poppaea(1) Sabina – mehr als nur einen Anflug antiker Tugend. Die Sabiner(1), ein bäuerliches Volk, das die Felder und Hügel nordöstlich von Rom bewohnte, waren schon früh am Aufstieg des römischen Volkes beteiligt gewesen. Numa(2) Pompilius zum Beispiel war ein Sabiner gewesen. Jeder erschöpfte Städter träumte davon, sich auf einen Sabinerhof zurückzuziehen. Sabinus diente immer noch als Kurzform für ehrliche, bäuerliche Werte. Poppaeas Vorfahren hatten jedoch den Bauernhof schon lange hinter sich gelassen. Ihr Großvater hatte das Konsulat(3) im selben Jahr wie sein Bruder inne. Ihr Stiefvater und ihr Halbbruder hatten ebenfalls als Konsuln gedient. Poppaea selbst – obwohl sie als Frau natürlich nicht für ein Amt in Frage kam – war berühmter geworden als jeder dieser Männer. Genauso wie ihr Gemahl genoss sie es, wenn man über sie sprach.
Mit Sicherheit war sie eine sehr facettenreiche Frau. »Von ihrer Mutter, der am meisten gefeierten Schönheit ihrer Zeit, hatte sie sowohl ihr Aussehen als auch ihren Ruf geerbt.«[6] Sie war ungemein gescheit. Sie war reich und wohlerzogen und hatte sich in der Öffentlichkeit mit der einer römischen Matrone angemessenen Würde benommen. Das hatte jedoch nicht verhindert, dass sie zum Objekt fiebriger Phantasien wurde. Ihre Angewohnheit, sich in der Öffentlichkeit nur halb zu verhüllen, wurde nicht als Zeichen der Bescheidenheit, sondern als Provokation aufgefasst. Die Römer waren ein klatschsüchtiges Volk, und Poppaea(2) hatte sie mit reichlich Futter versorgt. Sie beschlug ihre Maulesel mit Gold. Sie badete in Eselsmilch. Sie war ebenso promiskuitiv wie stolz. Ob wahr oder erfunden – diese Gerüchte hätten sich ohne das Feuer ihres Charismas und ihres Sexappeals nie so weit verbreitet. Frauen wollten so sein wie sie; Männer wollten mit ihr schlafen. Und nun war sie tot. Poppaea war vielleicht mit allem Pomp auf das Forum(7) gebracht worden, aber eine neue Lucretia(3) war sie sicher nicht.
Was hatte sie also dort zu suchen, diese Frau, die zur Gottheit erklärt worden war, die immerschöne Venus(1) Sabina? Die Senatoren in ihren Trauertogen hatten sich an diesem Sommertag nicht aus eigenem Antrieb auf dem Forum(8) versammelt, sondern weil sie dem Wunsch von Poppaeas(3) Ehemann Folge leisteten. Seit fast elf Jahren war der Imperator Nero(3) Claudius Caesar Augustus Germanicus vom römischen Volk als Princeps anerkannt: als Erster Bürger. Der Titel hatte alte Wurzeln. So misstrauisch die großen Männer der Republik auch immer gewesen waren, so war es doch möglich, dass ein Bürger, der sich ganz unstreitig besonders verdient gemacht hatte, als Princeps anerkannt wurde. Dieser Rang war nie offiziell und rief unweigerlich bitteren Groll hervor. Ein Bürger musste das Volk vor einem schrecklichen fremden Feind errettet, spektakuläre Eroberungen vollbracht oder als ausgezeichnetes Vorbild an Rechtschaffenheit gedient haben, um diesen Titel zu erhalten. Nichts von alledem traf auf Nero zu. Obwohl unter den römischen Eliten die Annahme tief verwurzelt war, dass Verantwortung dem Alter gebühre und man der Jugend nicht trauen dürfe, war er bereits im zarten Alter von siebzehn Jahren zum ersten Mal als Princeps gepriesen worden. Nicht genug damit, dass die Senatoren über dieses extravagante Lob nicht die Nase rümpften – sie konnten ihm gar nicht schnell genug eine ganze Reihe rechtlicher Befugnisse übertragen. Ehren, Vorrechte, Priesterwürden: Nero hatte alles erhalten. Das Ergebnis war, dass er faktisch die Herrschaft über die römische Welt innehatte. »Caesar ist die Republik.«[7] So wurde es formuliert. Wenn Nero beschloss, auf dem Forum ein öffentliches Begräbnis zu veranstalten, dann musste man schon sehr mutig sein, um die Einladung abzulehnen.
Sollte all das stark nach Monarchie klingen, dann liegt das daran, dass es tatsächlich eine Monarchie war. Im Lauf des letzten Jahrhunderts hatte sich in Rom vieles verändert. Die Senatoren, die an diesem Tag auf dem Forum(9) saßen, brauchten nur auf den Hügel über ihnen zu blicken, um diese Tatsache zu bemerken. Der Palatin(5), einst überfüllt mit den Villen der Strippenzieher der Republik, befand sich nun im Besitz eines einzigen Mannes: Nero(4). Die Fähigkeit der aristokratischen Sippen Roms, den bevorzugtesten Liegenschaften der Stadt ihren Stempel aufzudrücken, war systematisch zunichte gemacht worden. Selbst das Senatsgebäude(1), ein Komplex von Räumen direkt hinter dem Lapis Niger(4), trug den Namen Julius Caesars(4). Das galt auch für das glänzende Forum, das sich dahinter erstreckte. Dieselbe Beute aus Gallien(2), die Caesars Vorliebe für Großprojekte finanziert hatte, hatte es ihm ermöglicht, die gesamte Republik in seinen eigenen Schatten zu stellen. Unterstützt von Legionen, die auf den Schlachtfeldern Galliens gestählt worden waren, hatte er die traditionellen Strukturen der römischen Regierung in Schutt und Asche gelegt. Als Sieger in einem blutigen Bürgerkrieg war Caesar am Ende der Herrscher Roms.
Das war für viele seiner ehemaligen Mitstreiter selbstverständlich unerträglich gewesen. Im Bewusstsein, die Erben der antiken Helden zu sein, die Tarquinius(6) und seinen schändlichen Sohn vertrieben hatten, hatten sie Caesar unter einem Hagel von Dolchstichen niedergestreckt. Diese Verzweiflungstat hatte jedoch nichts zur Wiederherstellung der Republik beigetragen. Stattdessen war die römische Welt erneut in einen Bürgerkrieg verwickelt worden. Länger als ein Jahrzehnt hatte er gewütet. Warlord hatte gegen Warlord gekämpft. Am Ende dieses mörderischen Zyklus von Gewalt waren nur noch zwei übriggeblieben. Der eine war Caesars gefürchtetster Gefolgsmann, ein kampfgestählter Veteran mit großem Charisma und noch größerem Appetit: Marcus Antonius(1). Der andere war Caesars Adoptivsohn und Erbe: der junge Mann, der als Augustus(5) bekannt werden sollte. Im Jahr 31 v. Chr. waren die beiden Männer in einer großen Seeschlacht bei Actium(1), einer Bucht an der Westküste Griechenlands, aufeinander getroffen. Antonius war besiegt worden, und im Jahr darauf beging er Selbstmord. Es war Caesars Sohn, nicht sein Stellvertreter, der als Sieger aus dem großen Kampf um die Welt hervorgegangen war. Die Masse des römischen Volkes hatte an seiner Herrschaft keinen Anstoß genommen, sondern sie begrüßt. Die Menschen hatten genug von Chaos und Blutvergießen. Sie sehnten sich nach Frieden. Besser eine Monarchie als Anarchie. Die Republik war damit tot.
Augustus(6) war jedoch viel zu klug, seinen Landsleuten diese Realität unter die Nase zu reiben. Er war ebenso raffiniert wie diszipliniert und wollte nicht wie sein vergöttlichter Vater von seinen Senatskollegen ermordet werden. Dementsprechend tat er alles, um seine Vormachtstellung zu verschleiern. Er erklärte, die Republik wiederhergestellt zu haben. »Stets verabscheute er die Anrede ›Herr‹ als verfluchten und unehrenhaften Titel.«[8] Ganz sicher – obwohl er kurz erwogen hatte, sich den Namen Romulus(4) zu geben – hatte Augustus nicht die Absicht, als König zu regieren. Es war das Risiko einfach nicht wert. Er war interessiert an der Realität der Macht, nicht an der Show. Hinter der Fassade einer republikanischen Regierung – den Debatten im Senatsgebäude(2), der stetigen Abfolge von Konsuln, dem Beharren auf der Souveränität des römischen Volkes – nahm er systematisch die Zügel des Staates in die eigene Hand. Das imperium, das zuvor unter eine Vielzahl von Magistraten aufgeteilt gewesen war, hatte sich nun ein einziger Mann angeeignet. Diese königliche Machtfülle war dann auf Nero(5) mit seiner Ernennung zum Princeps übergegangen. Nicht nur Rom, sondern die ganze Welt, die von Rom beherrscht wurde, war nun seiner Autorität unterworfen. Und so überrascht es nicht, dass das Wort imperium im Lauf der Jahrzehnte, die auf die Lebenszeit des Augustus folgten, allmählich eine neue, subtile Bedeutungsnuance erhielt. Es bezeichnete nicht mehr nur die Macht, die ein Princeps ausübte, sondern auch die immense Ausdehnung des Territoriums, das dieser Macht unterstellt war. Wer wie Nero herrschte, der herrschte über ein imperium Romanum: ein »römisches Reich«. Es bedeutete, den Rang eines imperator, eines Kaisers einzunehmen.
»Es ist dein Schicksal, wie in einem Theater zu leben, in dem die ganze Welt dein Publikum ist«,[9] so hatte angeblich ein Ratgeber Augustus(7) gewarnt. Es genügte jedoch nicht, dass ein Kaiser ein Schauspieler war. Anders als ein König, anders als ein Konsul hatte er kein Drehbuch, dem er folgen konnte. Um in seiner Rolle erfolgreich zu sein, musste er sein eigenes Drehbuch schreiben. Niemand hatte das besser verstanden als Augustus, und niemand hatte damit so durchschlagenden Erfolg gehabt. Die Kaiser, die ihm folgten, hatten sich zu Extremen hinreißen lassen. Der unmittelbare Nachfolger des Augustus, ein Kriegsheld und Mann von beachtlichem Format namens Tiberius(1), hätte, wenn er in einer freien Republik gelebt hätte, aufgrund seiner eigenen Leistungen als Princeps gefeiert werden können; aber diese Zeiten waren für immer vorbei. Als Erbe einer Autokratie, die er insgeheim verabscheute, hatte sich Tiberius als miserabler Schauspieler erwiesen, der sowohl seine eigene Rolle als auch die Schmeichler, die ihn umgaben, so sehr verachtete, dass er sich schließlich für den Rest seines Lebens auf die Insel Capri zurückzog. Nero(6) hingegen liebte die Schauspielerei. Er liebte die große Bühne. Als erster Princeps seit Augustus(8), der den Titel Imperator als seinen Vornamen annahm, schwelgte er in dem Gedanken, dass er als Kaiser das Publikum der gesamten Welt beherrschen könnte. Er hatte bereits viele Rollen eingenommen. Er war als Apollo(1), strahlender Gott der Musik, aufgetreten. Er war als Sol(1), himmlischer Wagenlenker der Sonne, aufgetreten. Er hatte nicht nur Leier gespielt und Wagenrennen gefahren, sondern dies auch noch vor den Augen der Öffentlichkeit getan. Nach den Maßstäben der Konservativen in Rom war das ein schockierender Verrat an der Würde, die man von einem Bürger, und erst recht von einem Princeps, erwartete; aber viele im römischen Volk, darunter auch Angehörige der Elite, waren von diesem Verhalten ganz hingerissen. Jetzt, da Nero seine ganze Sucht nach Extravaganz, seine Vorliebe für große Reden und sein Händchen für Spektakel unter Beweis gestellt hatte, sollte er eine weitere Rolle spielen: die des hinterbliebenen Ehemanns.
Der Leichnam der Poppaea(4) war mit Kräutern gefüllt und mumifiziert worden. Daneben war in nie dagewesener Fülle Weihrauch aus dem ganzen Orient aufgestapelt: »die Frühlingsfrüchte aus Kilikien(1), die Blumen aus Saba, die flammennährenden Ernten aus Indien(2)«.[10] Es wurden so viele Duftstoffe aus Arabien(2) importiert, dass angeblich der gesamte Jahresvorrat der Region erschöpft war. Poppaea hatte eine solche Huldigung redlich verdient. Sie war nicht nur eine Göttin, sondern auch mit Neros Kind schwanger gewesen. Der Verlust des Knaben – falls es denn ein Knabe gewesen war – war eine Tragödie nicht nur für Nero(7), sondern für das ganze römische Volk. Die Familie des Augustus war eine heilige Sache, berührt vom Übernatürlichen, verklärt von der Kraft des Mannes, der sich durch die Rettung Roms vor dem Untergang als würdig erwiesen hatte, auf ewig als Gott zu herrschen. Die Erben des Augustus, welche die Welt weder als Könige noch als gewählte Magistrate regiert hatten, hatten dies stattdessen als Mitglieder seines Hauses getan: als Caesaren. Das galt auch für jene, die nicht zu seiner Blutsverwandtschaft gehörten. Tiberius(2) zum Beispiel hatte die Weltherrschaft als Adoptivsohn des Augustus(9) übernommen. Nero hingegen war ein echter Nachkomme. Als er dem Senat und dem Volk von Rom seine tote Frau übergab, tat er das als Ururenkel des Augustus. Als die Leute Poppaea(5) betrauerten, trauerten sie daher noch um eine weitere Person: den totgeborenen kleinen Caesar.
Das war, wie jeder wusste, ein sehr schwerwiegender Verlust. Rom gingen langsam aber sicher die Personen aus, die sich des heiligen Blutes des Augustus in ihren Adern rühmen konnten. Die verschiedenen Zweige der Familie des Augustus waren in dem halben Jahrhundert seit seinem Tod unerbittlich beschnitten worden. Tiberius(3)