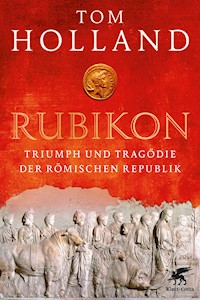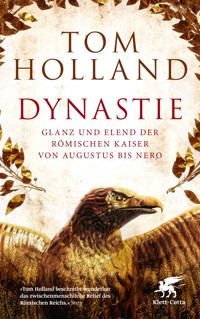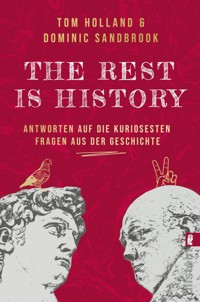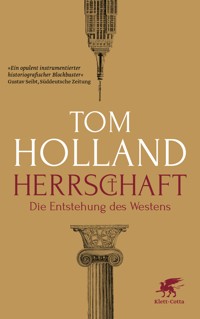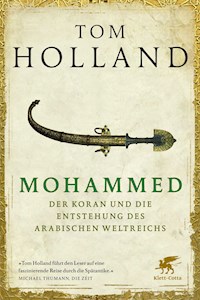
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Tom Holland erzählt den erstaunlichen Aufstieg der Araber im 7. und 8. Jahrhundert n. Chr. zu einer imperialen Weltmacht, die die antiken Reiche ablöste. Mit stilistischer Brillanz und mit historischem Scharfsinn schildert er die ungeheure Dynamik, mit der der Islam in religiös-politischen Konflikten mit Juden und Christen die antike Welt von Grund auf veränderte. Niemand ahnte um die Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert, dass die Araber eine weltgeschichtliche Revolution herbeiführen würden. Ausgehend von den legendenumrankten Lebensbeschreibungen des Propheten, schildert der Autor das politische Wirken Mohammeds und der Kalifen bis zur Gründung Bagdads im Jahre 762. Im Zentrum stehen die geistig-politischen Umwälzungen und die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Großmächten der damaligen Zeit. Zugleich spürt er den tiefer liegenden Gründen nach, warum und wie Mohammeds Offenbarungen in einem abgelegenen Winkel der damaligen Welt und seine unbedingte Forderung nach einer Unterwerfung unter Allah der menschlichen Zivilisation ein neues Gesicht gaben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 975
Ähnliche
Tom Holland
Mohammed, der Koran und die Entstehung des arabischen Weltreichs
Übersetzt aus dem Englischen von Susanne Held
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»In The Shadow of The Sword. The Battle for Global Empire
and the End of the Ancient World«
im Verlag Little, Brown, London 2012
© 2012 by Tom Holland
Für die deutsche Ausgabe
© 2012, 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659,
Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Schutzumschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
Fotos: akg-images (Maurischer Krummdolch);
Rui Vale de Sousa/123 rf (Goldenes Tor im Hintergrund)
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96146-1
E-Book: ISBN 978-3-608-10342-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Hillos
In memoriam
INHALT
DANK
I EINFÜHRUNG
1 BEKANNTE UNBEKANNTE
Zwischen zwei Welten
Die größte Geschichte aller Zeiten
Luftige Flausen
Der religiöse Kontext
II JAHILIYYA
2 IRANSHAHR
Sache des Schahs
Anzündhilfe
Die zwei Augen der Welt
An den Flüssen Babylons
3 DAS NEUE ROM
Katastrophensicher
Untrennbar verbunden
Ein neuer Himmel wird gebaut
4 DIE KINDER ABRAHAMS
Blumen in der Wüste
Kein Gott außer dem Einen
Die Wölfe Arabiens
5 COUNTDOWN ZUR APOKALYPSE
Neuer Wein in alten Schläuchen
Die Erde wird klagen und jammern
Der große Krieg
III HIJRA
6 MEHR FRAGEN ALS ANTWORTEN
Wann?
Wo?
Warum?
7 DIE ENTSTEHUNG DES ISLAM
Gottes Stellvertreter
Das Aufkommen der Sunna
Das Haus des Islam
AUSBLICK
Ewige Wiederkehr?
Nachwort 2017
Tafelteil
Zeittafel
Dramatis Personae
Glossar
Bibliographie
Anmerkungen
Verzeichnis der Karten
Bildnachweis
Register
Trachtet nicht danach, gegen den Feind zu kämpfen. Bittet Gott um Frieden und Sicherheit. Wenn ihr aber gegen den Feind antreten müsst, dann seid unermüdlich, und vergesst nicht, dass die Tore des Paradieses im Schatten des Schwertes liegen.
Spruch Mohammeds,aufgezeichnet von Salih Muslim
DANK
An diesem Buch habe ich länger gearbeitet, als ich es erwarten konnte, und während dieser Zeit eröffneten sich mir faszinierend vielschichtige Bereiche, von denen ich, als ich mit der ganzen Unternehmung anfing, keine Ahnung hatte. Meine Dankesschulden sind entsprechend immens. Jeder Autor dankt seinem Herausgeber – ich aber schulde Richard Beswick ganz besonders großen Dank dafür, dass er unbeirrbar an dem Projekt festhielt. Außerdem danke ich Iain Hunt, Susan de Soissons und der gesamten Belegschaft beim Verlag Little, Brown; ich danke Gerry Howard und Frits van der Meij. Mein Dank gebührt Patrick Walsh, dem besten Agenten überhaupt, und allen Mitarbeitern bei Conville and Walsh.
Ob nun als Zwerg auf den Schultern von Riesen oder als Tor, der in einen Bezirk hineinstolpert, den Engel nicht zu betreten wagen – jedenfalls schulde ich allen Gelehrten besonderen Dank, die mir halfen, mich mit dieser speziellen Thematik auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich gibt es in der gesamten Geschichtswissenschaft kein interessanteres Minenfeld. Reza Aslan, James Carleton Paget, Patricia Crone, Gerald Hawting, Robert Irwin, Christopher Kelly, Hugh Kennedy, Dan Madigan, Ziauddin Sardar, Guy Stroumsa, Bryan Ward-Perkins und Vesta Curtis lasen den ersten Entwurf in Teilen oder vollständig, und ihr freundliches Entgegenkommen war ebenso unermüdlich, wie ihre Reaktionen unterschiedlich ausfielen. Dankbar bin ich auch Fred Donner und Robert Howland, dass sie mir erlaubten, im direkten Dialog mit ihnen von ihrem Fachwissen zu profitieren; und Robin Lane Fox, der mir den Rücken stärkte, als mir erstmals in vollem Umfang bewusst wurde, worauf ich mich da eingelassen hatte. Im Anschluss an einen sehr viel bedeutenderen Historiker »muss ich meine völlige Unkenntnis der orientalischen Sprachen bekennen und meine Dankbarkeit gegenüber den gelehrten Übersetzern zum Ausdruck bringen, die ihre Wissenschaft in die lateinische, französische und englische Sprache übertragen haben«.
Übersetzungen aus dem Arabischen und Syrischen besorgte Salam Rassi für mich, dessen profundes Wissen mit außerordentlicher Geduld und Effizienz einhergeht. Meine beklagenswert mangelhaften Deutschkenntnisse machte in bewährter Weise Andrea Wulf wett.
Nicht zuletzt muss ich meinen Freunden und Familienangehörigen danken, die fünf lange Jahre obskures Gemurmel über Hephthaliten, Chalkedonier und Kharijiten erduldeten. Mein besonderer Dank gilt wie immer Jamie Muir für seine Hilfsbereitschaft, seine Ermutigungen und seine klugen Ratschläge; Kevin Sim, der das Manuskript so akribisch studierte, dass es ihm irgendwie gelang, einen Film daraus zu machen, und an den ich mich mittlerweile automatisch wende, wenn ich mein Verlangen, über Details des zubyranidischen Münzwesens zu reden, nicht mehr in den Griff bekomme; und natürlich ganz und gar nicht zuletzt meiner geliebten Familie: Sadie, Katy und Eliza.
IEINFÜHRUNG
Ich werde in meine Darstellung nur Dinge aufnehmen, die zuerst für uns und dann für spätere Generationen von Nutzen sind.
Eusebius, Kirchengeschichte
Was die Evangelisten über das Leben Jesu Christi mitteilen, ist vergleichsweise unzuverlässig. Im Unterschied dazu wissen wir vom Leben Mohammeds mehr oder weniger fast alles. Wir wissen, wo er lebte und in welchen Vermögensverhältnissen, in wen er sich verliebte. Wir wissen auch recht viel über die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten seiner Zeit.
Salman Rushdie
1BEKANNTE UNBEKANNTE
Zwischen zwei Welten
Yusuf As’ar Yath’ar, ein arabischer König, berühmt für sein langes Haar, seine Frömmigkeit und seine zynische Grausamkeit, war am Ende. Der Gestank des Schlachtfelds hinter ihm wurde allmählich schwächer. Zielstrebig ritt er auf seinem blutbespritzten weißen Streitross unmittelbar an den Saum des Roten Meeres. Er wusste, dass hinter ihm christliche Voraustrupps schon gegen seinen Palast vorrückten: Seine Schätze würden sie rauben, seine Königin gefangen nehmen. Natürlich hatten die Sieger keinerlei Grund, ihm gegenüber Gnade walten zu lassen. Kaum ein anderer war bei den Christen so berüchtigt wie Yusuf. Vor zwei Jahren hatte er, um seinen Glauben im südwestlichen Arabien auszubreiten, dort die christliche Festung Najran erobert. Was damals geschah, erfüllte auch die Christen weit jenseits der Grenzen des Königreichs Himyar am Roten Meer, über das Yusuf knapp ein Jahrzehnt lang mit Unterbrechungen geherrscht hatte, mit Schrecken und tiefem Entsetzen. Die Ortskirche, in der der Bischof und sein Gefolge eingeschlossen waren, wurde in Brand gesetzt. Eine Gruppe Jungfrauen begehrte sich ihnen anzuschließen, sie stürzten sich in die Flammen und riefen dabei in herausfordernder Lautstärke, wie süß es sei, »den Duft brennender Priester einzuatmen«.1 Eine Frau, »deren Antlitz man noch nie außerhalb ihres Hauses erblickt hatte und die sich tagsüber nicht in der Stadt zu zeigen pflegte«,2 hatte sich ihr Tuch vom Kopf gerissen, um dem König ihre Verachtung zu bekunden. Yusuf geriet darüber in solche Wut, dass er anordnete, Tochter und Enkelin dieser Frau vor ihren Augen zu töten, ihr das Blut der Getöteten in den Rachen zu schütten und ihr dann selbst den Kopf abzuschlagen.
Derartige Martyrien wurden zwar von der Kirche hoch gepriesen, aber vergeben werden konnten sie nicht. Daher war es nur recht und billig, dass ein großes Heer aus dem christlichen Königreich Äthiopien in Himyar anlandete. Die Verteidiger wurden in die Enge getrieben, angegriffen und niedergemacht. Nun umspülte das Wasser des Roten Meers die Hufe seines Pferdes: Yusuf war am Ende seines Weges angelangt. Sein bedingungsloser Gehorsam gegenüber dem Gesetz, das Gott Seinem erwählten Propheten anvertraut hatte, hatte nicht ausgereicht, ihn vor dem Untergang zu retten. Langsam trieb er sein Pferd vorwärts, immer tiefer ins Wasser, bis er schließlich, hinuntergezogen vom Gewicht seiner Rüstung, in den Wellen versank. Das war der Untergang des Yusuf As’ar Yath’ar, des letzten jüdischen Königs, der je in Arabien herrschte.
Der Zusammenbruch des Königreichs der Himyariten im Jahr 525 n. Chr. gehört natürlich nicht zu den bekannteren Episoden der Alten Geschichte. Das Land Himyar selbst prosperierte zwar immerhin gut sechs Jahrhunderte lang, bis es schließlich von Yusuf ein für alle Mal zunichte gemacht wurde, aber es lässt den durchschlagenden Wiedererkennungseffekt eines Babylon, Athen oder Rom vermissen. Und das ist wohl auch gar nicht so überraschend, lag doch der Süden Arabiens schon damals genau wie heute entschieden abseits der großen Zentren der Zivilisation. Sogar die Araber selbst, die von den Bewohnern der angeseheneren Staatswesen gern als offenkundige Unmenschen abgetan wurden – »von allen Völkern der Erde das verschmähteste und unbedeutendste«3 –, pflegten auf die angeblich barbarischen Sitten dieser Region herunterzuschauen. Ein arabischer Dichter berichtet mit einigem Befremden, dass die Himyariten ihre Frauen nicht beschneiden, »ja sich nicht einmal entblöden, Heuschrecken zu essen«4 – ein selbstverständlich ganz inakzeptables Verhalten.
Aber nicht nur aus geographischen Gründen scheint Himyar im Schatten zu liegen. Ähnlich dunkel ist die historische Epoche, in der Yusuf zu Tode kam. Das 6. Jahrhundert n. Chr. widersetzt sich präziser Kategorisierung. Es scheint zwischen zwei Zeitaltern zu liegen. Einerseits schaut es zurück auf die Welt der klassischen Kultur, andererseits nach vorn auf die Welt der Kreuzzüge. Historiker bezeichnen dieses und die beiden benachbarten Jahrhunderte als »Spätantike«: eine Wendung, mit der sie den Eindruck vermitteln, die Schatten der alten Welt seien länger geworden und das Mittelalter am Horizont aufgetaucht.
Wer sich die Geschichte als Aufeinanderfolge von sauber definierten, in sich abgeschlossenen Epochen vorstellt, empfindet diese unklare Schwellenzeit als eher irritierend. Sie erinnert an den Wissenschaftler in dem Horrorfilm-Klassiker Die Fliege, der zu einer Kombination aus Mensch und Insekt mutiert – auch die Welt der Spätantike kann aus unserer Perspektive als eigentümliche Mischform wahrgenommen werden. Weit jenseits der Grenzen von Yusufs Königreich Himyar beherrschten auf mythischen Fundamenten aufruhende Imperien nach wie vor und seit Jahrhunderten unverändert den Vorderen Orient und das Mittelmeer. Allerdings diente ihr ehrwürdiges Alter nur dazu, hervorzuheben, wie weitgehend sie sich inzwischen von ihrer fernen Vergangenheit losgemacht hatten. Man denke beispielsweise nur an die Region unmittelbar im Norden Arabiens: der Staat, den wir heute Irak nennen. Hier, in Flusslandschaften, die Zeugen für das Entstehen der ersten Hochkulturen waren, gehorchten die Menschen einem König, der ebenso wie sein Vorgänger 1000 Jahre zuvor ein Perser war. Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich genau wie das Territorium des Perserreichs vor 1000 Jahren nach Osten bis zu den Grenzen Indiens und bis tief nach Zentralasien hinein. Der Glanz des Hofs, an dem er residierte, die Herrlichkeit der Rituale, seine maßlose Überheblichkeit: All das hätte auf einen König von Babylon einen durchaus vertrauten Eindruck gemacht. Aber beim irakischen Volk selbst war dies alles fast vollständig in Vergessenheit geraten. Ein grassierender Gedächtnisschwund löschte die Erinnerungen aus, die Jahrtausende überdauert hatten. Sogar die Perser selbst waren im Begriff, ihr glanzvolles imperiales Erbe zu verdunkeln und zu verzerren, anstatt es in seiner ganzen Herrlichkeit zu verehren. Das Vermächtnis der unvergleichlichen irakischen Geschichte lebte nach wie vor – es war aufgehoben in den weltumspannenden Herrschaftsphantasien der Perser und in der allgemeinen Prachtentfaltung, die solchen Phantasien Glaubwürdigkeit verlieh –, aber zunehmend hatte dieses Vermächtnis nicht mehr das Aussehen von längst vergangenen Zeitaltern, sondern von etwas Neuem.
Andere Imperien hatten ein weniger nachlässiges Verhältnis zu ihrer Vergangenheit. Die großen Städte im Mittelmeerraum waren – im Gegensatz zu den Lehmziegeln, die die Menschen im Irak bevorzugten – aus Stein und Marmor errichtet, daher auch weniger anfällig dafür, zu Staub zu zerfallen. Und auch das alle beherrschende Imperium Romanum erweckte im Jahr 525 den Anschein altehrwürdiger Unzerstörbarkeit. Sogar die Perser meinten, Rom existiere seit unvordenklichen Zeiten. Bei Gelegenheit gaben sie zu, freilich nur widerstrebend: »Gott hat die Verhältnisse so geordnet, dass die ganze Welt von Anbeginn durch zwei Augen erleuchtet wurde: durch die weisen Herrscher des Perserreichs und durch das mächtige Reich der Römer.«5 Allerdings wussten es die Römer besser, auch wenn sie für Schmeicheleien durchaus empfänglich waren. Sie wussten, dass ihr Imperium nicht seit Anbeginn der Zeiten bestand, sondern dass sich seine Größe einst aus dem Nichts entwickelt hatte. Wenn man den Verlauf dieser Entwicklung erforschte, konnte man also möglicherweise auch auf die Geheimnisse ihres Erfolgs stoßen. Und so wurden zur selben Zeit, als Yusuf im Roten Meer verschwand, in Konstantinopel Pläne zu einer weit ausgreifenden Durchforstung von Bibliotheken und Archiven entworfen, einer so zuvor noch nie dagewesenen Forschungsanstrengung; sie hatte zum Ziel, das riesige Gesetzes-Erbe des Imperiums für alle Zeiten zu erhalten. Das war keine trockene Fleißarbeit von nur antiquarischem Interesse. Die Geschichte war neben Truppen und Gold zu einer Hauptstütze des römischen Staates geworden. Sie lieferte dem Imperium die Bestätigung, dass es wirklich das war, was zu sein es vorgab: Exempel und Vorbild menschlicher Ordnung. Wie anders als durch ständiges Hervorheben von Roms triumphalem Alter konnte das Ansehen des Kaisers erhalten bleiben?
Die Herausforderung für die römischen Politiker bestand nun natürlich darin, dass die Ruhmestaten der Vergangenheit ihnen nicht zwingend einen zuverlässigen Führer in die Zukunft lieferten. Unbestreitbar war das Imperium nach wie vor dasselbe wie seit fast einem Jahrtausend: die alle überragende Weltmacht. Rom war wohlhabender und bevölkerungsreicher als sein großer persischer Rivale, und seine Vorherrschaft im östlichen Mittelmeerraum – schon seit jeher die reichere Hälfte – schien unerschütterlich zu sein. Von den Gebirgen auf dem Balkan bis zu den Wüsten Ägyptens herrschte der Kaiser über alle. Allerdings stellte es – gelinde gesagt – eine gewisse Verlegenheit dar, dass die einstige westliche Hälfte des römischen Imperiums im Jahr 525 schon vollständig aufgehört hatte, römisch zu sein. Im Verlauf des 5. Jahrhunderts war ein riesiger Bereich des römischen Territoriums wie eine Sandburg, die von den Wellen der auflaufenden Flut vertilgt wird, vollkommen weggebrochen. Britannien war bereits im Jahr 410 verlorengegangen. Andere Provinzen folgten in den Jahrzehnten danach. Zum Ende des Jahrhunderts war die gesamte westliche Hälfte des Imperiums, sogar Italien, ja sogar Rom selbst, verschwunden. An Stelle der ehrwürdigen Ordnung des Imperiums breitete sich jetzt ein Flickenteppich unabhängiger Königreiche aus, die alle – außer ganz wenigen im westlichen Britannien – von Kriegereliten beherrscht wurden, die aus Regionen weit jenseits der Grenzen des ehemaligen Imperiums eingedrungen waren. Die Beziehung zwischen der einheimischen Bevölkerung und diesen »barbarischen« Neuankömmlingen gestalteten sich in jedem Königreich anders: Einige wie etwa die Briten wehrten sich mit Klauen und Zähnen gegen die Eindringlinge; andere, wie die Völker Italiens, hatten eher den Hang, ihnen zuzujubeln wie einst den Caesaren. In jedem Fall jedoch führte der Zusammenbruch des Imperiums zur Herausbildung neuer Identitäten, neuer Werte, neuer Grundannahmen, und diese führten auf lange Sicht zu einer radikal anderen politischen Ordnung in Westeuropa. Nie mehr erkannten Roms ehemalige Provinzen einen einzigen Reichsherrscher an.
Im Lauf der Zeit teilten dann beide großen Imperien des Zeitalters, das persische ebenso wie das römische, das Schicksal der Städte Ninive und Tyros. Ganz anders die Staaten, die in Roms westlichen Provinzen entstanden waren: Einige lassen ja noch heute in ihren Namen das Eindringen barbarischer Kriegerbanden erkennen. So ist es kein Wunder, dass europäische Historiker im Vordringen der Franken in das Territorium, das später Frankreich hieß, und in der Landung der Angeln im zukünftigen England Ereignisse von entschieden größerer Langzeitwirkung sehen als in den Aktivitäten eines Caesar oder eines persischen Großkönigs. Wir wissen heute – im Gegensatz zu ihren Zeitgenossen –, dass beiden Imperien der Untergang bevorstand. Ein Jahrhundert nach dem Zusammenbruch des Königreichs Himyar standen beide Großmächte am Rand des Abgrunds. Das persische Reich ging vollständig unter, während vom römischen nur ein zerfetzter Stumpf übrigblieb, und das hat dazu geführt, dass man beide als zum Aussterben verurteilte Fehlentwicklungen, gewissermaßen als Dinosaurier interpretierte. Wie nahe liegt da doch der Verdacht, dass sie aufgrund ihres hohen Alters an Altersschwäche zugrunde gingen! Der Aspekt des »Späten« an der Spätantike hat für Interpreten, die darin nur die fatale Tendenz zu Niedergang und Verfall sehen, die Qualität von Gästen, die einfach nicht in ihre Mäntel kommen, obwohl die Party schon vorbei ist.
Außer Acht bleibt dabei, dass die Reiche, die jetzt entstanden, nicht nur von dieser Welt waren. Für seine Untertanen war ein römischer Kaiser zwar eine strahlende Erscheinung, seine Paläste und Zitadellen überragten alles, und erbarmungslos setzten die Heerscharen seiner Soldaten, Bürokraten und Steuereinnehmer seinen Willen durch, doch auch er war nur ein Sterblicher – ein Sterblicher unter vielen in einem Kosmos, der von einem himmlischen König regiert wurde. Es gab nur einen einzigen universellen Monarchen – und das war Gott. Diese Vorstellung beherrschte zum Zeitpunkt von Yusufs Untergang, zu Beginn des 6. Jahrhunderts n. Chr., nahezu unangefochten den gesamten Bereich des Vorderen Orients –, und sie spielte in fast sämtliche geopolitische Aspekte der Region mit hinein. Als Yusuf mit den äthiopischen Eindringlingen zusammenstieß, ging es um weitaus mehr als die kleinlichen Ziele zankender Warlords. Auch die Interessen des Himmels waren betroffen. Die Gräben zwischen denen, die für die jüdische Sache kämpften, und ihren Gegnern, die im Namen Christi antraten, waren so tief, dass an Versöhnung gar nicht zu denken war. Beide Seiten waren überzeugt, dass der Gott, den sie verehrten, der einzige Gott war – monos theós im Griechischen –, aber diese gemeinsame Überzeugung ließ die Gegnerschaft zwischen ihnen nur umso unerbittlicher werden. Nicht nur in Südarabien, sondern in der gesamten zivilisierten Welt war die Hinwendung zu einer ganz bestimmten Vorstellung vom Göttlichen zu einer Gefühlsbewegung geworden, die das Leben von Millionen und Abermillionen Menschen bestimmte. In einem Zeitalter, in dem Reiche aufstiegen und stürzten wie die Wogen des Ozeans, in dem sogar große Imperien ins Wanken gerieten, konnte gewiss keine irdische Macht ein solches Ausmaß an Treue und Hingabe verlangen. Identität wurde nicht mehr definiert aufgrund der Königreiche dieser Welt, sondern auf der Grundlage unterschiedlicher Vorstellungen des Einen, des Einzigen Gottes: aufgrund von »Monotheismen«.
Hier kündigte sich eine Verwandlung der menschlichen Gesellschaft mit unabsehbaren Folgen für die Zukunft an. Von den diversen Besonderheiten der modernen Welt, die man bis in die Antike zurückverfolgen kann – das Alphabet, die Demokratie, Gladiatorenfilme –, war wohl keine für den ganzen Erdkreis einflussreicher als die historisch erstmalige Erhebung mehrerer unterschiedlicher Ausprägungen des Monotheismus zur Staatsreligion. Zu Beginn des 3. Jahrtausends nach Christi Geburt identifizieren sich um die dreieinhalb Milliarden Menschen – heute die Hälfte der Weltbevölkerung – mit der einen oder anderen dieser Religionen. In den 250 Jahren vor und nach Yusufs Tod stiegen sie zu einer umfassenden Machtfülle auf, die auch in der heutigen Form noch zu erkennen ist. Die Periode der Spätantike ist uns zwar im Vergleich zu anderen Epochen unvertraut, aber deswegen für uns heute nicht weniger relevant. Wo immer Männer und Frauen dem Glauben an den Einen Gott anhängen und aufgrund dieses Glaubens in einer bestimmten Weise denken oder sich verhalten, belegen sie den anhaltenden Einfluss der Spätantike. Die Wucht der Revolution, die sich damals ereignete, zittert noch heute nach.
In diesem Buch will ich die Ursprünge und den Fortgang dieser Revolution nachverfolgen. Wie kam es dazu, dass die Denkmuster der Menschen sich im Verlauf nur weniger Jahrhunderte so radikal und anhaltend veränderten? Diese Geschichte birgt eine Fülle von menschlichen Schicksalen, großen Dramen, außergewöhnlichen Gestalten und immer wieder äußerster Zügellosigkeit. Allerdings stellt sie an den Historiker auch spezifische Anforderungen, denn vieles spielt sich in Sphären außerhalb der sichtbaren Welt ab. Nicht nur Könige treten auf, sondern auch Engel, nicht nur Warlords, sondern auch Dämonen. Daher kann im Folgenden nicht jedes Ereignis ausschließlich nach den Kriterien materieller Eigeninteressen oder politischer Berechnung erklärt werden. Das rohe Treiben weltlicher Belange wird überwölbt von einem leuchtenden Himmel und verdunkelt von drohender Verdammnis. Natürlich kann man Yusufs Zeitgenossen für die Art, wie sie seinen Untergang deuteten, keine Naivität vorwerfen. Sie erkannten sehr wohl, dass komplexe handelspolitische Verwicklungen wie auch die Rivalität zweier entfernter Großmächte im Hintergrund eine Rolle gespielt hatten. Aber es stand für sie auch fraglos fest, dass die arabische Wüste Schauplatz eines durch und durch kosmischen Dramas war. Hier waren die Kräfte des Himmels und der Hölle aufeinandergeprallt. Auf welcher Seite Yusuf stand – ob bei den Engeln oder den Dämonen –, war Ansichtssache; doch weder Juden noch Christen hegten den geringsten Zweifel, dass alles, was dort geschehen war, auf den Willen Gottes zurückzuführen war. Darin bestand die innerste Grundüberzeugung des Zeitalters, und eine Geschichte der Spätantike, die es verabsäumt, dieser Überzeugung den ihr gebührenden Raum zu geben, ist zum Scheitern verurteilt.
Die Glaubensrichtungen der Epoche müssen daher nicht nur ernst genommen werden, wir müssen uns ihnen auch mit Empathie nähern − was natürlich nicht heißt, man solle ihre Behauptungen für bare Münze nehmen. Im frühen 4. Jahrhundert verfasste Eusebius, Bischof von Caesarea in Palästina, eine Geschichte der frühen Kirche. Mit ihr begründete er eine historische Forschungstradition, die den Blick zurück auf die Vergangenheit mit dem Aufspüren von Mustern gleichsetzte, die der Zeigefinger Gottes dieser Zeit aufgeprägt hatte. Diese Annahme übte zwar – nicht nur auf christliche Autoren – den allergrößten Einfluss aus, aber im Abendland kam sie schon vor mehreren Jahrhunderten aus der Mode. Ungeachtet ihrer persönlichen religiösen Ausrichtung pflegen moderne Historiker die Ereignisse der Vergangenheit nicht mehr als Wirken göttlicher Vorsehung zu erklären. Sämtliche Aspekte der menschlichen Gesellschaft, der Glaube nicht ausgenommen, gelten mittlerweile als Produkte der Evolution. Aber das ist nun wiederum seinerseits keine ausschließlich moderne Perspektive. Eusebius hatte 1500 Jahre vor Darwin darin eine verhängnisvolle, ganz besonders bedrohliche Häresie erkannt. Nichts war für ihn alarmierender als die von den Feinden seines Glaubens vertretene Auffassung, dieser Glaube sei etwas neu Aufgekommenes, entstanden unter zufälligen Umständen, nur ein verzerrtes Echo viel älterer Traditionen. Mit seinem Geschichtswerk wollte er nicht die Veränderungen in den Glaubensinhalten und Institutionen der Kirche nachverfolgen, er wollte vielmehr darlegen, dass sich an ihnen nichts, aber auch gar nichts geändert hatte. Und das Christentum selbst? Das Christentum, so seine These, gab es schon seit Anbeginn der Zeiten: »Denn wir dürfen ganz offensichtlich in der Religion, die in den letzten Jahren durch die Lehren Christi allen Völkern verkündet wurde, nichts anderes sehen als die erste, die älteste, die urtümlichste aller Religionen.«6
Für uns Heutige, die wir vertraut sind mit den Begräbnisriten der Neandertaler und der Höhlenmalerei des Cro-Magnon, hat diese Behauptung wenig Offensichtliches. Und trotzdem teilen auch heute noch viele Menschen die ihr zugrundeliegende Annahme, den Religionen wohne eine geheimnisvolle, fundamentale Essenz inne, die gegen das Vergehen von Zeit immun ist. Das verdanken wir zum großen Teil Eusebius und anderen Autoren, die in eine ähnliche Richtung argumentierten. Die bedeutendste Innovation der Spätantike bestand darin, dass sie aus etwas, das andernfalls ein diffuser Nebel aus Glaubensüberzeugungen und Dogmen gewesen wäre, unterscheidbare Vorlagen für unterscheidbare Religionen schuf und diese dann als maßgeblich festschrieb. Die Art, wie sich dieser Prozess vollzog, ergibt eine faszinierende, außergewöhnliche Geschichte, denn sie umfasst die höchsten Ebenen der Politik und die tiefsten menschlichen Gefühle. Der Zusammenstoß großer Imperien und das Elend der Sklaven, der Glanz von Mosaiken und der Gestank von Pestgruben, der geschäftige Lärm blühender Städte und die Stille menschenleerer Wüsten: Alles kommt darin vor. Die Geschichte beginnt in einer Welt mit deutlichen Merkmalen der Antike, und sie endet in einer mittelalterlichen Welt. Sie erzählt von einem Wandlungsprozess, der gleichwertig neben anderen bedeutenden historischen Wandlungsprozessen steht.
Doch birgt die Darstellung dieser Geschichte zahlreiche Tücken. Das liegt teilweise an den unvermeidlichen Lücken und Widersprüchen im Quellenmaterial, die jede Phase der alten Geschichte verzerren. Man nehme als Beispiel nur die Geschichte von Yusufs Tod. Es gibt Berichte, denen zufolge er im Schlachtgetümmel gefallen und nicht ins Meer hinausgeritten ist. Noch problematischer ist die Voreingenommenheit unserer Quellen – die meisten sind christlichen Ursprungs.*1 Sogar bei der Chronologie gibt es Ungereimtheiten, einige Historiker datieren Yusufs Tod nicht auf das Jahr 525, sondern auf 520. Man könnte das alles als Detailprobleme abtun – gäbe es da nicht eine zusätzliche, weitaus gravierendere Komplikation. Jede Darstellung der Entwicklung rivalisierender Monotheismen kann nicht umhin, Termini wie »Christen« und »Juden« zu verwenden; allerdings bezeichnen diese Termini in der Spätantike, wie uns die Geschichte von Yusuf lehrt, nicht unbedingt dasselbe wie heute. Eine Episode, in der beschrieben wird, wie eine verschleierte christliche Frau in Arabien durch einen jüdischen König verfolgt wird, ereignet sich offensichtlich in einer Welt, die von der unseren recht weit entfernt ist.
Aus diesem Grund ist die Geschichte der Spätantike sowohl befremdlicher als auch überraschender, als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Es ist geradezu ein Indiz für die Leistung der Personen, die sie in so verblüffender Weise prägten, dass es ihnen derart gut gelang, ihre eigene erstaunliche Kreativität zu verbergen. Natürlich gibt es in jeder Epoche Autoren, die daran arbeiten, die Vergangenheit im Dienst der Gegenwart umzuschreiben, aber keiner hat es wohl so konsequent und mit so frappierenden Auswirkungen getan wie die Historiker der Spätantike. Die überlegene Leistung der jüdischen und christlichen Gelehrten jener Zeit bestand darin, eine Geschichte ihres jeweiligen Glaubens zu verfassen, die ihnen selbst die Rolle des rechtmäßigen, unumgänglichen Kulminationspunkts zuschrieb, und alles, was diesem Eindruck hätte widersprechen können, vollständig außen vor ließ. Unabhängig davon, wer Moses wirklich war, ob er überhaupt existierte – das Bild, das die meisten Juden heute von Moses haben, wurde auf nicht mehr rekonstruierbare Art und Weise von den Rabbinern der Spätantike geprägt: von hochgelehrten, geistreichen Männern, die ganze Jahrhunderte geistiger Anstrengung darauf verwendeten aufzuzeigen, dass ihr größter Prophet – ungeachtet des großen historischen Abstands – ein Mann von ganz ähnlicher Eigenart wie sie selbst war. Und ebenso trägt das christliche Verständnis des Auftrags und der Gottheit Jesu Christi, wie es von der großen Mehrheit der heutigen Kirchen gelehrt wird – unabhängig davon, welche Auffassung Jesus selbst von sich hatte –, die Spuren der turbulenten Umwälzungen in der spätrömischen Politik: der immensen Anstrengungen von Bischöfen und Kaisern, einen Glauben zu gestalten, der alle Menschen als Volk Gottes zusammenführen konnte. Die Grundstruktur von Judentum und Christentum wurde – ungeachtet des Alters seiner ersten Ursprünge – in der Spätantike geprägt.
Nur Glaube – oder seine Abwesenheit – kann letztlich die großen Fragen beantworten, die im Innern dieser Religionen pulsieren: ob die Juden wirklich Gottes auserwähltes Volk sind; ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Allerdings gilt dasselbe auch für andere Fragen: Wie und warum entstand überhaupt der jüdische Glaube an einen einzigen Gott; wie sahen die Lehren der frühen Kirche aus? Einige der Funken, an denen sich die Flammen der jüdischen und christlichen Glaubenspraxis entzündeten, sind für den Historiker vielleicht noch erkennbar, sehr viele mehr jedoch sind es nicht. Wir schauen nur durch ein dunkles Glas – und dieses Glas wurde weitgehend von den Männern und Frauen geformt, die die Protagonisten dieses Buches sind.
Es war zugegebenermaßen nichts Neues, dass die Verehrung einer unvordenklichen Vergangenheit dazu führte, diese selbst zu überformen oder gar völlig zu verwischen. So manch ein wohlhabender Mäzen der antiken Welt protzte mit seiner Frömmigkeit, indem er über einem bescheidenen Schrein ein pompöses Gebäude errichten ließ. Den jüdischen und christlichen Gelehrten der Spätantike allerdings gelang einzig aufgrund ihres immensen Eifers eine unendlich viel weiter reichende, dauerhaftere Großtat in Sachen Erneuerung. Letztlich bestand ihre Leistung darin, nicht nur für ihre eigenen je spezifischen Formen des Monotheismus, sondern für Religion an sich eine Interpretation geschaffen zu haben: eine Interpretation, die für Milliarden von Menschen heutzutage die selbstverständliche Grundlage sowohl für ihr Verhalten auf dieser Erde als auch für das Schicksal ihrer Seele im Jenseits bildet. Aus diesem Grund ist das Vorhaben, die Quellen der Spätantike nach Belegen für die tatsächlichen Geschehnisse zu durchforsten, so heikel und gleichzeitig so faszinierend.
Man begibt sich selbstverständlich nicht leichtfertig an ein solches Projekt. Und da die Quellen derart komplex und mehrdeutig sind, kann man auch die Geschichte, die im Zentrum dieses Buches steht, nicht erzählen, ohne zuvor darzulegen, wie und warum sie in dieser Form wiedergegeben wird.
Daher werde ich, bevor ich beginne, eine Pause einlegen, um etwas ganz anderes zu schildern: die Entstehung einer Geschichte.
Die größte Geschichte aller Zeiten
Der Himmel liebt die Gewinner. Sogar Christen, deren Gott als verurteilter Verbrecher am Kreuz starb, waren für diese Annahme empfänglich. Für Eusebius bedeutete sie jedenfalls eine Selbstverständlichkeit. Und wie auch nicht – hatte er doch das Schauspiel eines römischen Staates vor sich, der sich nach all den Jahrhunderten, in denen das Blut christlicher Märtyrer vergossen wurde, nun wunderbarerweise in ein Bollwerk der Kirche verwandelte. Der Kaiser, der als Erster sein Haupt vor Christus gebeugt hatte, hatte es nicht nötig, auf den Tod zu warten, um den ihm zustehenden Lohn zu empfangen. Eusebius, in dem sich die Talente des geborenen Polemikers mit einem ausgeprägten Hang zur Heldenverehrung verbanden, verfasste eine umfangreiche Vita Konstantins, um diesen Punkt ganz unmissverständlich klarzumachen. »Gott liebte ihn so sehr und versah ihn mit so reichem Segen, er war so fromm und von Gott begünstigt in allem, was er unternahm, dass er mit größter Leichtigkeit die Herrschaft über mehr Völker errang als alle seine Vorgänger – und er konnte seine Macht uneingeschränkt bis ganz ans Ende seines Lebens genießen.«7
Das Vertrauen in diese Regel – dass der Glaube an Christus irdische Macht zur Folge hat – wurde allerdings im Lauf der folgenden Jahrhunderte deutlich erschüttert. Denn je mehr Römer den christlichen Glauben annahmen, desto enger schienen sich die Grenzen ihres Imperiums zusammenzuziehen. Theologen entwickelten diverse Erklärungen für dieses rätselhafte Phänomen – Erklärungen, die für Christen vollkommen überzeugend waren, weil sie nur die Evangelien lesen mussten, um Jesu Meinung über den Zusammenhang zwischen Diesseitigkeit und den Anmaßungen irdischer Machthaber zu vernehmen. Trotzdem war die zugrundeliegende Gleichung, die Eusebius so liebevoll herausgearbeitet hatte – dass Gott dem Menschen irdische Größe schenkte, an dem Er sein Wohlgefallen hatte –, doch insgesamt zu einleuchtend, um sie so einfach aufzugeben. Stattdessen geschah etwas ganz anderes: Je tiefer die Römer sich in einen verzweifelten Überlebenskampf verstrickt sahen, desto klarer schien eben diese Gleichung auf ein erst kürzlich in Erscheinung getretenes und bereits erschreckend erfolgreiches Volk zuzutreffen. Der Schock über die Identität dieser Eroberer, die nicht nur den Römern ihre reichsten Provinzen geraubt, sondern die Perser insgesamt vernichtend geschlagen hatten, hätte für die Besiegten nicht größer sein können. Das Ereignis widersprach allen Erwartungen so vollständig, dass es seinerseits den Charakter eines Wunders annahm. Gab es denn eine andere Erklärung als das unmittelbare Eingreifen Gottes für die Eroberung der Welt durch ein Volk, das bislang immer nur als Inbegriff von Wildheit und Rückständigkeit galt: die Araber?
Zu Beginn des 9. Jahrhunderts, also 500 Jahre nach Eusebius, genoss die von den Gelehrten unterstellte Einheit von Frömmigkeit und weltlicher Macht immer noch erhebliche Anziehungskraft. Den Christen war vielleicht bei dieser Vorstellung nicht mehr ganz so wohl; aber bei den Arabern verhielt es sich anders, sie sonnten sich unbeirrt in der Überzeugung, dass sie ihre erstaunlichen Siege einzig und allein dem Wohlwollen Gottes verdankten. Sie glaubten, der Himmel habe vor 200 Jahren ihren Vorfahren einen Strom übernatürlicher Offenbarungen zuteil werden lassen: eine Gabe, die alle Offenbarungen der Juden und Christen noch übertraf und denen, die sich dieser Gabe unterwarfen, den Weg zur Weltherrschaft eröffnete. Denn 800 Jahre nach Christi Geburt verstanden sich die meisten Araber als »Muslime« – als diejenigen, »die sich Gott unterwarfen«. Die unermessliche Ausdehnung der Territorien, die ihre Vorväter mit dem Schwert erobert hatten – sie erstreckten sich vom Atlantik bis zu den Rändern Chinas –, diente als sichtbarer Beweis für das, was Gott ihnen geschenkt hatte: ihre Unterwerfung. Sie nannten es »Islam« – der kurze Begriff für ein Phänomen, das bis zum frühen 9. Jahrhundert zu einer regelrechten Hochkultur aufstieg.
Aber nicht nur die Araber selbst waren durch den sieghaften Islam zu neuer Würde aufgestiegen. Gleiches galt auch für ihre Sprache. Die Muslime glaubten, Gott habe Seine Absichten der Menschheit passend zur geographischen Verbreitung ihres Glaubens in Arabisch für alle Zeiten enthüllt. Und es verstand sich von selbst, dass das, was für den Allmächtigen gut genug war, auch für die Sterblichen gut genug sein musste. Um 800 n. Chr. hatte sich das Arabische so weit entfernt von der Verachtung, die ihm vormals entgegengebracht wurde, dass sein Klang geradezu als »Musik der Macht« galt, und in den arabischen Kursiva, durch die Kunst der Kalligraphen zu erlesener Vollkommenheit verfeinert, sah man den Inbegriff von Schönheit. Für die Araber wurde das geschriebene Wort zu einer Manie. Ein Gelehrter hinterließ, als er im Jahr 822 starb, eine Bücherei, die 600 Truhen füllte. Über einem anderen brach im Zustand der Trunkenheit angeblich ein Bücherturm zusammen und zerquetschte ihn zu Mus. Die Geschichte ist nicht ganz so unglaubwürdig, wie sie uns vielleicht erscheinen mag. Es heißt, ein Band arabischer Geschichte habe an die 80 000 Seiten umfasst – was durchaus ein niederschmetterndes Gewicht ergäbe. Es verstand sich von selbst, dass ein Volk, das mit derart titanischen literarischen Leistungen aufwarten konnte, sich sehr weit von einem Zeitalter entfernt hatte, das einst seine Angehörigen als Barbaren brandmarkte − auf diesen Punkt wiesen die Araber selbst nur zu gern immer wieder hin.
Auch ihr Drang, die eigene Vergangenheit zu studieren, ist durchaus verständlich. Unablässig wünschten sie den Grund für den spektakulären Aufschwung in ihrer Geschichte zu verstehen, den Hergang zu erklären, durch den er zustande gekommen war, und zu erläutern, was dies alles über das Wesen ihres Gottes aussagte. Eusebius hatte 500 Jahre zuvor im Leben eines römischen Kaisers nach Antworten auf ganz ähnliche Fragen gesucht, und nun wandte sich auch Ibn Hisham – ein irakischer Gelehrter, der sich im frühen 9. Jahrhundert in Ägypten niedergelassen hatte – der Biographie zu, um die himmlischen Ratschlüsse zu ergründen. Seine literarische Form nannte er Sira: »exemplarisches Verhalten«. Ibn Hisham legte weniger Wert darauf, was die Persönlichkeit getan hatte, deren Biographie er nachzeichnete, sondern wie sie handelte. Dafür gab es einen zwingenden Grund, denn der Held in Ibn Hishams Lebensbeschreibungen war nach Überzeugung der Muslime der Inbegriff eines Rollenvorbilds. Gott hatte ihn dazu ausersehen, Sein Sprachrohr zu sein. Durch ihn hatte der Allerbarmer den Arabern Seine Wünsche enthüllt und ihnen die Offenbarungen gewährt, die sie zwei Jahrhunderte vor Ibn Hisham dazu inspiriert hatten, aus ihren Wüsten auszubrechen und die Großmächte der Welt in Stücke zu reißen. »Wir sind die Gehilfen Gottes und stehen Seinem Propheten zur Seite, und wir werden die Menschen bekämpfen, bis sie an Gott glauben; und wer an Gott und Seinen Propheten glaubt, der hat sein Leben und sein Eigentum vor uns gerettet; und den, der nicht glaubt, werden wir im Namen Gottes unerbittlich bekämpfen, und es wird eine Kleinigkeit für uns sein, ihn umzubringen.«8 So lautete nach Ibn Hisham das rabiate Programm, das arabische Krieger verbreiten ließen, bevor sie sich daranmachten, die Welt zu erobern.
Aber wer war nun dieser »Prophet«? Ibn Hisham hatte sich zum Ziel gesetzt, diese Frage zu beantworten. Er schrieb in Ägypten, umgeben von den Ruinen vergessener, längst untergegangener Hochkulturen, und verstand seine sira nicht nur als Biographie, sondern als Bericht über die folgenschwerste Revolution in der Geschichte der Menschheit. Sein Thema war ein Mann, der nur zwei Jahre vor dem Beginn der Auflösung des römischen und des persischen Reichs gestorben war: ein Araber namens Mohammed. Im Alter von 40 Jahren, als er schon eine unauffällige Karriere als Kaufmann hinter sich hatte, war er – wenn man Ibn Hisham Glauben schenken kann – in die folgenreichste Lebenskrise seit Menschengedenken geraten. Ruhelos und unzufrieden hatte er begonnen, die Wildnis zu durchstreifen, die sich um seine Heimatstadt erstreckte, »und es gab keinen Stein und keinen Baum, an dem er vorbeikam, der nicht gesagt hätte: ›Friede sei mit dir, o Prophet Gottes.‹«9 Verständlicherweise versetzte ihn dies in nicht geringe Unruhe. An den Orten, die er sich für seine Wanderungen auf seiner einsamen Suche nach spiritueller Erleuchtung ausersehen hatte, wurden normalerweise keine Stimmen gehört. Das nahe Mekka lag mitten in der arabischen Wüste: Der Gebirgszug, der sie rings umgab, war von der erbarmungslosen Glut der Sonne schwarz gebacken und erhob sich in öder, windgepeitschter Einsamkeit. Und ausgerechnet hier, an der Flanke von einem eben dieser Berge, hörte Mohammed, als er nachts in einer Höhle lag, eine über die Maßen bestürzende Stimme. Zuerst fühlte er sie wie einen Schraubstock, der sich um seinen Körper legte: der Griff einer schreckenerregenden übernatürlichen Wesenheit. Dann nur ein einziger Befehl: »Rezitiere!«*2 Und dann, als wären seine Worte ein verzweifeltes, gewaltsames Ausströmen des Atems, keuchte Mohammed ganze Zeilen von Strophen heraus:
Rezitiere: im Namen deines Herrn!
Er, Der erschaffen hat!
Er erschuf den Menschen aus einem Klumpen Blut.
Rezitiere! Dein Herr ist allgütig.
Er lehrte mit der Feder.
Er lehrte den Menschen, was dieser nicht wusste.10
Mohammed sprach, doch es waren nicht seine eigenen Worte. Aber von wem kamen sie dann? Mohammed selbst, so heißt es, nahm zunächst an, er sei von einem Dschinn besessen, einem Geist der Wüsten und der Winde. Das wäre nicht einmal so erstaunlich gewesen. Mekka war laut Ibn Hisham ein von Dämonen heimgesuchter Ort. Genau in der Mitte der Stadt stand ein aus Stein und Lehm erbauter Schrein – die Kaaba (Würfel) –, in der sich Heerscharen fürchterlicher Götter herumtrieben, Totemfiguren von derart teuflischer Macht, dass sich die Menschen aus ganz Arabien hier versammelten, um ihnen Respekt zu erweisen. Außerdem verfügte jeder Haushalt in Mekka über seine eigene private Götterfigur: Man rieb sie, um sich Glück für eine bevorstehende Reise zu sichern. Die Leute von Mekka waren derart verstockte Heiden, dass sie sogar bestimmten Felsbrocken Opfer darbrachten: Unter diesen befand sich auch ein ehemaliges Liebespaar, das es gewagt hatte, in der Kaaba miteinander zu schlafen, und auf der Stelle in Stein verwandelt wurde. In einer so unheimlichen Stadt, deren Atmosphäre geradezu waberte von Blut und Magie, war es nur natürlich, dass scharenweise von Dschinns besessene Hellseher auftraten, die sich im Schmutz der engen Straßen wälzten und ihre Offenbarungen ausspieen. Mohammed war von solchem Grauen bei dem Gedanken erfüllt, ihm könnte womöglich ein ähnliches Schicksal bevorstehen, dass er beschloss, sich das Leben zu nehmen. Er stand auf, verließ die Höhle und taumelte in die Nacht hinaus. Wie ein Gejagter eilte er den Berg hinauf. Auf dem Gipfel angekommen, war er kurz davor, sich in die Tiefe zu stürzen, um von den Felsen zerschmettert zu werden.
Aber da war wieder diese Stimme. »O Mohammed! Du bist der Abgesandte Gottes, und ich bin Gabriel.« Konnte das wahr sein? Gabriel war ein mächtiger Engel, der Bote des einen von den Juden und Christen verehrten Gottes, der in alten Zeiten – so hieß es jedenfalls – dem Propheten Daniel Visionen geschenkt und der Jungfrau Maria verkündet hatte, sie werde einen Sohn gebären. Mohammed blickte nach oben und sah die Gestalt eines Mannes, »dessen Füße auf dem Horizont standen« (siehe Abb. 1):11 Wer konnte das sein, wenn nicht tatsächlich der Engel? Er stieg vom Berg herab, suchte Trost bei seiner Frau, dachte über das erschütternde Trauma nach, das hinter ihm lag, und schließlich wagte er es, eine ganz und gar furchteinflößende Möglichkeit in Betracht zu ziehen: dass die Stimme die Wahrheit gesprochen hatte. Zwei Jahre lang sollte er sie nicht mehr vernehmen – als aber Gabriel schließlich zurückkehrte und das Schweigen aufgehoben wurde, hatte Mohammed keinen Zweifel mehr, dass er durch Vermittlung des Engels die authentischen Worte eines Gottes hörte. Und zwar nicht irgendeines Gottes, sondern des einen Gottes, des wahren Gottes, des unteilbaren Gottes. »Es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Schöpfer aller Dinge.«12
Hier, in dieser kompromisslossen Versicherung, dass es nur eine einzige Gottheit gab, lag der Schlüssel zur absolut neuen Sicht des Universums: Monotheismus in Reinform. Mit jeder anschließenden Offenbarung wurde Mohammeds Verständnis der Einheit Gottes und was Ihm der Mensch demzufolge schuldete, zu noch heller strahlendem Glanz gebracht. Die Menschen in Arabien mit ihren Idolen aus Stein, aus Holz oder aus mit ranziger Butter vermischten Datteln taten ja nichts anderes als einer Illusion zu folgen, die seit Urzeiten die schlimmste Wahnvorstellung der Menschheit war: dass es in den Himmeln und auf der Erde von Göttern nur so wimmelte. Und also begann Mohammed, dem seine Stimme befohlen hatte, Gottes Offenbarungen »laut zu verkünden«,13 zu predigen. Wieder und wieder, so seine Warnung, sei die Menschheit der einen Sünde erlegen, die nicht vergeben werden kann: Shirk– dem Glauben, dass Gott mit anderen Wesen vermischt werden kann. Wieder und wieder aber hatte der »Herr der Welten«14 in seiner Allbarmherzigkeit Propheten gesandt, um den Menschen ihre Torheit vor Augen zu führen und sie auf den Weg der Wahrheit zurückzubringen. Noah und Abraham, Moses und Jesus: Alle hatten sie die eine selbe Botschaft gepredigt, den Aufruf zur Unterwerfung unter Gott. Als nun die Offenbarungen, die Mohammed gewährt wurden, immer länger und zahlreicher wurden, war wohl – sechs Jahrhunderte nach Jesus – ein neuer Prophet aufgestanden. Und nicht nur irgendein neuer Prophet: Man konnte in ihm geradezu das »Siegel der Propheten« sehen.15 Und als ein Jahr nach dem anderen verging und das Göttliche auch weiterhin durch ihn sprach, erkannte er wie auch seine wachsende Anhängerschaft, dass er der Empfänger der endgültigen Botschaft war: der definitiven Offenbarung Gottes.
Nicht dass er damit auf einhellige Zustimmung gestoßen wäre. Von Ibn Hisham stammen die klugen Worte: »Die Gabe der Weissagung ist eine mühselige Last. Wegen des Widerstandes, auf den sie bei den Menschen stoßen, indem sie Gottes Botschaft vermitteln, können diese Last nur – durch Gottes Huld und mit Seiner Hilfe – starke, entschlossene Boten tragen.«16 Das war noch recht milde ausgedrückt. Die Stadtbewohner Mekkas sahen in Mohammed zunächst ein Ärgernis, dann eine Provokation, und schließlich eine Lebensgefahr. Ganz besonders empört über seine kompromisslose Botschaft waren die Angehörigen seines eigenen Stammes, die sogenannten »Quraishiten«: ein Zusammenschluss von Clans, die unter den versprengten Stämmen Arabiens schon seit Langem besonderen Respekt genossen. Die Achtung, die ihnen als »Volk Gottes« entgegengebracht wurde, war auf ein lukratives Amt zurückzuführen, das sich die Quraishiten selbst angeeignet hatten: Sie waren die Wächter der Kaaba und der dort beheimateten Schar von Göttern, und dieses Amt drohte Mohammed mit seinem wirren Gerede von einem einzigen Gott offensichtlich zu unterminieren.*3 Für den Propheten und seine Anhänger wurde das Pflaster von Mekka immer heißer. Im Jahr 622 n. Chr., zwölf Jahre nach der ersten Offenbarung, mussten sie um ihr nacktes Leben fürchten. Eines Nachts erschien Gabriel dem Propheten und warnte ihn, dass die Quraishiten vorhatten, ihn in seinem Bett zu ermorden: Zeit zum Aufbruch. In den Spuren seiner Anhänger, von denen viele Mekka schon verlassen hatten, stahl Mohammed sich gehorsam aus der Stadt hinaus und verschwand in der Nacht. Dieser Augenblick war von langer Hand vorbereitet: Das Unternehmen, zu dem Mohammed jetzt aufbrach, war nicht irgendeine kopflose Flucht in die Wüste, sondern eine minuziös geplante Wanderung – eine Hijra.
Diese nächtliche Flucht galt zu gegebener Zeit als entscheidender Gründungsakt; sie stiftete eine neue Zeitrechnung. Das Jahr dieser Flucht ist für Muslime bis heute das Jahr Eins, und die Jahreszahlen in ihrem Kalender sind nach wie vor mit AH gekennzeichnet, Anno Hegirae»im Jahr der Hijra«. Für Ibn Hisham war der eigentliche Wendepunkt im Leben Mohammeds nicht seine erste Offenbarung, sondern sein Aufbruch von Mekka. Seitdem war Mohammed nicht mehr nur ein Prediger, vielmehr lag eine spektakuläre Serie von Großtaten vor ihm, aus denen er am Ende als Anführer einer völlig neuen politischen Ordnung hervorging.
Sein Bestimmungsort, die Oase Yathrib im Norden Mekkas, brauchte dringend eine starke Hand. Die Stämme, die dort lebten, eine ungute Mischung aus jüdischen und arabischen Siedlern, frönten schon seit Langem einem wilden Fehdewesen; da aber die Gewalt zunehmend außer Kontrolle geriet, waren viele des ständigen Blutvergießens müde; sie wünschten sich sehnlichst einen unparteiischen, vertrauenswürdigen, mit Autorität auftretenden Friedensstifter, der vielleicht sogar – man darf ja träumen – ein ganz besonders unmittelbares Verhältnis zu Gott hatte. Kurz, Mohammed, ein Prophet, der einen Zufluchtsort brauchte, und Yathrib, eine Stadt, die einen Propheten brauchte, passten in idealer Weise zusammen. Diese Beziehung war buchstäblich im Himmel gestiftet, so wenigstens meinte Ibn Hisham.
Was Mohammed letztlich dort bewirken konnte, beweist allein schon der Umstand, dass der Name Yathrib von der Landkarte endgültig verschwand. Das Schicksal und der unsterbliche Ruhm der Oase, die ihm Zuflucht bot, offenbaren sich darin, dass sie für alle Zeiten den Namen »Stadt des Propheten«, Madinat an-Nabi: Medina trug. Mohammed verbrachte dort sein gesamtes weiteres Leben und errichtete eine Gesellschaftsordnung, die seitdem für alle Muslime vorbildlich ist. Die Worte des Propheten für Menschen, die nach den mörderischen Gesetzen der Wüste lebten, waren zornig und unmissverständlich: Dem Gold mit »ungeordneter Liebe« anzuhängen,17 Waisen zu bestehlen und ihr Erbe zu verschleudern; sich ungewollter Töchter zu entledigen, indem man sie lebendig im Sand vergräbt, dies alles sei, so seine Warnung, eine sichere Voraussetzung dafür, im ewigen Feuer zu brennen. »Rechenschaft wird verlangt von denen, die auf der Erde zu Unrecht Menschen unterdrücken und Übertretungen begehen. Sie erwartet schmerzhafte Qual.«18 Vor der ehrfurchtgebietenden Unendlichkeit Gottes auf Seinem Richterstuhl schrumpfte selbst das arroganteste und wildeste Stammesoberhaupt zu einem winzigen Staubkorn. Die verfeindeten Stämme von Yathrib waren so überwältigt von der Flutwelle der Offenbarungen Mohammeds, dass sich ihre alten Feindschaften ebenso wie die alten Loyalitäten in der Dringlichkeit und Erhabenheit seiner Botschaft auflösten. Doch der Prophet zähmte zwar ihren Hang zu den viel älteren Freuden der Stammesüberlegenheit, aber jeglichen Gemeinschaftssinn wollte er ihnen auch wieder nicht nehmen. Im Gegenteil: Es gelang ihm zwar durchaus, seinem Zufluchtsort Frieden zu bringen, wie man es von ihm erwartete, aber Friede war nicht alles, was er vermittelte. Etwas Größeres, sehr viel Größeres wurde den Leuten von Yathrib geboten: eine vollkommen neue Identität, geformt aus den Splittern ihrer zerschlagenen Stammesordnung; die Identität als ein einziges Volk – als Mitglieder einer einzigen Umma.
Nun war Mohammed zwar möglicherweise das »Siegel der Propheten«, aber das hielt ihn nicht davon ab, einen irdischen Staat zu gründen. Gott sprach nach wie vor zu ihm. Sein Selbstvertrauen war unangefochten. Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellten, wurden beiseite gewischt oder notfalls auch niedergetrampelt. Als die Kluft zwischen Reichen und Armen, die Mohammed zutiefst empörte, sich nicht schließen wollte, verbot er kurzerhand Wucher und führte ein gerechtes Steuersystem ein. Als die Juden von Yathrib in Unruhe gerieten, weil ihre Heimatstadt in die »Stadt des Propheten« umgewandelt wurde, und es wagten, gegen ihn zu arbeiten, wurden sie je nach Schwere des Falls vertrieben, versklavt oder abgeschlachtet. Als die Quraishiten auf die Information hin, Mohammed plane einen Überfall auf eine ihrer Karawanen, eine militärische Begleitmannschaft in die Wüste schickten, stellte der Prophet sich der Eskorte mit einer kleinen Gruppe von Anhängern bei einem Wasserloch namens Badr entgegen und zwang sie zu einer schmählichen Flucht. Engel, deren »weiße Turbane hinter ihnen herflogen«,19 schimmerten im Himmel über dem Schlachtfeld, sie schwangen ihre Feuerschwerter und schlugen den Quraishiten reihenweise die Köpfe ab.
Aber das spektakulärste und unangreifbarste Zeichen von Gottes Wohlwollen war die Verwandlung Mohammeds selbst: Der Flüchtling stieg zum faktischen Herrscher über Arabien auf, und das innerhalb von nur zehn Jahren. Laut Ibn Hisham führte er insgesamt 27 Feldzüge an; und wenn es darunter gelegentlich eine Niederlage gab, wenn die Engel einmal nicht ganz so vehement mitkämpften wie in Badr, sondern ihm vielmehr als Reserve dienten, so war sein letzter Triumph aus diesem Grund vielleicht umso spektakulärer. Im Jahr 632, das üblicherweise als sein Todesjahr angenommen wird, hatte er das Heidentum in Arabien fast überall weitgehend verdrängt. Der süßeste Moment tiefster Genugtuung war zwei Jahre zuvor die Eroberung Mekkas. Mohammed war zu Pferd in seine Heimatstadt eingezogen und hatte befohlen, die Kaaba von sämtlichen Göttern zu befreien. Man legte ein riesiges Feuer. Die gestürzten Götzenbilder wurden den Flammen übergeben. Der Teufel versammelte seine Anhänger um sich und rief wehklagend aus: »Lasst all eure Hoffnung fahren, dass die Anhänger Mohammeds nach diesem ihrem Tag jemals wieder zur Shirk zurückkehren!«20 Und er hatte allen Grund für sein Geheul. Das uralte Heiligtum, diese herausragende Bastion des Heidentums, wurde nun endlich zur gebührenden Unterwerfung gezwungen: zum Islam. Es war jedoch alles andere als eine Innovation, dass Mekka dem Dienst für den Einen wahren Gott geweiht wurde. Mohammed enthüllte seinen Anhängern, was er für das Heiligtum getan habe, sei eine Wiederherstellung seines uranfänglichen, makellosen Zustands gewesen. »Am Tag, da Gott Himmel und Erde erschuf, machte Er Mekka heilig. Es ist das Heilige des Heiligen bis zum Tag der Auferstehung.«
Diese Zusage bot den Gläubigen gerade in den Tagen der Erschütterung nach Mohammeds Tod zwei Jahre später viel Trost. Sie ließ sie wissen, dass sie nicht von Gott verlassen worden waren. Obwohl der große Prophet gestorben war, blieb Arabien doch nach wie vor durch das Heilige verwandelt. Und es war auch nicht nur Mekka, »das Heilige des Heiligen«, das auf der Erde fortbestand. Auch die Umma blieb bestehen – zu Ruhm und Ehre der Lehren des Propheten. Im Lauf der Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte nach Mohammeds Tod sah das Volk der Muslime seine Aufgabe darin, aus der gesamten Welt eine Kaaba zu machen: erobert, gereinigt, geheiligt. Als Ibn Hisham sich schließlich an die Abfassung seiner Biographie begab, waren es längst nicht mehr nur Araber, die sich beim Gebet nach Mekka wandten. Fremde Völker, von denen der Prophet sicher nie gehört hatte – die Westgoten und die Berber, die Sogder und die Parther –, durchquerten als Pilger zur Kaaba die Wüsten Arabiens. Ibn Hisham geht in seiner Sira auf diesen Punkt nicht ein, aber zahlreiche andere Gelehrte berichteten nur zu gern von den unerhörten Eroberungen nach dem Tod des Propheten weit jenseits der Grenzen Arabiens. Dieser Tatendrang war verständlich. Damals, in den wilden Tagen, als die Araber noch Heiden waren, gab es für sie keine größere Freude als dann und wann eine vollmundige Prahlerei – über irgendwelche bravourösen Scharmützel, ein mitreißendes Banditenstückchen oder die tiefe Demütigung, die man einem besiegten Rivalen triumphierend zugefügt hatte. Wenn sie jetzt ihr Eigenlob sangen, geschah es immer grundsätzlich im Namen Gottes. Von Badr bis zu den äußersten Enden der Welt war die Geschichte des Islam ein einziger, alles mitreißender triumphaler militärischer Siegeszug. Städte, die unendlich viel größer waren als Mekka, wurden erobert, unendlich viel mächtigere Völker als die Quraishiten gezwungen, ihren Nacken zu beugen. Schon die Anzahl dieser Siege über uralte Imperien und altehrwürdige Religionen war als Beweis dafür, dass der Prophet die Wahrheit verkündet hatte, gewiss mehr als hinreichend. Ein arabischer Autor frohlockte: »Das Zeichen dafür, dass Gott uns liebt und sich an unserem Glauben erfreut, ist eben genau dies, dass er die Herrschaft über alle Völker und Religionen in unsere Hand gegeben hat.«21
Aber es waren auch andere, sorgenvolle Stimmen zu hören. Mitten im Reichtum und Glanz eines riesigen Imperiums, unermesslich größer als alles, was Mohammed selbst sich hätte träumen lassen, konnte das Volk der Muslime ein unbehagliches Gefühl von Verfall nicht loswerden. Eine Generation nachdem Ibn Hisham seine Biographie abgeschlossen hatte, und eine Generation nachdem der erwähnte Gelehrte von der Last seiner Bücher erschlagen worden war, konnte der brillante Universalgelehrte Al-Jahiz bei seiner Betrachtung des insgesamt triumphalen Verlaufs der Geschichte des Islam nur noch Verfall erkennen. Es gab also ein einziges goldenes Zeitalter. Nur von denen, die tatsächlich den Worten des Propheten lauschen konnten, die an seiner Seite ritten, die ihm als seine Sahabah, seine »Gefährten« dienten: nur von ihnen konnte man mit Recht behaupten, sie hätten »den wahren Monotheismus« praktiziert – und das war natürlich auch der Grund für ihren erstaunlichen Erfolg gewesen. Ihre Generation war unmittelbar nach dem Begräbnis des Propheten aufgebrochen, um die Welt zu erobern – und, mehr noch, es gelang ihr auch. Die Anführer bei dieser grandiosen Siegesserie – sie wurden »Kalifen«, »Nachfolger« des Propheten genannt – standen alle bekanntermaßen in enger familiärer oder verwandtschaftlicher Beziehung zu Mohammed. Der erste, ein ergrauter Veteran namens Abu Bakr, war während seiner gefahrvollen Flucht nach Medina sein Gefährte gewesen, und er war der Vater von Mohammeds Lieblingsfrau; der zweite, Umar, war sein Schwager; der dritte, Uthman, verheiratet mit einer Tochter Mohammeds. Der vierte, Ali bin Abi Talib, hatte die eindrucksvollste Position von allen: Er war der Erste, der je zum Islam übertrat, und diesen Schritt tat er im zarten Alter von neun Jahren; außerdem war er ein Vetter des Propheten und wurde schließlich darüber hinaus auch noch sein Schwiegersohn. Diese vier Männer hatten insgesamt gerade einmal 30 Jahre lang geherrscht, aber als Al-Jahiz mit seinen Aufzeichnungen begann, wurden sie schon von der großen Mehrheit der Muslime als echte Vorbilder verehrt – als ar-Rashidun, die »recht Geleiteten«. Natürlich war die Periode ihrer Herrschaft nicht mit der Mohammeds in Medina zu vergleichen, aber in der Kategorie Goldenes Zeitalter errang sie doch einen ruhmreichen zweiten Platz. »Denn zu jener Zeit«, so die wehmütige Feststellung bei Al-Jahiz, »gab es keine beleidigenden Aktionen oder skandalösen Erneuerungen, keine Akte von Ungehorsam, Neid, Hass oder Rivalität.«22 Der Islam war damals noch makellos islamisch gewesen.
Aber auf jeden Sommer folgt ein Winter, und auf jedes goldene Zeitalter ein eisernes: Im Jahr 661 wurde die Ära der Rashidun zu einem blutigen, tragischen Ende gebracht. Kalif Ali wurde ermordet. Dann, zwei Jahrzehnte später, fiel sein Sohn in einer Schlacht; die Lippen, die den Propheten geküsst hatten, zerfleischte der Stock eines höhnischen Siegers. Nun hatten die Umayyaden, eine Dynastie aus dem Stamm der Quraishiten, ihre Klauen endgültig tief in das Kalifat geschlagen und es an sich gerissen – sehr zur Empörung aller Gottesfürchtigen. Die neuen Kalifen tranken Wein, sie hielten sich Affen als Schoßtiere, und sie nannten sich nicht Nachfolger des Propheten, sondern »Stellvertreter Gottes«. Ein so ungeheuerliches Verhalten musste den Zorn des Himmels provozieren; und so wurden die Umayyaden denn auch tatsächlich im Jahr 750 gestürzt, zur Flucht gezwungen und von rachedurstigen Todeskommandos systematisch verfolgt und niedergemacht. Die Flecken und Makel ihrer fast ein Jahrhundert währenden Machtausübung waren allerdings nicht so leicht zu tilgen. Die nächste Dynastie auf dem Kalifenthron, die Abbasiden, gab zwar vor, in direkter Linie vom Onkel Mohammeds abzustammen, dennoch kehrte das goldene Zeitalter der Rashidun nicht wieder. Stattdessen grassierten offensichtlich ebenso wie in den dunklen Jahren zuvor Neuerungen und Spaltung. Immer mehr rivalisierende Sekten traten auf, und mit ihnen rivalisierende Kalifen. Währenddessen sahen sich die Armen jenseits der Mauern der Paläste, in denen die Nachfolger des Propheten in seidenen Gewändern von goldenen Tellern speisten, von der Arroganz der Mächtigen, Reichen und Grausamen genau so unterdrückt wie immer. Unerbittlich erhob sich die Frage: Wie konnte es geschehen, dass alles so falsch gelaufen war? Und noch deutlicher: Wie konnte man am besten alles wieder in Ordnung bringen?
Zwei Jahrhunderte nach der Hijra war auch der Letzte, der den Propheten noch lebend gesehen hatte, schon längst vom Angesicht der Erde verschwunden. In dieser Zeit der Wirren war allerdings den meisten Muslimen klar, dass man kein Problem lösen konnte, ohne die Lösung durch ihren geliebten Propheten bestätigt zu wissen. Gott hatte den Gläubigen mitgeteilt: »Im Boten Gottes habt ihr ein hervorragendes Beispiel, dem ihr nachfolgen sollt.«23 Eine Darstellung Mohammeds war also gleichbedeutend mit der Darstellung eines letztgültigen Rollenvorbilds: eines Verhaltensmusters, das allen Menschen aller Zeiten als Ideal dienen konnte. Die Jahre vergingen, und immer mehr Biographien wurden verfasst, die immer stärker ins Detail gingen, und die Verehrung des Propheten nahm immer noch zu. Dass seine Geburt von unbestreitbaren Wundern begleitet war – das Auftauchen unbekannter Sterne am Himmel oder Dschinn-Geflüster in den Ohren von Hellsehern, das den Anbruch eines neuen Zeitalters verkündete –, hatte auch schon Ibn Hisham gewusst; allerdings füllte sich dieser Bestand an Wundern im Lauf der Zeit noch massiv auf. Nach neuen Erkenntnissen, von denen Mohammeds früheste Biographen noch keine Ahnung hatten, konnte er die Zukunft voraussagen, er empfing Botschaften von Kamelen, von Palmen und Fleischstücken, er hob das Auge eines verwundeten Soldaten auf, setzte es wieder ein, und der Mann konnte besser sehen als zuvor. All das zusammengenommen hatte schließlich ein weiteres Wunder zur Folge: Je größer der zeitliche Abstand zwischen dem Propheten und seinen Biographen wurde, desto ausführlicher geriet die Biographie.
Dabei brauchte man gar kein ganzes Buch, um aus dem Leben Mohammeds etwas zu lernen. Es reichte schon eine einzige Anekdote, ein einziger Satz. Diese biographischen Schnipsel wurden Hadith genannt, und bereits knapp ein Jahrhundert nach Ibn Hisham gab es Dutzende Beispiele dieser Gattung, vielleicht sogar schon Hunderte, von Tausenden. Jeder, der etwas für Listen übrig hatte, konnte sich einen Spruch aus einer der umfangreichen, sauber nach Themen geordneten Sammlungen aussuchen. Es hatte ganz den Anschein, als habe es kaum ein Thema gegeben, zu dem Mohammed sich nicht geäußert hatte. Falls ein Gottesfürchtiger wissen wollte, ob er Dämonen heiraten durfte, warum die meisten Verdammten in der Hölle weiblichen Geschlechts waren, oder wie der Orgasmus im Lauf eines Zeugungsakts sich auf das Aussehen des danach geborenen Kindes auswirkte – zu allem gab es ein Hadith, das die Antwort kannte. Vielleicht waren es ursprünglich nur Nebenprodukte von Mohammeds Biographie; jedenfalls hielten sie zur Erbauung späterer Generationen die gesamte Lebenseinstellung des Propheten fest. Konnte es für das Volk der Muslime etwas Kostbareres geben? Nahm man sämtliche Hadithe zusammen, wie es nun immer üblicher wurde, bildeten sie etwas unendlich viel Wertvolleres als nur eine Zitatensammlung. Sie stellten ein ganz außergewöhnliches Gesetzescorpus dar, das jede erdenkliche Facette menschlicher Existenz berücksichtigte und fast nichts unreguliert, fast nichts dem Zufall überließ: Die Gelehrten bezeichneten dieses Corpus als Sunna. Und auch die Sunna trug zum Ruhm des muslimischen Volkes bei. Die Gesetze der Muslime waren nicht aus den trüben Niederungen weltlicher Sitte oder Erfindung abgeleitet – sie stammten vielmehr, so rühmten die Muslime sich selbst, direkt vom Himmel. Die Sunna belehrte die Gläubigen bezüglich ihrer Verpflichtungen gegenüber den Armen, sie gab in großer Detailgenauigkeit vor, wie man zu beten hatte, wohin man pilgern sollte, was man essen durfte und wann man fasten musste. Damit war es der Sunna gelungen, die Triebe vormals wilder Gesellschaften zu zähmen und den Menschen eine Ahnung davon zu vermitteln, wie eine zivilisierte Gemeinschaft menschlicher Wesen aussehen konnte. Wer nach ihrer Lehre lebte, sah in ihr eine so wundersame Leistung, dass ihr göttlicher Ursprung nie auch nur im Mindesten angezweifelt wurde. Ein Hadith-Meister argumentierte mit bezwingender Logik: »Sie wurde dem Propheten von Gabriel überbracht, und Gabriel war von Gott gesandt.«24
So kam es, dass im Verlauf des 9. und 10. christlichen Jahrhunderts Episoden aus dem Leben Mohammeds unauflöslich im Gewebe des muslimischen Alltags eingezogen wurden. Das Zeitalter des Propheten und seiner Gefährten war nicht vergessen. Gelehrte und Juristen, die sich Generation für Generation daran abarbeiteten, die Erinnerung an den Propheten aufzubewahren, zweifelten nie an den weitreichenden, revolutionären Wirkungen ihres Tuns. Es genügte ja nicht, die große Masse der Gläubigen mit Verhaltensregeln und -maßstäben zu versorgen; auch die Begierden der Reichen, der Mächtigen und Wohlgenährten – also der Menschen, deren schamlose Missachtung der Vorgaben sozialer Gerechtigkeit den Zorn des Propheten von Anfang an erregt hatte – mussten gebändigt werden. »Kein Mensch ist gläubig, der sich den Magen füllt, während sein Nachbar hungert.«25 In solchen Sätzen und in der Vielzahl an Hadithenähnlichen Inhalts waren Maximen enthalten, die jeden befremden mussten, der sich schamlos an der Ausbeute der Eroberungen bereichert hatte. Mohammeds Empörung über die Ungerechtigkeiten in der menschlichen Gesellschaft, die in der Aufzeichnung seiner Aussprüche festgehalten war, musste auf eine moralisch zerrüttete, habgierige Elite, deren Sinn nur auf Unterdrückung gerichtet war, besonders abschreckend wirken. Deshalb gaben sich auch die Gelehrten des Kalifats, die hinsichtlich der Zielsetzungen und Gelüste ihrer Herrscher berechtigte Skepsis empfanden, alle Mühe, den Hadithen Authentizität zu verleihen. Wie anspruchsvoll und herausfordernd sie auch waren – es durfte unter den Muslimen kein Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. Das bedeutete für die Juristen und Biographen, für die Historiker und die islamischen Religionsgelehrten eine weitere wunderbare und schwierige Aufgabe. Die Verbindungen zwischen ihrer Gegenwart und der Lebenszeit des Propheten mussten hieb- und stichfest, für jeden unmissverständlich, beglaubigt werden.
Ein höherer Anspruch war kaum vorstellbar. Wer die Authentizität der Hadithe belegte, verknüpfte die Gegenwart unangreifbar mit der Vergangenheit. Natürlich war es von größter Bedeutung, dass die Unterstützungs- und Untermauerungskonstrukte, die zu diesem Zweck eingesetzt wurden – im Arabischen als Isnaden bezeichnet –, die Jahrhunderte unangetastet überdauern konnten. Das war nur durch eine über die Generationen hinweg lückenlose Abfolge von Autoritäten zu gewährleisten, und jede einzelne musste auf die voraufgehende zurückzuführen sein, bis sie schließlich bei einem Zeugnis über den Propheten selbst kulminierte.
Glücklicherweise gab es keinen Mangel an derartigen Übertragungsketten. Die Bindeglieder der Isnaden waren stabil. 500 Jahre nach dem Tod Mohammeds gewannen viele muslimische Gelehrte den Eindruck, es gebe kaum einen Aspekt im Leben der Menschen, der dank ihrer titanischen Anstrengungen nicht fest an ein bestimmtes heilbringendes Hadith angekoppelt war. Das Risiko, die Gläubigen könnten das Beispiel des Propheten aus den Augen verlieren, war gleich null – die Seile zwischen Vergangenheit und Gegenwart hätten schwerlich haltbarer sein können. Die Isnaden schienen wie ein aus Drähten gewirktes, über die Zeit gelegtes Netz ebenso unendlich wie unzerstörbar zu sein. Mohammeds Leben geriet nicht aus dem Blick, im Gegenteil: Es wurde in fast schon pointillistischer Detailtiefe konserviert.
Aber damit nicht genug – der Prophet hatte den Gläubigen noch mehr hinterlassen. Bei all der sich ständig vermehrenden Vielzahl an Wundern und staunenerregenden Taten, die ihm von seinen Biographen zugeschrieben wurde, wusste das Volk der Muslime, dass es im Grunde nur ein einziges transzendentes Wunder gab. »Wir haben veranlasst, dass das Buch auf dich herabkommt, eine deutliche Erklärung aller Dinge.«26 So hatte Gott es Mohammed zugesichert. Und das »Buch« war natürlich die Summe der zahlreichen Offenbarungen, die dem Propheten im Lauf seines Lebens gewährt wurden; seine Gefährten hatten sie niedergeschrieben und nach seinem Tod zu einer einzigen »Rezitation« – einem »qur’an«