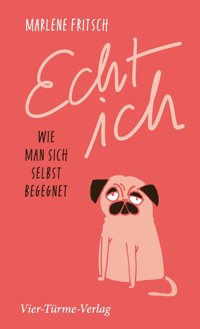
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Dieses Buch ist eine Einladung, sich auf den Weg zu machen zu dem Menschen, der jenseits von Erwartungen – eigenen und fremden –, Rollen und Masken in uns steckt. Es ist eine Ideensammlung, wie und wo er zu finden sein kann. Dabei möchte es keine "Gebrauchsanweisung" sein, im Sinn von: Wenn du dies tust, dann passiert (garantiert) das. Vielmehr geht es um Haltungen, die helfen können, sich selbst auf die Spur zu kommen und sich – wieder neu – kennenzulernen." Ein humorvoll-ehrliches Buch, das Mut macht, sich so anzunehmen, wie man geworden ist – und gerade deshalb ein anderer werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marlene Fritsch
Echt ich
Wie man sich selbst begegnet
Vier-Türme-Verlag
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie. Detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Printausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2021
ISBN 978-3-7365-0363-2
E-Book-Ausgabe
Zum Anfang: Eingeladen
In einem Artikel, in dem es um Gastfreundschaft ging, habe ich neulich sinngemäß gelesen: »Erwachsen zu sein bedeutet, dass man immer häufiger Gastgeber als Gast ist.« Irgendwie hat das etwas in mir angerührt und ich denke immer mal wieder daran herum. Als Gastgeber ist man darum bemüht, dass es allen gut geht, dass sie genug zu essen und zu trinken haben, den richtigen Tischnachbarn, mit dem sie sich auch unterhalten können und nicht nur zanken. Und sollte es doch Zank geben, wird man versuchen, das mit Freundlichkeit und Ablenkung wieder ins Lot zu bringen. Während die Gäste es gut miteinander haben, kommt man als Gastgeberin häufig selbst kaum dazu, seinen Hunger zu stillen, und man ist immer besorgt, ob das, was man gekocht hat, auch allen schmeckt und ob es wohl reichen wird. Man wird versuchen, mit allen zumindest ein kurzes Gespräch zu halten und ist insgesamt einfach sehr um das Wohl aller bemüht.
Ganz anders als Gast – und vielleicht ist das tatsächlich mit der Kindheit vergleichbar oder einer kindlichen Haltung zum Leben: Man kann sich einfach an den gedeckten Tisch setzen, wird meistens sogar noch bedient, darf genießen, was aufgetragen wird, ohne selbst dafür in der Küche gestanden zu haben. Man wird umsorgt und kann sich sogar mit ungewaschenen Fingern an den Tisch setzen (wenn keiner guckt), fragt »Was gibt’s heute?« und meckert dann am Essen rum, bis einem im besten Fall eine Extrawurst gebraten wird.
Als Gastgeberin bin ich in einer Rolle, in der es vor allem darum geht, dass es den Menschen, die an meinem Tisch sitzen, die ich eingeladen habe, gut geht. Tatsächlich fühlt man sich als Erwachsener oft so. Und häufig ist das auch eine schöne Rolle, die uns erfüllt – vielleicht auch mit Liebe erfüllt und die wir uns in gewisser Weise bewusst ausgesucht haben. Natürlich gibt es auch immer wieder Gäste an unserem Tisch, die wir nicht ganz freiwillig (in unser Leben) eingeladen haben. Aber wir fühlen uns verpflichtet, uns um sie zu kümmern. Und meistens spielen wir dann die Rolle, die man von uns erwartet.
Ich habe überlegt, woher eigentlich diese Erwartungen kommen und auch die verschiedenen Rollen, die wir über die Jahre übernehmen. Vielleicht ist es ein bisschen wie Fastnacht: Wir ziehen immer ein neues Kostüm über, je nachdem, wer wir gerade sein wollen oder sein müssen. Als Kind sind wir für unsere Eltern zum Beispiel der »Wildfang«, der lieber bei den Katzen im Heu schläft als mit Puppen zu spielen. Für die Freunde in der Schule sind wir der Kumpel, der immer für einen dummen Witz zu haben ist und die Party garantiert als Letzter verlässt. Später im Betrieb sind wir für die Kollegen die absolut Zuverlässige, die zudem noch die anderen auffängt, wenn es mit der Arbeit eng wird. Für die Tanten und Onkel sind wir das liebe Kind, das sie regelmäßig besucht und sich von angeblich kaputten Telefonen bis zum Bademantel um alles kümmert, was man so braucht im Alter. Und für die eigenen Kinder ist man oft genug der Gastgeber, an deren Essen man rummeckern kann und dem man anschließend die Wäsche in den Flur schmeißt. Irgendwann hat man dann so viele Verkleidungen übereinander an, so viel Schminke im Gesicht, dass man gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist – ungeschminkt, ohne Maske und Kostüm.
Dieses Buch ist eine Einladung, sich auf die Suche und den Weg zu machen nach und zu dem Menschen, der jenseits von Erwartungen – eigenen und fremden –, Rollen und Masken in uns steckt. Es ist eine Ideensammlung, wie und wo er zu finden sein kann. Dabei möchte es keine »Gebrauchsanweisung« sein, im Sinn von: Wenn du dies tust, dann passiert (garantiert) das. Vielmehr geht es um Haltungen, die helfen können, sich selbst auf die Spur zu kommen und sich (wieder neu) kennenzulernen. Es basiert auch nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Werken oder psychologischen Erkenntnissen. Vielmehr ist es so etwas wie ein Wanderführer für eine Route, die ich selbst schon gegangen bin – und auf der ich noch immer unterwegs bin. Das Schöne dabei und manchmal auch das Anstrengende: Wenn man am Ziel angekommen ist – die Begegnung mit sich selbst und sich selbst gefunden zu haben –, hat man die nächste Etappe immer schon vor sich. Denn solange wir leben, solange verändern wir uns, kommen neue Masken und Kostüme dazu und werden wir deshalb auch immer wieder neu nach uns selbst auf die Suche gehen.
Wer sich aber einmal selbst kennengelernt hat, wird vielleicht merken, wie gut es tut, sich zu begegnen, mit sich zusammen zu sein – und sich selbst richtig gut leiden zu können. Das heißt nicht, dass die Ecken und Kanten plötzlich verschwinden oder man keine Rollen mehr spielt, aber es bedeutet, zu all dem sagen zu können: Ja, das bin echt ich!
»Man braucht sich nur in die Einsamkeit zu begeben ...« – Still werden
Kennen Sie das? Sie haben sich diesen einen Abend in der Woche extra frei gehalten, weil Sie unbedingt zu einer Veranstaltung möchten, die Sie interessiert – ein Vortrag, ein Kurs, ein spiritueller Impuls. Und ausgerechnet an diesem Tag dauert die Sitzung im Büro länger, kommt die Ablösung bei der Schicht zu spät, lässt der Babysitter auf sich warten und Sie hetzen quer durch die Stadt und den Feierabendverkehr zum Veranstaltungsort. Dort schaffen Sie es gerade so in den Saal, ehe die Türen geschlossen werden, und die Veranstaltung beginnt, während Sie sich noch aus Ihrer Jacke schälen. Bei der Begrüßung oder der Meditation zu Beginn ist Ihr Hirn pausenlos mit anderem beschäftigt: »Wenn ich nach Hause komme, muss ich aber gleich noch …« – »Jetzt habe ich vergessen, Tante Maria zum Geburtstag anzurufen, dann kann ich das erst, wenn ich zurück bin, und dann ist es zu spät …« – »Wenn der Babysitter wieder wie beim letzten Mal den ganzen Abend telefoniert und die Kinder fernsehen lässt, was sie wollen, kriegt er richtig Ärger!« Und dann ist da wieder das schlechte Gewissen, dass Sie sich nicht auf die Meditation oder das Thema des Abends einlassen können, auch wenn Sie das noch so gerne möchten.
Wenn wir uns auf die Suche nach uns selbst machen, spielt das Stillwerden, die Ruhe, das Heraustreten aus dem Alltag und das Alleinsein mit sich selbst sicher eine große Rolle. Es hilft uns, das, was uns pausenlos in Atem hält, einmal hinter uns zu lassen und vor allem Ohren für unsere eigene Stimme zu bekommen, die in uns spricht und uns oft genug sagen kann, wo und wie dieser Weg zu uns selbst zu finden ist. Aber Stille, Einsamkeit und Ruhe sind Dinge, die in unserem täglichen Leben eher selten zu finden sind und daher oft eine Sehnsucht bleiben. Das liegt vor allem daran, dass jeder auf seine Weise in seinen ganz persönlichen Alltag eingebunden ist, der ihm, was die zeitliche Gestaltung des Tages angeht, nicht wirklich viel Spielraum lässt. Für gewöhnlich ist er vollgestopft mit Pflichten, die erledigt, Terminen, die eingehalten, und Gesprächen, die geführt werden müssen. Da bleibt einfach kein Platz mehr, um sich zurückzuziehen, in die Stille zu gehen, zu meditieren und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Oft genug fällt man am Ende eines Tages einfach nur ins Bett und wünscht sich nichts mehr als einen Knopf, mit dem man den Kopf ausschalten könnte, um endlich schlafen zu können.
Viele Menschen sind in solchen Momenten frustriert oder haben tatsächlich auch ein schlechtes Gewissen, weil sie wissen, was ihnen guttun würde, weil sie Ruhe und Stille so gern in ihren Alltag integrieren möchten, es aber einfach nicht schaffen, den Freiraum dazu zu finden. Und nicht selten erscheint dann die Sehnsucht nach der Stille als eine weitere Pflicht, der man − wie so vielen anderen − nicht nachgekommen ist.
Es ist etwas anderes, wenn man ein Seminar besucht, vielleicht auch über mehrere Tage, denn diese Zeiten sind an sich schon aus dem Alltag herausgehoben und etwas Besonderes, das man eben nicht jeden Tag erlebt. In den allermeisten Fällen wird man auch nicht spontan dazu aufbrechen, sondern es ist ein Termin, den man mit einigem zeitlichen Vorlauf ausgesucht hat, weil einen das Thema angesprochen hat oder weil man ein Bedürfnis nach einer solchen besonderen Zeit verspürt. Dann ist man meistens auch bereit, sich auf das Besondere einzulassen: die Stille, die Einsamkeit, das Für-sich-Sein. Und genau darin besteht das Problem, wenn die Tagung, der Vortrag vorbei ist: Das, was ich dort gehört habe, hat, wenn ich Montagmorgens aufstehe, keinen Ort in meinem Leben. Es bleibt eine Sehnsucht, die ich nicht erfüllen kann. Und auch hier plagt viele dann ein schlechtes Gewissen, weil sie das, was sie gerne tun oder was sie tun »sollten«, nicht tun oder nicht tun können.
Wenn ich mich auf die Suche nach mir selbst machen möchte, braucht diese Suche aber einen Platz in meinem Alltag. »Auszeiten« sind wichtig und sie unterstützen diesen Prozess auch, aber sie werden mir nicht helfen, wenn ich sie als Muss in meinem Leben verstehe oder sie nur alle paar Wochen oder Monate wieder aufnehme, falls ich es schaffe, mir Zeit dafür zu reservieren. Viele Menschen erfahren zudem, dass die Fragen, die sich ihnen im Prozess dieser Suche stellen, viel zu drängend sind, um sie zu verschieben oder sich nur zu besonderen Zeiten damit auseinanderzusetzen.
»Muss man denn Flügel haben, um auf die Suche nach sich selbst zu gehen?«
Jemand, der mir auf meinem eigenen Weg zu mir selbst als Weggefährtin immer wichtiger wurde, ist die spanische Mystikerin Teresa von Ávila. Sie war für ihre Zeit eine sehr fortschrittliche und vor allem selbstbewusste Frau, und wenn sie über sich selbst sagt: »Ich bin ein Weib – und obendrein kein gutes«, dann meinte sie damit wohl eher, dass sie nicht unbedingt den Normen ihrer Zeit entsprach, was oder wie ein »Weib« zu sein hatte. Für Teresa geht es nie um sie selbst, denn bei ihr steht Gott immer an erster Stelle. Sie möchte ein gottgefälliges Leben führen. Dieses Leben ist aber in ihren Augen etwas, um das man sich immer weiter bemühen muss. Es fällt sozusagen nicht vom Himmel, sondern wird nur dann Wirklichkeit, wenn man als Mensch bereit ist, sich auf den Weg zu machen, um Gott in sich selbst und im anderen, im Mitmensch zu finden. Dieser Weg ist erst mit dem Tod zu Ende und der Mensch in Gott angekommen. Bis dahin bleibt das Leben ein Unterwegssein, ein Zugehen auf dieses Ziel. Die Gefahr dabei ist in den Augen Teresas, dass wir entweder den Weg mit dem Ziel verwechseln oder aber auf Abwege geraten.
Ihre Spiritualität ist geprägt von »Stützen« oder Hilfen für diesen Weg. Sie erklärt immer wieder, wie er zu beschreiten ist und auch, worin die Gefahren oder Abwege bestehen. Im Gegensatz zu vielen männlichen Geistlichen ihrer Zeit bleibt sie aber bei dem, was sie dabei von ihren Mitmenschen und vor allem Klosterschwestern fordert, bodenständig und realistisch, das heißt, sie behält vor allem immer im Blick, was menschenmöglich ist. Sie predigt nicht einen – wenn man so will – »männlichen« Glauben, der von Disziplin und Kasteiung, Verzicht und Strenge gekennzeichnet ist, sondern einen alltagstauglichen Glauben, der Gott auch zwischen den Kochtöpfen findet – und vor allem im Antlitz ihres Nächsten oder ihrer Nächsten. Ihr geht es nicht um einen Glauben um des Glaubens willen, sondern um des Menschen willen. Um überhaupt ein gottgefälliges Leben führen zu können, muss man ihrer Ansicht nach jedoch erst einmal bei sich selbst ankommen, sich selbst kennenlernen.
Teresas »Weganleitung« dorthin und ihre gesamte Spiritualität atmen einen unglaublichen Sinn für Realität. Und gerade deshalb kann sie uns auch heute noch etwas vermitteln, das wie Balsam für unsere Seele ist, weil es uns entlastet, auch in dieser Hinsicht. »Muss man denn Flügel haben, um auf die Suche nach sich selbst zu gehen? Man braucht sich nur in die Einsamkeit zu begeben«, sagt sie. Flügel haben, fliegen können, sich und die Welt von oben betrachten: Teresa spricht hier von großen menschlichen Sehnsüchten, die gerade für ihre Zeitgenossen beinahe unerfüllbar waren − so wie die Sehnsucht nach Ruhe und Stille für uns heute. Sie meint jedoch: Das ist gar nicht nötig! Ich brauche diese Flügel, diese ganz besonderen Zeiten nicht, um mich auf die Suche nach mir selbst zu machen. Es braucht nicht das herausgehobene Ereignis, ich muss auch nicht in irgendwelche Fernen reisen, um mich dort zu suchen. »Man braucht sich nur in die Einsamkeit zu begeben.«
Für sie gehörten die Einsamkeit, das Alleinsein, die Stille, das Schweigen selbstverständlich zu ihrem Alltag als Nonne. Es war für sie ohne große Hilfsmittel, ohne besonderen Aufwand zu erreichen. Sie konnte in ihre Zelle gehen, um allein zu sein, oder auch in den Klostergarten oder in die Kirche. Für uns heute ist es manchmal schwer, wirklich Abgeschiedenheit und Stille zu finden. Dazu ist unser Alltag zu sehr von Kommunikation – auf den verschiedensten Kanälen und über die verschiedenen Sinne – geprägt. Aber: Teresa macht immer wieder deutlich, dass sie, um in die Einsamkeit zu finden, nicht unbedingt müßig und in Kontemplation versunken auf einer Kirchenbank sitzen muss, sondern die Stille auch erfährt, während sie beispielsweise Kartoffeln schält oder Unkraut jätet. Oder stickt, näht, betet. Diese Art der Einsamkeit gibt es auch für uns Menschen heute häufiger, als wir uns das bewusst machen. Vielleicht nicht beim Sticken oder Nähen, aber beim Zähneputzen und Kochen, beim Staubsaugen, im Bus, in der Bahn, im Auto.
Sich der Dinge entledigen, die nicht notwendig sind
In unzähligen Artikeln und Büchern ist von »unserer lauten Zeit« die Rede, in der jeder permanent irgendwelchen Geräuschen und Sinneseindrücken ausgesetzt ist. Sicher hat das gegenüber früher zugenommen, sicher ist man heute ganz anderen Einflüssen ausgesetzt, vor allem unsere Ohren. Und beim Kochen, Staubsaugen, im Bus und in der Bahn ist es auch äußerlich alles andere als still. Aber wenn es in meinem Inneren ruhig ist, spielt der Lärmpegel außen eigentlich keine Rolle. Dann kann ich die Einsamkeit, die Stille auch mit meinen »inneren Ohren« wahrnehmen.
Wenn ich darüber nachdenke, sind es aber ganz oft statt der äußeren Geräusche und Eindrücke vielmehr die Stimmen in meinem Kopf, die diesen Lärm erzeugen, weil sie permanent auf mich einreden: »Du musst noch … Hast du daran gedacht, dass … Und morgen, und übermorgen, nächste Woche …« Es geht also häufig gar nicht darum, Lärmquellen abzustellen, sondern die Ruhe in uns selbst zu finden. Teresa fasst das in einem Satz, der uns heute vielleicht noch mehr betrifft als ihre Zeitgenossinnen: »Es ist sehr nützlich (...), dass jeder entsprechend seiner Situation versucht, sich der Dinge und der Geschäfte zu entledigen, die nicht nötig sind. Das ist von so großer Wichtigkeit, dass ich es für unmöglich halte, jemals die wesentlichen Stufen zu betreten, ohne damit zu beginnen.«
»Sich der Dinge und Geschäfte zu entledigen, die nicht nötig sind« – darunter verstehe ich, dass ich in vielen Situationen erst einmal die Stimmen in meinem Kopf zum Schweigen bringe, die mir ständig vorhalten, was ich noch alles tun müsste oder sollte, egal ob in der nächsten Minute oder nächstes Jahr um die gleiche Zeit. Für mich steckt darin die Aufforderung, Prioritäten zu setzen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, das Eilige von dem, was noch Zeit hat, das, was jetzt gleich und unbedingt erledigt werden muss von dem, was ich getrost erst einmal vergessen kann. Dann wird es mit Sicherheit schon ein bisschen leiser in meinem Kopf.
Manche Menschen ertragen tatsächlich keine Stille. Sie nutzen Radio, Fernsehen und Computer dazu, um sie zu füllen, sobald sich die Möglichkeit ergibt, dass es einmal still werden könnte. Oft sind aber die Stimmen in unserem Kopf, die von den Sorgen und Nöten und dem allgegenwärtigen Stress reden, ebenfalls nichts anderes als »Stillefüller«, außer dass sie nur für uns hörbar sind und für andere vielleicht ablesbar an unserem gehetzten Gesichtsausdruck. Und egal, ob ich das Radio laufen lasse oder auf die Stimmen in meinem Kopf höre: Es geht immer darum, die eine Stimme – meine eigene, die mir etwas über mich selbst sagen möchte – zu übertönen oder erst gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Wir fürchten uns vor dem, was in der Stille laut wird.
Die Stille anschreien





























