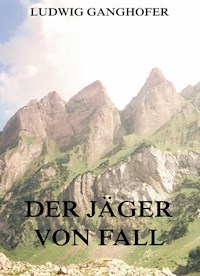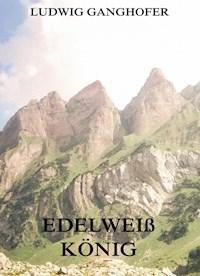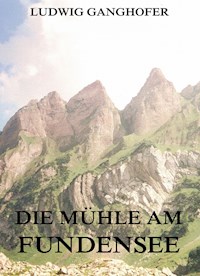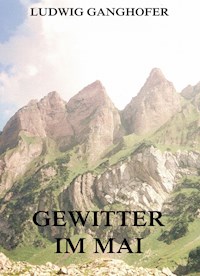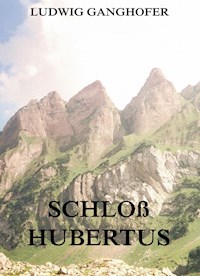Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem historischen Roman 'Edelweißkönig' entführt uns Ludwig Ganghofer in die dramatische Zeit des Ersten Weltkriegs in den Alpen. Mit seinem detailreichen Schreibstil und seiner akribischen Recherche erweckt Ganghofer die Ereignisse und Charaktere dieser Zeit zum Leben. Der Roman bietet einen Einblick in den Alltag der Soldaten, aber auch in die tragischen Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung in den Bergen. Ganghofers literarischer Stil fesselt den Leser und lässt ihn tief in die Geschichte eintauchen. Als einer der einflussreichsten Schriftsteller seiner Zeit, schafft es Ludwig Ganghofer, historische Fakten mit fiktiven Elementen zu verweben und so eine packende Erzählung zu kreieren. 'Edelweißkönig' ist ein eindringliches Werk, das nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt. Mit seiner sensiblen Darstellung der menschlichen Schicksale im Krieg, zeichnet Ganghofer ein beeindruckendes Bild dieser turbulenten Zeit. Der historische Roman 'Edelweißkönig' ist ein Must-Read für alle Liebhaber von historischer Literatur und für diejenigen, die auf der Suche nach einer bewegenden Lektüre sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edelweißkönig: Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
1
Von der Bergseite des Tales kam ein Jäger über die Wiesen her, deren junges Grün in der Nachmittagssonne einen Glanz wie Metall bekam. »Grüß dich Gott, Finkenjörg! Schaust dir dein' Hof an?« rief er einem Bauern zu, der, die Pfeife zwischen den Zähnen, am Zaun seines Gehöftes lehnte. »Aber hast schon recht! Da is auch was dran zum Schauen!«
Der Finkenhof mit dem zweistöckigen Wohnhaus, mit dem Gesindetrakt, dem Back- und Waschhause, mit der eigenen Schmiede, mit den Stallungen, Scheunen und Heustadeln und Holzschuppen bildete ein Dörfl inmitten des Dorfes. Ein brauner Staketenzaun mit breitem Gattertor und einer kleinen, zum Wohnhaus führenden Pforte schied das Gehöft von der Straße; ein gleicher Zaun umschloß auf der Rückseite des Hauses den Gemüsegarten, während graue Bretterplanken die hügeligen Wiesen von den Nachbarhöfen trennten. Höher und höher stiegen diese Planken hinauf, bis sie im Wald der Berge sich verloren, die mit zerrissenen Graten in weitem Bogen das Dorf umspannten. Weiß lag noch der Schnee auf allen Felskuppen, und wie mit bleichen Fingern griff er durch viele Schluchten hinunter ins Tal. Die Almen waren schon frei von Schnee, aber ihre Grashänge zeigten noch ein totes Gelb; die Lärchenbestände waren bereits von zartem Grün überhaucht, und auch die tiefer stehenden Fichten begannen schon jene hellere Färbung anzunehmen, die der frische Trieb des Frühjahrs den dunklen Nadelbäumen verleiht. Wo aber von den obersten Wiesen aus der Buchenwald in breiten Streifen sich einzwängte zwischen die Fichten, blickte durch das Gewirr der nackten Äste noch das rötliche Braun des Berggrundes, auf dem die Blätter des verwichenen Sommers moderten. Auch die Haselnußstauden, die den grauen Bretterzaun geleiteten, waren in der Nähe des Bergwaldes noch unbelaubt; je mehr sie dem Tal sich näherten, desto sichtlicher zeigte sich an ihnen die Kraft des Lenzes; in der Nähe des Finkenhofes waren sie schon übersät mit kleinen blaßgrünen Frühlingsherzen. An den Kastanienbäumen, die das Wohnhaus umringten, sproßte das Laub, und die jungen Blätter lispelten im lauen Wind. Dazu das Gurren der Tauben und das Glucksen der Hühner. Aus der Schmiede tönte Hammerschlag, und in der offenen Scheune klang, von einer kräftigen Mädchenstimme gesungen, die muntere Weise eines Liedes.
Der Tag wollte sinken. In zarter Bläue blickte der Himmel herunter durch die klare Luft, in die sich vom Dach des Finkenhofes der Rauch emporkräuselte mit langsamen Wirbeln. Zu diesem Hofe paßte der Bauer, ein Zweiundvierzigjähriger, dessen hohe, feste Gestalt den jüngeren Jäger um einen halben Kopf überragte. Er machte ein gutes Bild: in der schwarzledernen Bundhose mit den dunkelblauen Strümpfen, in der grünen Weste mit den kleinen Hirschhornknöpfen und in dem weißen Hemd mit den gebauschten Ärmeln. Auf breiten Schultern saß ein energischer Kopf mit klugen, lebhaften Augen; sie waren braun wie das Haar; ein kurzer Bart umkräuselte die Wangen; Kinn und Oberlippe waren rasiert, und man sah einen Mund, der ebenso freundlich reden wie streng befehlen konnte.
Neben diesem Bauern war der Jäger wie das Kind einer anderen Rasse. Seine Gestalt schien beweisen zu wollen, daß Knochen und Sehnen zur Bildung eines menschlichen Körpers völlig ausreichen. Die mit blanken Kappennägeln beschlagenen Schuhe, in denen die nackten Füße staken, mochten schwere Pfunde wiegen. Zwischen den grauen Wadenstutzen und der verwetzten Lederhose waren die braunen Kniescheiben bedeckt mit zahlreichen Narben. Die dicke Lodenjoppe stand wie ein Brett von den Hüften ab und krümmte sich nur widerwillig um die Schultern, die das Gewicht des bauchig angepackten Rucksackes und der Büchse nicht zu fühlen schienen. Schief über dem kurzgeschorenen Schwarzhaar saß ein mürber Filzhut, und über die schmale Krempe nickte eine Spielhahnfeder gegen die Stirn, unter der die grauen Augen blitzten, verwegen und heiter. Scharf hob sich die gekrümmte Nase aus dem hagern, sonnverbrannten Gesicht, und unter dem aufgezwirbelten Schnauzer lachte aus dem Gestrüpp des schwarzen Vollbartes ein lustiger Mund heraus. Bei aller derben Kraft, die in diesem Mannsbild steckte, waren seine Bewegungen von einer lebhaften Geschmeidigkeit. Alles an ihm redete mit, während er schwatzte: »In der Fruh hab ich a bißl nach die Auerhahnen gschaut. Hoffentlich rührt sich noch einer, wann mein Herr Graf zum Hahnfalz kommt. Möcht nur wissen, warum er so lang ausbleibt! D' Hauserin im Schlößl droben kennt sich schon gar nimmer aus. Allweil sagt dös Gansl: ›Paß auf, da stimmt ebbes net!‹« Er sah zu dem kleinen Kastell hinauf, das von einer nahen Anhöhe mit seinen Türmchen und Erkern herwinkte. »Es wird schon a bißl spat für'n Falz. No, vielleicht kommt er morgen, der Graf. Da schießt er noch allweil seine sechs, acht Hahnen.«
»Oho!« wehrte der Finkenbauer. »Ich saget gleich gar: a Dutzend.«
»Net an einzigen laß ich abhandeln. Mein Jagderl steht da! Freilich, d' Füß sind mir schier wie Brezeln worden vor Laufen und Laufen, bis ich sauber gmacht hab mit die Lumpen. Jeder hat's lassen müssen. Grad an einzigen hab ich noch auf der Muck.« Der Jäger überflog das Gehöft mit einem Blick, der den Bauer stutzig zu machen schien. »Mei' Rennerei allein hätt's freilich net ausgmacht. Er hat sich's a Trumm Geld kosten lassen für Winterfutter, Gangsteig und Jagdhütten, der alte Graf!«
»Unser Herrgott hab ihn selig! Jeds hat ihn gern ghabt. Und 's ganze Ort hat mittrauert, wie s' ihn aussitragen haben vor zwei Jahr, mit die Füß voraus. Is schad drum.«
»Und der Junge, weißt, der schlagt ihm nach. A lieber, a feiner Mensch! Und seelengut! Was ich hab, dös hab ich von ihm, mein' Hund, mei' Gwehr, mei' Häusl, alles! Und a Jager! Durchs Feuer springet ich für mein' Grafen, und wann er's haben wollt, reißet ich dem Teufel d' Nasen aussi aus der höllischen Visasch.«
»Gern is er allweil dagwesen bei uns im Hof, wie er noch a Bürscherl von zwölf, vierzehn Jahr gwesen is. Und gute Kameradschaft hat er ghalten mit mein Ferdl.«
»Laßt sich der Ferdl bald wieder anschaun?«
»Die nächste Woch kommt er. Jetzt is er in der Münchnerstadt auf Übung als Unteroffizier. Die nächsten Täg wird er frei. Da hab ich ihm gschrieben, er soll a bißl bei uns einkehren, vor er wieder nach Bertlsgaden geht zu seiner Schnitzerei. Am liebsten hätt ich ihn ganz bei mir. Aber weißt ja, wie er is! Bei uns fehlt ihm d' Werkstatt, und hat er net 's Schnitzmesser in der Hand, nacher is ihm net wohl.«
»Wahr is's! Wann er mit mir droben war am Berg, hat er allbot was aufklaubt vom Boden, a Wurzn oder a Trümml Holz, hat umanand bosselt mit sein Taschenfeitl, und kaum ich's versehen hab, hat er a Köpfl, a Manndl oder a Viecherl fertig ghabt. Ja, der Ferdl! Den hab ich gern!«
»Der is auch zum Gernhaben!« stimmte der Bauer mit einem Lächeln seines Bruderstolzes bei. »Haben kunnt er von mir, was er möcht. Oft schon hab ich dran denkt – bei uns wird's von Jahr zu Jahr besser mit die Sommerleut – und da laß ich ihm a saubers Häusl hinsetzen an d' Straßen. Da kunnt er a Werkstatt einrichten und an Laden auftun. Und wär daheim! Bei mir!«
»Du bist halt einer, Finkenbauer! Was Schöners kann's net geben auf der Welt, als wann Gschwisterleut so eisern zammhalten. Aber sag, was is denn mit der Schwester? Bei der Frau Gräfin in der Münchnerstadt wird s' a schöns Bleiben haben. Net? Und hinpassen tut s' an so a Platzl, d' Hanni? So a feinboanlets Frauenzimmerl! Ich hab mir s' oft gar net anreden traut in ihrem städtischen Gwandl und mit ihrem Muttergottesgsichtl. Wie geht's ihr denn?«
Schweigend, mit ernsten Augen, sann der Bauer vor sich hin. Der Jäger schien keine Antwort zu erwarten. Sein spähender Blick hing an der nahen Scheune, und ein unruhiges Zucken ging um seine Lider. Nun hob er lauschend den Kopf, als möcht' er die Worte des heiteren Gesanges verstehen, der aus der Scheune klang. »Is dös net d' Emmerenz? Die singt a drauflos, als ob s' zahlt werden tät dafür!«
Wie ein Erwachender sah der Bauer auf. »Hätt gmeint, daß du der Enzi ihr Stimm soweit schon kennst, daß d' nimmer drum fragen mußt?«
»Hast gmeint?« Der Jäger machte die Augen klein. »No, weißt, von die paarmal her, wo ich d' Emmerenz im letzten Sommer gsehen hab auf der Alm, da kannst so a Weibsbilderpfeiferl leicht vergessen. Der Winter is lang. Aber wahr is's: a richtiger Vogel hat allweil sein Gsangl. Aufs Dudeln versteht sich d' Enzi!« Der Jäger guckte zum Himmel hinauf, als wäre vom Wetter die Rede. »Wirst auch sonst kein' Grund zum Klagen haben. Wenigstens hab ich d' Emmerenz noch nie net anders gsehn als mit rührige Händ, allweil bei der Arbeit.«
»He, du, warum lobst denn dös Mädel so über'n Schellenkönig?«
»Gar net! Ich red halt, wie alles redt.«
»Geh, tu net so fein!« Schmunzelnd tippte der Bauer mit der Pfeifenspitze über den Zaun hinüber. »Meinst, ich hab's net lang schon gmerkt, daß du der Enzi seit'm Sommer z' Gfallen gehst?«
»Ich?« Der Jäger verzog die Nase und schüttelte den Kopf: »Ah na! Dös Madl hätt mir für mein' Gusto alles z'viel Haar auf die Zähn!«
»Du wärst grad der Rechte, der ihr die Borsten ausrupfen kunnt.«
»Meinst?« Jetzt lachte der Jäger. Dazu klang aus der Scheune die Stimme der Emmerenz:
»Gasselgehn is mei' Freud, Gasselgehn hab ich gern, Wann schön der Mondschein scheint Unter die Stern!
Wann ich kei' Schneid net hätt, Hätt ich beim Tag a Gfrett, Hätt ich bei'r Nacht –«
Das wunderlich zwiegeschlechtliche Liedl brach mitten in der Strophe ab, ein halb erstickter Aufschrei wurde hörbar, dann ein klatschender Schlag und die zornige Stimme des Mädels: »Da hast ebbes, du Schmierbartl, du heimtückischer!« Mit gerunzelter Stirn blickte der Finkenbauer zur Scheune hinüber, aus deren Tor ein Knecht getreten war, der außer dem unsauberen Hemd nur eine verblichene Soldatenhose am Leibe trug. Den Kopf mit den semmelblonden Haaren hielt er zwischen die Schultern gezogen. Das Gesicht mit dem langen Schnurrbart, dessen gedrehte Spitzen bis auf die Brust heruntertrauerten, wäre hübsch gewesen, wenn ihm nicht der schiefe Schnitt der Augen einen Ausdruck von lauernder Verschlagenheit gegeben hätte. Dazu war jetzt die eine Hälfte dieses Gesichtes sehr auffällig gerötet, und der Bursche schien es eilig zu haben, den apfelroten Backen in der dunklen Stalltür verschwinden zu lassen. »Ha! Was hat's denn da geben?« rief ihm der Finkenbauer zu.
»Nix!« brummte der Knecht.
Schon wollte der Bauer erwidern, als ihn ein scharfklingendes Kichern veranlaßte, sich nach dem Jäger umzublicken. Was er in diesen grauen Augen blitzen sah, war die Schadenfreude eines glühenden Hasses. Höhnend rief der Jäger: »Valtl, mir scheint, du hast an linksseitigen Sonnenstich kriegt?«
Der Bursch erwiderte keine Silbe und verschwand im Pferdestall. Durch eine Spalte des Scheunentores klang die streithafte Stimme der Emmerenz: »Gelt, Jager, geh fein du auch in'n Schatten! D' Sonn macht dürr. Schaust eh schon aus wie a Zwetschgen am Nickelstag!«
Und der Jäger antwortete: »Geh, laß dich a bißl anschaun. Mußt ja heut sakrisch sauber sein, weil schon beim Reden so süß bist, als wärst a halbs Jahr lang mit die Immen gflogen.«
»Da kannst recht haben!« klang es aus der Scheune. »Und wann ich vom Honigmachen nix glernt hab, kunnt ich bei die Immen leicht ebbes anders profitiert haben!« Die Worte des Mädels schlugen über in Gesang:
»Der Immenstock steht hinterm Haus, D' Imm fliegen ein und aus, Büaberl, gelt, rühr net dran, Weil der Imm stechen kann!«
Mit einem Jodler entfernte sich die Stimme, während der Jäger zur Antwort sang:
»Daß der Imm stechen kann, Dös schreckt mich weni, Wann der Imm gstochen hat, Laßt er sein' Höni.«
Der Finkenbauer wurde heiter. »So! Schön hin und schön her! Nur allweil lustig, 's Lachen halt d' Leber gsund. Und komm, kehr ein a bißl im Haus, nacher trinken wir a Krügl.«
»Da laß ich mich net nöten! Ich hab allweil an rauchen Hals, der's Netzen vertragen kann.« Der Weg durch die Gattertür mochte dem Jäger als ein zeitraubender Umweg erscheinen. Er sprang mit einem flinken Satz über den Zaun hinüber an die Seite des Bauern. Sie durchschritten den Hof. Als sie um die Ecke des Wohnhauses lenkten, verhielt ein reizvoller Anblick ihren Fuß.
Entlang dem Hause zog sich eine mit Holzplatten gepflasterte, gegen den Hof durch ein Geländer abgesperrte Terrasse. Bis unter das Dach war die Mauer überspannt von einem grünen Lattengitter. An seinen Stäben hatte sich der wilde Wein zu einem dichten Netz verflochten, aus dem schon die jungen, weißgrünen Triebe hervorstachen. Wie glühende Augen aus einem Schleier, funkelten die von der Abendsonne beleuchteten Fenster aus diesem Netzwerk, das ein laubenförmiges Dach über der offenen Tür bildete, zu der drei Stufen aus Backsteinen emporführten. Auf der obersten Stufe saß ein Mädel, das kaum das sechzehnte Jahr überschritten haben konnte. Braune Flechten umrahmten ein feines Köpfl von länglichem Oval. In dem halb kindlichen, halb jungfräulichen Gesicht mit dem schlanken Näschen, dem kirschroten Mund und den runden Wangen paarten sich gesunde Frische und ein leiser Ausdruck von Schwermut. Vielleicht waren es nur die großen Rehaugen, die dem Gesichte diesen Ausdruck verliehen; sie bewegten sich langsam, erzählten von wunderlichen Träumen und waren anzusehen, als hätten sie über alles zu staunen, was ihnen auf ihren langsamen Wegen begegnete. Der schlanke Hals verschwand in dem fransigen, blaßblauen Seidentuch, das um die Schultern geschlungen und über der knospenden Brust hinter das schwarze, mit silbernen Haken besetzte Mieder gesteckt war. Ein dunkelblaues Röckl guckte unter der weißen Schürze hervor. Zu beiden Seiten des Mädels waren kurzgeschnittene Fichtenzweige über die Stufen verstreut, und auf dem Schoße lag ein aus solchen Reisern geflochtener Kranz. Der war zum Schmuck des Brettchens bestimmt, das auf weißem Grunde die schnörkelige Aufschrift ›Willkommen!‹ trug. Dem Mädel zu Füßen saßen zwei pausbäckige, von Gesundheit strotzende Kinder, ein Knabe von fünf und ein Mädchen von sieben Jahren. Als Dritter im Bunde hatte sich der schwarzzottige Hofhund zu dem kleinen Paar gesellt; und wie die beiden lauschenden Kinder, so blickte auch er mit funkelnden Augen zu dem Gesicht des Mädels empor, das seinen zwei Schützlingen von Berggeistern und Waldfeen erzählte, während es mit geschickten Händen gelbe Schlüsselblumen und weiße Schneerosen zwischen die Reiser des fertigen Kranzes fügte. Mit warmen Lichtern spielte die Abendsonne über die liebliche Gruppe.
»Und so hat a jeder Stein sein' eigenen Geist: der Kreidenstein, der Blutstein, der Eisenstein, der Salzstein, der Marmelstein, und überhaupt a jeder, hat mein Vater gsagt!« So hörten Bauer und Jäger das Mädel erzählen. »Die Bäum aber und die Pflanzen und Blümlein, die haben Geisterinnen, wo man Feyen heißt, und die sind sanft und gütig gegen alle Menschen, hat mein Vater gsagt. Die zürnen bloß, wann einer aus Übermut einischneidt in a Bäuml oder so a liebs Blüml zammtritt mit die Füß. Und so gibt's an Almrauschfey, an Enzianweibl und a Steinrautalfin. Grad an einzigs Blüml, dös schöne Edelweiß, dös droben wachsen tut z'höchst auf die Berg, dös hat an Mannergeist, der's hüten tut und schützen. Und dem sein Nam heißt Edelweißkönig. Der hat a freundlichs Gsicht mit blaue Augen, an braunen Bart und braune Lockenhaar. Sein grüner Hut hat a Kranzl von lauter Edelweiß, und 's ganze Gwand is gemacht aus söllene Blümeln. Ja, und so viel sorgen tut er sich um seine Pflanzerl! Lang vor'm ersten Schnee kommt er aus'm Berg aussi und deckt alle Ständerln zu, daß keins erfrieren kann. Im Sommer, hat mein Vater gsagt, wann's lang net gregnet hat und d' Sonn so hinbrennt auf die armen Blümeln, daß schier alle verschmachten möchten, da holt er's Wasser aus die Bäch, damit er seine Pflanzerln gießen kann. Und weil er weiß, wie gern als d' Menschen 's Edelweiß haben, drum führt er alle, die suchen gehn, unsichtbar an die Platzeln hin, wo die weißen Sterndln wachsen. Dieselbigen aber, dö mit die Blümeln allein net zufrieden sind und dö Pflanzen mitsamt die Wurzeln ausreißen, daß an so eim Platz kein Stammerl nimmer wachsen kann, die haßt er bis aufs Blut. Als an Unsichtbarer stößt er s' abi über d' Wand, zur Straf!« Ein tiefer Atemzug schwellte die junge Brust der Erzählerin, deren Stimme sich zu geheimnisvollem Flüstern gedämpft hatte.
Als sie schwieg, rüttelte ein Schauer den Flachskopf des kleinen Lieserls. In dem frischen Gesicht des braunlockigen Buben war keine Spur von Angst zu sehen. Er runzelte nachdenklich die Stirn. Plötzlich warf er das Köpfl auf und sagte: »Du, Veverl! Wie kann man denn wissen, wie er ausschaut und was er tut, der Edelweißkönig? Wann er allweil unsichtbar is?« Drüben an der Hausecke stieß der Finkenbauer in lächelndem Vaterstolz dem Jäger den Ellbogen an die Rippen.
Veverl richtete die großen Augen vorwurfsvoll auf den fürwitzigen Jungen. »Aber Pepperl, wie kannst denn so daherreden!« schalt sie mit einer Stimme, deren ernster Klang ihren Glauben an die Wahrheit dessen verriet, was sie den Kindern erzählt hatte, fast mit den gleichen Worten, in denen es ihr vor Jahr und Jahr zu dutzend Malen der Vater erzählt hatte, im tiefen Bergwald unter rauschenden Bäumen. »So hat mein Vater gsagt!« Das war für ihr kindliches Gemüt ein Argument, das keinen Zweifel duldete. »Allweil is er net unsichtbar, der Edelweißkönig! Er laßt sich schon diemal sehen, aber net vor jedem, der daherlauft auf zwei Füß.«
»Hast ihn du schon gsehen?« fragte das blonde Liesei gruslig, während der Bruder mißtrauisch zwinkerte.
»Aber!« erwiderte Veverl. »Wie kunnt ich ihn denn gsehen haben! Da müßt man doch z'erst sein Königsblüml finden! Mein Vater hat mir erzählt von eim, der ihn gsehn hat, gwiß hundertmal, und was mein Vater gsagt hat –«
»Und mein Vater sagt, es gibt keine Geister net!« fuhr Pepperl dem Mädel in die Rede. Wieder bekam der Jäger den Ellbogen des Finkenbauern zu spüren.
»So, du! Paß auf!« warnte Veverl. »So ebbes därfst net gar so laut sagen. Hast ihn gestern ums Betläuten net schreien hören, den Holiman, droben im Wald: huhu, huhu!«
»Jawohl, Holiman! Dös is doch a Käuzl gwesen!« trotzte Pepperl.
»Was? A Käuzl? Der Holiman is's gwesen! Und wann dein Vater sagt, es gibt keine Geister, so tut er's, daß dich net fürchten sollst. Aber freilich gibt's Geister, gute und böse. Die bösen laßt der Herrgott umgehn zur Sündenstraf, und bloß in der Nacht zu gwisse Stunden kann man s' sehen. Sie können aber keim braven Menschen ebbes anhaben, wenn man s' anruft: Alle guten Geister loben den Herrn.«
»In Ewigkeit amen!« lispelte das Liesei.
»Die guten Geister aber glauben selber an unsern lieben Herrgott und beten zu ihm wie fromme Menschen. Ja, die hat unser Herrgott erschaffen, damit s' ihm Obacht geben auf seine Tierln und seine Berg, auf seine Bäum und Blümeln, weil er selber im Himmel droben mit seine Gnadensachen und mit der Weltregierung soviel z' schaffen hat. Halb sind s' wie d' Engel, weil sie sich unsichtbar machen können, und weil s' überall durchschlupfen, durch Wasser und Feuer, Stein und Holz. Und halb sind s' wieder wie d' Menschen, weil s' Freud und Schmerzen gspüren und lachen und weinen, weil s' Hunger und Durst haben und essen und trinken. Ja, Pepperl, schau, so einer von die guten Geister is der Edelweißkönig. Wann amal groß bist, daß d' auffi kannst auf die Berg, und 's Glück will, daß d' sein Königsblüml findst, nacher kannst ihn rufen. Da siehst ihn mit eigene Augen. Und da bist a gmachter Mann! Wer 's Königsblüml findt, dem kann nix Unguts gschehen. Der kann sich net versteigen und net derstürzen. Wo einer in Gfahr is droben auf die Berg und er ruft den Edelweißkönig an, mit 'm Königsblüml in der Hand, da steht er gahlings da vor eim und hilft eim aus der Not.«
»An was kennt man denn dös Blüml?« fragte das Liesei, dem die Augen glänzten.
»Kennen tut man's leicht! Aber 's Finden? So a Blüml wachst in die Berg grad an einzigs alle Jahr. Wen aber 's Glück dran hinführt, der kennt's auf'n ersten Blick. 's Königsblüml is fünfmal so groß als wie an anders Edelweiß. In der Mitt, da hat's sechs gelbe Schöpferln, wie an anders Sterndl grad an einzigs hat, und rings drum rum, da stehen dreißig bluhweiße Strahlen.«
»Dös muß aber schön sein!« seufzte das Lisei, während Pepperl unternehmungslustig hinaufspähte zu den schneebedeckten Gipfeln der Berge, als erginge er sich in stillen Plänen, wie und wo er die Königsblume suchen wollte. Dabei fragte er: »Is dös wahr? Gibt's da droben so a Blüml?«
»No freilich!« scholl von der Hausecke die Stimme des Jägers. Die Kinder fuhren erschrocken zusammen, während der Hofhund dem Jäger mit Gebell entgegenstürzte. »No freilich is wahr, du kleiner Thomasl du! Ich hab selber schon eins gfunden, so a Blüml, ja! Schad, daß ich dir's nimmer zeigen kann. Ich hab's am Hut tragen, und da hat mir's der Wind abigweht über d' Wänd, daß ich's nimmer finden hab können.« Er wandte sich an Veverl, die ihn mit einem Blick betrachtete, als möchte sie aus seinem Gesicht ergründen, ob er scherze oder die Wahrheit spräche. »Schön kannst verzählen, Veverl! Dir möcht ich zuhören ganze Stunden lang.«
Veverl errötete und reichte dem Jäger die Hand, die in dieser braunen Tatze völlig verlorenging. Schüchtern beantwortete sie die Frage, wie sie sich auf dem Finkenhof eingewöhnt hätte – gut natürlich! Auch an die Kinder richtete der Jäger noch ein paar lustige Worte; dann stellte er den Bergstock an die Wand, trat mit dem Bauer ins Haus und fragte auf der Schwelle: »Wie lang lauft denn 's Faßl im Keller schon?«
»Seit der Brotzeit erst.«
»Brav, mei' durstige Seel! Jetzt schau nach aufwärts! Da kommt ebbes.«
2
Als die beiden die geräumige Stube betraten, die den Wohlstand ihrer Bewohner verriet, sagte der Jäger: »A saubers Madl, 's Veverl! Die wachst sich aus!«
»Und Arbeit brauchst ihr keine schaffen, alles schaut s' eim von die Augen ab. Für alles hat s' an Dank, und völlig drauf sinnieren tut s', wie s' eim a Freud machen kann. Zu die Kinder stellt sie sich besonders gut. Wann s' nur net gar so voller Gschichten stecket! Jeden Tag verzählt s' dem Paarl söllene Sachen, wie grad jetzt eine ghört hast.«
»Dös mußt ihr net wehren!« Der Jäger legte Gewehr und Rucksack auf die den Kachelofen umziehende Holzbank. »An söllene Sachen haben Kinder ihr Freud. Dös macht ebbes lebendig in ihrem Gmüt. Da profitieren s' mehr als in der Schul. Kommt man ins richtige Alter, so weiß man, was man von söllene Sachen halten muß. Und lacht man drüber, 's Gute davon bleibt deswegen doch: daß man an Sinn hat für alles, was überm Gartenzaun draußen wachst.«
»Ich red net dagegen. Aber es wär für d' Vevi an der Zeit mit 'm richtigen Alter. Die glaubt an ihre Gschichten so fest wie an unsern Herrgott.«
»Is gscheiter, als wann s' eine von die Aufgeklärten wär, die sich mit vierzehn Jahr schon Wulsten in d' Röck einipoistern, 's Mieder ausspreizen und d' Strümpf auf der Ruckseit mit siebenfacher Woll stopfen. Und a gschickts Dingl muß dös Madl sein! Dös hab ich an ihrem Kranzl gsehen. Gelt, der Willkomm is für 'n Ferdl grechnet?«
Der Bauer schüttelte den Kopf, während er den Tisch rückte, um dem Jäger einen bequemen Weg in den Herrgottswinkel zu schaffen. »s Veverl hat meiner Mariann a Freud machen wollen.«
»Die Bäuerin is auf der Reis'?«
»Nach der Münchnerstadt!« erwiderte der Bauer zögernd. »Unser Hanni hat in der letzten Zeit allweil so sinnierliche Brief gschrieben. Ich hab mich a bißl gsorgt. Da hab ich zur Mariann gsagt: ›Fahrst eini in d' Stadt und gehst hin zur Gräfin. Bei so was reden sich d' Weiberleut allweil besser mitanander. Und erfahrst ebbes‹, hab ich gsagt, ›was dir net taugt, so mach kurzen Prozeß, pack 's Madl zamm und bring 's mit heim.‹« Draußen eine trällernde Stimme. »Du! Hörst!« Der Bauer ging zur Tür und rief in den Flur hinaus: »Enzi!«
»Was schafft der Bauer?« klang's von der Küche her.
»Komm a bißl eini! Der Eberl-Gidi hockt bei mir!«
»Soll ich ihm leicht d' Füß heben, daß er besser sitzt?«
»Geh, sei net so hantig!« brummte der Bauer. »Komm eini!«
Die Emmerenz erschien unter der Tür, eine Gestalt von gesunden Formen. Der graue Lodenrock zeigte die nackten, auffallend kleinen Füße. Das dunkelbraune Tuchleibl umspannte straff die festen Brüste. Dem groben, kurzärmeligen Hemde waren hoch am Hals mit roter Wolle zwei Buchstaben eingemärkt, E. und B., darunter eine Zahl, die verriet, daß Enzi vor fünfundzwanzig Jahren das Licht der Welt erblickt hatte. Der mollige Hals trug einen kugelrunden Kopf, über dem das rotblonde Haar mehr praktisch als gefallsüchtig zu einem dicken Knoten zusammengewirbelt war. Das Gesicht mit den vollen Lippen, zwischen denen die weißen Zähne blitzten, mit der keck aufgestumpften Nase und mit den Blauaugen unter den starken, lichten Brauen konnte sonst den Eindruck gemütlichen Frohsinns machen. Jetzt waren die gespannten Nasenflügel streitbar gehoben, und unter der gerunzelten Stirn schauten die Augen mit einem verdrossenen Blick in die Stube. »Also, was soll's?« fragte sie kurz, während sie die nassen Hände an der blauen Schürze trocknete.
»An grausamen Durst haben wir alle zwei, der Bauer und ich«, rief ihr der Jäger zu, »sollst uns ebbes herschaffen zum Abkühlen.«
»A Wasser?«
»Mar' und Josef! Du meinst es gut mit mir! A Wasser mag ich net amal in die Schuh haben, viel weniger im Magen.«
»'s Wasser macht hell in die Augen.«
»Aber dumm im Kopf.«
»Kunnt dir net schaden, weil d' allweil meinst, daß d' gar so gscheit bist!«
»Mei' Gescheitheit kannst dir gfallen lassen. Dö sagt mir, wie schön als bist!«
»Schön bin ich net, aber gsund. Und grob kann ich auch sein, wann ich merk, daß mich einer föppeln will.«
»Geh weiter«, unterbrach der Bauer lachend den Streit, »hol uns a paar Krügeln Bier auffi aus'm Keller!«
»Und laß dein' Zorn über mich net beim Einschenken aus!« rief Gidi dem Mädel nach, das wortlos die Stube verließ.
»Mußt ihr doch amal den Hamur ausbügelt haben?« forschte der Bauer. »Weil s' gar so igelborstig is mit dir?«
»Na, da weiß ich nix davon!« beteuerte Gidi, dachte aber dabei an eine Morgenstunde des verwichenen Sommers, in dem die Emmerenz, nachdem sie auf dem Finkenhof in Dienst getreten war, die Brünndlalm auf dem Höllberg bezogen hatte.
Der Bauer guckte zum Fenster hinaus und sah nach der Uhr. »Ich kann mir gar net denken, warum d' Mariann so lang ausbleibt. Es ist schon fünfe vorbei.«
»Soll die Bäuerin heut noch heimkommen?«
»Ich hab den Dori mit'm Wagen einigschickt in d' Station. Um viere kommt der Zug.«
»Da können s' noch gar net dasein. In einer Stund fahrt man so an Weg net.«
»Mit meine Roß aber schon! Wann ich nur an andern gschickt hätt als 'n Dori. Der Bub, der lacklete, hat sein' langohreten Hirnkasten allweil voll mit Unfürm. Hoffentlich hat er mir den Wagen net umgschmissen!«
»Aber Bauer! Wart halt noch a halbs Stündl und mach dir keine überflüssigen Sorgen!«
»Ich weiß schon, ich bin allweil a bißl übertrieben bei so was!« erwiderte der Bauer ruhiger. »Auf d' Mariann kann ich mich auch verlassen. Die is wie d' Uhr, die geht auf d' Minuten. Die verhalt sich net, weil s' weiß, was ich für a sorgsames Gmüt hab. Aber der Dori halt, der Dori! Kein Tag vergeht, wo er net ebbes anstift. Ich bin ordentlich froh, wenn er wieder droben is auf der Alm.«
»Schickst ihn auf d' Brünndlalm wieder auffi als Hüterbub?« fragte der Jäger, als Emmerenz die Stube betrat, in den Händen zwei Steinkrüge, von denen der weiße Schaum in Flocken niedertroff.
»Ja freilich!« erwiderte der Bauer und zwinkerte mit den Augen. »Aber d' Sennern muß ich wechseln. Ich schick statt der Enzi die alte Waben auffi.«
»Was!« fuhr Gidi auf. »Die zahnluckete Hex willst mir vor d' Nasen hinsetzen, statt –« Er sprach den Namen nicht aus. Für den Fortgang der Unterhaltung sorgte die Emmerenz. Sie setzte die beiden Steinkrüge so energisch auf die Tischplatte, daß die zinnernen Deckel ein Hupferl machten. »Bauer! Von der Brünndlalm willst mich fortschaffen? Von meim liebsten Platzl auf der Gotteswelt? Warum denn? Hab ich deine Küh net heimbracht von der Alm, daß dich spiegeln hättst können in ihrem Glanz? Und zum Dank dafür –« Die Stimme schlug ihr um. »Bauer, wann mir so ebbes antust, kannst mich lieber gleich aussifegen aus'm Dienst.«
»No, no, no!« begütigte der Finkenbauer mit gut gespieltem Ernst. »Ich hab dir's zum Besten gmeint. A Katzensprüngl von der Brünndlalm steht d' Höllberg-Jagdhütten. So a jungs Madl und so a schneidiger Jager? A Dienstherr muß auf alles denken.«
Kichernd duckte Gidi den Kopf. Emmerenz aber fuhr auf wie eine gereizte Wölfin: »So? Jetzt is gut! Gelt, Bauer, verstrapazier dir 's Köpfl wegen meiner Unschuld net! Ich kann mich selber hüten. Gar vor so eim windigen Jagerlippl! Dös kunnt er selber schon gmerkt haben!«
»Aber Enzi!« mahnte der Jäger, während der Bauer lachend seine Nase in seinen Krug steckte. »Merkst denn net, daß dich der Bauer a bißl bei der Falten hat?«
»Laß mich aus, gelt!« schnauzte ihn das Mädel an. »So was kann man haben bei deiner sauberen Bekanntschaft, du –« Sie schien nach einem Wort zu suchen, das ihrer Entrüstung gleichgewichtig wäre, und fand keines, das den nötigen Zentner wog.
»So mußt net reden!« Der Jäger hatte Mühe, seine gute Laune festzuhalten. »Da, nimm lieber den Krug und stich an! A richtiger Trunk macht jede Menschengall sanftmütig.«
»Trink dein Bier selber!«
»Du! Beleidigen därfst mich deswegen net!«
Emmerenz sah betroffen auf; aus dem Klang dieser Worte hatte sie einen Ton gehört, der ihren Ärger beschwichtigte; und als sie gewahrte, wie dem Jäger die Adern an den Schläfen schwollen, griff sie wortlos nach dem Krug und setzte ihn zu kräftigem Trunk an die Lippen. Je fester sie schluckte, desto freundlicher wurde das Gesicht des Jägers. Als er den Krug aus Enzis Händen nahm und ihn fast zur Hälfte geleert fand, sagte er heiter: »Hast an saubern Zug! Drum zieht's mich halt auch so hin zu dir.«
»Wird dich schon wieder wegziehen auch!« brummte das Mädel und ging zur Tür. Hier traf sie mit Veverl zusammen, die den Bauer in den Hof hinausrief, um den vollendeten Schmuck der Haustür zu betrachten. Inzwischen vertiefte Gidi sich in seinen Krug, an dessen Rand er sich mit gewissenhafter Forschung die von Enzi benützte Stelle ausgesucht hatte. Dann folgte er dem Bauer. Gerechtermaßen bestaunte er das schmucke Aussehen der Tür, als auf der Straße Räderrollen und Hufschlag nähertönte. Jetzt ein hallendes Peitschenknallen. »Vater! Dös is der Dori! Ich kenn ihn am Schnallen! D' Mutter kommt!« jubelte Pepperl und rannte zum Tor. Das Liesei klammerte sich an den Arm des Bauern: »Vater? Kommt d' Hannibas mit?«
»Aber Dapperl, man sieht ja den Wagen noch net.«
Valtl war aus dem Stall gekommen und hatte das Einfahrtstor geöffnet. Jetzt trabten um die Hausecke des Nachbargehöfts mit wehenden Mähnen die zwei prächtigen Rappen. Dann sah man den Dori mit der schnalzenden Peitsche und die Kutsche mit dem schwarz glänzenden Lederzeug. »Ja heiliger Gott«, stammelte der Finkenbauer, »der Wagen is ja leer! Da hat's ebbes geben!«
Ohne den Lauf der Pferde zu mäßigen, lenkte Dori in tadelloser Kurve das schmucke Gefährt in den Hof, wo er das Gespann zum Stehen brachte. Unter dem Einfahrtstor hatte Pepperl sich an die Kutsche gehängt, und so war er nun der erste, der vor Dori stand, mit der Frage: »Du, wo is denn d' Mutter?«
»Wahrscheinlich in ihrem Unterrock!« Dori nahm den grünen Spitzhut ab. Dieser siebzehnjährige Bursch war eine sonderbare, fast unglaubhafte Menschenerscheinung. Mit dem kurzen, kugeligen Leib, den langen Armen und den mageren, knochenstelzigen Beinen, deren Gabel sich gleich unter dem Schlüsselbein auseinanderzuspalten schien, sah er einer aufrecht wandelnden Riesenspinne ähnlich; dieser Eindruck wurde noch unterstützt durch die gaukelnde Bewegung, in der sich seine Arme und Beine fortwährend befanden; das sah sich immer an, als möchte er irgend etwas von einem hohen Schrank herunterfangen. Man konnte sich die Notwendigkeit dieser Bewegung erklären, wenn man die qualvoll engen, aus einem braun und grau karierten Stoff gefertigten Beinkleider und die spannenden Falten des schwarzen Jankers betrachtete, der dem Burschen kaum bis zu den Hüften reichte; an die Ärmel, die bei jeder Bewegung zu platzen drohten, waren zinnoberrot gefütterte Aufschläge angestückelt; der lange Hals war umwunden von einem rot und weiß gesprenkelten Tuch, dessen Zipfel scharf hinausstachen über die Schultern. Die rotbraunen Haare waren bei reichlicher Pomade glatt um die abstehenden Ohren gebürstet. In dem braunen, häßlichen Gesicht mit der breiten, sanguinisch nach aufwärts geschwungenen Maulkurve und den lustig vorstupfenden Backenknöcherln war ein ruheloses Zwinkern und Blinzeln. Wenn der Dori dazu die Stim runzelte, rührte sich die ganze Kopfhaut mit dem kleinen Hut, und die Ohrmuscheln gerieten in eine Bewegung gleich den Löffeln eines Hasen, der den nahenden Jäger wittert. Mit forschendem Blick studierte Dori den näher kommenden Bauer; er fürchtete wohl, daß sein Herr die wenig ehrfurchtsvolle Antwort gehört haben könnte, die er auf Pepperls Frage gegeben hatte. Als er aber aus dem Mund des Bauern nichts anderes hörte als nur die erregte Frage, weshalb er allein zurückkäme, war alle Scheu wie weggeblasen, und in wortreicher Geschäftigkeit, mit Händen und Füßen redend, erzählte er den Verlauf seiner Fahrt. »Und wie der Zug einigfahren is in d' Starzion, da hab ich allweil gschaut und gschaut. D' Augen hab ich gstellt – so kann der Schneck seine Hörndln net fürischieben. Aber d' Leut alle sind aussikommen, der Zug is wieder furtgfahren, als müßt er vorm Tuifi davonsausen, und allweil war noch kei' Bäuerin beim Zeug. Da hat mir einer d' Roß ghalten, und ich bin selber in d' Starzion eini. Überall, wo a Türl aufgangen is, in alle Buriauxen und Wartsaaler hab ich 's Nasenspitzl einigschoben, aber von unserer Bäuerin hab ich nix ghört und nix gsehen.«
Schweigend wandte sich der Finkenbauer von dem Burschen ab und ging kopfschüttelnd der Haustür zu.
Emmerenz fuhr scheltend auf Dori los: »Du Lalle, du dummer! Was mußt denn nacher so lustig knallen, wann d' allein kommst!«
»Jawohl, ich soll einifahren wie a hölzernes Manndl!« schnatterte Dori. »Wann ich fahr, müssen d' Leut ans Fenster springen und schauen! Und sie haben weiters net gschaut! Fixsakrawolt, auf a halbe Stund hinter meiner is allweil noch der Staub aufbrudelt. So bin ich gfahren!«
»So gfahren, ja, daß d' Roß dämpfen wie frisch gsottene Erdäpfel.« Mit der strengsten Amtsmiene, die sie als Fürmagd aufzuziehen wußte, fügte sie bei: »Da kann sich jetzt der Knecht wieder hinstellen vor die armen Viecher und mit'm Strohwisch rippeln, bis er Blasen kriegt an die Händ!«
»Du?« fiel Gidi stichelnd ein. »Is dir denn gar so drum z' tun, daß der Valtl weniger Arbeit hat?«
Emmerenz würdigte ihn keiner Antwort, sondern ging zum Gesindehaus hinüber, wobei sie was murmelte von »dreinreden« und »nix angehen«. Gidi schickte ihr einen Blitz seiner grauen Augen nach und musterte den Valtl. Der bemühte sich, ein harmloses Gesicht zu zeigen. »Du, Jager, was is«, wurde Gidi in seiner Beobachtung durch Dori unterbrochen, »hast net a paar Hirschgranln oder an Adlerklau? Weißt, zum Anhängen an d' Uhr?«
»Hast ja gar kei' Uhr net.«
»Na! Aber ich laß mich heuer a zweitsmal firmeln, nacher krieg ich schon eine. Mein erster Godl hat mir zum Firmgeschenk bloß an verdorbenen Magen kauft. A ganze Nacht lang sind mir die sauren Pfingsttäuberln aussigfahren aus der schmerzhaften Seel.«
Gidi lachte und folgte dem Bauer in die Stube. Um den Finkenjörg zu beruhigen, führte er alle Möglichkeiten an, die ihm einfielen. Immer schüttelte der Bauer den Kopf. Er kannte seine Mariann, und sie kannte ihren Jörg und seine ›sorgsame‹ Natur. Da gab's kein Versäumen des Zuges. Wenn seine Mariann gesagt hatte: zu der und der Stunde komm ich, dann kam sie auch, oder –
»Aber geh, warum machst dir denn 's Herz so schwer! Was soll denn deiner Bäurin geschehen können? So a verständigs, achtsames Weiberleut!«
»Mei' Mariann, freilich! Was soll denn meiner Mariann geschehen? Aber – allweil in der letzten Zeit is mir's fürgangen: Bei der Hanni is ebbes net sauber in ihrem Gmüt! Ich kenn s' ja! Wann s' da amal ebbes drin hat – sie müßt mei' Schwester net sein –, da gibt sie's nimmer her. Hättst nur ihre gspaßigen Brief lesen sollen! Und am End kann ich net alles sagen, was ich mir denk.« Seufzend schob sich der Bauer hinter den Tisch, an dem der Jäger saß, stützte die Arme auf und legte den Kopf zwischen die Fäuste. »Hätt ich nur 's Madel net fortlassen im Herbst. Aber wie's halt kommen is! Wann so a fürnehme Frau vor eim dasteht und allweil redt und redt, da mußt am End ja sagen. An d' Hanni selber hab ich halt auch a bißl denkt. Es is halt amal so kommen. Weißt es ja selber!«
Der Jäger nickte; er wußte das freilich; während der sechs Jahre, die er im Dorfe lebte, hatte er's zum Teil mit angesehen, wie das gekommen war. Und was jener Zeit vorausgegangen, hatte er aus dem Gespräch der anderen erfahren. Viel des Guten hatte er dabei über die selige Finkenbäuerin gehört, die an dem Tage dahingegangen war, an dem sie der Hanni das Leben geschenkt hatte. Wenige Wochen später waren dem alten Finkenbauer, dem man nach seinem Aussehen hundert Jahre hätte prophezeien mögen, von einem schlagenden Pferd die Rippen der Herzseite zerschmettert worden; lange Monate mußte er in schwerem Siechtum liegen, ehe der Tod ihn erlöste. Von ihm hatte Jörg, der damals bei seinen dreiundzwanzig Jahren schon ein festes Mannsbild war, als der Erstgeborene unter den fünf Geschwistern das Regiment auf dem Finkenhof mit kräftigen Händen übernommen. Gleich im ersten Jahr seiner Herrschaft kam schwere Kümmernis über den jungen Bauer. Es schien, als hätte der Tod in dem freundlichen Hause sich heimisch gefühlt. Noch trauerte Jörg um die Eltern, da mußte er auch die beiden Geschwister zu Grabe tragen, die im Alter zwischen ihm und Ferdl standen; in der gleichen Woche waren sie an den schwarzen Blattern gestorben. Als die Krankheit bei ihnen ausgebrochen war, hatte Jörg die zwei jüngsten Geschwister aus dem Haus gegeben. Seinen ›Ferdlbuzzi‹, ein Bürschl von sechs Jahren, hatte er zu einem Verwandten der Mutter gebracht, in ein fünf Stunden vom Dorf entferntes Gehöft. Ehe noch eine Woche vergangen war, erschien eines Abends der Bub im Finkenhof, allein, verstaubt, triefend von Schweiß – »ganz verlechznet und derlegen«, wie der Finkenbauer zu erzählen pflegte, wenn er auf diese Geschichte zu sprechen kam. »Und weißt, was er gesagt hat, der kleine Loder, wie ich ihn ordentlich angfahren hab: warum er durchbrennt wär bei die Vettersleut? Da hat er aufgschaut zu mir mit nasse Augen. Grad gstößen hat's ihn, wie er gsagt hat: ›Ich hab's nimmer ausghalten, weil's mich so blangt hat nach meim Jörgenbruder!‹ – Da hab ich ihm a Bussel auffidruckt, dös er gspürt hat vierzehn Täg! Und seit der Stund is dös Bübl mein Auf und Nieder gwesen!«
Dieser Geschichte pflegte der Finkenbauer in lächelndem Bruderstolz die Vermutung beizufügen, daß wohl auch sein Hannerl so zu ihm gelaufen wäre, wenn es damals überhaupt schon hätte laufen können. Das Kind hatte in jenen Tagen eine ›hochwürdige Unterkunft‹ gefunden. Die alte Schwester des Pfarrers, die das Kind aus der Taufe gehoben, hatte es zu sich in den Pfarrhof genommen, und da wurde das liebe Ding in kurzer Zeit die lachende Sonne des sonst so stillen Hauses, der gehätschelte Liebling des hochwürdigen Herrn und seiner Schwester. Als dann der Finkenhof wieder rein war von dem bösen Odem jenes finsteren Gastes, entspann sich zwischen Jörg und der Schwester des Pfarrers ein hartnäckiger Kampf; der eine wollte das Kind bei sich im Haus haben, die andere wollte den Liebling nicht aus ihrer Pflege entlassen. Und Jörg war es, der nachgab. Er mußte sich sagen, daß er selbst bei aller Liebe das Kind nicht warten konnte und ihm eine fremde Person halten müßte. Die würde dem Kinde nicht jene Fürsorge widmen, deren es bei der Pfarrschwester sicher war, die es liebte wie eigenes Blut. So verblieb Hannerl im Widum; täglich wurde es in den Finkenhof zu Besuch getragen, bis es diese Besuche auf eigenen Füßen abzustatten vermochte; an Grobwettertagen und auch sonst an manch einem Abend kam Jörg mit dem munter sich streckenden Ferdl auf ein Plauderstündchen in den Pfarrhof, und niemals kam er, ohne dem Kind einen Leckerbissen oder ein Spielzeug mitzubringen.
Die Jahre vergingen, und aus dem Hannerl wurde ein liebliches Mädchen, dem alle Bewohner des Dorfes gut waren, obwohl sie es bald nicht mehr als ihresgleichen betrachteten, sondern ihm eine respektvolle Behandlung angedeihen ließen, als wär' es ein Kind ›fürnehmer‹ Leute. Vielleicht lag die erste Ursache dazu nur in der städtischen Kleidung, die das Mädchen auf Anordnung seiner Patin zu tragen bekam; bald aber fanden sich weitere Ursachen hiefür in der Art, in der sich Hannis Wesen entwickelte. Der alte Pfarrer, ein gebildeter Mann, der außer dem Katechismus auch andere Bücher nach ihrem Werte gelten ließ, hatte seinen Liebling auch zu seiner Schülerin gemacht. Dadurch kam es, daß Hanni bald in allem und jedem ihre Altersgenossinnen überragte, in denen die Scheu jede gespielsame Vertraulichkeit erstickte. So sah sich das Mädchen in den Ferienwochen und Freistunden auf den Verkehr mit ihrem Bruder Ferdl beschränkt, der mit einer abgöttischen Verehrung an seiner Schwester hing. Wenn sie kam, warf er Holz und Messer in die Ecke, diese beiden Dinge, die ihm schon in der Schulzeit über Tafel und Griffel, über Essen und Trinken gingen. Späterhin fand das Mädchen noch einen zweiten Gespielen in dem jungen Grafensohn aus dem Schlosse droben, einem hübschen, schlank gewachsenen Knaben. Von der Stunde an, in welcher Luitpold mit seinen Eltern auf dem Kastell zur Sommerfrische eintraf, war er von Ferdl unzertrennlich, tobte und tollte mit ihm, ließ sich von ihm leiten und verführte ihn auch selbst zu kecken Streichen, die stets, wie sie auch ausfallen mochten, an Jörg einen lächelnden Verteidiger fanden. Der junge Bauer war stolz auf den ›nobligen Umgang‹ seines Herzbuben. Doch wenn man den Verkehr der beiden Knaben in ihrem Zusammensein mit ›Hannchen‹, wie Luitpold das Mädchen nannte, genauer beobachtete, mochte es fast den Anschein gewinnen, als pflege das junge Herrchen die Kameradschaft mit dem Bauernsohn viel mehr um der Schwester willen, die in seiner Sprache mit ihm redete und seine Gedanken mit ihm dachte.