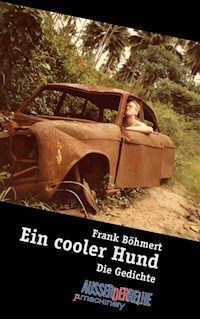Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aber: "Ich habe nie verstanden, warum noch keiner seine Storys mal gesammelt rausgebracht hat." Klaus N. Frick Nun: "Immer wenn man glaubt, diesen Schriftsteller durchschaut zu haben, zertrümmert er jegliche Erwartungen mit geradezu erschütternder Beiläufigkeit." Hannes Riffel Also: 24 beste Geschichten aus knapp 30 Jahren, quer durch Böhmerts Schaffen und über alle Genregrenzen hinweg. Unterhaltsam, eindringlich, romantisch, abgebrüht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Böhmert
Ein Abend beim Chinesen
Beste Geschichten
AndroSF 6
Frank Böhmert
Ein Abend beim Chinesen
Beste Geschichten
AndroSF 6
Die Rechtschreibung folgt, es muss ja nicht immer der Duden sein, dem Wahrig Deutsches Wörterbuch von 1997. Soweit die Schreibung dem Autor recht war, versteht sich.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© der Printausgabe: Dezember 2009, dieser Ausgabe: Mai 2016
Frank Böhmert & p.machinery
Titelbild: anegada, clipdealer.de
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 8391 0096 7
(nur noch antiquarisch lieferbar)
Frank Böhmert
Ein Abend beim Chinesen
Beste Geschichten
Fußstapfen in der Zeit
»Mein Ort. Meine Welt. Meine Galaxis.«
»Berlin ist riesig. Berlin wimmelt von Menschen. Berlin ist unübersichtlich. Ich bin in Berlin geboren, aber es fällt mir nicht schwer, mich hier mit dem Fahrrad zu verfransen und in einer Gegend zu landen, die ich im Leben noch nicht gesehen habe. Berlin ist arm. Das ist von Vorteil, weil die Stadt dadurch nicht genug Geld hat, alles Unkraut, alles Ungeziefer, allen Unrat zu entfernen. Dadurch hat Berlin immer wieder wilde bzw. verwilderte Ecken. Und die liebe ich. In Berlin gibt es tausend Subkulturen, die du aufsuchen kannst. Berlin ist ein hartes Pflaster, manchmal zu hart. Aber in keiner deutschen Stadt gibt es so viele Orte, an denen du relativ frei sein kannst. In keiner deutschen Stadt hast du diese Chance, Leute zu finden, die zu dir passen, und wenn du fünfmal ein Außenseiter bist. Ich sage manchmal, ich bin ein Dörfler, der zufällig in Berlin geboren worden ist. Ich bin nie weiter als vielleicht fünf Kilometer von der Straße weggezogen, in der ich geboren worden bin. Ich steh auf Natur, auf wilde Natur, und Berlin hat so viele ökologische Nischen zu bieten.«
Frank Böhmert in einem Interview im März 2003
Braucht eine Storysammlung wie diese ein Vorwort? Oder, grundsätzlicher, braucht die Welt noch ein Buch mehr, in diesem Fall eben die Storysammlung des Berliner Schriftstellers und Übersetzers Frank Böhmert? Zugegeben, seine wenigen Ausflüge in das Perry-Rhodan-Universum haben bewiesen, dass der Mann nicht nur erzählen kann, sondern dass er auch etwas zu sagen hat. Aber ist es deswegen zwingend, das eh schon leidgeplagte Lesepublikum (und, nicht zu vergessen, unsere Umwelt) mit einer Anhäufung seiner Geschichten aus knapp drei Jahrzehnten zu belasten?
Diese und andere, weder für mich noch für Herrn Böhmert besonders schmeichelhafte Gedanken plagten mich, als ich mir überlegte, ob ich mich darauf einlassen sollte, die zwei Dutzend Kurzgeschichten, die da in Form von Ausdrucken auf Recyclingpapier vor mir lagen, zu lesen und mit einer Einleitung zu versehen.
Nun, die Tatsache, dass Sie dieses Buch in Händen halten und dieses Vorwort lesen (wobei nun wiederum Sie sich fragen können, was Selbiges eigentlich soll), nimmt das Ergebnis meiner Überlegungen bereits vorweg. Ein Abend beim Chinesen mag ein zusammengewürfelter Haufen von Storys sein, die Frank Böhmert aus subjektiven Gründen der Überlieferung an die Nachwelt für wert erachtet hat. Aber sie verbindet eines: Sie sind alle äußerst lesenswert, und sie rufen uns ins Gedächtnis, wozu gelungene Erzählungen in der Lage sind – sie unterhalten uns, das ja und vor allem, aber sie verfremden auch, was wir für gegeben hinnehmen, und liefern uns damit Stoff zum Nachdenken.
Nehmen wir beispielsweise die Geschichte, die diesen Band eröffnet. »Der Baum beim Blutbunker« ist bestimmt nicht der anspruchsvollste oder gelungenste Text auf den folgenden Seiten, aber er schildert aufs Eindringlichste Ereignisse, die echt sind – echt nicht unbedingt im Sinne von genau-so-passiert, sondern eher im Sinne von »ja, so etwas Ähnliches habe ich auch erlebt, so war das damals«. Damals, in einem keinesfalls unschuldigeren, sondern mehr von vielfältigen Verwirrungen geprägten Alter, in dem Mann (von Frau kann ich nicht reden, die kamen damals viel zu wenig vor) hauptsächlich – und verzweifelt – versucht, seinen Spaß zu haben, ohne sich dabei allzu auffällig zu blamieren. Was einem, im Nachhinein betrachtet, scheißschlecht gelungen ist, aber das merkte man in jener Zeit glücklicherweise meist nicht. Oder wenn, dann jedenfalls nur in Form dieses sonderbaren Gefühles in der Magengegend, dass hinter den Dingen doch noch mehr sein müsse, das könne doch noch nicht alles gewesen sein.
Was da mehr hinter den Dingen lauert, bringt der »Blutbunker« aufs Schönste auf den Punkt und erinnert mich noch ganz nebenbei an die Stunden, die ich als 13jähriger (oder so) mit meinem damaligen besten Freund Uwe zugebracht habe, während wir uns den Inhalt des neusten Macabros-Heftchens erzählten. Karo (siehe Seite 11) kann das bestimmt gut nachvollziehen. Und Frank auch.
Oder die Geschichte mit dem wunderschönen Titel »Love Bug«, ein durch und durch romantischer Text, der trotzdem nicht verlogen ist. Auch hier wieder: Oje, was haben wir damals alles nicht gerafft – zum Glück, denn was wäre uns sonst entgangen!
Völlig anders »Wie ein Adler«, eine stilistisch ebenso gewagte wie gekonnte Endzeitgeschichte, bei der der Autor nicht nur alle Register zieht, sondern auch, ohne zu blinzeln, die Konsequenzen aus den ganzen nostalgisch verbrämten Zukunftsvisionen, in denen trotz aller Katastrophen dann doch alles irgendwie gut wird. Wäre vielleicht ein wirklich lohnendes Experiment, aus diesem Stoff einen Roman zu machen.
Völlig anders kristallisiert sich dann auch als einziges übergreifendes Prinzip dieser Storysammlung heraus. Immer wenn man glaubt, diesen Schriftsteller durchschaut zu haben, zertrümmert er jegliche Erwartungen mit geradezu erschütternder Beiläufigkeit. Oder hätte irgendjemand, bei Story Nummero zwölf angekommen, mit einer so gewieften Vignette wie »Als Raucher unter Linken« gerechnet? Mit einer so abgebrühten Konfrontation mit der Einsamkeit wie »Die Welt, von Türmen aus betrachtet«, die eigentlich von einem deutlich älteren Autor stammen müsste? Mit Arbeitsweltpersiflagen wie »Die Hubschrauber« und »Das Lager«, beides längere Texte, die zeigen, dass Frank wohl so manches am eigenen Leib erfahren hat?
Mich jedenfalls hat dieser Stapel Papier, den ich da anfangs noch recht skeptisch, dann immer begeisterter zerlesen habe, immer aufs Neue kalt erwischt. Und mit jeder Story wuchs meine Überzeugung: Ja, daraus muss tatsächlich ein Buch werden. Denn hier bestätigt ein Schriftsteller, der im Jetzt lebt, in unserer Zeit, was kluge Leser von Science Fiction wissen, was jedoch nur selten überzeugend umgesetzt wird: Über die Zukunft schreiben, schreibend verfremden, sich das Phantastische nutzbar machen, um das Alltägliche auszuleuchten, gehört zu den besten Strategien, um die Gegenwart realistisch abzubilden, um sich über uns selbst klar zu werden.
Und außerdem kann es, wenn der Schreiber sein Handwerk versteht, verdammt vergnüglich sein. Wie Frank mit jeder einzelnen der in Ein Abend beim Chinesen enthaltenen Geschichten unter Beweis stellt.
(Braucht eine Storysammlung wie diese ein Vorwort? Unbedingt! Und wenn es nur dazu taugt, meinen Namen in diesem großartigen Buch gedruckt zu sehen …)
Hannes Riffel
im Mai 2009
Der Baum beim Blutbunker
Es war längst Nachtruhe im Schullandheim. Die anderen Jungen in dem Sechsbettzimmer schliefen schon. Karo lag mit seiner Taschenlampe oben im Etagenbett und verschlang sein neuestes Mystery-Heft, Purgator der Folterer.
Er war gerade bei der Stelle, als der Katzenmensch Purgator sich endlich gegen seinen bösen Herrn auflehnte, den Grafen Grambor-Zuli, da fiel ihm auf, dass er das Heft fast ausgelesen hatte. Karo blätterte vor. Nur ein paar Kapitel noch! Hollerdipoller!
Rasch verstaute er Brille, Heft und Taschenlampe am Fußende, kuschelte sich in die dünne Schullandheimdecke und schloss die Augen. So war es immer am gruseligsten – wenn man das Ende nicht kannte und dann einzuschlafen versuchte! Dann hörten sich die kleinen Nachtgeräusche auf einmal ganz anders an, und wenn man Glück hatte, sah man schlimme Dinge in den Schatten. Und träumte später davon, wie die Geschichte weiterging …
Er nickte langsam ein. Wie es wohl war, ein Fell zu haben und ausfahrbare Krallen? Und einfach so, zackzackzack, einen Baumstamm hochklettern zu können?
Er schmatzte und kuschelte sich zurecht, und dann rutschte ihm die Bettdecke weg. Er griff nach ihr, aber sie rutschte noch weiter weg, und als er sich hinterherdrehte, stürzte er über den Bettrand ins Leere. Krachte mit dem Gesicht auf irgendetwas Hartes und landete dann weniger hart auf dem Fußboden, auf seiner verkrumpelten Decke.
Er setzte sich auf. Seine Nase tat weh wie Hölle. Und sie lief. Es lief aus ihr raus wie Wasser.
Jemand machte Licht. Karo blinzelte. Es war Ben, der da am Lichtschalter stand. Ben sah ihn entsetzt an.
Karo schaute an sich hinunter. Er blutete. Sein ganzer Schlafanzugpulli war bekleckert.
Dann kam Frau Schüppel ins Zimmer gestürzt: »Um Gottes willen! Was ist denn hier passiert?« Sie trug einen leuchtend orangefarbenen Bademantel.
»Er ist auf einmal einfach rausgefallen«, sagte Ole, der das Bett unter Karo hatte. »Voll auf den Stuhl hier.«
»Ah ja«, sagte Frau Schüppel. »Einfach so.«
Es tat zwar weh wie Hölle, aber es war halb so schlimm. Das Bluten hörte schnell wieder auf. Frau Schüppel wusch ihm das Gesicht mit einem Lappen ab und fand keine Platzwunde. Karo musste aufstehen und ein paar Schritte gehen, zum Beweis, dass ihm nicht schwindelig war, dass er keine Gehirnerschütterung davongetragen hatte. »Ist dir schlecht, Oskar?«, fragte sie.
»Nein«, sagte er.
»Dann ist ja gut.« Sie sah erleichtert aus. Da war er froh, dass er gelogen hatte. Ihm wurde immer schlecht, wenn er Blut sah.
Dann wurden alle wieder ins Bett geschickt. Karo zog sich den blutigen Schlafanzugpulli aus und ein Sweatshirt an. Als er den engen Kragen über die Nase zog, zeckte es gewaltig.
Er sagte nichts, aber beim Einschlafen dachte er, dass Ole ihm die Decke vielleicht weggezogen hatte.
Am nächsten Tag hatten sie tolles Wetter. Goldener Oktober. Trotz der Sonne war es kühl. Alle hatten Anoraks an oder Kapuzenpullis. Heute hatten die Schüler bestimmen dürfen, und so machten sie keinen Ausflug, sondern spielten einfach bloß draußen.
Das Schullandheim war toll. Erstens wohnten sie alle in einer Reihe von Blockhäusern, die schon ganz alt aussahen. Das Holz war grau und verwittert. An den Rückseiten wucherte Unkraut bis zu den Fenstern hoch. Es war fast wildwestmäßig, wie in einer Goldgräbersiedlung oder so.
Zweitens lag das Heim an einem See. Man brauchte bloß um das Steinhaus der Herbergseltern herumzulaufen, dann konnte man ihn schon glitzern sehen zwischen den hohen Birken und Kiefern.
Drittens, und das war das absolut Beste, in den sandigen, mit Grasflecken besetzten Hängen lagen die Überreste eines gesprengten und zugeschütteten Bunkers aus Beton. Eines richtigen Bunkers.
Dort hatten Karo, Ole und Ben gerade versucht, sich einen Zugang freizuschaufeln. Wieder einmal erfolglos. Nun sollte Karo eine seiner selbst ausgedachten Gruselgeschichten erzählen.
»Nur wenn ihr von da oben runterspringt«, sagte er und zeigte auf eine der glatten Bunkermauern, die aus ungefähr drei Metern Höhe steil abfielen. Unten lag weicher Sand. »Die Klippen des Wahnsinns!«
»Erst du«, sagte Ben.
»Nee, erst ihr!«
So ging das eine Weile hin und her. Schließlich sprangen sie alle drei gleichzeitig, und dann saßen sie unten im kühlen Sand in der Sonne, und Karo fing mit seiner Gruselgeschichte an: »Wisst ihr eigentlich, warum sie diesen Bunker gesprengt haben damals? Es war ein Experimentierlabor der Nazis. Die haben da Kampfmonster gezüchtet, aus Katzen … Der Blutbunker, so hat er hier in der Gegend geheißen. Hat mir der Herbergsvater erzählt.«
Ole schnaubte. »Und das glaubste? Der hat doch’n Rad ab!«
»Nee, echt! Fast hätten sie den Zweiten Weltkrieg doch noch gewonnen damit …«
Ole schnaubte noch einmal.
»Der hat sogar zwei Räder ab«, sagte Ben. Sie lachten. »Aber Blutbunker? Klingt voll gut. Voll horrormäßig. Und dann noch Nazis? Oh, Mann. Die hatten sogar Werwolf-Soldaten damals, hat mein Bruder gesagt. Und manche hatten sich Totenköpfe an der Uniform festgemacht.«
Karo rieb sich die Nase. Sie fühlte sich zu weich an und tat immer noch weh. Ole und Ben sahen ihn erwartungsvoll an. Er hatte sie am Haken. Sie wollten wissen, wie seine Geschichte weiterging.
Abendbrot. Weil das Wetter so schön war, aßen sie draußen, auf dem Platz zwischen dem Steinhaus und den Blockhütten. Er wurde auf der einen Seite von einem großen, flachen Schuppen abgeschlossen, der dem Herbergsvater als Garage diente. Sie saßen auf den zerschrammten grünen Bierbänken und löffelten gerade Linsensuppe mit Würstchen in sich hinein, da hörten sie wildes Geknatter in der Auffahrt.
Der Herbergsvater kam mit seinem Schrottauto angefahren. Er reichte mit den Augen kaum über das Lenkrad, weil er den Fahrersitz ausgebaut hatte und mit dem Hintern zwischen den Halteschienen saß. Die Jungs johlten begeistert. Vorne rechts fehlte der Kotflügel, dort waren nur der rissige Reifen und der verrostete Radkasten zu sehen; und der Kofferraumdeckel war mit Paketschnur runtergebunden.
»Ho-ho-ho!«, brüllten die Jungs und: »Au warte!«, als der schwarze Klapperkasten zu scharf in die Kurve ging und genau auf die äußerste Bierbank zuhielt. »Stopp! Bremsen!«
Der Herbergsvater reckte den Hals, dann klappte ihm der Mund auf, und er stieg so hart auf die Bremse, dass er erst mit dem Kopf ans Lenkrad krachte und dann nach hinten kippte.
Es reichte trotzdem nicht ganz. Der Wagen rollte bis gegen die Bierbank, schob sie ein Stück seitwärts, und alle Kinder darauf purzelten hinunter. Alles kreischte und kicherte und grölte durcheinander, aber zum Glück war niemandem etwas passiert. Jedenfalls niemandem aus der Klasse.
»Hollerdipoller!«, rief Karo. »Der Herbergsvater aus der Hölle!«
Ole, Ben und er lachten.
»Ja, und ihr seid das teuflische Trio!«, sagte Frau Schüppel. Sie ging zu dem Auto. »Ist Ihnen was passiert, Herr Bennigsen?«
»Nein, danke«, sagte Herr Bennigsen. »Ich hab schon gegessen.« Es waren nur seine Füße zu sehen. Sie steckten in grauen Filzpantoffeln.
Abwasch. Frau Schüppel hatte das teuflische Trio dazu verdonnert. Ben spülte, Ole übernahm das Klarspülen, Karo trocknete ab. Frau Bennigsen war irgendwo hinten im Haus und kümmerte sich um ihren Mann, der ein ordentliches Horn auf der Stirn gehabt hatte, als er aus dem Auto geklettert war.
»Örks«, sagte Ben auf einmal. Er war zu faul gewesen, den Dreck von den Tellern zu kratzen, und nun schwammen lauter Linsen und Würstchenscheiben auf dem Spülwasser. »Voll ekelig!« Ben nahm eine Würstchenscheibe und schnippte sie durch die Küche. Sie blieb nass am Geschirrschrank kleben.
Ole und Ben lachten.
»Seid ihr bescheuert?« Karo pulte die Scheibe wieder ab und warf sie zurück. Sie landete im Klarspülbecken.
»Örks!«, rief nun Ole. Er fischte das Teil raus und schnippte es – »Passt auf!« – Richtung Küchendecke.
Die Scheibe blieb dort oben hängen.
»Cool!« Ben fischte eine zweite Scheibe aus dem Wasser und schnippte sie hinterher. Auch sie blieb an der Decke kleben.
»Jetzt du!«
Aber Karo wollte nicht. Auch dann nicht, als sie ihn als Schisshasen verhöhnten. »Ich bin kein Schisshase«, sagte er. »Ich hab bloß keine Lust, denen die Küche zu versauen.«
»Ach ja? Dann …« Ben sah sich in der Küche um und fing zu grinsen an. »Dann kannste ja davon was futtern.« Er zeigte auf eine schmale Packung neben dem Herd.
»Salz?«, fragte Karo. »Kann doch jeder.«
»Aber nicht ’nen ganzen Löffel voll.« Ben nahm einen Teelöffel aus dem Besteckständer. »Da.«
Karo schluckte.
»Na, was nun?«, fragte Ben.
Karo nahm den Löffel. Sah zum Salz. Dann fing er zu grinsen an und stellte den Teelöffel wieder in den Ständer zurück. »Kann doch jeder. Aber nicht damit.« Er zog einen Esslöffel aus dem Ständer.
Ben und Ole machten große Augen.
Karo nahm die Packung, kippte einen ordentlichen Berg Salz auf den Löffel und führte ihn an den Mund. »Nur, wenn ihr’s nachmacht.«
Ole und Ben starrten ihn an.
»Na? Was ist?«
Sie sahen zu Boden.
»Ich mach’s vor, und ihr macht’s nach.« Karo steckte sich den Löffel in den Mund. Es schmeckte absolut total horrormäßig widerwärtig abscheulich, aber er tat so, als genieße er es. Er ließ sich das Salz auf der Zunge zergehen wie eine Praline.
»Voll lecker!«, sagte er. »Ich bin cool, und ihr seid schwul!«
Dann stand Frau Schüppel in der Küche. Typisch Lehrerin. Sie merkte sofort, wenn etwas nicht stimmte. Sie sah zu dem Esslöffel in Karos Hand, dann zu der Salzpackung.
»Ja, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen!«, schimpfte sie los. »Wollt ihr euch eine Natriumchloridvergiftung holen oder was!«
»Natrium-Klo-was?«, fragte Ben.
»Kochsalz!«, rief Frau Schüppel. »Das ist in großen Mengen hochgiftig! Wieviel hast du gegessen? Einen Esslöffel voll? Herrgott nochmal! Wie bescheuert kann man denn sein? Hier. Du trinkst jetzt sofort Wasser. Mindestens drei Gläser. Und wenn dir schlecht wird, dann wartest du nicht lange. Dann gehst du sofort aufs Klo und steckst dir einen Finger in den Hals.«
Sie passte auf, dass Karo auch wirklich drei Glas Wasser trank. Dann sah sie alle drei nacheinander an. »So, meine Herren. Dann reden wir mal Klartext. Wenn ihr noch einmal irgend so eine bescheuerte Mutprobe macht oder euren Mitschülern einen eurer ekeligen Streiche spielt, dann nehme ich euch die Gruselhefte weg. Dann hat sich's ausgegruselt, bis wir wieder zu Hause sind. Ist das klar?«
Sie nickten. Wenigstens hatte sie nicht an die Decke gesehen.
Bis sie mit dem Abwasch fertig waren, dämmerte es schon. Einige Kinder spielten noch Fußball hinter der Garage, andere waren schon im Aufenthaltsraum und machten Brettspiele. Dort waren auch die Lehrer. Dort wollten Karo, Ben und Ole nicht sein.
Sie beschlossen, sich lieber mal in die Garage von Herrn Bennigsen zu schleichen, wo gerade keiner zusah.
Sein Schrottauto stand immer noch neben den Bierbänken herum. Vielleicht hatte es den Herbergsvater ja doch doller erwischt.
Das Hängetor lehnte immer auf einem roten, zerbröselten Mauerstein; wusste der Geier warum. Sie zogen es ein Stück hoch und schlüpften darunter hindurch.
Drinnen war es toll gruselig. Zuerst sahen sie nur Schwärze, bis auf die schimmernde Reihe Glassteine oben unter der Decke. Dann gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit, und es schälten sich Umrisse hervor.
Sie waren schon tagsüber hier drin gewesen; deshalb wussten sie, was hier alles herumstand. Ein Puppentheater zum Beispiel und, an die Wand gelehnt, die Reste einer riesigen Ritterburg aus Spanplatten. Im Dunkeln sah die Ritterburg fast echt aus. Die Ecktürme reichten bis unter die Decke. »Als hätten wir uns in einem fiesen Märchenwald verirrt«, flüsterte Karo.
Ole und Ben sahen sich an.
»Habt ihr etwa Schiss?«, fragte Karo.
»Nee, aber du gleich!« Seine beiden Freunde gaben ihm einen Stoß, dass er zwischen die Kulissen des Puppentheaters fiel. Er landete auf etwas wie einem Lumpensack, ertastete Haare und Stoff unter seinen Fingern und ein Puppengesicht und ein riesiges, hartes Maul voller Zähne.
Dann schlug hinter ihm scheppernd das Tor auf den Mauerstein.
Er kämpfte sich hoch, sprang auf. Auf einmal kam es ihm stockfinster vor hier drin. Durch die Glassteine unter der Decke kam kaum Licht, sie waren völlig verdreckt. Und überall diese blöden Umrisse.
»Hey, lasst mich raus!« Er drängte sich gegen das schiefe Tor. Aber Ben und Ole waren zu zweit, sie waren stärker. Er bettelte, er drohte, er flehte. Er hörte sie lachen.
Dann merkte er, dass ihm der Magen brodelte. War das die Natriumklodingsvergiftung? Er hatte auch ganz dollen Durst, trotz der drei Glas Wasser vorhin. Er sackte zusammen. Da war öliger Erdboden unter seinen Fingern. Oder war er blutdurchtränkt?
Karo sah nach oben. Die Türme der Burg sahen plötzlich viel größer aus. Und was war das für ein Geräusch dort beim Puppentheater? Dieses Scharren? Dieses Klappern? Dieses Schmatzen wie von einem riesigen Maul?
Er fing zu weinen an. »Lasst mich raus«, schluchzte er.
»Auf gar keinen Fall«, sagte Ole, und Ben fügte hinzu: »Erst, wenn du sagst: Ihr seid cool, und ich bin schwul!«
»Lasst mich raus!«, rief er. Sein Magen krampfte sich zusammen. »Ich hab eine Vergiftung, Mann!« Er übergab sich.
Da erst ließen seine Freunde ihn frei. »Hey, entschuldige«, sagte Ben. »Wir wollten dich bloß ärgern. Weil du so angegeben hast.«
»Das gibt Ärger!« Karo brannte der Hals. »Das sag ich Frau Schüppel!«
»Ach ja?«, sagte Ole. »Dann bringst du ihr am besten deine Mystery-Hefte gleich mit, Alter.«
Sie hatten das Tor kaum wieder unten, da ging am anderen Ende der Blockhütten eine Tür auf. Herr Wachholz schaute nach draußen, ihr Lehrer: »Hey, Jungs! Kommt ihr?«
Auch am nächsten Tag war Schönwetter. Nur beim teuflischen Trio nicht: Ole zog Karo im Hallenbad den ganzen Vormittag über damit auf, dass er ja doch ein Schisshase wäre.
Irgendwann, als sie wieder im Schullandheim waren, hatte Karo die Nase voll. »Ich werd dir beweisen, dass ich mutig bin! Der Mutigste von allen! Ich werd …« Er sah sich auf dem Gelände um. »Ich werd auf den höchsten Baum klettern, den es hier gibt. Bis ganz nach oben!«
Beim Bunker standen drei riesengroße Laubbäume; eine Sorte, die Karo nicht kannte.
Er suchte sich den größten aus, spuckte in die Hände und sprang nach dem untersten Ast. Er verfehlte ihn. »Der Mutigste von allen«, höhnte Ole. »Bis ganz nach oben.«
Karo sprang erneut. Diesmal erwischte er den Ast. Holte Schwung, schwang sich hoch. Am Reck war er Klassenbester. »Ja. Bis ganz nach oben. Ihr werdet’s schon sehen.«
Der Anfang war schwer, aber dann standen die Äste allmählich enger zusammen. Vom See kam Wind, zerrte an den Zweigen. Karo kletterte immer höher. Bald war der See auch zu sehen hinter den Blättern, die bereits rotgelb waren an manchen Stellen.
Karo konnte schon auf den Dachfirst des Steinhauses hinuntersehen, da kam ihm ein toter Ast in die Quere. Das schwarzgraue Holz war nur noch lose mit dem Stamm verbunden.
Karo biss die Zähne zusammen. Er stellte den Fuß so weit vom Stamm weg auf den Ast, wie es ging, und trat zu.
Der Ast gab krachend nach.
Karo klammerte sich am Stamm fest und sah zu, wie der Ast hinuntersackte, bis er auf den gesunden Ästen darunter zu liegen kam. Schwärzliche Zweige trudelten zu Boden.
»Hey, Mann!«, riefen Ole und Ben unten. »Komm wieder runter, das reicht!«
»Bis ganz nach oben, hab ich gesagt!«
»Komm runter, Mann! Wenn Frau Schüppel sieht, dass du so weit hochkletterst, kriegen wir einen Mordsärger!«
Aber Karo kletterte weiter. Die Welt sah toll aus von hier oben. Der See. Wald drum herum. Das Schullandheim mit dem Bunker. Er war der Mutigste! Der Mutigste von allen! Niemand aus der Klasse traute sich so hoch. Und Erwachsene waren zu schwer. Es wackelte ja jetzt schon ganz schön. Die Krone schwankte richtig unter dem Wind; sie schaukelte immer doller hin und her, je höher er kam.
Er begann seinen Puls im Nasenrücken zu spüren, in der Prellung. Inzwischen war der Stamm so schmal, dass er ihn ganz umfassen konnte, wenn er wollte. Die Äste wuchsen fast senkrecht daraus hervor. Sie behinderten ihn mehr, als dass sie etwas nützten. Die Kordeln seines Anoraks verhakten sich darin, die Schnürbänder seiner Turnschuhe.
Er fragte sich allmählich, ob er es überhaupt wieder heil hinunterschaffen würde. Dann war er fast oben, sah die letzte Gabelung vor sich.
Der See war ein einziges riesiges Flimmern, und Karo konnte von hier oben zum ersten Mal das andere Ufer sehen. Er musste sich jetzt richtig festklammern am Stamm, es war fast wie Stangenklettern in Sport. Oder wie Maibaumklettern; das hatte er in einem Familienferiendorf mal gemacht – und den letzten halben Meter einfach nicht mehr geschafft. Aber jetzt schaffte er es!
Er zog sich hoch, und als er in die letzte Gabelung kuckte, war darin ein Stöckchen eingeklemmt.
Und auf das Stöckchen war eine Reihe von Fischen gezogen.
Fünf, sechs, sieben, acht Fische, den Stock durch die Augen gestochen.
Karo hing dort im brausenden Wind, hielt sich an dem schwankenden Wipfel fest und konnte nicht glauben, was er dort sah.
Konnte nicht glauben, dass hier jemand hochgeklettert war, um Fische zu trocknen!
Oder war es ein Tier gewesen? Aber welches Tier tat so etwas? Eine besonders schlaue Katze? Eines der Katzenmonster aus seiner Geschichte vielleicht? Er schaute auf den schimmernden See hinaus. Vielleicht versteckten sich ja dort noch welche, die auch unter Wasser leben konnten. Weil sie Kiemen hatten.
Aber er hatte sich die Geschichte doch bloß ausgedacht, das war doch bloß eine Geschichte gewesen …
Durch das Brausen des Windes hörte Karo jemanden rufen. Er sah nach unten. Dort stand ihr Lehrer, Herr Wachholz, und brüllte etwas von schön langsam wieder runterkommen.
Karo machte sich an den Abstieg.
Er würde nichts sagen.
Er würde es nie jemandem sagen.
Und als er abends ins Bett ging, ohne Gruselheft, weil Frau Schüppel sie ihnen alle weggenommen hatte, da sah er die Fische vor sich, die Fische in dem Baum beim Blutbunker. Vielleicht hatte sie ja ein Junge im Krieg dort oben versteckt, hatte vor lauter Hunger heimlich beim Bunker geangelt und seine Fische dann dort oben versteckt. Und dann hatten ihn sich die Nazis geholt.
Aber das kann doch nicht sein, dachte Karo. Das ist doch viel zu lange her. Die Fische wären doch längst runtergepustet worden.
Aber er sah es alles vor sich. Das Gesicht des halb verhungerten Jungen. Wie er den Baum raufkletterte und sich einen Vorrat anlegte. Das Gesicht des Herbergsvaters heute Nachmittag, mit der riesigen Beule auf der Stirn. Vielleicht war ja er der halb verhungerte Junge gewesen, und er war vom Baum gestürzt und hatte das Gedächtnis verloren und wusste überhaupt nichts mehr von den Fischen, sondern war irgendwann Herbergsvater geworden und fuhr nur noch blöde in einem Schrottauto durch die Gegend.
Karo lag da, lag dort oben in seinem Bett, als einziger hellwach, und wartete.
Aber es wollte nicht heller werden draußen, und die Geschichten wollten einfach nicht aufhören.
Brüderlein und Schwesterlein
Havlek und Jelena waren Geschwister, und sie waren einander in kindlicher Liebe zugeneigt. Der Wald, der ihr Dorf umgab, war riesig und voll wunderbarer Verstecke. Einige von ihnen teilten sie mit ihren Freunden, andere hielten sie geheim, als Zuflucht für Tage, an denen die Welt zu groß war – oder das Dorf zu klein.
Es ging ihnen gut im Schoße ihrer Familie, aber es ging ihnen auch gut im Wald. Und als ihnen eines Morgens das Sonnenlicht zur Nase hereinfuhr und zu den Ohren wieder hinaus, kam es, dass niemand ein Auge dafür hatte. Die Frühlingsregen waren vorüber, die Felder wurden bestellt und die Hütten ausgebessert. Männer und Frauen trugen Werkzeuge hin und her.
Also liefen die beiden wieder einmal in den Wald, doch diesmal spielten sie nicht darin. Sie wanderten einen Tag, und sie wanderten noch einen Tag. Die Sonne malte goldene Ränder um die mächtigen Baumkronen und Schatten auf das Unterholz. Einmal sahen sie etwas Großes, Dunkles, das mit seinem Maul Wurzeln aus der nassen Erde grub, und es schien ihnen das Tier zu sein, vor dessen Schreien sie in der Nacht Angst gehabt hatten. Einmal traten sie auf eine Lichtung, die mit strahlend blauen Blüten übersät war, und da erhoben sich die Blüten in die Luft und flogen davon. Es waren Vögel, und ihren Gesang hatten sie nie zuvor gehört.
Dann wurde der Wald düster. Überall hingen Wurzeln und Efeu herab, und in den Schatten roch es nach Moder.
»Ich will nach Hause«, flüsterte Jelena. »Wir waren schon viel zu lange fort. Und ich habe Hunger.«
»Ich auch«, sagte Havlek. »Und die Pilze dort sehen aus wie die, die Mama immer pflückt.« Er brach einen ab und kostete davon. Er spuckte es wieder aus.
»So schlimm sind sie nicht«, sagte seine Schwester. Sie sammelte einige in ihrem Rock, und dann kehrten sie um.
Als Havlek am nächsten Morgen erwachte, war er allein.
»Jelena?«
Er fand sie zusammengekrümmt in einem Gebüsch, und sie war bleich wie der Tod.
Im Dorf herrschte helle Aufregung. Fünf Tage waren die Kinder vermisst gewesen, und dann war Havlek hereingestolpert, seine Schwester in den Armen, und zuerst hatte man sie ihm nicht abnehmen können, so fest hatte er sie gehalten.
Havlek schlief einen Tag, und er schlief noch einen Tag. Dann war er kräftig genug, um nach Jelena zu sehen. Sie hatten sie zur Hütte der Heilerin gebracht, doch die junge, verwachsene Frau wusste keine Rettung für sie.
»Ich hatte einen Traum«, sagte Havlek zögernd. »Von einem Einhorn.«
Die Heilerin sah ihn an, und ihre wasserblauen Augen machten die Narben und Geschwüre auf ihren Armen vergessen. »Einhörner gibt es hier nicht. Wir kennen nur die Sagen. Jenseits des großen Waldes, ja, da vielleicht.«
Havlek betrachtete die unförmigen Töpfe der Mixturen, die Bündel von Kräutern unter der niedrigen Decke, die toten Schlangen an der Wand über dem Bett. Havlek betrachtete die knochigen Züge Jelenas. Dann machte er sich auf den Weg.
Er wanderte ein Jahr, und er wanderte noch ein Jahr. Er wurde von einem habgierigen Bauern als Stallbursche verdingt, doch er konnte fliehen. Er verlief sich zwischen den wilden Armen eines Flusses, doch er traf auf Wanderer. Er hatte Träume, in denen seine kleine Schwester nach ihm rief. Er hatte zerrissene Schuhe, und die Kleider hingen ihm in Fetzen herab. Und dann fand er das Einhorn.
Er war tagelang marschiert, ohne einer Menschenseele zu begegnen, und so machte er Rast an einem See, aus dem wohl noch nie jemand getrunken hatte. Stille hing über dem Schilf, glitzerte im Ufersand. Wassertropfen klingelten, und etwas Weißes trennte die Schatten.
Aber wie sollte er es fangen? Es war größer als alle Pferde, die er kannte. Und aus seiner Stirn wuchs hoch das Horn empor, überzogen mit weißen und grauen Bahnen.
Havlek weinte, und das Tier kam heran und knabberte an seinem Haar. Havlek weinte auch, als er es tötete, weinte, als er von seinem Fleisch aß und das Horn längst gebrochen war. Die Tränen versiegten erst auf dem Weg nach Haus, traurig und hoffnungsvoll zugleich. Jetzt konnte er wieder mit seiner Schwester durch den Wald streifen und ihr all die Geschichten erzählen, die er unterwegs erlebt und gehört hatte.
Als Havlek dicht bei seinem Dorf war, kratzte er den Flaum auf seinen Wangen. Er wusste nicht, wie viele Jahre vergangen waren. Und er trat ein in den Kreis der Häuser, und die Freude war groß. Männer und Frauen liefen herbei, plötzlich hatte jeder noch einen guten Krug in der Kammer und einen Schinken dazu. Wer singen konnte, sang, und wer spielen konnte, holte seine Laute herbei.
Havlek aß und trank und lachte. Er wusste gar nicht, wie groß sein Hunger nach all dem gewesen war.
Dann fragte er nach seiner Schwester, und sie zeigten zum Friedhof.
Zuerst hatte er geweint über dem kleinen Grab, und die anderen hatten ihm zugeschaut, scheu und schweigsam. Dann war er allein, und sein Magen wurde heiß wie ein Stein in der Mittagssonne. Mit bloßen Händen grub er den Leichnam aus. Sein Ekel war groß, aber seine Liebe war größer. Sanft nahm er das Horn und schob es unter den einst gefalteten Händen hindurch, legte es auf die eingefallene Brust.
Als die Finger sich zitternd bewegten, weinte er wieder. Als die Brust, diese leere Brust, sich hob und senkte, lächelte er. Und als der geschwärzte Schädel ihm die Augenhöhlen zuwandte, lachte Havlek.
»Jelena!«
Er hatte sie wieder, und er lachte und weinte zugleich.
So kam es, dass Fremde diese Gegend meiden. Verirrt sich doch einmal ein Wanderer in das kleine Dorf, so ist er bleich und zittert. Trinkt wortlos den angebotenen Kräuterschnaps und erzählt eine wirre Geschichte. Von einem Bärtigen, der mit einem hellen Lachen durch den Wald streift, auf seinen Schultern einen Leichnam reiten lässt, der zu leben scheint. Und der Bärtige lacht und lacht und redet von Pilzen.
Pech für Opa
»Familie! Essen fassen!« Grundschüler Sascha W. (10) hörte seinen Vater im Erdgeschoss des Ferienhauses in Dänemark in die Hände klatschen. »Essen fassen! Lecker, lecker!« Sein Vater machte immer so eine Schau, wenn er einmal etwas kochte. Dann gab es entweder Hamburger oder Kartoffelpuffer. Die wären Männersache, sagte sein Vater immer.
Er machte die Burger immer viel zu knusprig. Sie schmeckten überhaupt nicht wie bei McDonalds. Er toastete sogar die Brötchen auf.
Sascha wischte sich noch einmal mit den nassen Händen übers Gesicht, wischte mit dem Handtuch nach, dann sah er in den Spiegel über dem kleinen Waschbecken. Er sah völlig sauber aus. Blass wie immer. Sauber wie immer.
Bis auf die hässlichen Flecken am Hals. Immer wenn er den Kopf bewegte, tat es höllisch weh. Ein Mist. In den Vampirromanen wehrten die sich nie so.
Und dann das ganze Gespritze, als Opa ihn weggerissen hatte. Zum Glück hatte sein T-Shirt nichts abgekriegt. Er hob den Pullover von den Fliesen auf und legte ihn so zusammen, dass der ganze Schlonz innen lag. Dann verließ er die kleine Extratoilette.
Auf dem Weg zum Kinderschlafzimmer kam er am Bad vorbei. Hinter der Tür hörte er Opa ächzen und fluchen und herumklappern. Sascha musste grinsen. Das Badezimmer war perfekt gewesen. Er ging in das Zimmer und versteckte den Pulli unter dem Etagenbett. Vielleicht konnte er ihn nachher im Wald verbrennen. Oder in der Garage zur Tarnung mit Öl einsauen oder so.
Sascha zog sich einen Rollkragenpullover über. Dann ging er die Treppe hinunter. Seine Eltern und seine Großmutter saßen schon in der Essecke und machten sich über die Puffer her.
– Ich hab’s getan, dachte er. Ich hab’s endlich getan. Ich hab zugebissen, und dann hab ich’s runtergeschluckt. Gluck, gluck, gluck.
– Und jetzt ist mir ganz anders.
Als er den Stuhl vom Tisch wegzog, sah er niemanden an. Er setzte sich hin. Gebannt starrte er auf seinen Teller, auf das weiße Porzellan. Die Lampe spiegelte sich darin. Es blendete höllisch. Ging das etwa schon los mit dem Tageslicht? Da würde sich Mama aber wundern.
Klatsch, fuhr ihm ein Puffer auf den Teller.
Er zuckte hoch.
»Gott, Sascha, Junge, was hast du denn schon wieder für Augenringe!« Seine Mutter sah ihn an. Dann sah sie zu seinem Vater. »Ob das mit diesem Kratzer zusammenhängt? Vielleicht hat er ja eine Blutvergiftung.«
»Ach, was! Da würde der Arm ganz anders aussehen. Der Junge muss mehr spielen, anstatt immer nur diesen Schund zu lesen. Ich hab mich in seinem Alter den ganzen Tag draußen rumgetrieben.«
»Ich will nachher noch in den Wald«, sagte Sascha schnell. Sein Vater fand es nicht gut, wenn ein Junge so viel las. Lesen, hatte er einmal verkündet, sei etwas für Mädchen. Und Horrorromane wären ja nun völlig krank. Ja, wenn es wenigstens mal ein Abenteuerroman wäre! Die brächten einem wenigstens was bei fürs Leben!
– Meine Stephen Kings auch, Papa.
Sascha verteilte einen Löffel Apfelmus auf dem Puffer. Aber er glaubte nicht, dass er ihn herunter bekam. Das Ding stank total nach Fett.
»Zeig mal her, den Kratzer«, sagte sein Vater. Sascha hielt ihm den Arm hin. In seinem Mund war alles ganz salzig. Der Gaumen fühlte sich an, als würde daran etwas kleben. Wie nach Rhabarberkompott. Ganz komisch. Und so metallisch, wie wenn man Dosenmandarinen aß.
»Na also. Heilt doch alles gut ab.« Sein Vater machte sich wieder über das Essen her. Sascha war froh, dass er noch herumgeschnippelt hatte an dem Arm. Mit der Klinge aus dem Bleianspitzer. Am liebsten hätte er den Biss ja einfach stehen gelassen, damit es aussah wie in den Filmen immer, aber dann hätte seine Mutter garantiert Zeck gemacht.
Die beiden Punkte, als ob ihn Dracula persönlich gebissen hätte. Bloß dass er nicht so blöd gewesen war, sich die Fledermaus an den Hals zu drücken.
Die Fledermäuse hatte ihm sein Papa gezeigt, beim Spazierengehen. Da war so ein komisches Vogelhäuschen oben im Baum gewesen, kurz vor dem Distelfeld. »Da wohnen Fledermäuse drin«, hatte sein Papa gesagt. Und da hatte Sascha endlich gewusst, wie er Vampir werden konnte.
»Wo bleibt Vater denn?«, fragte Mama, und Papa rief: »Komm runter! Die Puffer werden kalt!«
Aber wenn es so war wie in den Romanen, dann konnte Sascha jetzt bestimmen. Er hatte zugebissen, und gluck, gluck, gluck, jetzt war er Opas Herr.
– Oben bleiben, dachte er.
»Ich komm gleich«, rief Opa von der Treppe. Seine Stimme klang, als ob er nicht richtig Luft bekam.
Na also. Klappte doch. War ja auch schwierig genug gewesen mit den blöden Viechern. Nicht bloß, dass man den Vampir einladen musste, damit er einen beißen konnte. Nein, der Vampir musste einen ja auch noch beißen wollen