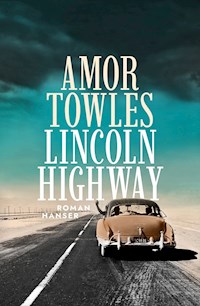9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Moskau, 1922. Der genussfreudige Lebemann Graf Rostov wird verhaftet und zu lebenslangem Hausarrest verurteilt, ausgerechnet im Hotel Metropol, dem ersten Haus am Platz. Er muss alle bisher genossenen Privilegien aufgeben und eine Arbeit als Hilfskellner annehmen. Rostov mit seinen 30 Jahren ist ein äußerst liebenswürdiger, immer optimistischer Gentleman. Trotz seiner eingeschränkten Umstände lebt er ganz seine Überzeugung, dass selbst kleine gute Taten einer chaotischen Welt Sinn verleihen. Aber ihm bleibt nur der Blick aus dem Fenster, während draußen Russland stürmische Dekaden durchlebt. Seine Stunde kommt, als eine alte Freundin ihm ihre kleine Tochter anvertraut. Das Kind ändert Rostovs Leben von Grund auf. Für das Mädchen und sein Leben wächst der Graf über sich hinaus. "Towles ist ein Meistererzähler" New York Times Book Review "Eine charmante Erinnerung an die Bedeutung von gutem Stil" Washington Post "Elegant, dabei gleichzeitig filigran und üppig wie ein Schmuckei von Fabergé" O, the Oprah Magazine
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Moskau, 1922. Der genussfreudige Lebemann Graf Rostov wird verhaftet und zu lebenslangem Hausarrest verurteilt, ausgerechnet im Hotel Metropol, dem ersten Haus am Platz. Er muss alle bisher genossenen Privilegien aufgeben und eine Arbeit als Kellner annehmen. Rostov mit seinen dreißig Jahren ist ein äußerst liebenswürdiger, immer optimistischer Gentleman. Trotz seiner eingeschränkten Umstände lebt er ganz seine Überzeugung, dass selbst kleine gute Taten einer chaotischen Welt Sinn verleihen. Aber ihm bleibt nur der Blick aus dem Fenster, von dem aus er das Bolschoi-Theater und seine schönen Gäste und die Mauern des Kreml sieht. Draußen vor den Türen des Hotels durchlebt Russland stürmische Dekaden. Rostovs Stunde kommt, als eine alte Freundin ihm ihre kleine Tochter anvertraut. Das Kind ändert sein Leben von Grund auf. Für das Mädchen wächst der Graf über sich hinaus.
Der Autor
AMOR Towles hat in Yale und Stanford studiert. Sein Debüt Eine Frage der Höflichkeit war in den USA auf Anhieb ein Bestseller und hat auch bei uns viele begeisterte Leser gefunden. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Manhattan.
Susanne Höbel, seit über fünfundzwanzig Jahren Literaturüber-setzerin, übertrug Autoren wie Nadine Gordimer, John Updike, William Faulkner, Thomas Wolfe und Graham Swift ins Deutsche. Sie lebt in Südengland.
Amor Towles
Ein Gentlemanin Moskau
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch
von Susanne Höbel
List
Die Originalausgabe erschien 2016unter dem Titel A Gentleman in Moscowbei Viking, einem Verlag von Penguin Random House, New York
Der Abdruck des Tschechow-Briefs im Kapitel »Aufsteigen, aussteigen«. erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Diogenes Verlags.Anton Čechov: Briefe 1901–1904. Aus dem Russischen von Peter Urban. Copyright der deutschsprachigen Übersetzung © 1979 Diogenes Verlag AG, Zürich.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1619-2
© 2016 by Cetology, Inc.© der deutschsprachigen Ausgabe2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: ROTHFOS & GABLER, HAMBURGAutorenfoto: DAVI D JACOBS
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für Stokley und Esmé
Moskau um 1922
Wie gut ich mich erinnere
Einst kam es als Besucher zu Fuß
und verweilte eine Zeitlang unter uns,
eine Melodie, ähnlich der einer Bergkatze.
Und wo ist unser Vorwärtsstreben jetzt?
Wie so viele Fragen
beantworte ich diese
mit abgewandtem Auge beim Schälen einer Birne.
Mit einer Verneigung wünsche ich gute Nacht
und trete durch die Terrassentüren
in die schlichte Pracht
eines neuen milden Frühlings.
Aber dies weiß ich:
Es ist nicht verloren unter den Herbstblättern des Petersplatzes.
Es ist nicht in der Asche der Aschetonnen des Athenäums.
Es ist nicht in den blauen Pagoden eurer feinen Chinoiserie.
Es ist nicht in Wronskis Satteltaschen,
Nicht in Sonett XXX, Vers eins,
Nicht auf siebenundzwanzig roten …
Wo ist es jetzt? (Zeilen 1–19Graf Alexander Iljitsch Rostov, 1913
21. Juni 1922
ERSCHIENEN IST GRAF ALEXANDER ILJITSCH ROSTOVVOR DEM NOTSTANDSKOMITEE DES VOLKSKOMMISSARIATS FÜR INNERE ANGELEGENHEITEN
Vorsitzende: Genossen V. A. Ignatow, M. S. Zakowski, A. N. KosarewStaatsanwalt: A. J. Wischinski
Staatsanwalt W.: Geben Sie Ihren Namen an.
Rostov: Graf Alexander Iljitsch Rostov, Träger des Ordens des Heiligen Andreas, Mitglied des Jockey-Clubs, Meister der Jagd.
Wischinski: Sie mögen auf Ihren Titeln bestehen, aber sonst nützen die niemandem. Für das Protokoll: Sind Sie Alexander Rostov, geboren am 24. Oktober 1889 in St. Petersburg?
Rostov: Der bin ich.
Wischinski: Bevor wir anfangen, muss ich doch sagen, dass ich noch nie ein Jackett mit so vielen Knöpfen gesehen habe.
Rostov: Vielen Dank.
Wischinski: Das war nicht als Kompliment gemeint.
Rostov: In dem Fall verlange ich Satisfaktion auf dem Feld der Ehre.
[Gelächter]
Schriftführer Ignatow: Ruhe auf der Galerie.
Wischinski: Ihre derzeitige Adresse?
Rostov: Suite 317, Hotel Metropol, Moskau.
Wischinski: Seit wann wohnen Sie dort?
Rostov: Ich residiere dort seit dem 5. September 1918. Seit knapp vier Jahren.
Wischinski: Und Ihr Beruf?
Rostov: Für einen Gentleman geziemt es sich nicht, einen Beruf zu haben.
Wischinski: Also gut. Wie verbringen Sie Ihre Zeit?
Rostov: Mit Dinieren und Debattieren. Lesen und Reflektieren. Das Übliche.
Wischinski: Und Sie schreiben Gedichte?
Rostov: Ich habe wohl schon einmal mit der Feder gerungen.
Wischinski [hält ein Pamphlet hoch]: Sind Sie der Urheber dieses Langgedichts von 1913, »Wo ist es jetzt?«
Rostov: Es ist mir zugeschrieben worden.
Wischinski: Warum haben Sie das Gedicht geschrieben?
Rostov: Es verlangte, geschrieben zu werden. Eines Morgens saß ich an einem Schreibtisch, als das Gedicht geschrieben werden wollte.
Wischinski: Und wo genau war das?
Rostov: Im Südsalon von Gut Weile.
Wischinski: Gut Weile?
Rostov: Das Landgut der Rostovs in Nischni Nowgorod.
Wischinski: Ah, ja. Natürlich. Wie passend. Aber widmen wir uns wieder dem Gedicht. Als es erschien, in den eher bedrückenden Jahren nach der fehlgeschlagenen Revolte von 1905, wurde es weitläufig als Aufruf zum Handeln verstanden. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu?
Rostov: Dichtung ist immer ein Aufruf zum Handeln.
Wischinski [liest seine Notizen]: Und im Frühjahr des folgenden Jahres verließen Sie Russland und gingen nach Paris?
Rostov: Ich glaube mich an blühende Apfelbäume zu erinnern. Demnach war es wohl Frühling.
Wischinski: Am 16. Mai, um genau zu sein. Wir verstehen Ihre Gründe für das selbstauferlegte Exil, und wir haben auch einiges Verständnis für die Handlungen, die dieser Flucht vorausgingen. Was uns interessiert, ist Ihre Rückkehr 1918. Es stellt sich die Frage, ob Sie zurückgekommen sind in der Absicht, zu den Waffen zu greifen, und wenn ja, ob für oder gegen die Revolution.
Rostov: Meine Zeit, zu den Waffen zu greifen, gehörte da schon der Vergangenheit an, fürchte ich.
Wischinski: Warum sind Sie dann zurückgekommen?
Rostov: Ich habe das Klima vermisst.
[Gelächter]
Wischinski: Graf Rostov, Sie scheinen den Ernst Ihrer Lage nicht zu erfassen. Außerdem lassen Sie es an gebührendem Respekt für die vor Ihnen Versammelten mangeln.
Rostov: Die Zarin hat zu ihrer Zeit die gleichen Beschwerden geäußert.
Ignatow: Vorsitzender Wischinski. Dürfte ich …
Wischinski: Schriftführer Ignatow.
Ignatow: Ich habe keinen Zweifel, Graf Rostov, dass manch einer auf der Galerie von Ihrem Charme überrascht ist, ich hingegen bin nicht im mindesten überrascht. Die Geschichte hat gezeigt, dass Charme der einzig verbleibende Ehrgeiz der begüterten Klasse ist. Überraschend erscheint mir hingegen, dass der Urheber des vorliegenden Gedichts ein Mann geworden ist, dem absichtsvolles Streben offenbar vollkommen fremd ist.
Rostov: Ich bin mit dem Eindruck aufgewachsen, das einzige Streben des Menschen sei es, Gott zu erkennen.
Ignatow: In der Tat. Wie Ihnen das zugesagt haben muss.
[Das Komitee zieht sich für zwölf Minuten zurück.]
Ignatow: Alexander Iljitsch Rostov, nach umfassender Betrachtung Ihrer eigenen Aussagen können wir nur zu der Annahme gelangen, dass der klarsichtige Geist, der das Gedicht »Wo ist es jetzt?« verfasst hat, unwiederbringlich den Korruptionen seiner Klasse anheimgefallen ist und jetzt eine Bedrohung derselben Ideale darstellt, die er einst verfochten hat. Auf dieser Grundlage sehen wir uns geneigt, Sie aus diesem Saal an die Mauer draußen zu führen. Für einige hohe Funktionäre sind Sie jedoch einer der Helden der vorrevolutionären Zeit. Deshalb kommt dieses Komitee zu dem Schluss, dass Sie in das Hotel zurückkehren sollen, wo es Ihnen so gut gefällt. Aber dessen können Sie gewiss sein: Sollten Sie das Hotel Metropol jemals verlassen, werden Sie auf der Stelle erschossen.Der nächste Fall.
Unterschrieben vonV. A. IgnatowM. S. ZakowskiA. N. Kosarew
BUCH EINS
1922
Der Attachékoffer
Um halb sieben am Abend des 21. Juni 1922, als Graf Alexander Iljitsch Rostov durch die Tore des Kremls auf den Roten Platz geführt wurde, war es draußen herrlich kühl. Ohne den Schritt zu verlangsamen, warf der Graf die Schultern zurück und atmete die Luft ein wie jemand, der gerade vom Schwimmen kommt. Der Himmel war von exakt dem Blau, für das die Farben der Kuppeln der Basilius-Kathedrale ausgewählt worden waren. Ihr Rosa und Grün und Gold schimmerte, als wäre der einzige Sinn einer Religion der, die Göttlichkeit zu erfreuen. Sogar die bolschewistischen jungen Frauen vor den Schaufenstern des Staatskaufhauses schienen sich zur Feier der letzten Frühlingstage schöngemacht zu haben.
»Guten Abend, mein Freund«, rief der Graf zu Fjodor am Rande des Platzes hinüber. »Die Brombeeren sind in diesem Jahr früh reif, wie ich sehe.«
Der Graf wartete die Antwort des verdutzten Obstverkäufers nicht ab und ging forschen Schrittes weiter, sein gewachster Schnurrbart ausgebreitet wie die Flügel einer Seemöwe. Er passierte das Auferstehungsportal, ließ den Flieder im Alexandergarten hinter sich und ging auf den Theaterplatz zu, an dem das Hotel Metropol in all seiner Pracht stand. Auf der Schwelle zwinkerte er Pawel, dem Portier der Nachmittagsschicht, zu und drehte sich mit ausgestreckter Hand zu den beiden Soldaten um, die hinter ihm gingen.
»Besten Dank, meine Herren, dass Sie mir bis hierher Ihren Schutz gewährt haben. Jetzt bedarf ich Ihrer Hilfe nicht mehr.«
Obwohl die Soldaten kräftige Burschen waren, mussten sie unter ihren Mützen zum Grafen aufsehen, um seinen Blick zu erwidern, denn wie schon zehn Generationen im Stamm der Rostovs vor ihm maß der Graf fast einen Meter neunzig.
»Gehen Sie weiter«, sagte der Gröbere der beiden und legte die Hand auf den Pistolengriff. »Wir sollen Sie zu Ihrem Quartier bringen.«
In der Halle winkte der Graf mit einer ausholenden Bewegung dem durch nichts aus der Ruhe zu bringenden Arkadi (der am Empfangstisch stand) und der entzückenden Valentina (die den Staub auf einer Statuette wegwischte) zum Gruß zu. Obwohl der Graf beide auf dieselbe Weise schon Hunderte von Malen gegrüßt hatte, sahen sie ihn jetzt mit weit aufgerissenen Augen an. So würde man bei einer Abendgesellschaft angestarrt, wäre man versehentlich ohne Anzughose gekommen.
Der Graf ging an dem Mädchen mit einer Vorliebe für Gelb vorbei, das in seinem Lieblingssessel saß und in einer Zeitschrift blätterte, und blieb dann unvermittelt vor den Topfpalmen stehen und wandte sich an seine Begleiter.
»Aufzug oder Treppe, meine Herren?«
Die Soldaten sahen sich gegenseitig, dann den Grafen und dann wieder einander an, offenkundig unfähig, eine Entscheidung zu treffen.
Wie soll ein Soldat auf dem Schlachtfeld siegreich sein, wenn er nicht imstande ist, sich zwischen Aufzug und Treppe zu entscheiden?
»Treppe«, entschied der Graf an ihrer Stelle und rannte diese zwei Stufen auf einmal nehmend, wie er es seit seinen Tagen an der Militärakademie machte, hinauf.
Im dritten Stock ging er auf dem mit rotem Teppich ausgelegten Flur zu seiner Suite, die Schlafzimmer, Badezimmer, Speisezimmer und einen großen Salon umfasste und von deren Fensterfront aus man auf den Theaterplatz mit seinen Linden blickte. Und dort erwartete ihn die Ungeheuerlichkeit des Tages. Denn vor den weit geöffneten Türen zu seiner Suite stand neben Pascha und Petja, den Hotelpagen, ein Hauptmann. Die beiden jungen Männer sahen dem Grafen mit einem Ausdruck der Verlegenheit entgegen, denn ganz offensichtlich war ihnen eine Aufgabe zugefallen, die ihnen widerstrebte. Der Graf wandte sich an den Hauptmann.
»Was hat das hier zu bedeuten, Herr Hauptmann?«
Der Mann schien von der Frage überrascht, hatte aber in seiner Ausbildung die Fähigkeit erworben, in solchen Fällen eine gleichmütige Miene zu wahren.
»Ich bin hier, um Sie zu Ihrem Quartier zu begleiten.«
»Dies hier ist mein Quartier.«
Mit der leisesten Andeutung eines Lächelns sagte der Hauptmann: »Leider nicht mehr.«
Pascha und Petja blieben zurück, während der Hauptmann den Grafen und dessen Begleiter zu einem Dienstbotenaufgang führte, der sich hinter einer unauffälligen Tür im Innern des Hotels verbarg. In dem dürftig beleuchteten Treppenhaus ging es alle fünf Stufen scharf um die Ecke, wie in einem Glockenturm. So schraubten sie sich zwei Stockwerke hoch zu einer Tür, die in einen schmalen Flur führte. Davon gingen ein Badezimmer und sechs Schlafzimmer ab, die an Mönchszellen erinnerten. Ursprünglich war der Dachboden für die Butler und Zofen der Gäste des Metropol ausgebaut worden, aber als das Reisen mit Dienstpersonal aus der Mode kam, wurden in diesen Stuben allerlei Gerümpel sowie schadhafte oder ausgemusterte Möbelstücke untergestellt.
Am Morgen dieses Tages war aus der Stube, die der Treppe am nächsten lag, alles bis auf ein eisernes Bettgestell, eine dreibeinige Kommode und eine zehn Jahre alte Staubschicht entfernt worden. In der Ecke bei der Tür stand ein kleiner Wandschrank, einer Telefonzelle nicht unähnlich, der wie nachträglich dort hingestellt aussah. Der Neigung des Daches folgend senkte sich die Zimmerdecke von der Tür zur Außenwand, und die einzige Stelle, wo der Graf aufrecht stehen konnte, war die Gaube mit dem Fenster von der Größe eines Schachbretts.
Während die Wachen vom Flur aus selbstgefällig in die Kammer blickten, erklärte der gute Hauptmann, die Pagen würden dem Grafen helfen, die wenigen Besitzstücke, die in dem neuen Quartier Platz fänden, zu transportieren.
»Und der Rest?«
»Wird Volkseigentum.«
So ist das also gemeint, dachte der Graf.
»Bestens.«
Er sprang die Treppen hinunter, und während die Wachen mit ihm Schritt zu halten versuchten, klackerten ihre Gewehre an der Wand. Im dritten Stock marschierte der Graf den Flur entlang zu seiner Suite, wo die beiden Pagen ihm mit ernsten Mienen entgegensahen.
»Kein Grund zur Aufregung«, beruhigte der Graf sie und zeigte hierhin und dorthin. »Das. Und das. Die da. Und alle Bücher.«
Für die Ausstattung seines neuen Quartiers wählte der Graf zwei Lehnstühle, den orientalischen Couchtisch seiner Großmutter und einen Satz ihrer Lieblingsporzellanteller aus. Er wählte zwei Tischlampen aus Ebenholz, die in der Form von Elefanten geschnitzt waren, sowie das Porträt seiner Schwester, das Serow 1908 bei einem kurzen Aufenthalt auf Gut Weile gemalt hatte. Er vergaß nicht die lederne Aktentasche, die Asprey in London speziell für ihn angefertigt und die sein guter Freund Mischka so passend »Attachékoffer« getauft hatte.
Jemand hatte die Höflichkeit gehabt, eine der Reisetruhen des Grafen in sein Schlafzimmer bringen zu lassen. Während also die Pagen die genannten Möbel ins Dachgeschoss trugen, packte der Graf Kleidung und persönliche Gegenstände in die Truhe. Plötzlich bemerkte er, dass die zwei Flaschen Kognak auf der Konsole die begehrlichen Blicke der Wachen auf sich zogen, und packte auch die ein. Und nachdem die Truhe nach oben getragen worden war, zeigte er schließlich auf seinen Schreibtisch.
Die beiden Pagen, deren Uniformen von der Schlepperei bereits Schmutzspuren zeigten, packten an den vier Ecken an.
»Der ist ja schwer«, bemerkte der eine zum anderen.
»Die Festung eines Königs ist sein Schloss«, erklärte der Graf, »die eines Gentleman sein Schreibtisch.«
Als die Pagen den Schreibtisch auf den Flur schleppten, schlug die Standuhr von Rostovs Großvater, deren Schicksal es war, zurückgelassen zu werden, dumpfe acht Mal. Der Hauptmann war längst wieder an seinen Standort zurückgekehrt, und die Wachen, die jetzt nicht mehr streitlustig, sondern gelangweilt um sich blickten, lehnten an der Wand und ließen die Asche von ihren Zigaretten aufs Parkett rieseln, während das ungeminderte Licht des Moskauer Mittsommerabends in den Salon strömte.
Mit wehmütigem Blick näherte der Graf sich den Fenstern an der Nordwestecke. Wie viele Stunden hatte er hier verbracht? Wie oft hatte er am Morgen, bekleidet mit seinem Morgenmantel und einer Tasse Kaffee in der Hand, die neuen Gäste beobachtet, die müde und übernächtigt nach der Reise aus ihren Taxis gestiegen waren? Wie viele Male hatte er an Winterabenden dem langsam fallenden Schnee zugesehen, während eine einsame, gebeugte Gestalt unter den Straßenlaternen entlangging? Jetzt sprang am nördlichen Ende des Platzes ein junger Offizier der Roten Armee die Stufen zum Bolschoi-Theater hinauf, eine halbe Stunde verspätet für den Beginn der Abendvorstellung.
Der Graf lächelte bei der Erinnerung an seine eigene Jugend und seine Vorliebe, nach Beginn der Vorführung anzukommen. Im English Club hatte er verkündet, er könne nur auf ein Glas bleiben, blieb aber für drei. Dann war er in die wartende Kutsche gesprungen, hatte eilends die Stadt durchquert und die berühmten Stufen erklommen und war, wie dieser junge Bursche soeben, durch die goldenen Türen getreten. Während die Ballerinen anmutig über die Bühne tanzten, hatte der Graf sich unter wiederholtem Excusez-moi zu seinem gewohnten Platz in der zwanzigsten Reihe geschlängelt, von dem aus er einen privilegierten Blick auf die Damen in den Logen hatte.
Zuspätkommen, dachte der Graf mit einem Seufzer. Eine Anfälligkeit der Jugend.
Er drehte sich auf dem Absatz um und durchmaß seine Zimmer. Zunächst bewunderte er die großzügigen Dimensionen des Salons und die beiden Kronleuchter. Er bewunderte die bemalten Holzpaneele des kleinen Speiseraums und die raffinierte Messingvorrichtung, mittels deren man die Flügeltüren des Schlafzimmers feststellen konnte. Kurzum, er begutachtete die Räume so, wie ein potentieller Käufer das tun würde, der sich zum ersten Mal durch die Räumlichkeiten bewegte. Im Schlafzimmer blieb der Graf vor dem Tisch mit der Marmorplatte stehen, auf dem verschiedene Objekte lagen. Er nahm eine Schere in die Hand, die seiner Schwester teuer gewesen war. Sie war wie ein Königsreiher gestaltet, wobei die beiden Klingen den Schnabel des Vogels darstellten und die goldene Schraube im Gelenk des Vogels Auge sein sollte, und sie war so zierlich, dass Daumen und Ringfinger des Grafen kaum durch die Griffe passten.
Von einem Ende der Suite überblickte der Graf das gesamte Inventar, das zurückbleiben würde. Schon damals, vor vier Jahren, waren die persönlichen Dinge, die Möbel und objets d’art, die er in diese Räume mitgenommen hatte, das Ergebnis eines Aussiebeprozesses gewesen. Denn als der Graf Nachricht von der Hinrichtung des Zaren bekommen hatte, war er sofort aus Paris abgereist. Innerhalb von zwanzig Tagen war er durch sechs Staaten gefahren, hatte acht Bataillone, die unter fünf verschiedenen Flaggen gegeneinander kämpften, umrundet und war am 7. August 1918 mit nur einem Rucksack auf dem Rücken auf Gut Weile, dem Familienlandsitz, angekommen. Obwohl das Land am Rande immenser Umwälzungen stand und er den Haushalt in großer Aufregung vorfand, bewahrte seine Großmutter, wie es ihrem Wesen entsprach, die Fassung.
»Sascha«, sagte sie, ohne sich aus dem Sessel zu erheben, »wie gut, dass du kommst. Du musst krank sein vor Hunger. Komm, setz dich zu mir zum Tee.«
Als er ihr erklärte, warum es nötig war, dass sie das Land verließ, und die Vorkehrungen beschrieb, die er für ihre Reise gemacht hatte, verstand sie, dass es keine Alternative gab. Obwohl alle Dienstboten bereit waren, sie zu begleiten, sah sie ein, dass sie mit nur zweien reisen müsste. Auch begriff sie, dass ihr Enkel und einziger Erbe, den sie seit seinem zehnten Lebensjahr aufgezogen hatte, nicht mit ihr kommen würde.
Einmal, als der Graf gerade sieben Jahre alt war, hatte ein Nachbarsjunge ihn so gründlich im Mühlespiel geschlagen, dass es zu Tränen und bösen Worten kam und er die Spielsteine auf den Boden schmiss. Der Vater des Grafen ahndete diesen Mangel an Sportsgeist mit einem deutlichen Tadel, und der Junge wurde ohne Abendessen ins Bett geschickt. Doch als der kleine Graf unglücklich unter die Decke kroch, kam seine Großmutter herein. Sie setzte sich ans Fußende des Bettes und sprach voller Mitgefühl. »Zu verlieren ist niemals angenehm«, begann sie, »und der junge Obolenski ist ein kleines Scheusal. Aber Sascha, mein lieber Junge, warum erlaubst du ihm diese Genugtuung?« Das war der Geist, in dem er und seine Großmutter sich ohne Tränen am Kai von Peterhof trennten. Dann kehrte der Graf auf seinen Familiensitz zurück und überwachte dessen Schließung.
Der Reihe nach wurden die Schornsteine geputzt, die Speisekammern geleert, die Möbel abgedeckt. Es war ganz so, als würde die Familie für die Saison nach St. Petersburg aufbrechen, nur dass diesmal die Hunde aus den Zwingern, die Pferde aus den Ställen und die Dienstboten von ihren Aufgaben befreit wurden. Und nachdem der Graf einen einzelnen Wagen mit den feinsten Möbeln im Besitz der Rostovs beladen hatte, verriegelte er das Haus und machte sich auf den Weg nach Moskau.
Ist doch seltsam, reflektierte der Graf, als er im Begriff war, seine Suite zu verlassen. Von früh an müssen wir lernen, uns von Freunden und Verwandten zu verabschieden. Wir trennen uns am Bahnhof von Eltern und Geschwistern, wir besuchen Cousins, gehen zur Schule, treten in ein Regiment ein; wir heiraten oder machen Reisen ins Ausland. Es gehört zu den menschlichen Erfahrungen, dass wir immer wieder einen nahen Menschen bei den Schultern nehmen, ihm alles Gute wünschen und uns mit der Vorstellung trösten, schon bald von ihm zu hören.
Jedoch lehrt die Erfahrung weniger, wie wir uns von unseren teuersten Besitztümern trennen. Und wenn sie es lehren würde? Wir wären ihr nicht dankbar. Denn es kommt eine Zeit, da unsere liebsten Dinge uns teurer sind als unsere Freunde. Wir tragen sie mit uns von Ort zu Ort, oft zu einem hohen Preis und unter großen Umständen. Wir säubern und polieren sie und verbieten Kindern, in ihrer Nähe allzu ausgelassen zu spielen, während wir unserer Erinnerung gleichzeitig erlauben, den Dingen immer größere Bedeutung beizumessen. Dies ist der Schrank, in dem wir uns als Kinder versteckt haben, diese silbernen Kerzenhalter standen zu Weihnachten auf dem Festtisch, mit diesem Taschentuch hat sie sich damals die Tränen getrocknet, et cetera, et cetera. Und am Schluss bilden wir uns ein, dass diese sorgfältig gehüteten Dinge uns über den Verlust eines Gefährten hinwegtrösten können.
Dabei ist ein Ding einfach ein Ding.
Und deshalb steckte der Graf die Schere seiner Schwester in die Tasche, betrachtete ein letztes Mal das, was von seinem Erbe geblieben war, und löschte es endgültig aus seinem sehnsuchtsvollen Herzen.
Eine Stunde später federte der Graf zweimal auf seiner neuen Matratze, um die Tonhöhe der Bettfedern zu bestimmen (Gis), und als er sich die Möbel besah, die ihn umgaben, dachte er daran, wie sehnlich er sich als Jugendlicher gewünscht hatte, mit dem Schiff nach Frankreich oder mit dem Zug nach Moskau zu fahren.
Und warum hatte er sich diese Reisen so sehnlichst gewünscht?
Weil die Kojen so schmal waren!
Und welche Wunderdinge es da zu entdecken gab: den Tisch, der sich wegklappen ließ und in der Wand verschwand, die eingebauten Schubladen unter dem Bett, den Strahl der Wandleuchte, der gerade stark genug war, um eine Buchseite auszuleuchten. Die zweckmäßige Gestaltung war wie Musik für den jungen Mann. Sie bezeugte Präzision und versprach ein Abenteuer. Denn so hätte das Quartier von Kapitän Nemo ausgesehen, als er zwanzigtausend Meilen unter dem Meer auf die Reise ging. Und würde nicht jeder Junge, der einigen Schneid besaß, frohen Herzens hundert Nächte in einem Palast gegen eine Nacht an Bord der Nautilus eintauschen?
Endlich hatte er das erreicht.
Außerdem, nachdem die Hälfte der Zimmer im zweiten Stock vorübergehend von den Bolschewiken in Beschlag genommen worden waren, die dort unermüdlich ihre Direktiven tippten, konnte man im sechsten Stock wenigstens ungestört seinen Gedanken nachhängen.*
Der Graf stand auf und stieß mit dem Kopf an die Dachschräge.
»Ganz richtig«, sagte er.
Er schob den einen Lehnstuhl zur Seite, legte die Elefanten-Lampen aufs Bett und öffnete die Truhe. Er nahm das Foto der Delegation heraus und stellte es auf den Tisch, wo es hingehörte. Dann nahm er die beiden Flaschen Kognak und die Uhr mit dem Zweimalschlag, die seinem Vater gehört hatte. Aber in dem Moment, als er das Opernglas seiner Großmutter auspackte, wurde seine Aufmerksamkeit von einem Flattern bei der Dachluke abgelenkt. Obwohl das Fenster lediglich die Größe einer Abendeinladung hatte, sah der Graf, dass eine Taube auf der kupfernen Verkleidung des Fensterbretts gelandet war.
»Hallo«, sagte der Graf. »Wie freundlich von dir vorbeizuschauen.«
Der Blick der Taube schien einen Besitzanspruch geltend zu machen. Sie stolzierte mit kratzenden Klauen über das Kupferblech und hackte mehrmals mit dem Schnabel an die Scheibe.
»Ah, stimmt«, sagte der Graf. »Das kann man so sagen.«
Er wollte schon anheben und seiner neuen Nachbarin den Grund für sein unerwartetes Erscheinen erklären, als er vom Flur ein zartes Räuspern hörte. Ohne sich umzudrehen, wusste der Graf, dass dies Andrei war, der Maître d’Hôtel des Bojarski, denn so meldete dieser üblicherweise sein Erscheinen.
Nachdem der Graf der Taube zugenickt hatte, womit er zum Ausdruck brachte, dass er das Gespräch mit ihr später fortsetzen würde, sein Jackett zugeknöpft und sich umgedreht hatte, sah er, dass es nicht Andrei allein war, der ihm einen Besuch abstattete, sondern dass insgesamt drei Hotelangestellte in der Tür standen.
Da war Andrei mit seiner aufrechten Haltung und den langen, geschickten Händen, Wassili, der unverwechselbare Portier, und Marina, die schüchterne Schönheit mit dem unsteten Auge, die kürzlich vom Zimmermädchen zur Näherin befördert worden war. Die drei sahen ihn staunend an, so wie Arkadi und Valentina wenige Stunden zuvor, und jetzt begriff er: Als er am Morgen abgeholt worden war, hatten sie angenommen, dass sie ihn nie wiedersehen würden. Er war aus den Mauern des Kremls hervorgekommen wie ein Flugzeugpilot aus dem Wrack seiner abgestürzten Maschine.
»Meine werten Freunde«, sagte der Graf. »Zweifellos würdet ihr gern etwas über die Ereignisse des heutigen Tages erfahren. Wie ihr vielleicht wisst, wurde ich zu einem Tête-à-Tête in den Kreml eingeladen. Dort kamen etliche pflichtgemäß mit Ziegenbart gezierte Staatsdiener des derzeitigen Regimes zu der Entscheidung, dass ich für das Verbrechen, als Aristokrat geboren zu sein, dazu verurteilt werden soll, den Rest meines Lebens … in diesem Hotel zu verbringen.«
Auf ihre Freudenbekundungen hin schüttelte der Graf jedem seiner Gäste die Hand und verlieh seiner Dankbarkeit angesichts ihres freundschaftlichen Mitgefühls Ausdruck.
»Kommt herein, kommt herein«, sagte er.
Die drei Mitarbeiter zwängten sich zwischen den aufgetürmten Möbeln herein.
»Wenn Sie so freundlich wären«, sagte der Graf und reichte Andrei eine der Kognakflaschen. Dann kniete er sich vor den Attachékoffer, öffnete die Verschlüsse und klappte ihn auf wie ein riesiges Buch. Darin waren zweiundfünfzig Gläser untergebracht – oder besser, sechsundzwanzig Gläserpaare –, jedes für seinen Verwendungszweck geformt, von der bauchigen Form des Rotweinglases bis hin zu den entzückenden Gläschen für die farbenprächtigen Liköre Südeuropas. Wie es dem Geist der Stunde entsprach, nahm der Graf irgendwelche vier Gläser und verteilte sie, und Andrei, der den Korken schon aus der Flasche gezogen hatte, schenkte ein.
Sobald seine Gäste mit Kognak versorgt waren, hob der Graf sein Glas.
»Auf das Metropol«, sagte er.
»Auf das Metropol!«, sagten die drei.
Der Graf war der geborene Gastgeber, und in der Stunde des Beisammenseins, während er hier ein Glas nachfüllte und dort die Unterhaltung wieder in Gang brachte, standen ihm die verschiedenen Temperamente im Zimmer klar vor Augen. So wagte Andrei an dem Abend ein ungezwungenes Lächeln und ein gelegentliches Zwinkern, ohne jedoch die seiner Position angemessene Förmlichkeit abzulegen. Wassili, der gewöhnlich mit bewundernswert klarer Aussprache Wegbeschreibungen zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gab, sprach plötzlich mit einem singenden Tonfall, wie jemand, der sich am nächsten Tag vielleicht nicht daran erinnern könnte, was er am Tag zuvor gesagt hatte. Und bei jedem Scherz erlaubte sich die scheue Marina ein Kichern, ohne die Hand vor den Mund zu legen.
Mehr als an jedem anderen Abend freute sich der Graf über die fröhliche Stimmung seiner Gäste, aber er war nicht eitel genug anzunehmen, dass sie allein der Nachricht seines knappen Entrinnens zuzuschreiben war. Denn besser als den meisten anderen war ihm bewusst, dass im September 1905 die Mitglieder der Delegation den Vertrag von Portsmouth unterschrieben hatten, mit dem der Russisch-Japanische Krieg beendet wurde. In den siebzehn Jahren seit jenem Frieden – nicht einmal eine Generation – hatte Russland einen Weltkrieg, einen Bürgerkrieg, zwei Hungersnöte und den sogenannten Roten Terror erduldet. Kurzum, es hatte eine Ära der Umwälzungen durchlaufen, die niemanden verschonte. Ob man links- oder rechtsgerichtet war, Rot oder Weiß, ob die eigenen Umstände sich zum Besseren oder Schlechteren gewandelt hatten, es war einfach ein guter Zeitpunkt, auf das Wohl der Nation zu trinken.
Um zehn Uhr begleitete der Graf seine Gäste zum Glockenturm, und mit demselben Zeremoniell wie an der Tür seines Familiensitzes in St. Petersburg wünschte er ihnen eine gute Nacht. Als er wieder in seine Kammer kam, öffnete er das Fenster (das nicht größer als eine Briefmarke war), goss sich den Rest Kognak ein und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Den Schreibtisch, der aus dem Paris Ludwigs XVI. stammte und nach der Mode der damaligen Zeit mit Vergoldungen und einer Lederauflage verziert war, hatte der Graf von seinem Patenonkel, dem Großherzog Demidow, geerbt. Der Großherzog, ein Mann mit weißen Koteletten, hellblauen Augen und goldenen Epauletten, konnte vier Sprachen sprechen und sechs lesen. Er war unverheiratet, vertrat in Portsmouth sein Heimatland, hatte die Leitung von drei Landgütern inne, hielt grundsätzlich nichts von Dummheiten und setzte im Allgemeinen auf Tüchtigkeit. Doch zuvor hatte er zusammen mit dem Vater des Grafen als waghalsiger Kadett in der Kavallerie gedient. So war der Großherzog der aufmerksame Vormund des Grafen geworden. Als 1900 die Eltern des Grafen innerhalb weniger Stunden von der Cholera dahingerafft wurden, war der Großherzog derjenige, der den Jungen beiseitenahm und ihm erklärte, er müsse fortan für seine Schwester stark sein. Schicksalsschläge, sagte er, gebe es in den verschiedensten Formen, und wenn ein Mann nicht Herr über seine Umstände sei, würden die Umstände Herr über ihn werden.
Der Graf fuhr mit der Hand über die unebene Oberfläche des Schreibtisches.
Wie viele der Worte des Großherzogs spiegelten die zarten Eindellungen wider? Über vierzig Jahre lang waren hier knappe Anweisungen für Verwalter, überzeugende Argumente für Staatsmänner und ausgezeichnete Ratschläge für Freunde verfasst worden. Somit war dies ein Schreibtisch, mit dem man zu rechnen hatte.
Der Graf leerte sein Glas und setzte sich auf den Fußboden. Mit der Hand fuhr er an der Rückseite des rechten vorderen Tischbeins entlang, bis er die Sperrklinke fand. Er drückte darauf, so dass sich ein unsichtbares Türchen öffnete, hinter dem ein samtbeschlagenes Fach verborgen war, das – so wie die Fächer in den anderen drei Beinen auch – mit Goldstücken gefüllt war.
Anmerkung zum Kapitel
* Tatsächlich handelte es sich um die Suite unmittelbar unter der des Grafen, wo Jakow Swerdlow, Erster Vorsitzender des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees, des Komitees, das mit der Ausarbeitung der sowjetischen Staatsverfassung beauftragt war, sich eingeschlossen und gelobt hatte, erst dann wieder aufzuschließen, wenn die Arbeit getan war. Deshalb gingen die Schreibmaschinen die ganze Nacht, bis das historische Dokument aufgesetzt war, das allen Russen Gewissensfreiheit (Artikel 13), Meinungsfreiheit (Artikel 14) und Versammlungsfreiheit (Artikel 15) zubilligte sowie die Freiheit, jedes dieser Rechte wieder abgesprochen zu bekommen, sobald sie »zum Schaden der sozialistischen Revolution verwendet« würden (Artikel 23).
Ein Engländer wird an Land gespült
Als Graf Alexander Iljitsch Rostov um halb zehn erwachte, gönnte er sich in den verschwommenen Momenten, bevor das Bewusstsein wieder einsetzte, einen Vorgeschmack auf den vor ihm liegenden Tag.
In weniger als einer Stunde würde er in der warmen Frühlingsluft die Twerskajastraße entlangschlendern, sein Schnurrbart ihm voraus wie ein geblähtes Segel. An einem Zeitungsstand in der Gasetnigasse würde er den Herald kaufen und nur einen kurzen Moment an der Bäckerei Filippow verweilen, um die Kuchen im Schaufenster zu betrachten, und dann weitergehen, denn er hatte einen Termin bei seiner Bank.
Doch sobald er am Bordstein stehen bliebe (und den Verkehr abwartete), würde ihm klar, dass sein Lunch im Jockey-Club für zwei Uhr anberaumt war – und dass seine Bankiers ihn zwar um halb elf erwarteten, aber in aller Wahrscheinlichkeit mit ihren Deponenten beschäftigt wären, folglich könnte auch er sie auf ihn warten lassen … und bei diesen Gedanken würde er eine Kehrtwendung machen, den Zylinder vom Kopf ziehen und die Tür zur Bäckerei Filippow öffnen.
Unverzüglich würden seine Sinne von den Düften unbestreitbar meisterhafter Backkunst betört. Die Luft wäre erfüllt von dem sanften Aroma frisch gebackener Brezeln, süßer Brötchen und krustiger Brotlaibe, die ihrer unübertroffenen Qualität wegen täglich per Eisenbahn in die Eremitage geliefert wurden – und in den Glaskästen wären in perfekten Reihen Kuchen angeordnet, deren Glasuren farblich so vielfältig wären wie die Tulpen in Amsterdam. Der Graf würde an die Theke treten und das junge Mädchen mit der hellblauen Schürze um ein Millefeuille (ein so treffender Name) bitten und bewundernd zusehen, wie es das Kuchenstück mit einem Teelöffel von dem silbernen Tortenheber auf einen Porzellanteller schob.
Mit dem Teller in der Hand würde der Graf an einem Tisch Platz nehmen, möglichst nah bei den modischen jungen Damen, die sich hier jeden Morgen trafen, um die Verstrickungen des Vorabends zu besprechen. Mit Rücksicht auf ihre Umgebung würden die drei zunächst mit vornehm gedämpften Stimmen sprechen, doch sobald die Gefühle in ihnen aufwallten, würde die Lautstärke zunehmen, so dass gegen Viertel nach elf auch der diskreteste Verzehrer eines Tortenstücks nicht umhinkonnte, Mithörer der tausendschichtigen Komplikationen ihrer Herzensangelegenheiten zu werden.
Gegen elf Uhr fünfundvierzig, nachdem er seinen Teller leer gegessen und sich die Krumen aus dem Schnurrbart gestrichen hätte, nachdem er ferner dem Mädchen hinter der Theke dankend gewinkt und seinen Zylinder in Richtung der drei Damen gezückt hätte, mit denen er zuvor ein wenig geplauscht hätte, würde er wieder auf die Twerskajastraße treten und einen Moment innehalten, um zu überlegen: Was jetzt? Sollte er bei der Galerie Bertrand vorbeischauen und sich die neuesten Bilder aus Paris ansehen? Oder einen Abstecher ins Konservatorium machen, wo ein Quartett junger Leute gerade ein Beethoven-Stück probte? Vielleicht würde er auch einfach zurück zum Alexandergarten gehen, wo er auf einer Bank sitzen und den Flieder bewundern könnte, während die Tauben gurrten und mit kratzenden Krallen über das Kupferblech des Fensterbretts hüpften.
Das Kupferblech des Fensterbretts …
Ach ja, wurde dem Grafen klar, all das wird es nicht geben.
Wenn er jetzt die Augen schlösse und sich zur Wand drehte, könnte er dann zu der Bank zurückkehren, gerade rechtzeitig, um in dem Moment, da die drei jungen Damen aus der Bäckerei Filippow vorbeikämen, die Bemerkung zu machen: Was für ein hübscher Zufall!?
Zweifellos. Aber sich auszumalen, was passieren könnte, wenn die Umstände anders als die gegebenen wären, ist der sicherste Weg in den Wahnsinn.
Der Graf setzte sich aufrecht hin, stellte beide Füße flach auf den nackten Fußboden und zwirbelte die Kompassenden seines Schnurrbarts.
Auf dem Schreibtisch des Grafen standen ein Champagnerglas und ein Kognakglas. Die schmale, aufrechte Form des ersteren neben der gedrungenen Rundung des zweiten weckte unwillkürlich das Bild von Don Quijote und Sancho Pansa auf der Ebene der Sierra Morena. Oder das von Robin Hood und Friar Tuck im Sherwood Forest. Oder das von Prinz Hal und Falstaff vor den Toren von –
Es klopfte an der Tür.
Der Graf stand auf und stieß sich den Kopf an der Decke.
»Einen Moment«, rief er, rieb sich den Kopf und suchte in der Truhe nach seinem Morgenmantel. Nachdem er passend angezogen war, öffnete er die Tür, vor der ein eifriger Bursche stand, der das Frühstück des Grafen brachte – eine Kanne Kaffee, zwei Haferkekse, ein Stück Obst (heute eine Pflaume).
»Sehr gut, Juri! Kommen Sie herein, kommen Sie. Stellen Sie es da ab.«
Während Juri das Frühstück auf der Truhe anordnete, setzte sich der Graf an den Schreibtisch des Großherzogs und schrieb eine kurze Notiz an einen Konstantin Konstantinowitsch in der Durnowskistraße.
»Wären Sie so freundlich, dies abzugeben, mein Freund?«
Juri zögerte keinen Moment, nahm den Brief und versprach, ihn persönlich zu überbringen. Das Trinkgeld quittierte er mit einer Verneigung. Auf der Schwelle blieb er stehen.
»Soll ich … die Tür angelehnt lassen?«
Eine vernünftige Frage, denn im Zimmer war es stickig, und im sechsten Stock bestand wohl kaum die Gefahr, gestört zu werden.
»Ja, bitte.«
Während Juris Schritte auf der Treppe verklangen, legte der Graf sich die Serviette auf den Schoß, goss Kaffee ein und gab zwei Tropfen Sahne dazu. Beim ersten Schluck stellte er zufrieden fest, dass Juri die zusätzlichen Stockwerke besonders schnell erstiegen haben musste, denn der Kaffee war so heiß wie sonst auch.
Als er mit seinem Obstmesser ein Stück Pflaume vom Kern schnitt, bemerkte er einen silbrigen Schatten, so flüchtig wie ein Fetzen Rauch, der hinter die Reisetruhe glitt. Der Graf beugte sich zur Seite, sah um den Lehnstuhl herum und entdeckte, dass dieses Irrlicht niemand anders war als die Hauskatze des Metropol, ein einäugiger Kater der Rasse Russisch Blau, dem nichts innerhalb des Hotelgebäudes entging und der offenbar auf den Dachboden gekommen war, um das neue Quartier des Grafen in Augenschein zu nehmen. Er trat aus dem Schatten und sprang geräuschlos vom Fußboden auf den Attachékoffer, vom Attachékoffer auf den Couchtisch, und vom Couchtisch auf die dreibeinige Kommode. Von diesem Aussichtspunkt aus ließ er seinen aufmerksamen Blick durch die Kammer schweifen und schüttelte anschließend enttäuscht den Kopf.
»Ja«, sagte der Graf, nachdem er sich ebenfalls umgesehen hatte. »Ich stimme dir zu.«
Die ungeordneten, gedrängt stehenden Möbelstücke verliehen dem kleinen Reich des Grafen das Aussehen eines Trödelladens im Arbat. In einer Stube von dieser Größe hätte dem Grafen ein einzelner Lehnstuhl genügt, ein einzelner Nachttisch, eine einzelne Lampe. Auf das Limoges seiner Großmutter hätte er ganz und gar verzichten können.
Und die Bücher? Alle Bücher!, hatte er gestern so großspurig angeordnet. Aber bei Tage besehen musste er zugeben, dass diese Anweisung weniger von praktischer Vernunft ausgegangen war als vielmehr von dem kindischen Wunsch, die Pagen zu beeindrucken und die Wachen auf ihren Platz zu verweisen. Denn die Bücher entsprachen gar nicht dem Geschmack des Grafen. Seine persönliche Bibliothek großartiger Erzählungen von Schriftstellern wie Balzac, Dickens und Tolstoi war in Paris zurückgeblieben, während die Bücher, die die Pagen auf den Dachboden geschleppt hatten, die seines Vaters waren, und jedes dieser Werke, allesamt Studien der rationalen Philosophie und der Wissenschaft moderner Landwirtschaft, bot schwere Kost und war nahezu undurchdringlich.
Zweifellos war ein weiteres Ausdünnen nötig.
Nachdem der Graf gefrühstückt, gebadet und sich angekleidet hatte, machte er sich an die Arbeit. Zunächst versuchte er, die Tür zum Zimmer nebenan zu öffnen. Offenbar war sie von innen durch etwas Schweres blockiert, denn sie bewegte sich kaum, als der Graf sich mit der Schulter dagegenstemmte. Die nächsten drei Kammern fand der Graf vom Fußboden bis zu den Dachsparren mit Gerümpel vollgestellt. Aber in der letzten Kammer war neben einem Stapel Schieferplatten und einem Haufen Kupferbleche genügend Platz rund um einen alten zerbeulten Samowar, wo einst die Dachdecker ihren Tee getrunken hatten.
Der Graf ging in sein Zimmer zurück und hängte ein paar Jacketts in den Schrank. Er verstaute Hosen und Hemden in der hinteren rechten Ecke der Kommode (damit das dreibeinige Biest nicht das Gleichgewicht verlor). Dann zerrte er die Reisetruhe und die Hälfte der Möbel und alle Bücher seines Vaters über den Flur in die Kammer. Auf diese Weise hatte er innerhalb einer Stunde das Mobiliar in seiner Kammer auf das Wesentliche reduziert – den Schreibtisch mit Stuhl, das Bett mit Nachttisch, einen Lehnstuhl für Besucher – und eine drei Meter lange Passage geschaffen, in der ein Gentleman schreiten und seinen Gedanken nachgehen konnte.
Zufrieden sah der Graf den Kater an (der bequem im Lehnstuhl zusammengerollt lag und sich die Sahne von den Pfoten leckte): »Wie findest du es jetzt, alter Pirat?«
Der Graf setzte sich an den Schreibtisch und nahm das einzige Buch in die Hand, das er behalten hatte. Es war sicherlich zehn Jahre her, dass der Graf sich vorgenommen hatte, dieses in allen Landen gelobte und von seinem Vater hochgeschätzte Werk zu lesen. Aber jedes Mal, wenn er mit dem Finger auf den Kalender gezeigt und erklärt hatte: Diesen Monat widme ich mich den Essai von Michel de Montaigne, hatte das Leben mit einer teuflischen Verlockung gewinkt. Sei es, dass unerwartet ein Liebesinteresse aufgekommen war, an dem er guten Gewissens nicht vorbeigehen konnte, oder dass sein Bankier angerufen hatte oder dass der Zirkus in die Stadt gekommen war.
Das Leben hatte seine Verlockungen, fürwahr.
Doch hier waren die Umstände endlich derart, dass sie den Grafen nicht ablenken, sondern ihm im Gegenteil Zeit und Muße schenken würden, so dass er sich ganz dem Buch widmen konnte. Also nahm er es entschlossen in die Hand, legte einen Fuß auf die Kante der Kommode und kippte sich so weit zurück, dass der Stuhl auf den hinteren Beinen balancierte, und begann zu lesen:
Auf verschiedenen Wegen erreichen wir dasselbe Ziel
Die üblichste Methode, die Herzen derjenigen zu erweichen, die wir gekränkt haben, wenn sie auf Rache sinnen und wir ihrer Willkür ausgesetzt sind, besteht in der Unterwerfung, um sie damit zu Mitgefühl und Milde zu bewegen. Jedoch haben Kühnheit und Standfestigkeit – ganz entgegengesetzte Mittel – gelegentlich dieselbe Wirkung gezeitigt …
Schon auf Gut Weile hatte der Graf die Angewohnheit entwickelt, beim Lesen auf dem Stuhl zu kippeln.
An herrlichen Frühlingstagen, wenn die Obstgärten in Blüte standen und die Mäusegerste aus dem Gras herauswuchs, hatten Helena und er sich eine schöne Ecke ausgesucht, wo sie einige Stunden verweilten. Einmal war es vielleicht unter der Pergola auf dem oberen Patio, ein andermal neben der großen Ulme mit Blick auf die Flussbiegung. Während Helena stickte, kippte der Graf seinen Stuhl zurück, wobei er den Fuß leicht an den Rand des Springbrunnens oder gegen den Baumstamm stützte, und las laut aus ihren Lieblingswerken von Puschkin vor. Und Stunde um Stunde, Strophe für Strophe stichelte ihre kleine Nadel.
»Was soll mit all diesen Stichen geschehen?«, fragte er manchmal am Ende einer Seite. »Inzwischen muss doch jeder Kissenbezug im Haus mit einem Schmetterling verziert sein und jedes Taschentuch mit einem Monogramm.« Und wenn er ihr unterstellte, dass sie des Nachts die Stiche wieder auftrennte, damit er ihr noch ein Versepos vorlesen musste, lächelte sie geheimnisvoll.
Der Graf lenkte den Blick von Montaigne auf Helenas Porträt, das an der Wand lehnte. Es war in einem August auf Gut Weile gemalt worden und zeigte seine Schwester am Esstisch vor einem Teller Pfirsiche. Wie gut Serow sie eingefangen hatte – das rabenschwarze Haar, die Wangen leicht gerötet, ihr Ausdruck weich und nachgiebig. Vielleicht war etwas in den Stichen gewesen, dachte der Graf, eine zarte Weisheit, der sie mit jeder kleinen gestickten Schlaufe näherkam. Solche Warmherzigkeit besaß sie mit vierzehn Jahren, dass man sich die Anmut, die ihr mit fünfundzwanzig zu eigen gewesen wäre, nur ausmalen konnte …
Der Graf wurde von einem leisen Klopfen aus seiner Träumerei geweckt. Er schlug das Buch seines Vaters zu und drehte sich zur Tür um, wo ein sechzig Jahre alter Grieche stand.
»Konstantin Konstantinowitsch!«
Der Graf ließ die vorderen Beine des Stuhls auf den Boden knallen, ging zur Tür und schüttelte dem Besucher die Hand.
»Ich bin sehr froh, dass Sie kommen konnten. Wir haben uns nur ein- oder zweimal gesehen, und vielleicht erinnern Sie sich nicht an mich – ich bin Alexander Rostov.«
Der alte Grieche verneigte sich zum Zeichen, dass er keiner Erinnerung bedurfte.
»Kommen Sie herein, kommen Sie herein. Setzen Sie sich.«
Der Graf wedelte mit Montaignes Meisterwerk vor dem einäugigen Kater (der mit einem Zischen auf den Boden sprang), bot dem Besucher den Lehnstuhl an und setzte sich selbst wieder auf den Schreibtischstuhl.
Im nächsten Moment erwiderte der alte Grieche den Blick des Grafen mit einem Ausdruck gemäßigter Neugier – der durchaus verständlich war, denn geschäftlich waren sie einander noch nicht begegnet. Da der Graf es nicht gewohnt war, beim Kartenspiel zu verlieren, eröffnete er jetzt das Gespräch.
»Wie Sie sehen, Konstantin, haben sich meine Umstände verändert.«
Der Besucher erlaubte sich eine überraschte Miene.
»Wahrhaftig«, sagte der Graf. »Sie haben sich erheblich verändert.«
Der alte Grieche ließ seinen Blick durch das Zimmer schweifen und bekannte mit erhobenen Händen die beklagenswerte Unbeständigkeit der Umstände.
»Brauchen Sie vielleicht Zugang zu … Kapital?«, begann er.
Er machte eine winzige Pause vor dem Wort Kapital. Und in der geschätzten Meinung des Grafen war es eine perfekte Pause – eine, die in Jahrzehnten delikater Gespräche verfeinert worden war. Es war eine Pause, die ein gewisses Mitgefühl für den Gesprächspartner ausdrückte, ohne auch nur im Geringsten anzudeuten, dass es in seinem jeweiligen Status eine Veränderung gegeben habe.
»Nein, nein«, versicherte der Graf nachdrücklich und schüttelte den Kopf, um zu betonen, dass Geld zu leihen nicht die Sache der Rostovs war. »Im Gegenteil, Konstantin, ich habe etwas, das Sie interessieren könnte.« Und der Graf produzierte wie aus der Luft eine der Münzen aus dem großherzoglichen Schreibtisch und hielt sie aufrecht zwischen Daumen und Zeigefinger.
Der alte Grieche betrachtete die Münze einen Augenblick lang und ließ den Atem zum Zeichen seiner Würdigung langsam entweichen. Denn Konstantin Konstantinowitsch war zwar von Beruf Geldverleiher, seine Kunst aber bestand darin, ein Objekt eine Minute anzusehen, es einen Moment in der Hand zu halten und sofort seinen wahren Wert zu erfassen.
»Darf ich …?«, fragte er.
»Selbstverständlich.«
Er nahm die Münze, drehte sie einmal herum und reichte sie ehrfürchtig zurück. Denn nicht nur war das Stück in einem metallurgischen Sinne rein, das Funkeln des Doppeladlers auf der Rückseite bestätigte außerdem dem erfahrenen Auge, dass es sich um eine der fünftausend Münzen handelte, die zum Gedenken an die Krönung Katharinas der Großen geprägt worden waren. Kaufte man eine solche Münze einem in Not geratenen Gentleman ab, konnte man sie in den besten Zeiten auch einem vorsichtigen Bankhaus zu einem gesunden Gewinn verkaufen. Und in Zeiten der Unruhe? Zwar brach die Nachfrage nach gewöhnlichen Luxusgütern ein, der Wert von Schätzen wie diesem aber stieg beständig.
»Entschuldigen Sie bitte meine Neugier, Eure Exzellenz, ist das … ein Einzelstück?«
»Ein Einzelstück? Keineswegs«, sagte der Graf mit einem Kopfschütteln. »Es lebt wie ein Soldat in der Kaserne. Wie ein Sklave auf einer Galeere. Nicht einen Moment allein.«
Der alte Grieche stieß wieder den Atem aus.
»Wenn das so ist …«
Und in wenigen Minuten hatten die beiden Männer ohne Wenn und Aber eine Vereinbarung getroffen. Überdies erklärte sich der alte Grieche bereit, drei Briefe zuzustellen, die der Graf unverzüglich zu schreiben begann. Darauf schüttelten sie sich wie alte Bekannte die Hände und vereinbarten ein neuerliches Treffen in drei Monaten.
Als der alte Grieche das Zimmer verlassen wollte, blieb er stehen.
»Eure Exzellenz … darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?«
»Selbstverständlich.«
Er deutete fast schüchtern auf den großherzoglichen Schreibtisch.
»Können wir mit neuen Versen von Ihnen rechnen?«
Der Graf lächelte.
»Ich bedauere, Konstantin, ich fürchte, meine Tage als Dichter sind vorbei.«
»Wenn Ihre Tage als Dichter vorbei sind, dann sind wir diejenigen, die das bedauern.«
Etwas versteckt in der nordöstlichen Ecke im zweiten Stock des Hotels lag das Bojarski, das beste Restaurant Moskaus, wenn nicht gar ganz Russlands. Mit seinen Gewölbedecken und weinroten Wänden, die die Heimstatt eines Bojaren, eines aristokratischen Landbesitzers, beschworen, war seine Innenausstattung die eleganteste in der ganzen Stadt, sein Personal war vorbildlich und sein Küchenchef unübertroffen.
So viele wollten einmal im Bojarski speisen, dass sich Abend für Abend eine erwartungsvolle, auf Einlass hoffende Menge einfand, durch die man sich kämpfen musste, wollte man Andreis Blick erhaschen, der über das große schwarze Buch herrschte, in dem die Namen der Glücklichen eingetragen waren, und wenn der Maître d’Hôtel einen herbeiwinkte, wurde man auf dem Weg zu einem Tisch in der Ecke möglicherweise fünfmal in vier verschiedenen Sprachen angesprochen und dann von einem Kellner in weißem Jackett zuvorkommend bedient.
Zumindest war das bis 1920 so gewesen, aber nachdem die Bolschewiken die Grenzen geschlossen hatten, beschlossen sie auch, den Rubel als Zahlungsmittel in den feinen Restaurants zu verbieten, was zur Folge hatte, dass sie neunundneunzig Prozent der Bevölkerung versagt waren. Als der Graf also an dem Abend das Hauptgericht zu essen begann, schlugen Wassergläser leicht an Besteck, unterhielten Paare sich verlegen flüsternd, und auch die besten Kellner hatten nichts zu tun und starrten an die Decke.
Aber jede Zeit hat ihre guten Seiten, selbst eine Zeit der Unruhe …
Als Emile Schukowski 1912 den Posten des Chef de Cuisine im Metropol angeboten bekam, übernahm er sowohl das erfahrene Personal als auch eine gut ausgerüstete Küche. Dazu gehörte die beeindruckendste Vorratskammer östlich von Wien. Ihr Gewürzsortiment bot einen Überblick über die Aromen der Welt und die Kühlabteilung eine umfassende Auswahl von Geflügel und anderen Tieren, die an den Füßen aufgehängt waren. Folglich konnte man zu dem Schluss kommen, das Jahr 1912 sei bestens geeignet, die Talente eines Kochs auf die Probe zu stellen. Aber in Zeiten des Überflusses vermag jeder Dummkopf mit einem Löffel in der Hand die Gaumen seiner Gäste zufriedenzustellen. Um den Erfindungsreichtum eines Kochs wirklich auf die Probe zu stellen, bedarf es einer Zeit des Mangels. Und wann herrscht Mangel, wenn nicht im Krieg?
In den postrevolutionären Zeiten – mit ihrem wirtschaftlichen Niedergang, den Missernten und dem ins Stocken geratenen Handel – waren feine Zutaten in Moskau so selten wie Schmetterlinge am Meer. Die Vorratskammer des Metropol wurde Bündel um Bündel, Pfund für Pfund, Prise nach Prise geleert, und der Küchenchef musste die Erwartungen seiner Gäste mit Maismehl, Mohrrüben und Weißkohl befriedigen – also mit dem, was er ergattern konnte.
Manch einer mochte behaupten, Emile Schukowski sei ein Haudegen, und ein anderer ihn als unwirsch bezeichnen. Wieder andere sagten, er sei genauso kurz angebunden, wie er kurz geraten sei. Doch sein Genie konnte niemand in Frage stellen. Nehmen wir das Gericht, von dem der Graf just in diesem Moment die letzten Bissen aß: ein aus der Not gestaltetes Saltimbocca. Statt Kalbsfilet hatte Emile eine Hühnerbrust flach geklopft. Statt Parmaschinken hatte er Schinken aus der Ukraine in hauchdünne Scheiben geschnitten. Und statt Salbei, des feinen Gewürzes, das die verschiedenen Aromen bindet? Er hatte sich für ein Gewürzkraut entschieden, das so weich und aromatisch war wie Salbei … weder Basilikum noch Oregano, davon war der Graf überzeugt, aber er kannte es von irgendwoher …
»Ist alles recht, Eure Exzellenz?«
»Vorzüglich wie immer, Andrei.«
»Und das Saltimbocca?«
»Kreativ. Aber eine Frage habe ich. Das Kraut, mit dem Emile den Schinken unterlegt hat – ich weiß, es ist kein Salbei. Könnte es Brennnessel sein?«
»Brennnessel? Das bezweifle ich. Aber ich frage nach.«
Mit einer Verneigung zog sich der Maître d’Hôtel zurück.
Kein Zweifel, Emile Schukowski war ein Genie, überlegte der Graf, aber derjenige, der dem Bojarski seinen Ruf der Exzellenz sicherte, indem er dafür sorgte, dass im Restaurant alles reibungslos lief, war Andrei Duras.
Das auffallendste Merkmal von Andrei, einem attraktiven, schlanken Mann mit grauen Schläfen, der aus Südfrankreich stammte, war weder sein Aussehen noch seine Größe noch sein Haar. Es waren seine Hände. Seine weißen, gepflegten Finger waren einen guten Zentimeter länger als bei anderen Männern seiner Größe. Wäre er Pianist gewesen, hätte er mühelos eine Duodezime greifen können. Als Puppenspieler hätte er unter den Augen der drei Hexen allein den Schwertkampf zwischen Macbeth und Macduff aufführen können. Aber Andrei war weder Pianist noch Puppenspieler, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Er war der erste Mann im Bojarski, und man sah staunend zu, wie seine Hände in jedem Moment wussten, was sie zu tun hatten.
Soeben hatte er beispielsweise eine Gruppe von Damen an einen Tisch geleitet, wo er sämtliche Stühle gleichzeitig für sie zurückzuziehen schien. Kaum nahm eine der Damen eine Zigarette aus dem Etui, hatte er schon das Feuerzeug in der einen Hand und legte die andere um die Flamme. (Als wäre im Bojarski schon jemals ein Luftzug zu spüren gewesen!) Und als die Dame mit der Weinkarte um eine Empfehlung bat, zeigte er nicht mit bloßem Finger auf den 1900er Bordeaux, wenigstens nicht im teutonischen Sinne, sondern vollführte vielmehr eine Geste ähnlich der, mit der an der Decke der Sixtinischen Kapelle die oberste göttliche Instanz den Lebensfunken spendet. Er verneigte sich, ging durch den Saal und verschwand in der Küche.
Doch es war kaum eine Minute vergangen, als die Tür sich wieder öffnete und Emile heraustrat.
Der Küchenchef, knapp einen Meter siebzig groß und einhundert Kilo schwer, ließ den Blick durch den Raum schweifen und steuerte dann auf den Grafen zu, Andrei hinterdrein. Auf dem Weg quer durch den Speisesaal stieß der Koch an den Stuhl eines Gastes und hätte beinahe einen Hilfskellner, der mit einem Tablett von Tisch zu Tisch ging und abräumte, angerempelt. Vor dem Tisch des Grafen kam er abrupt zum Stehen und musterte ihn, wie man vielleicht einen Gegner abschätzt, bevor man ihn zum Duell herausfordert.
»Bravo, Monsieur«, sagte er in verletztem Ton. »Bravo!«
Damit drehte er sich auf dem Absatz um und ging wieder in die Küche.
Andrei, leicht außer Atem, verneigte sich, sowohl zur Entschuldigung als auch um Hochachtung auszudrücken.
»Es war in der Tat Brennnessel, Eure Exzellenz. Ihr Gaumen ist wie eh und je unübertroffen.«
Der Graf neigte normalerweise nicht dazu, sich zu brüsten, doch jetzt konnte er ein zufriedenes Lächeln nicht unterdrücken.
Andrei, der wusste, dass der Graf eine Schwäche für Süßes hatte, deutete auf den Wagen mit den Desserts.
»Darf ich Ihnen ein Stück Pflaumentorte auf Kosten des Hauses bringen?«
»Vielen Dank für die Freundlichkeit, Andrei. Normalerweise gern, aber heute habe ich mich schon anderweitig festgelegt.«
Nachdem der Graf verstanden hatte, dass ein Mensch Herr seiner Umstände sein muss, wenn er nicht von ihnen beherrscht werden will, begann er zu überlegen, wie ein Mensch das erreichen konnte, wenn er zu einem Leben unter Hausarrest verdammt worden war.
Für Edmond Dantès im Château d’If waren es Rachegedanken, die ihm halfen, einen klaren Verstand zu bewahren. Nachdem er ungerechterweise ins Gefängnis gesperrt worden war, hielt er sich mit Gedanken an die systematische Vernichtung der Personen aufrecht, die diese Niederträchtigkeit gegen ihn verübt hatten. Cervantes, der in Algier von Piraten festgehalten wurde, gab die Aussicht auf das, was er noch schreiben wollte, die nötige Kraft, während Napoleon, der auf Elba zwischen Hühnern umherstapfte, Fliegen verscheuchte und Schlammpfützen vermied, von der Vorstellung seiner triumphalen Rückkehr nach Paris gestärkt wurde.
Der Graf jedoch hatte nicht das Naturell für Rache, ihm fehlte die Phantasie, um Epen zu schreiben, und schon gar nicht besaß er das Selbstbewusstsein, sich in Träumen als der Retter eines Reiches zu sehen. Nein. Ihm sollte als Vorbild für die Beherrschung seiner Umstände ein ganz anderer Gefangener dienen, ein Engländer nämlich, der an Land gespült worden war. Wie Robinson Crusoe, der auf der Insel der Verzweiflung gestrandet war, würde der Graf durchhalten, indem er sich mit den praktischen Dingen befasste. Haben die Crusoes dieser Welt den Traum schneller Rettung erst einmal abgehakt, suchen sie Unterschlupf und eine Wasserquelle. Sie bringen sich bei, mit Feuerstein ein Feuer zu entzünden, und studieren die Topographie der Insel, das Klima, die Flora und Fauna, während sie mit den Augen unermüdlich den Horizont nach Segeln absuchen und den Sand nach Fußspuren.
Mit diesem Ziel vor Augen hatte der Graf dem alten Griechen die drei Briefe ausgehändigt. Binnen weniger Stunden waren zwei Boten beim Grafen erschienen: Ein junger Mann kam von Muir & Mirrielees und brachte feine Leinenbetttücher und ein gutes Kissen, ein anderer kam aus der Petrowski-Passage mit vier Stücken von der Lieblingsseife des Grafen.
Und die dritte Briefempfängerin? Offenbar war sie ins Hotel gekommen, als der Graf beim Essen war. Denn auf seinem Bett stand ein hellblauer Karton, der ein einzelnes Mille-feuille enthielt.
Ein Termin
Nie war das Schlagen der Uhr um zwölf so herbeigesehnt worden. Nicht in Russland. Nicht in Europa. In der ganzen Welt nicht. Hätte Romeo von Julia erfahren, dass sie um zwölf Uhr mittags an ihrem Fenster erscheinen würde, hätte das Entzücken des jungen Mannes aus Verona, als die Stunde gekommen war, dem des jungen Grafen nicht gleichkommen können. Wäre Herrn Stahlbaums Kindern – Fritz und Clara – am Weihnachtstag gesagt worden, dass die Türen zum Salon um die Mittagszeit aufgehen würden, hätte ihre Freude die des Grafen beim ersten Glockenschlag nicht übertreffen können.
Denn nachdem der Graf erfolgreich jeden Gedanken an die Twerskajastraße (und die zufälligen Begegnungen mit modischen jungen Damen) abgewehrt hatte, nachdem er gebadet und sich angezogen und seinen Kaffee getrunken und das Obst (heute eine Feige) gegessen hatte, nahm er kurz nach zehn die Lektüre von Montaignes Meisterwerk wieder auf, wobei er allerdings merkte, dass sein Blick spätestens alle fünfzehn Zeilen zur Uhr wanderte …
Zugegeben, dem Grafen war am Tag zuvor, als er das Buch zum ersten Mal vom Schreibtisch genommen hatte, leicht beklommen zumute gewesen. Denn das Werk, in einem einzigen Band, hatte die Dichte eines Wörterbuchs oder einer Bibel – Bücher also, in denen man blättern oder etwas nachschlagen konnte, die man aber niemals ganz las. Als sich der Graf das Inhaltsverzeichnis ansah – die Liste von einhundertsieben essai mit Titeln wie Beständigkeit, Mäßigung, Einsamkeit, Schlaf –, fand er seinen ursprünglichen Verdacht bestätigt, dass nämlich das Buch im Hinblick auf Winterabende geschrieben worden war. Zweifellos war es ein Buch für die Zeit, wenn die Vögel ihre Reise nach Süden angetreten hatten und das Holz beim Kamin gestapelt war und die Felder unter einer Schneedecke lagen, eine Zeit mithin, in der man nicht den Wunsch verspürte, das Haus zu verlassen, und die Freunde keinen Wunsch hatten, einen zu besuchen.
Dennoch sah der Graf entschlossen auf die Uhr, so wie ein erfahrener Schiffskapitän die genaue Zeit festhält, wenn er den Hafen zu einer großen Reise verlässt, und wagte sich erneut in die Wellen der ersten Meditation: »Auf verschiedenen Wegen erreichen wir dasselbe Ziel.« In diesem ersten essai – der treffende Beispiele aus den Annalen der Geschichte enthielt – lieferte der Autor eine überaus überzeugende Argumentation dafür, dass man, wenn man auf Gedeih und Verderb einem anderen ausgeliefert war, um Gnade bitten solle.
Oder stolz und ungebeugt bleiben solle.
Nachdem der Autor festgestellt hatte, dass beide Haltungen richtig sein konnten, ging er zu seiner zweiten Meditation über: »Von der Traurigkeit«.
Hier führte Montaigne eine ganze Reihe von unanfechtbaren Quellen des Goldenen Zeitalters an, die schlüssig darstellten, dass Traurigkeit ein Gefühl ist, das man am besten mit anderen teilt.
Oder für sich behält.
Irgendwo in der Mitte des dritten essai fiel dem Grafen plötzlich auf, dass er schon das vierte oder fünfte Mal auf die Uhr geguckt hatte. Oder sogar das sechste Mal? Obwohl die genaue Anzahl der Blicke zur Uhr nicht festgestellt werden konnte, schien doch die Vermutung nahezuliegen, dass die Aufmerksamkeit des Grafen immer wieder zur Uhr hingezogen wurde.
Aber schließlich, was war das auch für ein Chronometer!
Die Uhr mit dem Zweimalschlag, von der alteingesessenen Firma Breguet für den Vater des Grafen gefertigt, war ein wahrhaftes Meisterstück. Das Ziffernblatt aus weißer Emaille hatte die Größe einer Pampelmuse, die Schmucksteine aus Lapislazuli bildeten von oben nach unten eine asymptotische Kurve, während das innere Werk aus Edelsteinen von Uhrmachern hergestellt worden war, die in der ganzen Welt für ihre unfehlbare Präzision bekannt waren. Und dieser Ruf war wohlbegründet. Denn während der Graf sich in den dritten essai vertiefte (in dem Plato, Aristoteles und Cicero sich mit Kaiser Maximilian auf eine Couch drängten), konnte der Graf jedes einzelne Ticken hören.
Zehn Uhr, zwanzig Minuten und sechsundfünfzig Sekunden zeigte die Uhr an.
Zehn Uhr zwanzig und siebenundfünfzig.
Achtundfünfzig.
Neunundfünfzig.
Ja, die Uhr zählte die Sekunden so präzise wie Homer seine Versfüße und Petrus die Sünden der Sünder.
Aber wo waren wir stehengeblieben?
Ach ja, beim dritten essai.
Der Graf verschob seinen Lehnstuhl etwas nach links, um die Uhr nicht mehr im Blickfeld zu haben, dann suchte er den Absatz, den er gelesen hatte. Er war sich fast sicher, dass es der fünfte Absatz auf Seite fünfzehn war. Doch als er wieder in die Sätze eintauchte, schien ihm der Zusammenhang völlig unvertraut, so wie auch die Absätze unmittelbar davor. Schließlich musste er drei Seiten zurückblättern, bis er ein Stück fand, das ihm hinreichend bekannt vorkam, so dass er vertrauensvoll weiterlesen konnte.
»Ist es bei Ihnen auch so?«, wollte der Graf von Montaigne wissen. »Ein Schritt vorwärts, zwei zurück?«
Entschlossen zu zeigen, wer hier wen beherrschte, gelobte der Graf, erst dann wieder aufzublicken, wenn er den fünfundzwanzigsten essai gelesen hatte. Mit diesem Vorsatz las der Graf die essai vier, fünf und sechs zügig durch. Und als er auch den siebten und achten recht schnell gelesen hatte, schien der fünfundzwanzigste essai so nah wie eine Wasserkaraffe auf dem Esstisch.
Doch während der Graf sich mit den essai elf, zwölf und dreizehn abmühte, schien sein Ziel wieder in weite Ferne zu rücken. Jetzt war das Buch nicht mehr der Esstisch, sondern eine Art Sahara. Und nachdem der Graf seine Wasserflasche geleert hatte, müsste er bald über die Sätze kriechen, und hinter jedem hart eroberten Gipfel einer gelesenen Seite käme nur ein neuer zum Vorschein …
Gut, dann war das eben so. Der Graf kroch weiter.
Über die elfte Stunde hinweg.
Über den sechzehnten essai hinweg.
Dann, plötzlich, holte der schnell ausschreitende Wächter der Minuten seinen krummbeinigen Bruder oben auf dem Ziffernblatt ein. Als die beiden sich trafen, lockerten sich die Federn im Uhrwerk, die Zahnräder drehten sich, und der kleine Hammer ließ den ersten der lieblichen Töne erklingen, die zwölf Uhr mittags anzeigten.