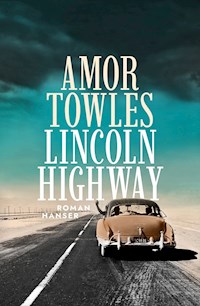Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beim Besuch einer Kunstausstellung in New York erkennt Kate auf zwei Fotos ihre Jugendliebe Tinker Grey wieder. Sie durchlebt daraufhin Erinnerungen an einen ausgelassenen Sommer im New York der späten 30er, den sie als Dreiergespann mit ihrer besten Freundin Eve gemeinsam verbracht haben – ehe er durch einen verheerenden Unfall ein plötzliches Ende fand. "Eine Frage der Höflichkeit" ist zugleich ein elegantes modernes Märchen und ein mitreißendes Gesellschaftsporträt in der Erzähltradition von F. Scott Fitzgerald.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Beim Besuch einer Kunstausstellung in New York erkennt Kate auf zwei Fotos ihre Jugendliebe Tinker Grey wieder. Sie durchlebt daraufhin Erinnerungen an einen ausgelassenen Sommer im New York der späten 30er, den sie als Dreiergespann mit ihrer besten Freundin Eve gemeinsam verbracht haben — ehe er durch einen verheerenden Unfall ein plötzliches Ende fand. »Eine Frage der Höflichkeit« ist zugleich ein elegantes modernes Märchen und ein mitreißendes Gesellschaftsporträt in der Erzähltradition von F. Scott Fitzgerald.
Amor Towles
Eine Frage der Höflichkeit
Roman
Aus dem Amerikanischen von Susanne Höbel
Hanser
Für Maggie, meinen Kometen
Da sprach er zu seinen Knechten: »Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren’s nicht wert. Darum geht hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet.« Und die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute; und die Tische wurden alle voll.
Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an, und sprach zu ihm: »Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an?« Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: »Bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus! Da wird sein Heulen und Zähneklappern.« Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Matthäus 22, 8—14
IM MUSEUM OF MODERN ART
Vorspann
Am Abend des 4. Oktober 1966 gingen Val und ich, beide nunmehr fortgeschritteneren Alters, zur Eröffnung der Fotoausstellung Many Were Called im Museum of Modern Art — die erste Ausstellung der Porträts, die Walker Evans in den späten Dreißigerjahren mit versteckter Kamera in der New Yorker Subway gemacht hatte.
Es war, wie es in den Klatschspalten gern hieß, eine »Veranstaltung der Superlative«. Die Männer waren im Anzug, mit weißem Hemd mit schwarzer Fliege, entsprechend der Palette der Fotos, die Frauen trugen leuchtend bunte Kleider in jeder Länge, von knöchellang bis zwei Handbreit über dem Knie. Arbeitslose junge Schauspieler mit makellosen Zügen und der Anmut von Akrobaten reichten Champagner auf kleinen, runden Tabletts herum. Nur wenige Besucher sahen sich die Bilder an. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, sich zu amüsieren.
Ein angetrunkenes junges Mädchen der High Society stolperte hinter einem Kellner her und hätte mich beinahe umgerannt. Sie war nicht die Einzige in dieser Verfassung. Es galt als salonfähig, ja sogar als schick, bei formellen Anlässen schon vor acht betrunken zu sein.
Aber vielleicht war das nicht so schwer zu verstehen. In den Fünfzigerjahren hatte Amerika den Erdball auf den Kopf gestellt und ihm das Wechselgeld aus den Taschen geschüttelt. Europa war jetzt der arme Verwandte — lauter Familienwappen, aber kein Tafelsilber mehr. Und die voneinander nicht zu unterscheidenden Länder Afrikas, Asiens und Südamerikas hatten gerade erst begonnen, über die Wände unserer Klassenzimmer zu huschen wie Salamander in der Sonne. Klar, irgendwo da draußen waren die Kommunisten, aber nachdem Joe McCarthy unter der Erde und noch niemand auf dem Mond war, geisterten die Russen bislang lediglich durch die Seiten von John le Carrés Romanen.
In gewisser Weise waren wir also alle betrunken. Wir starteten in den Abend wie Satelliten und umkreisten die Stadt zwei Meilen über dem Boden, unser Treibstoff waren die schwachen ausländischen Währungen und die fein gefilterten geistigen Getränke. Wir diskutierten lautstark bei Dinnerpartys, verzogen uns heimlich mit dem falschen Ehepartner ins nächste leere Zimmer und feierten mit der Begeisterung und Indiskretion griechischer Götter. Und morgens wachten wir Punkt halb sieben auf, mit klarem Kopf und voller Optimismus, einsatzbereit, unsere Plätze an den Edelstahlschreibtischen einzunehmen und die Geschicke der Welt zu lenken.
Das Rampenlicht an diesem Abend war nicht auf den Fotografen gerichtet. Evans, Mitte sechzig, dünn und verknittert wie jemand, dem Essen nichts bedeutet, sodass sein Smoking lose an ihm herunterhing, sah so traurig und so unscheinbar aus wie ein pensionierter mittlerer Verwaltungsangestellter von General Motors. Hin und wieder unterbrach jemand seine Einsamkeit und machte eine Bemerkung, aber den größten Teil des Abends stand er unbeholfen in der Ecke wie ein Mauerblümchen auf einem Tanzabend.
Nein, aller Augen galten nicht Evans. Die Blicke galten stattdessen einem jungen Autor mit schütterem Haar, der gerade mit der Veröffentlichung der Affären seiner Mutter einen sensationellen Erfolg gelandet hatte. Von seinem Lektor und seinem Presseagenten flankiert, nahm er haufenweise Komplimente seiner Fans entgegen und sah dabei listig aus wie ein Neugeborenes.
Val blickte erstaunt in die Runde der Schmeichler. Er konnte an einem Tag zehntausend Dollar verdienen, indem er die Fusion eines Schweizer Kaufhauses mit einem amerikanischen Waffenhersteller in die Wege leitete, aber es war ihm schleierhaft, wie so ein bisschen Klatsch einen solchen Aufruhr hervorrief.
Der Presseagent, der seine Umgebung genau im Auge hatte, erspähte mich und winkte mir zu. Ich winkte zurück und hängte mich bei meinem Mann ein.
»Komm, Schatz, sehen wir uns die Bilder an.«
Wir begaben uns in den zweiten Raum der Ausstellung, der weniger voll war, und gingen in aller Ruhe die Wände entlang. In der Mehrzahl waren es querformatige Porträts von Menschen in der Subway, die dem Fotografen direkt gegenübersaßen.
Da war ein ernster junger Mann aus Harlem mit einem keck sitzenden Bowler und einem französischen Oberlippenbärtchen.
Dort ein Vierzigjähriger mit Brille, Pelzkragen und breitkrempigem Hut, Typ Gangsterbuchhalter.
Hier zwei unverheiratete Mädels aus der Kosmetikabteilung bei Macy’s, beide gut in den Dreißigern und etwas sauertöpfisch, weil sie wussten, dass ihre besten Jahre hinter ihnen lagen, mit Augenbrauen, bis hinauf zur Bronx gezupft.
Hier ein Er, da eine Sie.
Hier jemand Junges, da jemand Altes.
Hier jemand Fesches, da jemand Abgerissenes.
Die Fotos waren zwar schon vor fünfundzwanzig Jahren entstanden, aber noch nie öffentlich gezeigt worden. Evans hatte anscheinend Bedenken im Hinblick auf die Privatsphäre der von ihm fotografierten Personen gehabt. Das mag seltsam oder sogar ein wenig übertrieben klingen angesichts der Tatsache, dass er sie in einem so öffentlichen Raum gemacht hatte. Aber wenn man sich die Gesichter entlang den Wänden ansah, konnte man Evans’ Skrupel verstehen. Denn in gewisser Weise fingen die Fotos das Menschsein schonungslos ein. Gedankenverloren, in der Anonymität des Pendlerzugs und ahnungslos, dass ein Fotoapparat direkt auf sie gerichtet war, offenbarten viele von ihnen unbewusst ihr innerstes Ich.
Jeder, der zweimal täglich mit der Subway fährt, um sein Brot zu verdienen, weiß, wie es ist: Beim Einsteigen ist man noch die Person, als die einen auch die Kollegen und Bekannten kennen. So geht man durch das Drehkreuz und durch die automatischen Türen, und die anderen Fahrgäste nehmen uns wahr, wie wir sind: großspurig oder zurückhaltend, verliebt oder gleichgültig, betucht oder am Hungertuch nagend. Dann sucht man sich einen freien Platz, und der Zug fährt los; eine Station folgt auf die andere; Menschen steigen ein und aus. Und bei dem einschläfernden Geschaukel des Zuges gleitet die sorgfältig fabrizierte Persönlichkeit von einem ab. Wenn die Gedanken um Sorgen und Träume zu schweifen beginnen, löst sich das Über-Ich auf, oder vielmehr, es entschwebt in eine Art Hypnose, wo selbst Sorgen und Träume in den Hintergrund treten und eine friedliche, kosmische Stille sich über alles legt.
Da geht es uns allen gleich. Nur dass dieser Zustand nach unterschiedlich vielen Stationen eintritt. Bei manchen nach zweien, bei anderen nach dreien. 68. Straße, 59. Straße, 51. Straße, Grand Central. Welche Erholung, diese wenigen Minuten, in denen wir den Blick ins Unbestimmte gleiten lassen und den einzig wahren Trost finden, den menschliche Isolation ermöglicht.
Wie befriedigend diese fotografische Studie für die Uneingeweihten gewesen sein musste! Für die jungen Anwälte und Banker und die munteren jungen Mädchen aus reichem Hause, die durch die Ausstellung schlenderten und beim Anblick der Bilder sicherlich dachten: Was für eine Tour de Force. Was für eine künstlerische Leistung. Hier sehen wir endlich das Antlitz der Menschheit!
Doch für diejenigen von uns, die damals jung waren, sahen die Gestalten aus wie Geister.
Die Dreißigerjahre …
Was für ein aufreibendes Jahrzehnt das war.
Ich war sechzehn, als die Depression begann, gerade alt genug, um all meine Träume und Erwartungen vom leichtfüßigen Glanz der Zwanzigerjahre täuschen zu lassen. Es war, als hätte Amerika die Depression nur deshalb erfunden, um Manhattan eine Lektion zu erteilen.
Nach dem Börsenkrach konnte man zwar nicht hören, wie die Leichen auf dem Pflaster aufschlugen, aber es gab so etwas wie ein gemeinschaftliches Aufstöhnen und dann eine Stille, die sich wie Schnee auf die Stadt senkte. Die Lichter flackerten. Die Musiker legten ihre Instrumente ab, und die Menschen bewegten sich leise zum Ausgang.
Dann drehte der Wind von West nach Ost und blies die Wanderarbeiter bis in die 42. Straße. Er trieb große Wolken vor sich her, die sich über die Zeitungsstände und Parkbänke legten und auf die Seligen und Verdammten gleichermaßen senkten, wie die Asche von Pompeji. Plötzlich hatten wir unsere eigenen Armen — zerlumpt und niedergedrückt schleppten sie sich durch die Straßen, an den Feuern in Ölfässern vorbei, an schäbigen Behausungen und billigen Herbergen vorbei, unter Brücken hindurch; sie bewegten sich langsam, aber zielbewusst auf ein inneres Kalifornien zu, das ebenso armselig und unbarmherzig war wie die Wirklichkeit. Armut und Ohnmacht. Hunger und Hoffnungslosigkeit. Zumindest bis die ersten Anzeichen von Krieg unsere Schritte beflügelten.
Ja, die Fotos der verstecken Kamera von Walker Evans, aufgenommen zwischen 1938 und 1941, zeigten das Menschsein. Und zwar einen ganz bestimmten Aspekt des Menschseins — den des Gedemütigten. Ein paar Schritte vor uns sah sich eine junge Frau die Fotos an. Sie mochte kaum älter als zweiundzwanzig sein. Jedes Bild schien sie angenehm zu überraschen — als wäre sie in der Ahnengalerie eines Schlosses, wo alle Gesichter majestätisch und entrückt wirken. Ihr Teint war gerötet und von naiver Schönheit, die mich mit Neid erfüllte.
Für mich waren die Gesichter auf den Bildern nicht entrückt. Der gedemütigte Ausdruck, der nicht erwiderte Blick, sie waren mir sehr vertraut. So ähnlich ist die Erfahrung, die man in einem Hotel einer fremden Stadt machen kann, wenn die Aufmachung und das Verhalten der Menschen in der Halle dem eigenen so ähnlich sind, dass man geradezu zwangsläufig auf jemanden treffen wird, den man nicht sehen möchte.
Und genau das passierte dann auch, gewissermaßen.
»Das ist Tinker Grey«, sagte ich, als Val schon zum nächsten Bild ging.
Er kam wieder zu mir, um sich das Foto eines schlecht rasierten achtundzwanzigjährigen Mannes in einem blank gewetzten Mantel genauer anzusehen.
Er war abgemagert, hatte den rosigen Hauch seiner Wangen fast verloren, sein Gesicht sah schmutzig aus. Aber seine Augen leuchteten wach und lebendig und blickten unverhohlen geradeaus, und die winzige Spur eines Lächelns auf seinen Lippen erweckte den Anschein, als wäre er derjenige, der den Fotografen betrachtet. Und derjenige, der uns betrachtet. Er sah uns über drei Jahrzehnte hinweg an, über eine weite Schlucht von Begegnungen hinweg, wie eine Erscheinung. Und sah doch ganz aus wie er selbst.
»Tinker Grey …«, wiederholte Val zögerlich. »Ich glaube, mein Bruder kannte einen Bankier, der Grey hieß …«
»Ja«, sagte ich. »Das ist er.«
Val sah sich das Bild jetzt genauer an — mit dem höflichen Interesse, das ein entfernter Bekannter verdient, der inzwischen verarmt ist. Aber die Frage, wie gut ich den Mann gekannt hatte, musste ihm durch den Sinn gegangen sein.
»Unglaublich«, sagte Val schlicht und runzelte kaum merklich die Stirn.
In dem Sommer, in dem Val und ich uns kennenlernten, waren wir erst um die dreißig und hatten vom Erwachsenenleben des jeweils anderen kaum mehr als ein Jahrzehnt versäumt. Aber das war eine Menge Zeit. Genug, um richtig oder falsch gelebt zu haben. Genug, um gemordet oder etwas erschaffen zu haben — und zumindest genug, um jemanden zu berechtigen, eine Frage dazu zu stellen.
Aber für Val galt es nur selten als Tugend, auf Vergangenes zurückzublicken, und hinsichtlich der Geheimnisse meiner Vergangenheit, wie auch in fast jeder anderen Hinsicht, war er in erster Linie ein Gentleman.
Trotzdem machte ich ein Geständnis.
»Er war auch einer meiner Bekannten«, sagte ich. »Er gehörte eine Weile zu meinem Freundeskreis. Aber ich habe seit vor dem Krieg nichts mehr von ihm gehört.«
Vals Stirn glättete sich. Vielleicht beruhigte ihn die vermeintliche Schlichtheit dieser wenigen Fakten. Er betrachtete das Bild jetzt mit maßvollem Interesse und schüttelte kurz den Kopf, womit er den Zufall kommentierte und gleichzeitig bekräftigte, wie ungerecht doch die Depression war.
»Unglaublich«, sagte er wieder, diesmal einfühlsamer. Er nahm meinen Ellbogen und führte mich sanft weiter.
Wir verbrachten die erforderliche Minute vor dem nächsten Bild. Und dem nächsten und dem nächsten. Aber jetzt zogen die Gesichter an mir vorbei wie Fremde, die auf der Rolltreppe in die entgegengesetzte Richtung fahren. Ich nahm sie kaum wahr.
Tinker lächeln zu sehen … Nach all den Jahren war ich nicht darauf gefasst. Es war, als hätte mich jemand hinterrücks überrascht.
Vielleicht war es nur Selbstzufriedenheit — die unbegründete süße Selbstzufriedenheit wohlhabender Leute mittleren Alters in Manhattan —, aber als ich das Museum betrat, hätte ich ohne Weiteres ausgesagt, dass mein Leben ein perfektes Gleichgewicht erreicht hatte. Unsere Ehe war ein Bund zweier Seelen, zweier Großstadtgeister, die sich so sanft und unausweichlich der Zukunft zuneigten wie weißes Papier der Sonne.
Doch nun stellte ich fest, dass meine Gedanken in die Vergangenheit strebten. Sie kehrten der mühsam erwirkten Perfektion des Jetzt den Rücken und suchten nach den süßen Unwägbarkeiten eines verflossenen Jahres und seinen zufälligen Begegnungen — Begegnungen, die damals willkürlich und prickelnd schienen, die aber im Laufe der Zeit etwas Schicksalhaftes angenommen hatten.
Ja, meine Gedanken wanderten zu Tinker und zu Eve — aber auch zu Wallace Wolcott und Dicky Vanderwhile. Und auch zu Anne Grandin.
Und zu den Drehungen des Kaleidoskops, die meinen Erlebnissen im Jahr 1938 Farbe und Form verliehen hatten.
Hier stand ich, neben meinem Mann, und hatte Mühe, die Erinnerungen an dieses Jahr für mich zu behalten.
Nicht dass eine einzige so skandalös gewesen wäre, um Val zu schockieren oder unsere Ehe zu bedrohen — im Gegenteil, hätte ich ihm davon erzählt, wäre er sicherlich noch liebevoller zu mir gewesen. Aber ich wollte ihm nicht davon erzählen. Ich wollte die Erinnerungen nicht verwässern.
Mehr als alles andere wollte ich allein sein. Ich wollte aus dem blendenden Licht meines jetzigen Daseins treten. Ich wollte in einer Hotelbar einen Drink bestellen. Oder, noch besser, mit dem Taxi ins Village fahren, zum ersten Mal nach so langer Zeit …
Ja, auf dem Bild sah Tinker arm aus. Er sah aus, als wäre er arm und hungrig und ohne Aussichten. Aber er sah auch jung und kraftvoll aus. Und seltsam lebendig.
Plötzlich kam es mir so vor, als würden die Gesichter an der Wand mich ansehen. Die Geister in der Subway, müde und allein, betrachteten mein Gesicht und bemerkten die Spuren der Kompromisse, die unseren Gesichtern im fortschreitenden Alter ihr ganz eigenes Pathos verleihen.
Dann überraschte Val mich. »Lass uns gehen«, sagte er.
Ich sah ihn an, er lächelte.
»Komm. Wir können an einem Vormittag wiederkommen, wenn es nicht so voll ist.«
»Ist gut.«
Die Menschen drängten sich in der Mitte des Ausstellungsraums, wir gingen also außen an den Bildern entlang. Die Gesichter flackerten vorüber wie die von Gefangenen in den kleinen Fenstern ihrer Zellentüren. Sie folgten mir mit ihrem Blick, als wollten sie sagen: Wo willst du denn hin? Und dann, kurz vor dem Ausgang, blieb ich abrupt bei einem der Fotos stehen.
Ein schmerzliches Lächeln trat in mein Gesicht.
»Was ist?«, fragte Val.
»Da ist er wieder.«
Zwischen den Fotos von zwei älteren Frauen hing ein zweites Porträt von Tinker. Tinker im Kaschmirmantel, glatt rasiert, ein praller Krawattenknoten zwischen den Kragenspitzen eines maßgeschneiderten Hemdes.
Val zog mich an der Hand zu dem Bild, bis wir knapp davorstanden. »Du meinst, das ist derselbe wie auf dem anderen Bild?«
»Ja.«
»Unmöglich.«
Val ging noch einmal zu dem anderen Bild zurück. Ich sah, wie er auf der anderen Seite des Raumes das schmutzige Gesicht studierte und nach erkennbaren Merkmalen suchte. Er kam zurück und stellte sich wieder unmittelbar vor den Mann im Kaschmirmantel. »Nicht zu fassen«, sagte er. »Es ist tatsächlich derselbe Mann.«
»Treten Sie bitte einen Schritt von der Wand zurück«, sagte ein Museumswächter.
Wir traten zurück.
»Wenn man es nicht wüsste, würde man sie für völlig verschiedene Personen halten.«
»Ja«, sagte ich, »du hast recht.«
»Na, auf jeden Fall hat er sich wieder berappelt.«
Plötzlich war Val guter Dinge. Der Weg vom abgetragenen Mantel zum Kaschmirmantel entsprach seinem natürlichen Optimismus.
»Nein«, sagte ich, »das hier ist das frühere Bild.«
»Wie meinst du das?«
»Das andere Bild ist nach diesem hier entstanden. Es ist von 1939.« Ich zeigte auf die Legende. »Das hier ist von 1938.«
Man konnte Val den Irrtum nicht verdenken. Es war nur natürlich, dass er dies für das spätere Bild hielt, nicht nur, weil es in der Ausstellung später kam, sondern auch, weil Tinker auf dem Bild von 1938 zwar wohlhabender aussah, aber auch älter wirkte. Sein Gesicht war voller, es zeugte von einer pragmatischen Weltgewandtheit, als hätte eine Reihe von Erfolgen auch die eine oder andere hässliche Wahrheit im Schlepptau gehabt. Das andere Foto hingegen, ein Jahr später aufgenommen, war eher das Porträt eines Zwanzigjährigen in Friedenszeiten: lebendig, furchtlos, naiv.
Tinkers Schicksal machte Val verlegen.
»Oh«, sagte er. »Das tut mir leid.«
Wieder nahm er meinen Arm und schüttelte den Kopf, für Tinker und für uns alle.
»Nach dem Aufstieg der Niedergang«, sagte er zärtlich.
»Nein«, sagte ich, »ganz so ist es nicht.«
New York City, 1969
WINTER
1. Kapitel
VOR LANGER ZEIT
Es war der letzte Abend des Jahres 1937.
Da wir nichts Besseres vorhatten, schleppte meine Zimmergenossin mich wieder in den Nachtklub in Greenwich Village mit dem optimistischen Namen Hotspot, zu dem man anderthalb Meter hinabsteigen musste.
Wenn man sich im Klub umsah, hätte man nicht gedacht, dass es Silvesterabend war. Keine Papphüte, keine Luftschlangen, auch keine Tröten. Hinten im Lokal, am Rand der leeren Tanzfläche, spielte ein Jazzquartett ohne Sänger alte Schlager. Der Saxofonist, ein traurig anmutender Riese, seine Haut schwarz wie Maschinenöl, hatte sich anscheinend im Labyrinth eines seiner langen, einsamen Soli verirrt. Der Bassist, ein Milchkaffeemulatte mit einem kleinen, abwärts geschwungenen Oberlippenbärtchen, war darauf bedacht, ihn nicht zu sehr anzutreiben. Plong-plong-plong machte er im halben Pulsschlagtempo.
Die wenigen Gäste sahen fast so melancholisch aus wie die Band. Niemand war festlich gekleidet. Es gab ein paar Pärchen hier und da, aber keine Liebespaare. Wer verliebt war oder Geld hatte, war im Café Society um die Ecke und tanzte zu Swing. Zwanzig Jahre später sollte die ganze Welt in solchen Kellerlokalen hocken und einem ungeselligen Solisten zuhören, der seinem Seelenschmerz nachspürte, aber wenn einer am letzten Abend des Jahres t937 einem Quartett zuhörte, dann lag das daran, dass er sich das ganze Orchester nicht leisten konnte oder dass er keinen guten Grund hatte, den Jahreswechsel zu feiern.
Wir fanden das alles sehr tröstlich.
Nicht dass wir unbedingt verstanden, was wir da hörten, aber wir begriffen, dass die Musik gewisse Vorteile hatte. Sie würde keine Hoffnungen in uns wecken, aber auch keine zerstören. Sie hatte einen gewissen Rhythmus und ein Übermaß an Aufrichtigkeit. Sie war Grund genug, unser Zimmer zu verlassen, und so behandelten wir sie auch, beide in bequemen flachen Schuhen und einem kleinen Schwarzen. Obwohl Eve, wie mir auffiel, unter ihrem Fummel ihre beste gestohlene Unterwäsche trug.
Eve Ross …
Eve war eine der überraschenden Schönheiten aus dem Mittleren Westen Amerikas.
In New York konnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass die attraktivsten Frauen in der Stadt aus Paris oder Mailand angereist waren. Dabei sind die eine Minderheit. Eine viel größere Schar kommt aus den bodenständigen Staaten, die mit I anfangen — Iowa, Indiana, Illinois. Wenn diese Blondinen, die mit genau der richtigen Mischung aus frischer Luft, Ungestüm und Unwissenheit aufgewachsen waren, sich von den Weizenfeldern auf den Weg machten, sahen sie aus wie Sternenglanz auf Beinen. Jeden Morgen im Frühling hüpfte eine von ihrer Veranda, ein Sandwich in einer Zellophantüte, und hielt an der Straße den ersten Greyhound nach Manhattan an — der Stadt, wo alles, was schön ist, willkommen geheißen, mit prüfendem Blick gemustert und wenn schon nicht gleich angenommen, so doch zumindest ausprobiert wird.
Ein großer Vorteil der Mädchen aus dem Mittleren Westen bestand darin, dass man sie nicht unterscheiden konnte. Eine reiche New Yorkerin kann man jederzeit von einer armen unterscheiden. Auch eine reiche Bostonerin von einer armen. Dafür gibt es Aussprache und Manieren. Aber für den gebürtigen New Yorker sahen alle Mädchen aus dem Mittleren Westen gleich aus und klangen auch gleich. Sicher, die Mädchen waren je nach Herkunft in unterschiedlichen Elternhäusern aufgewachsen und auf verschiedene Schulen gegangen, aber ihnen war doch so viel von der Demut des Mittleren Westens gemein, dass uns die feinen Abstufungen von Reichtum und Privilegien verborgen blieben. Oder vielleicht schrumpften die Unterschiede (die in Des Moines zweifellos deutlich zutage traten) angesichts der Bandbreite der sozialen Schichten, dieser tausendfach geschichteten Gletscherformation, die von einem Mülleimer in der Bowery bis zu einem Penthouse im Paradies reichte. Wie auch immer, in unseren Augen sahen sie allesamt wie die Unschuld vom Lande aus: unbefleckt, großäugig, gottesfürchtig, obwohl nicht unbedingt frei von Sünde.
Eve stammte aus Indiana, aus Familienverhältnissen am oberen Ende der Einkommensskala. Ihr Vater wurde in einem Firmenwagen ins Büro gefahren, und sie aß zum Frühstück Toast, den ihr eine Negerin namens Sadie zubereitete. Sie war zwei Jahre auf einem Mädchenpensionat gewesen und hatte einen Sommer in der Schweiz verbracht, vorgeblich, um Französisch zu lernen. Aber wenn man sie in einer Bar kennenlernte, ließ sich nicht eindeutig sagen, ob sie eine vom Land kommende Glücksjägerin war oder eine Millionärin auf Vergnügungstour. Mit Bestimmtheit konnte man nur sagen, dass sie eine echte Schönheit war. Und das machte es umso leichter, sie kennenzulernen.
Sie war unbestreitbar von Natur aus blond. Ihr schulterlanges Haar, das im Sommer die Farbe von gelbem Sand hatte, färbte sich im Herbst golden, im Gleichklang mit den heimatlichen Weizenfeldern. Sie hatte ein fein gezeichnetes Gesicht, blaue Augen und zwei punktgroße Grübchen, die so klar zu sehen waren, dass man denken konnte, an den Innenseiten ihrer Wangen sei ein Draht befestigt, der straff gezogen wurde, wenn sie lächelte. Zwar war sie nur einen Meter fünfundsechzig groß, aber sie konnte in Schuhen mit zehn Zentimeter hohen Absätzen elegant tanzen, und sie wusste sie ebenso schwungvoll wegzuschleudern, sobald sie bei einem Verehrer auf dem Schoß landete.
Fairerweise musste man sagen, dass Eve sich in New York ernsthaft ins Zeug legte. Als sie 1936 in die Stadt kam, hatte sie genug Geld von ihrem Vater dabei, um in Mrs. Martingales Pension ein Einzelzimmer zu nehmen, und genug von seinem Einfluss im Rücken, um bei der Pembroke Press eine Stelle als Werbeassistentin zu bekommen — wo sie für all die Bücher, die sie in der Schule so fleißig gemieden hatte, Werbung machen musste.
Als sie sich an ihrem zweiten Abend in der Pension zum Essen an den Tisch setzte, rutschten ihr die Spaghetti vom Teller und mir in den Schoß. Mrs. Martingale sagte, am besten könne man die Flecken mit Weißwein rausbekommen. Sie holte eine Flasche Chablis-Kochwein aus der Küche und schickte uns damit ins Badezimmer. Dort verteilten wir ein bisschen von dem Wein auf meinem Rock und tranken den Rest auf dem Boden sitzend und mit dem Rücken an die Tür gelehnt.
Sobald Eve ihre erste Gehaltszahlung bekommen hatte, war sie aus dem Einzelzimmer ausgezogen und hörte auf, Geld vom Konto ihres Vaters abzuheben. Nach ein paar Monaten der finanziellen Selbstständigkeit schickte ihr Daddy ihr einen Umschlag mit zehn Fünfzig-Dollar-Scheinen und einen Brief, in dem er ihr mitteilte, wie stolz er auf sie sei. Sie schickte das Geld zurück, als wäre es mit TB infiziert.
»Ich lasse mich verwöhnen und hofieren«, hatte sie gesagt, »aber nicht herumkommandieren.«
Also schnallten wir beide den Gürtel enger. Beim Frühstück in der Pension aßen wir alles, was auf den Tisch kam, und mittags hungerten wir. Wir tauschten mit den Mädchen auf unserer Etage die Kleider. Wir schnitten uns gegenseitig die Haare. Freitagabends erlaubten wir Jungen, die wir keinesfalls küssen wollten, uns Drinks zu spendieren, und für ein Essen küssten wir welche, die wir kein zweites Mal küssen wollten. An manchem regnerischen Mittwoch, wenn die Ehefrauen der Wohlhabenden bei Benders einkaufen gingen, zog Eve in Rock und Blazer, ihren besten Sachen, los, fuhr mit der Rolltreppe in den zweiten Stock und stopfte sich jede Menge Seidenstrümpfe in den Slip. Und wenn wir mit der Miete im Rückstand waren, spielte sie großartiges Theater, stellte sich an Mrs. Martingales Tür und vergoss die salzlosen Tränen der Großen Seen.
An besagtem Silvesterabend nahmen wir uns vor, so viel wie möglich aus drei Dollar rauszuholen. Mit Männern hatten wir nichts am Hut. Mehr als einer davon hatte im Laufe des Jahres seine Chance bei uns gehabt, und wir wollten die letzten Stunden nicht an Nachzügler verschwenden. Wir wollten uns in diese einfache Bar hocken, wo die Musik so ernst genommen wurde, dass niemand zwei attraktive Mädchen belästigen würde, und wo der Gin so billig war, dass jede von uns pro Stunde einen Martini trinken konnte. Dafür wollten wir ein bisschen mehr rauchen, als in guter Gesellschaft erlaubt war. Und sobald Mitternacht ohne weitere Zeremonie verstrichen war, würden wir weiterziehen in ein ukrainisches Lokal auf der Second Avenue, wo es die ganze Nacht hindurch Kaffee, Eier und Toast für fünfzehn Cent gab.
Doch kurz nach halb zehn tranken wir unseren Elf-Uhr-Gin. Und um zehn vertranken wir das Geld für die Eier auf Toast. Jetzt hatten wir zusammen noch zwanzig Cent und keinen Happen gegessen. Wir mussten uns etwas anderes einfallen lassen.
Eve machte dem Bassisten schöne Augen. Das war eins ihrer Hobbys. Sie flirtete gern mit den Jazzmusikern, während sie spielten, und schnorrte in den Pausen Zigaretten von ihnen. Dieser Bassist war, wie die meisten Kreolen, auf ungewöhnliche Weise attraktiv, aber er war so verzaubert von seiner Musik, dass er die Blechdecke anhimmelte. Eine göttliche Intervention wäre nötig gewesen, wollte Eve seine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich versuchte, ihr zu verstehen zu geben, sie solle sich auf den Barkeeper verlegen, aber sie beachtete mich gar nicht. Stattdessen zündete sie sich eine Zigarette an und warf das Streichholz über die linke Schulter — als Glücksbringer. Wenn wir nicht bald einen barmherzigen Samariter fanden, dachte ich bei mir, würden auch wir die Decke anstarren.
In dem Moment betrat er den Klub.
Eve sah ihn als Erste. Sie drehte sich gerade um und machte eine Bemerkung, als sie ihn über meine Schulter hinweg erblickte. Sie trat mich gegen das Schienbein und deutete mit dem Kopf in seine Richtung. Ich rückte meinen Stuhl rum.
Er sah umwerfend gut aus. Er war gut eins fünfundsiebzig groß, trug einen Abendanzug und hatte einen Mantel über dem Arm. Er hatte braunes Haar, blaue Augen und eine sternförmige Rötung auf den Wangen. Man konnte sich seinen Vorfahr am Bug eines Schoners vorstellen — den Blick forsch zum Horizont gerichtet, das Haar von der salzigen Luft leicht gewellt.
»Meiner«, sagte Eve.
Er blieb an der Tür stehen, wartete, bis seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, und ließ seinen Blick über die Gäste wandern. Offensichtlich hoffte er, jemanden zu treffen, denn sein Blick verriet leichte Enttäuschung, als er feststellte, dass die Person nicht da war. Er setzte sich an den Tisch neben unserem und sah sich noch einmal im Raum um, dann gab er der Kellnerin ein Zeichen und legte, alles in einer einzigen fließenden Bewegung, seinen Mantel über die Lehne des Stuhls neben mir.
Es war ein wunderschöner Mantel. Er war aus kamelfarbener Kaschmirwolle, vielleicht ein bisschen heller, etwa so wie die Haut des Bassisten, und makellos, als käme er direkt vom Schneider. Er hatte bestimmt fünfhundert Dollar gekostet. Oder vielleicht mehr. Eve konnte ihre Augen gar nicht wieder abwenden.
Die Kellnerin näherte sich dem Tisch wie eine Katze der Sofaecke. Einen Moment lang dachte ich, sie würde einen Buckel machen und ihre Klauen in sein Hemd versenken. Als sie seine Bestellung aufnahm, beugte sie sich etwas vor, sodass er ihr in den Ausschnitt gucken konnte. Er schien es gar nicht zu bemerken.
Er bestellte in freundlichem und zugleich höflichem Ton einen Scotch, wobei er der Kellnerin mehr Respekt zollte, als ihr gebührte. Dann setzte er sich bequem zurück und betrachtete seine Umgebung. Als sein Blick von der Bar zur Band glitt, bemerkte er aus dem Augenwinkel Eve, die unentwegt auf seinen Mantel starrte. Er errötete. Er war so sehr damit beschäftigt gewesen, sich umzugucken und der Kellnerin zu winken, und dabei war ihm gar nicht aufgefallen, dass er seinen Mantel über einen Stuhl an unserem Tisch gelegt hatte.
»Oh, entschuldigen Sie bitte«, sagte er. »Wie unhöflich von mir.« Er stand auf und griff nach dem Mantel.
»Nein, nein. Das macht doch nichts«, sagten wir. »Da sitzt ja niemand. Das ist doch in Ordnung.«
Er hielt inne.
»Bestimmt?«
»Unbedingt«, sagte Eve.
Die Kellnerin kam und brachte den Scotch. Sie wollte schon wieder gehen, da hielt er sie zurück und bot an, uns einen Drink zu spendieren — die letzte gute Tat im alten Jahr, erklärte er.
Uns war jetzt schon klar, dass er von der gleichen hervorragenden Qualität war — so vornehm und so vollkommen — wie sein Mantel. Sein Benehmen drückte ein gewisses Selbstvertrauen aus, ein demokratisches Interesse an seiner Umgebung, und die stillschweigende Erwartung, dass man ihm mit Freundlichkeit begegnen würde. So etwas findet man nur bei jungen Männern, die von Geld und guten Manieren umgeben aufgewachsen sind. Ihnen kommt es gar nicht in den Sinn, dass sie irgendwo nicht willkommen sein könnten, weshalb sie normalerweise auch überall gern gesehen sind.
Wenn ein Mann zwei gut aussehenden Mädels einen Drink spendiert, könnte man erwarten, dass er sich mit ihnen unterhält, ganz gleich, auf wen er wartet. Aber unser elegant gekleideter Samariter sprach nicht mit uns. Er hob das Glas einmal mit einem freundlichen Kopfnicken in unsere Richtung und widmete dann seine Aufmerksamkeit der Band.
Nach zwei Stücken machte Eve das unruhig. Immer wieder sah sie zu ihm hinüber und hoffte, er würde etwas sagen. Irgendwas. Einmal trafen sich ihre Blicke, und er lächelte höflich. Mir war klar, dass sie nach diesem Song selbst die Initiative ergreifen und ein Gespräch mit ihm anfangen würde, und wenn sie ihm erst ihren Gin über die Hose kippen musste. Aber dazu kam es nicht.
Als das Stück zu Ende war, sprach der Saxofonist zum ersten Mal seit einer Stunde. Mit sonorer Predigerstimme erging er sich in ausführlichen Erläuterungen über die nächste Nummer. Es war eine neue Komposition. Das Stück war dem Tin-Pan-Alley-Pianisten Silver Tooth Hawkins gewidmet, der mit zweiunddreißig gestorben war. Es hatte etwas mit Afrika zu tun. Es hieß Tincannibal.
Mit dem Fuß — er trug stramm geschnürte Gamaschen — gab er den Takt vor, den der Schlagzeuger mit dem Stahlbesen auf seiner Seitentrommel aufgriff. Dann setzten der Bassist und der Pianist ein. Der Saxofonist hörte andächtig zu und nickte im Takt. Dann schlich er sich mit einer hübschen kleinen Melodie hinein, die im munteren Trab das vorgegebene Tempo einhielt. Im nächsten Moment machte sie mit einem lauten Wiehern, als hätte sie ein Gespenst gesehen, einen Satz über den Zaun und war auf und davon.
Unser Tischnachbar sah aus wie ein Tourist, der sich von einem Gendarmen den Weg erklären lässt. Sein Blick streifte durch Zufall meinen, und er verzog ratlos das Gesicht. Ich lachte, und er lachte zurück.
»Ist da eine Melodie drin?«, fragte er.
Ich rückte meinen Stuhl etwas näher zu ihm und tat so, als hätte ich ihn nicht verstanden. Ich beugte mich in einem Winkel vor, der fünf Grad weniger offenherzig war als vorher bei der Kellnerin.
»Was haben Sie gesagt?«
»Ich wollte nur wissen, ob da eine Melodie drin ist.«
»Die ist eine rauchen gegangen und kommt gleich zurück. Aber ich schließe daraus, dass Sie nicht wegen der Musik hier sind.«
»Merkt man das?«, fragte er und lächelte verlegen. »Ich warte auf meinen Bruder. Er ist der Jazzfan.«
Ich hörte, wie Eves Wimpern auf der anderen Seite des Tisches zu klimpern begannen. Ein Kaschmirmantel und eine Silvesterverabredung mit dem Bruder. Mehr brauchte sie nicht zu wissen.
»Möchten Sie sich so lange zu uns setzen?«, fragte sie.
»Oh. Ich will mich nicht aufdrängen.«
(So etwas hörten wir nicht alle Tage.)
»Sie drängen sich doch nicht auf«, sagte Eve tadelnd.
Wir rückten ein wenig zusammen, und er schob seinen Stuhl an unseren Tisch. »Theodore Grey.«
»Theodore!«, rief Eve aus. »Selbst Roosevelt wurde Teddy genannt.«
Theodore lachte. »Meine Freunde nennen mich Tinker.«
Das hätte man sich gleich denken können. Diese weißen angelsächsischen Protestanten nannten ihre Kinder nur zu gerne nach den alten Handwerksberufen. Tinker — Kesselflicker. Cooper — Böttcher. Smithy — Schmied. Vielleicht wollten sie damit an ihre Ursprünge im Neuengland des 17. Jahrhunderts erinnern — an das ehrliche Handwerk, das sie im Auge ihres Herrn zu so standfesten, demütigen und tugendhaften Menschen gemacht hatte. Vielleicht war es aber auch eine Methode, höflich davon abzulenken, dass sie dazu bestimmt waren, die Besitzenden zu sein.
»Ich bin Evelyn Ross«, sagte Eve und gab ihrem Namen etwas zusätzlichen Glanz. »Und das ist Katey Kontent.«
»Katey Kontent! Wie schön!«
Tinker hob mit einem freundlichen Lächeln sein Glas. »Trinken wir auf das Jahr 1938!«
Tinkers Bruder kam nicht, was uns ganz gut passte, und gegen elf Uhr winkte Tinker der Kellnerin und bestellte eine Flasche Champagner.
»Schampus haben wir nicht, Mister«, sagte sie — und zwar wesentlich kühler, jetzt, da er mit uns am Tisch saß.
Er bestellte stattdessen eine Runde Martini.
Eve war in Hochform. Sie erzählte die Geschichte von zwei Mädchen in ihrer Highschool, die darum wetteiferten, Ballkönigin zu werden, so wie Vanderbilt und Rockefeller darum wetteiferten, wer der reichste Mann der Welt war. Eins der Mädchen ließ am Abend vor dem Abschlussball im Haus ihrer Rivalin ein Stinktier frei, worauf die andere im Vorgarten der Ersten eine Ladung Pferdeäpfel ablud. Die Auseinandersetzung gipfelte am Sonntagmorgen auf den Stufen von Saint Mary, wo die beiden Mütter sich gegenseitig an den Haaren zogen. Father O’Fallon, der es eigentlich hätte besser wissen müssen, versuchte die beiden zu trennen und bekam dabei selbst sein Fett ab.
Tinker lachte so sehr, dass man ahnen konnte, so hatte er seit Langem nicht mehr gelacht. Es brachte alle seine gottgegebenen Vorzüge zum Leuchten: sein Lächeln, seine Augen und die rosa Flecken auf seinen Wangen. Oder vielleicht war es auch eine geheimnisvolle Qualität unter der Oberfläche, die das Leuchten bewirkte.
»Und Sie, Katey?«, fragte er, als er wieder zu Atem kam. »Wo kommen Sie her?«
»Katey ist in Brooklyn aufgewachsen«, sagte Eve — als wäre es ein Grund zum Angeben.
»Wirklich? Wie war es in der Schule dort?«
»Na ja, ich weiß gar nicht, ob es bei uns eine Ballkönigin gab.«
»Du wärst auch nicht zu dem Ball gegangen, wenn es einen gegeben hätte«, sagte Eve.
Eve lehnte sich vertrauensselig zu Tinker vor. »Katey ist ein echter Bücherwurm«, sagte sie. »Wenn man alle Bücher stapeln würde, die sie gelesen hat, könnte man glatt bis zur Milchstraße hochklettern.«
»Vielleicht bis zum Mond«, gab ich zu.
Eve bot Tinker eine Zigarette an. Er lehnte ab, doch in dem Moment, da sie sich selbst eine Zigarette zwischen die Lippen steckte, hatte er schon sein Feuerzeug gezückt. Es war aus Gold mit eingravierten Initialen.
Eve legte den Kopf in den Nacken, schürzte die Lippen und blies den Rauch zur Decke. »Und was ist mit Ihnen, Theodore?«
»Na, wenn man die Bücher, die ich gelesen habe, stapeln würde, könnte man vielleicht in ein Taxi klettern.«
»Nein«, sagte Eve. »Ich meine, was haben Sie gemacht?«
Tinker antwortete mit den ungefähren Auskünften der Reichen: Er kam aus Massachusetts, war in Providence zur Universität gegangen, arbeitete in einer kleinen Firma an der Wall Street — was so viel hieß wie: Er war an der Back Bay geboren, hatte am Brown College studiert und arbeitete jetzt in der Bank, die sein Großvater gegründet hatte. Gewöhnlich waren solche ausweichenden Antworten so offensichtlich unaufrichtig, dass es ein Ärgernis war, aber bei Tinker hatte man den Eindruck, er befürchtete, schon der Schatten einer Ivy-League-Universität würde uns gegen ihn einnehmen. Zum Schluss sagte er, er wohne »Uptown«.
»Wo, Uptown?«, fragte Eve mit gespielter Unschuld.
»211 Central Park West«, sagte er leicht verlegen.
211 Central Park West! Im Beresford. Zweiundzwanzig Stockwerke, und alle Wohnungen mit Terrasse und Blick über den Park.
Eve trat mir wieder unter dem Tisch ans Schienbein, aber dann wechselte sie zum Glück das Thema und fragte ihn nach seinem Bruder: War er älter oder jünger? Kleiner oder größer?
Älter und kleiner. Er hieß Henry Grey, war Maler und wohnte im West Village. Eve fragte, mit welchem Wort man seinen Bruder am besten beschreiben könne, und nachdem Tinker einen Moment lang nachgedacht hatte, sagte er »unbeirrbar« — sein Bruder habe immer gewusst, wer er war und was er tun wollte.
»Klingt anstrengend«, sagte ich.
Tinker lachte. »Das stimmt wahrscheinlich.«
»Und vielleicht ein bisschen langweilig?«, meinte Eve.
»Nein, langweilig ist er mit Sicherheit nicht.«
»Gut, belassen wir es bei ›unbeirrbar‹.«
Irgendwann entschuldigte Tinker sich und ging raus. Fünf Minuten vergingen, dann zehn. Eve und ich wurden unruhig. Er sah nicht aus wie jemand, der uns mit der Rechnung sitzen lassen würde, aber eine Viertelstunde auf der Toilette war sogar für Mädchen eine lange Zeit. Gerade als wir anfingen, unruhig zu werden, kam er wieder. Sein Gesicht war gerötet. Von seinem Anzug stieg die kalte New Yorker Nachtluft auf. Er hielt eine Flasche Champagner hoch und grinste wie ein Junge, der einen Fisch gefangen hat.
»Hat geklappt!«
Er ließ den Korken mit einem Knallen an die Blechdecke fliegen, was uns empörte Blicke der anderen Gäste einbrachte. Nur der Bassist zeigte unter seinem Oberlippenbart die Zähne, nickte und schenkte uns ein kräftiges Plong-plong-plong.
Tinker goss den Champagner in die leeren Martini-Gläser.
»Wir müssen ein paar Vorsätze fürs neue Jahr fassen!«, sagte er.
»Wir sind ohne Vorsätze gekommen, Mister.«
»Wie wär’s, wenn wir füreinander Vorsätze fassen würden?«, schlug Eve vor.
»Bestens!«, sagte Tinker. »Ich fange an. Im neuen Jahr sollten Sie …«
Er musterte uns von oben bis unten.
»… weniger schüchtern sein.«
Wir lachten beide.
»Okay«, sagte Tinker. »Sie sind dran.«
Eve sprach, ohne zu zögern.
»Sie sollten mal aus Ihrem Trott ausbrechen.«
Sie zog eine Augenbraue hoch, dann kniff sie die Augen zusammen, als meinte sie es als Herausforderung. Einen Moment lang war er verdutzt. Offenbar hatte sie etwas in ihm getroffen. Er nickte ein paarmal langsam, dann lächelte er.
»Was für ein schöner Wunsch«, sagte er, »wünschen wir es uns gegenseitig.«
Als Mitternacht näher rückte, konnten wir draußen ausgelassene Stimmen und Autohupen hören. Also beschlossen wir, rauszugehen. Tinker bezahlte mit neuen, knisternden Scheinen und gab ein üppiges Trinkgeld. Eve nahm sich seinen Schal und wickelte ihn sich wie einen Turban um den Kopf. Dann eilten wir zwischen den Tischen hindurch ins Freie.
Draußen schneite es noch immer.
Eve und ich hakten uns rechts und links bei Tinker ein. Wir lehnten uns an seine Schultern, als suchten wir Schutz vor der Kälte, und führten ihn den Waverley Place hinunter zum Washington Square, wo großer Trubel herrschte. Als wir an einem schicken Restaurant vorbeikamen, stiegen gerade zwei Paare mittleren Alters in ein wartendes Auto und fuhren davon. In dem Moment bemerkte der Portier Tinker.
»Noch mal vielen Dank, Mr. Grey«, sagte er.
Zweifelsohne war dies die mit einem großzügigen Trinkgeld bedachte Quelle unseres Champagners.
»Ich danke Ihnen, Paul«, sagte Tinker.
»Frohes neues Jahr, Paul«, sagte Eve.
»Ihnen auch, Madam.«
Schneebedeckt sah der Washington Square besonders schön aus. Jeder Baum und jedes Tor waren überpudert. Die ehemals noblen Brownstone-Häuser, die an Sommertagen bedrückt den Blick senkten, schwelgten einen Moment lang in sentimentalen Erinnerungen. Im zweiten Stock der Nummer 2 war ein Vorhang zurückgezogen, und der Geist Edith Whartons blickte mit scheuem Neid auf den Platz. Sie, die liebenswürdige, feinfühlige, unerfüllte Schriftstellerin, sah uns dreien nach und fragte sich, wann die Liebe, die sie so kunstvoll erdacht hatte, wohl endlich den Mut fände, zu ihrer Tür zu kommen. Wann, zu welcher unpassenden Stunde, würde sie anklopfen und Einlass begehren und an dem Butler vorbei die puritanische Treppe hinaufstürmen und laut ihren Namen rufen?
Niemals, könnte ich mir denken.
Als wir zur Mitte des Platzes kamen, sahen wir, was der Trubel um den Springbrunnen herum zu bedeuten hatte. Eine Gruppe betrunkener Studenten hatte sich versammelt, um das neue Jahr mit einer billigen Ragtimeband einzuläuten. Die Jungen waren alle im Abendanzug, nur vier Studenten aus dem ersten Jahr trugen Pullover, auf denen griechische Buchstaben prangten. Sie schoben sich durch die Menge und füllten die Gläser auf. Ein junges Mädchen in einem für das Wetter unzulänglichen Kleid tat so, als würde es die Band dirigieren, die aber immer nur, sei es aus Gleichgültigkeit, sei es aus mangelnder Erfahrung, ein und dieselbe Melodie spielte.
Plötzlich wurde die Band von einem jungen Mann, der mit einem Megafon in der Hand auf eine Parkbank sprang, zum Verstummen gebracht. Er trug die Selbstgewissheit eines Ringmeisters in einem Zirkus für Aristokraten zur Schau.
»Meine Damen und Herren«, rief er, »die Jahreswende ist nah!«
Mit einer großartigen Handbewegung gab er einem aus seinem Trupp ein Zeichen, worauf der einen älteren Mann in grauer Robe neben ihn auf die Bank hob. Der Mann trug einen Wattebart, wie ein Moses aus der Theaterklasse, und hielt eine Sense aus Pappe in der Hand. Er schien etwas unsicher auf den Beinen.
Der Ringmeister öffnete eine Schriftrolle, die bis zum Boden fiel, und fing an, dem alten Mann die schlimmen Ereignisse von 1937 vorzuhalten: die Rezession … die Hindenburg … der Lincoln-Tunnel! Dann hob er sein Megafon und forderte das Neue Jahr auf, sich zu zeigen. Jetzt trat ein übergewichtiger Student, nur bekleidet mit einer Windel, hinter einem Busch hervor. Er kletterte auf die Bank und begann zur Erheiterung der Menge, seine Muskeln spielen zu lassen. In dem Moment löste sich der Wattebart von dem Ohr des alten Mannes, sodass man sein hageres, schlecht rasiertes Gesicht sah. Anscheinend war er ein Stadtstreicher, den die Studenten mit dem Versprechen, ihm Geld oder Wein zu geben, von der Straße geholt hatten. Was immer ihn verlockt hatte, es musste seine Wirkung getan haben, denn plötzlich sah er aus wie ein Penner in den Händen eines Wachtrupps.
Mit der Begeisterung eines Verkäufers pries der Ringmeister jetzt die verschiedenen Körperteile des Neuen Jahres und die Verbesserungen: die flexible Federung, das stromlinienförmige Chassis, die rasche Beschleunigung.
»Kommt, weiter!«, sagte Eve und lief lachend voraus. Tinker schien keine besondere Lust zu haben, sich in den Trubel zu stürzen.
Ich nahm eine Packung Zigaretten aus meiner Manteltasche, und sofort zückte er das Feuerzeug. Er trat näher, um mit den Schultern den Wind abzuhalten.
Als ich den Rauch ausblies, betrachtete Tinker die Schneeflocken über uns, die im Schein der Straßenlaterne langsam zu Boden taumelten. Dann drehte er sich zu dem Treiben der jungen Leute um und musterte sie mit fast trauervollem Blick.
»Ich wüsste gern, wer Ihnen mehr leidtut«, sagte ich. »Das alte Jahr oder das neue?«
Er lächelte verhalten. »Sind das die einzigen beiden Möglichkeiten?«
Plötzlich sauste ein Schneeball durch die Luft und traf einen der Studenten am Rande der Menge am Rücken. Als er und zwei seiner Mitstudenten sich umdrehten, landete ein zweiter Schneeball auf der Hemdbrust des einen.
Wir wandten uns um und sahen, dass ein Junge, kaum älter als zehn und sicher hinter einer Parkbank verschanzt, den Angriff gestartet hatte. Er war in mindestens vier Schichten warmer Kleidung gehüllt und sah aus wie das dickste Kind in der Klasse. Rechts und links von sich hatte er Berge von Schneeballgeschossen aufgehäuft. Bestimmt hatte er stundenlang damit zugebracht, sie zu formen. Er blickte so ernst entschlossen wie jemand, der die Kunde vom Nahen der Redcoats von Paul Revere persönlich erhalten hat.
Die drei Studenten starrten ihn sprachlos an. Der Junge nutzte den Vorteil ihrer verzögerten Reaktion und warf nacheinander drei wohlgezielte Schneebälle.
»Dem zeigen wir’s!«, sagte einer der Studenten ohne die Spur von Humor.
Die drei kratzten Schnee von den Wegen, formten ihn und bewarfen ihrerseits den Jungen.
Ich nahm mir eine neue Zigarette und richtete mich auf ein interessantes Schauspiel ein, aber meine Aufmerksamkeit wurde in die andere Richtung gelenkt, wo sich eine überraschende Entwicklung abzeichnete. Neben dem Penner auf der Parkbank hatte der Mann in Windeln, der das Neue Jahr darstellte, in makellosem Falsett angefangen, Auld Lang Syne zu singen. Rein und tief empfunden, körperlos wie die Töne einer Oboe, die über einem See schweben, verlieh seine Stimme der Nacht eine geisterhafte Schönheit. Obwohl bei Auld Lang Syne eigentlich alle mitsingen müssen, wagte niemand, mit einzustimmen, so überirdisch schön war dieser Gesang.
Als der letzte Refrain mit exquisit gehaltenem Ton verklungen war, herrschte einen Moment lang Schweigen, dann wurde applaudiert. Der Ringmeister legte dem Tenor die Hand auf die Schulter — in Anerkennung der guten Leistung. Dann nahm er seine Uhr heraus und bat mit erhobener Hand um Ruhe.
»Bitte um Aufmerksamkeit. Ruhe bitte. Sind alle so weit …? Zehn …! Neun …! Acht …!«
Aus der Menschenmenge winkte Eve aufgeregt in unsere Richtung.
Ich wandte mich zur Seite und wollte Tinkers Arm nehmen — aber Tinker war fort.
Links von mir waren die Wege durch den Park menschenleer, rechts entschwand eine einsame Silhouette, klein und gedrungen, unter einer Straßenlaterne. Ich drehte mich also um, zum Waverly Place — und da sah ich ihn. Er kauerte hinter der Bank neben dem kleinen Jungen und kämpfte gegen die Studenten. Angesichts der unerwarteten Verstärkung feuerte der Junge die Schneebälle mit umso größerer Entschlossenheit. Und das Lächeln auf Tinkers Gesicht hätte die Dunkelheit bis zum Nordpol erhellen können.
Als Eve und ich nach Hause kamen, war es fast zwei. Normalerweise wurden in der Pension um Mitternacht die Türen abgeschlossen, aber die Sperrstunde war wegen der Jahreswende aufgehoben worden. Nur wenige der Mädchen hatten diese Freiheit ausgenutzt. Der Aufenthaltsraum war leer und wirkte deprimierend. Überall war Konfetti verstreut, und auf jedem Tischchen standen Gläser mit Resten von Cider. Eve und ich sahen uns zufrieden um und gingen in unser Zimmer.
Still ließen wir unseren geglückten Abend ausklingen. Eve zog sich das Kleid über den Kopf und ging ins Badezimmer. Wir schliefen in einem großen Bett, und jeden Abend schlug Eve die Decke zurück, als wären wir in einem Hotel. Ich fand das immer ein wenig übertrieben, eine unnötige Vorbereitung, aber diesmal schlug ich die Decke für sie zurück. Dann nahm ich die Schachtel mit dem Nähzeug aus der Schublade mit meiner Unterwäsche, um die restlichen Münzen darin zu verstauen — so wie mein Vater es mir beigebracht hatte.
Als ich aber in meine Manteltasche griff, stieß ich auf einen schweren, glatten Gegenstand. Überrascht zog ich ihn heraus und sah, dass es Tinkers Feuerzeug war. Und da fiel mir wieder ein, dass ich es ihm — in einer Geste, die eher Eve ähnlich war — aus der Hand genommen hatte, um meine zweite Zigarette anzuzünden. Das war in dem Moment gewesen, als der Mann, der das Neue Jahr darstellte, zu singen begonnen hatte.
Ich setzte mich in den gerstenbraunen Lehnsessel beim Fenster — das einzige Möbelstück, das ich besaß. Ich klappte das Feuerzeug auf und zündete es an. Die Flamme sprang hoch, flackerte und verströmte einen Benzingeruch. Dann klappte ich es wieder zu.
Das Feuerzeug lag angenehm in der Hand und hatte von tausendfacher Benutzung eine glatte, polierte Oberfläche. Und die Gravur mit Tinkers Initialen in Tiffany-Schrift war so präzise ausgeführt, dass man mit dem Fingernagel den Linien der Buchstaben folgen konnte. Aber da war nicht nur sein Monogramm. Darunter war, weniger professionell wie von einem Kaufhausjuwelier, eingraviert:
TGR
1910 — ?
2. Kapitel
SONNE, MOND UND STERNE
Am folgenden Morgen hinterlegten wir beim Portier des Beresford ein Briefchen ohne Unterschrift für Tinker:
Wenn Sie Ihr Feuerzeug wiedersehen wollen, dann kommen Sie um 18.42 Uhr zur Ecke 34. Straße und Third Avenue, und zwar allein.
Meiner Einschätzung nach lagen die Chancen, dass er kommen würde, bei fünfzig Prozent. Laut Eve bei einhundertzehn. Als er aus dem Taxi stieg, warteten wir in Trenchcoats im Schatten der Hochbahn. Er trug ein Jeanshemd, darüber einen Lammfellmantel.
»Hände hoch«, sagte Eve, und er hob folgsam die Arme.
»Wie sieht es aus mit dem Ausbrechen aus dem Trott?«, fragte Eve.
»Na ja, ich bin zur normalen Zeit aufgewacht. Nach dem üblichen Squashmatch bin ich wie immer zum Lunch gegangen …«
»Die meisten Menschen geben sich Mühe, wenigstens bis zur zweiten Woche im neuen Jahr.«
»Vielleicht komme ich nur langsam in Gang?«
»Vielleicht brauchen Sie Hilfe.«
»Oh, Hilfe brauche ich auf jeden Fall.«
Wir verbanden ihm die Augen mit einem gepunkteten Halstuch und führten ihn in Richtung Westen. Er spielte mit und streckte auch nicht die Hände aus wie jemand, der gerade erblindet ist. Er überließ sich uns, und wir führten ihn durch die Menschenmenge.
Es fing wieder an zu schneien. Es waren vereinzelte große Flocken, die langsam zu Boden taumelten, und manche blieben auf den Haaren liegen.
»Schneit es?«, fragte er.
»Keine Fragen.«
Wir überquerten Park Avenue, Madison Avenue, Fifth Avenue. Passanten gingen an uns vorbei und ignorierten uns in geübter New Yorker Gleichgültigkeit. Als wir die Sixth Avenue überquerten, sahen wir in dreieinhalb Meter Höhe über der 34. Straße die leuchtende Markise des Capitol-Filmtheaters. Es sah aus, als wäre der Bug eines Ozeandampfers durch das Gebäude gekracht. Das Publikum strömte aus der Frühvorstellung in die Kälte hinaus. Die Menschen waren fröhlich und entspannt und strahlten eine etwas müde Selbstgefälligkeit aus, die so typisch für den ersten Abend im neuen Jahr ist. Er hörte die Stimmen.
»Wohin gehen wir, Mädels?«
»Psst«, machten wir und bogen in eine Seitengasse ein.
Große graue Ratten huschten ängstlich zwischen Tabakdosen im Schnee umher. Rechts und links krochen die Feuertreppen wie Spinnen an den Mauern hoch. Eine kleine rote Lampe über dem Notausgang des Theaters verbreitete ein schummriges Licht. Wir gingen weiter und bezogen hinter den Mülltonnen Stellung.
Ich nahm Tinker das Tuch von den Augen und legte meinen Finger auf die Lippen.
Eve zog einen alten schwarzen Büstenhalter aus ihrer Bluse. Sie lächelte und zwinkerte. Dann schlich sie zurück zu der Stelle, wo die Feuertreppe über ihr in der Luft hing. Sie stellte sich auf Zehenspitzen und drapierte den Büstenhalter auf der untersten Sprosse.
Dann kam sie zu uns zurück. Wir warteten.
Zehn vor sieben.
Sieben Uhr.
Zehn nach sieben.
Die Tür des Notausgangs öffnete sich quietschend.
Ein Saaldiener mittleren Alters in roter Uniform kam heraus, um eine Auszeit von dem Film zu nehmen, den er schon tausend Mal gesehen hatte. Im Schnee sah er aus wie ein Holzsoldat aus der Nussknackersuite, der seine Mütze verloren hat. Er zog die Tür vorsichtig hinter sich zu und steckte einen Programmzettel in den Türschlitz, damit sie nicht zuschnappte. Die Schneeflocken fielen zwischen den Feuertreppen herab und sanken auf seine falschen Epauletten. Er lehnte sich an die Tür, zog eine Zigarette hinter dem Ohr hervor und zündete sie an. Er stieß den Rauch aus und lächelte wie ein wohlgenährter Philosoph.
Nach drei Zügen bemerkte er den Büstenhalter. Ein paar Sekunden lang betrachtete er ihn aus sicherer Entfernung, dann schnippte er die Zigarette gegen die Hauswand. Er ging hinüber und legte den Kopf schräg, als wollte er das Etikett lesen. Er blickte nach rechts und nach links. Vorsichtig zog er den Büstenhalter von der Sprosse und hielt ihn in der Hand. Dann presste er ihn an sein Gesicht.
Wir schlüpften durch den Notausgang und steckten das Programm wieder in den Türschlitz.
Wie immer liefen wir geduckt vor der Leinwand quer durch den Saal und gingen auf der entgegengesetzten Seite des Parketts nach oben, während hinter uns die Wochenschau lief: Roosevelt und Hitler winkten abwechselnd aus offenen schwarzen Limousinen. Wir kamen ins Foyer, eilten die Treppe hoch und betraten den Rang. Im Dunkeln schlichen wir zur hintersten Reihe.
Tinker und ich fingen an zu kichern.
»Pst«, machte Eve.
Auf der Empore hatte Tinker die Tür aufgehalten, und Eve war vor ihm hineingegangen; deshalb saß sie jetzt innen, ich in der Mitte und Tinker am Gang. Ich warf einen Blick zu Eve hinüber und bemerkte, dass sie mich mit einem irritierten Lächeln ansah, als hätte ich das so geplant.
»Machen Sie das oft?«, fragte Tinker.
»So oft wie möglich«, sagte Eve.
»Pst!«, sagte jetzt ein Kinogast mit Nachdruck, als es auf der Leinwand dunkel wurde.
Im ganzen Kinosaal flackerten Feuerzeuge beim Anzünden der Zigaretten wie Glühwürmchen. Dann wurde die Leinwand wieder hell, und der Film fing an.
Es war Ein Tag beim Rennen. Wie in allen Filmen der Marx Brothers begann die Geschichte mit lauter eleganten und vornehmen Leuten, die eine sittsame Stimmung verbreiteten. Die Zuschauer nahmen das höflich hin. Aber als Groucho Marx auf der Leinwand erschien, richteten sie sich in ihren Sitzen auf und applaudierten, als wäre er ein Shakespeare’scher Held, der nach einem verfrühten Bühnenabschied sein Comeback feiert.
Nachdem der Film angefangen hatte, holte ich eine Schachtel Weingummi hervor, Eve hatte eine Flasche Whiskey dabei. Wenn man Tinker von dem Weingummi anbieten wollte, musste man die Schachtel vor seiner Nase schütteln, damit er es merkte.
Die Flasche kreiste einmal, dann ein zweites Mal. Als sie leer war, holte Tinker seinen Beitrag hervor: eine silberne Flasche in einem Lederetui. Als ich sie nahm, konnte ich die auf dem Leder aufgeprägten Initialen mit den Fingern erfühlen.
Langsam wurden wir betrunken, und wir lachten, als wäre es der komischste Film, den wir je gesehen hatten. Bei der Szene, als Groucho die alte Dame untersuchte, musste Tinker sich die Tränen aus den Augen wischen.
Irgendwann musste ich so dringend austreten, dass ich es unmöglich aufschieben konnte. Ich quetschte mich zum Gang durch und rannte die Treppe hinunter zur Damentoilette. Als ich wieder in den Saal kam, hatte ich kaum mehr als eine Szene verpasst, aber jetzt saß Tinker in der Mitte. Wie es dazu gekommen war, konnte man sich leicht vorstellen.
Ich ließ mich in seinen Kinosessel sinken und dachte, wenn ich nicht aufpasste, würde ich bald in meinem Vorgarten eine Ladung Pferdeäpfel vorfinden.
Junge Mädchen mochten zwar geschickt in der Ausübung kleiner Racheakte sein, aber auch das Universum hatte einen Sinn für ausgleichende Gerechtigkeit. Denn während Eve in Tinkers Ohr kicherte, umschmiegte mich sein I,ammfellmantel. Das Wollfutter, so dick wie die Wolle auf einem Schafsrücken, strahlte noch Tinkers Körperwärme aus. Der Schnee auf dem hochgestellten Kragen war längst geschmolzen, und der Geruch nasser Wolle vermischte sich mit dem schwachen Duft von Rasierseife.
Beim ersten Anblick von Tinker in diesem Mantel war er mir ziemlich angeberisch vorgekommen — einer, der in Neuengland geboren und aufgewachsen war und sich wie ein Held in einem Film von John Ford kleidete. Aber der Geruch der schneefeuchten Wolle machte das viel authentischer. Plötzlich konnte ich mir Tinker auf einem Pferd vorstellen: am Waldrand unter wolkenschwerem Himmel … vielleicht auf der Ranch eines Studienfreundes, wo sie mit veralteten Gewehren auf Jagd gingen und die Hunde eine bessere Kinderstube hatten als ich.
Nach dem Film verließen wir zusammen mit den aufrechten Bürgern das Kino durch den Haupteingang. Eve fing an, Lindyhop zu tanzen, wie die Neger in der großen Tanzeinlage im Film. Ich nahm ihre Hand, und wir tanzten zusammen in perfekter Harmonie. Tinker war offensichtlich schwer beeindruckt, aber eigentlich ganz grundlos. Tanzschritte zu üben war die traurige Freizeitbeschäftigung aller amerikanischen Mädchen, die in Pensionen wohnten.
Wir nahmen Tinker bei der Hand, und er machte ein paar unbeholfene Schritte.
Dann riss Eve sich los, stellte sich an den Straßenrand und hielt ein Taxi an. Wir stiegen hinter ihr ein.
»Wohin fahren wir?«, fragte Tinker.
Ohne das leiseste Zögern sagte sie: »Essex Street, Ecke Delancey.«
Ja, natürlich, sie wollte mit ihm ins Chernoff.
Obwohl der Fahrer Eve gehört hatte, wiederholte Tinker die Anweisung.
»Essex Street, Ecke Delancey bitte.«
Der Fahrer legte den Gang ein, und der hell erleuchtete Broadway glitt an den Fenstern vorbei, als würde jemand die Lichterkette vom Weihnachtsbaum ziehen.
Das Chernoff war eine ehemalige Flüsterkneipe. Es wurde von einem ukrainischen Juden geführt, der, kurz bevor die Romanows im Schnee erschossen wurden, ausgewandert war. Es lag unter der Küche eines koscheren Restaurants und war einerseits bei russischen Verbrechern beliebt, andererseits aber auch bei russischen Exilanten mit gegensätzlichen politischen Überzeugungen. Jeden Abend etablierten sich die beiden Lager beiderseits des winzigen Parketts. Links saßen die ziegenbärtigen Trotzkisten, die den Sturz des Kapitalismus planten, rechts die Zaristen mit dicken Koteletten, die ihren Erinnerungen an die Eremitage nachhingen. Wie so viele miteinander verfeindete Stämme auf der Welt hatten auch diese beiden nach New York gefunden, wo sie sich nebeneinander einrichteten. Sie wohnten im selben Viertel und gingen in dieselben schmalen Cafés, wo sie sich gegenseitig bestens im Auge behalten konnten. In so großer Nähe zueinander verstärkten sich mit der Zeit die Gefühle, die Entschlossenheit hingegen ließ nach.
Wir stiegen aus dem Taxi und gingen ein paar Schritte in die Essex Street, an dem hell erleuchteten Restaurant vorbei. Dann bogen wir in die Gasse ein, die zur Küchentür führte.
»Schon wieder eine Gasse«, sagte Tinker freundlich.
Wir kamen an einer Mülltonne vorbei.
»Schon wieder eine Mülltonne!«
Am Ende der Gasse standen zwei bärtige Juden und beklagten die modernen Zeiten. Sie beachteten uns nicht. Eve machte die Küchentür auf, und wir gingen an zwei Chinesen vorbei, deren Arme in einem großen Abwaschbecken mit aufsteigenden Dampfschwaden steckten. Auch sie beachteten uns nicht. Gleich hinter den Töpfen mit schmorendem Winterkohl führten enge Stufen zu einem Keller mit einem begehbaren Gefrierschrank hinunter. Der Messingriegel an der schweren Eichentür war so oft benutzt worden, dass er hellgolden leuchtete, wie der Fuß eines Heiligen an der Tür einer Kathedrale. Eve zog daran, und wir betraten einen Raum voll mit Sägemehl und Eisblöcken. An der Rückseite war eine verborgene Tür, die in einen Nachtklub mit einer kupferbeschlagenen Bar und roten Lederbänken führte.
Wir hatten Glück, da eine Gruppe gerade aufbrach und wir eine kleine Nische auf der Seite der Zaristen zugewiesen bekamen. Die Kellner im Chernoff fragten nie, was man wollte, sondern sie stellten einfach Teller mit Piroggen, Heringen und Zunge auf den Tisch. Außerdem brachten sie drei Schnapsgläser und eine alte Weinflasche mit Wodka, der, obwohl der Prohibitionsparagraf längst abgeschafft worden war, immer noch in einer Badewanne hergestellt wurde. Tinker goss die drei Gläser voll.
»Eines Tages finde ich Jesus«, sagte Eve und leerte das Glas in einem Zug. Dann entschuldigte sie sich und ging zur Toilette.
Auf der Bühne sang ein einzelner Kosak zu einer Balalaika. Es war ein altes Lied von einem Pferd, das ohne Reiter aus dem Krieg zurückkehrt. Als es sich dem Heimatort des Soldaten nähert, erkennt es den Duft der Lindenbäume, die blühenden Gänseblümchen, den Klang des Schmiedehammers. Der Text war schlecht übersetzt, aber der Kosak sang so gefühlvoll, wie es nur jemand kann, der seine Heimat verloren hat. Selbst bei den Amerikanern im Raum kam Heimweh auf. Auch Tinker sah traurig aus, als hätte das Lied von einem Land gehandelt, aus dem er vertrieben worden war.
Am Ende applaudierten die Gäste herzlich, aber auch gemessen, wie nach einer edlen, bescheidenen Rede. Der Kosak verneigte sich und trat von der Bühne.
Tinker ließ seinen Blick durch den Raum schweifen und sagte, seinem Bruder würde das Lokal sicherlich gefallen. Ich schlug vor, dass wir alle zusammen einmal hierherkommen könnten.
»Das wäre fantastisch«, sagte er.
»Sie glauben, Eve und ich würden ihn mögen?«
»Ich glaube, Sie würden ihn mögen. Sie würden sich bestimmt glänzend verstehen.«
Tinker schwieg und drehte das leere Glas in den Händen. Ich wusste nicht, ob er in Gedanken bei seinem Bruder war oder noch unter dem Eindruck des Kosakenlieds stand.
»Sie haben keine Geschwister, oder?«, sagte er und stellte das Glas ab.
Darauf war ich nicht vorbereitet.
»Warum fragen Sie? Wirke ich verwöhnt?«
»Nein! Eher das Gegenteil. Sie erwecken vielmehr den Eindruck, dass Sie sich allein wohlfühlen würden …«
»Geht es Ihnen nicht auch so?«
»Früher war das so … glaube ich. Aber jetzt fällt es mir schwer. Wenn ich heute allein in meiner Wohnung bin und nichts zu tun habe, fange ich an zu überlegen, wen ich anrufen könnte.«
»Ich lebe in einem Hühnerstall, da habe ich das umgekehrte Problem. Wenn ich allein sein will, muss ich rausgehen.«
Tinker lächelte und goss mir ein. Einen Moment lang schwiegen wir beide.
»Und wohin gehen Sie dann?«, fragte er.
»Wohin gehe ich wann?«
»Wenn Sie allein sein wollen?«
An der einen Seite der Bühne nahm jetzt ein kleines Orchester Platz.