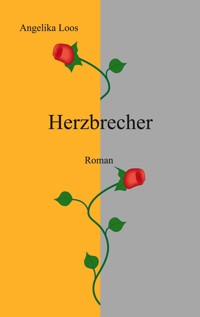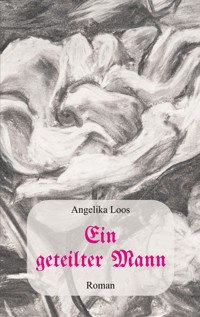
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im vorletzten Kriegsjahr 1944 begegnen sich der Schreiner Arnold Reinelt und ein fremder junger Mann an einem sonnigen Frühlingstag in dem Kurort Bad Orb. Misstrauen und Furcht bestimmen den ersten Kontakt . Die folgenden Ereignisse stellen das Leben zweier Familien nach und nach immer mehr auf den Kopf. Doch gerade daraus wächst die Hoffnung auf ein glückliches Ende des Zweiten Weltkriegs und der Schrecken des NS-Regimes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Als der Schreiner Arnold Reinelt eines Tages seine Werkstatt nach getaner Arbeit verlassen will, bemerkt er den jungen Mann, der sich schon ein paar Augenblicke lang draußen herumgedrückt hat.
Arnold nimmt dessen Zögern wahr, der Fremde sieht sich dauernd um, so, als hätte er vor irgendetwas Angst, er traut sich aber schließlich doch, an der Holztür anzuklopfen. Der Unbekannte senkt den Blick, als er seine Bitte unbeholfen vorträgt: ob der Schreiner vielleicht eine Kleinigkeit zu essen übrig habe, er würde es gern abarbeiten, wenn das möglich wäre. Er wäre ihm sehr dankbar.
Arnold kann ein leises Misstrauen nicht verbergen, wer ist der Mann? Ein Dieb? Ein Deserteur? Womöglich ein Jude? Er hat ihn in Bad Orb noch nie gesehen. Der Schreiner trifft eine folgenschwere Entscheidung, bittet ihn herein, gibt ihm Brot und Butter. Arnold mag ihn, irgendwoher kommt dieses Gefühl. Schließlich fragt er ihn einfach: „Du bist Jude, nicht wahr?“ Der Gast nickt und sieht Arnold zum ersten Mal an: „Ja, ich bin Jude. Was nun?“
Es ist Frühling im vorletzten Kriegsjahr 1944, als die Geschichte von Arnold und Jakob und all den anderen beginnt.
Angelika Loos, Jahrgang 1955, studierte Theaterwissenschaft, Neuere Deutsche Literatur und Philosophie, arbeitete als Lektorin und Redakteurin. Sie war Übersetzerin und Herausgeberin der Liebesbriefe des französischen Königs Heinrich IV., die 1989 unter dem Titel „Ich küsse millionenmal Eure Hände – Die private und intime Korrespondenz des Königs Henri Quatre“ bei Rowohlt erschienen sind. Sie lebt in München.
Ihren ersten Roman, „Herzbrecher“, veröffentlichte sie 2023 bei Books on Demand.
„Wo aber Gefahr ist,
wächst das Rettende auch.“
Friedrich Hölderlin, „Patmos“-Hymne
INHALT
In Frankfurt
Der Fremde, der Freund
Die „Mädchen“ aus der großen Stadt
Das glücklichste Paar der Welt
Herrn Müllers Café
Verschwörung
Im Versteck
Der König hinter den Alpen
Bekenntnis
Luft anhalten, tarnen, täuschen
Wahlverwandtschaft
Amalie, Marie
Der Heinz muss fort
Liebe in Zeiten des Krieges
Stadtansichten
StaLag IX-B
Der Weinkeller Gottes
Bekenntnisse & Wahrheiten
Der blinde Sohn
Was passiert, wenn Otto heimkommt?
Katrins Mut
Amalies Brief
Vom Suchen und Heimfinden
Flucht vor dem Ende?
Vergebung
Wie das Leben so ist
Apfel- und Weißwein
Eine kurze Reise in die Trümmerstadt
Evas Apfel und das Ende der Täuschung
Das Wunderhaus in der Schloßborner Straße
Die Raben sind verschwunden
Orber Winternächte
Kriegsweihnacht
Die Amis kommen
Da musste er sich auf den Panzer setzen
Ende gut, alles gut?
Wonnemonat
Alles neu macht der Juni
1
In Frankfurt
„Um Himmels willen, was war das?“ Amalie stand in ihrer Küche und versuchte, sich wieder zu beruhigen. Ihr Herz klopfte wild, sie spürte es bis zum Hals an der Schlagader, wo die Verbindung zum Kopf ist. Es hatte im Stockwerk über ihr einen kurzen ohrenbetäubenden Aufprall gegeben, aber es passierte Gott sei Dank nichts weiter. Es war sicher nur ein Topf oder ein anderes schweres Gerät in der Kochecke gewesen, irgendetwas Massives musste auf den Boden geknallt sein. Wenn ein Sprengkörper auf die Erde krachte, das war viel lauter. Ganz bestimmt. Sie war nur erschrocken.
Heinrich, ihr Mann, war zu ihr in die Küche geeilt, instinktiv, um sie zu beruhigen. Er kannte seine Frau, sie war so ängstlich geworden seit den nächtlichen Bombardements.
Er hatte sie zitternd und völlig aufgelöst vorgefunden, in den Arm genommen, obwohl er es eigentlich eilig hatte, er musste zur Arbeit.
Amalie schluchzte leise vor sich hin. Sie hielt es bald nicht mehr aus, sie war das reinste Nervenbündel, jeden Tag, sie traute sich kaum noch vors Haus, irgendjemand musste doch einkaufen, im Schrebergarten gießen, kochen für die Tochter, den Sohn, den Mann. Am liebsten würde sie abhauen aufs Land, nach Bad Orb zu ihrer Mutter. Einmal wieder ruhig durchschlafen!
Nur vierzig Kilometer von Amalies und Heinrichs Heimatort Bad Orb entfernt, waren die Häuser der großen Stadt Frankfurt am Main zu schaurig-schwarzen Gerippen gebombt worden.
Heinrich sagte, als die beiden vor dem vertrauten Holzkohleherd standen, vor dem Steinspülbecken, dem fest montierten eisernen Fleischwolf: „Malchen, du kannst es nicht vor mir verstecken, ich versteh dich, wirklich, ich fürchte mich auch manchmal, wennʼs laut wird, das ist der Krieg. Ich glaub, es wäre am besten, wenn du ein, zwei Wochen raus zu den Orbern fährst, deine Mutter freut sich. Du wirst mir hier sonst noch krank vor lauter Aufregung. Nimm die Emma mit, die Schule ist sowieso geschlossen. Wir zwei Männer kommen auch mal so zurecht.“
*
An das Großstadtleben in Frankfurt, von der in diesem vorletzten Kriegsjahr nicht mehr viel übrig geblieben war, hatte sich Amalie Döpfner, geborene Reinelt, gewöhnt, als es sie nach der Hochzeit mit Heinrich dorthin verschlagen hatte. An Fliegeralarm und Bombenteppiche aber würde sie sich nie gewöhnen. Amalie lebte seit Kriegsbeginn in ständiger Angst, am schlimmsten war es, wenn die Kinder nicht in der Wohnung waren, auf dem Weg zur Schule, draußen beim Spielen. Heinrich hatte sie durchschaut: Sie wollte tatsächlich weg aus der Stadt, nach Hause, nach Bad Orb, in die Geborgenheit bei ihrer Mutter, wenigstens die Kleine würde sie mitnehmen. Heinrichs Frau wollte es aber nicht zugeben, ihren Mann nicht enttäuschen.
Amalie lebte mit ihrem geliebten Ehemann Heinrich und dem Erstgeborenen, Sohn Heinz, und der Tochter Emma im Frankfurter Gallusviertel. Das Mädchen war 1944, als am Himmel über ihrer Stadt immer öfter die Bomber der britischen Royal Airforce Luftangriffe flogen, vierzehn Jahre alt. Sie galt als munteres BDM-Mädel, obwohl es in ihr drin an diesen düsteren Kriegstagen oft verschattet aussah, sie war Aufbauschülerin, strebte den Mittelschulabschluss an. Heinrich hatte zugestimmt, als sie ihren Vater deswegen angebettelt hatte, es kostete zumindest kein Schulgeld.
Emma und ihr großer Bruder hatten Glück im Unglück, denn sie lebten auch in der schweren Zeit in relativer Geborgenheit mit den Eltern in der Gegend nahe Rebstock und Galluswarte ̶ kein vornehmes Viertel war das, aber es hatte schöne Bürgerhäuser in der Schloßborner Straße. An den Hauswänden wucherte der Efeu bis in den vierten Stock hoch, in dem Emma im „kleinen“ Zimmer auf der Sofa-Couch schlief. Die Nachbarn hielten es miteinander aus, und sie hielten zusammen.
Emmas Vater war Oberpostangestellter, was ihn ein bisschen stolz machte. Er fühlte sich durch und durch als Herr im Haus, dabei war er ein Mann von sanftem Gemüt und mit gutem Herzen. Tochter Emma sagte hinter vorgehaltener Hand, wer in Wirklichkeit das Heft in der Hand hielt: dass ihre Mutter stets ihren Willen bekam, manchmal nicht sofort, „aber mit ein bisschen Diplomatie schafft Mama es meistens zu kriegen, was sie sich in den Kopf gesetzt hat“.
Emma war drei Jahre jünger als ihr Bruder, der bald Achtzehnjährige hätte mit aller patriarchaler Unterstützung zum Stammhalter heranwachsen sollen, aber Heinz hatte das Gymnasium nicht geschafft, ging schließlich in die Lehre beim selben Telegraphenamt wie einst sein Vater. Der war es dann auch zufrieden.
Als der Krieg in Frankfurt angekommen war, als Bomben vom Himmel fielen und Häuser in die Luft flogen, war Amalie von Anfang an ständiger Furcht ausgesetzt. Vor dieser Unumgänglichkeit der grausamen Wirklichkeit, vor der anhaltenden Bedrohung, auch wenn es still war. Sie wünschte, sie könnte ihre komplette Familie mit aufs Land nehmen, „nach Hause“, sagte sie. Heinrich und Amalie stammten beide aus Bad Orb, dem harmlosen Kurort, aber ihr Mann musste zur Arbeit, war als Telegraphenvorarbeiter ein „unersetzlicher Mitarbeiter“ und vom Dienst in der Wehrmacht freigestellt. Er „kämpfte an der Heimatfront“, bei der Post, auf dem Fernamt, allerdings nicht in der Vermittlung, die überließ er diesen Fräuleins vom Amt, die den ganzen Tag Stöpsel in Löcher steckten. Außerdem war Heinz, der Sohn, nicht weit weg. Das mit der Lehrstelle, wo Heinrich selbst den heutzutage wichtigen Beruf gelernt hatte, das war ein echter Glücksfall gewesen. Obwohl Heinz schon mehr als siebzehn Jahre alt war, hatte er die Einberufung bislang nicht bekommen. Die Hoffnung: Vielleicht war er auf der Behörde vergessen worden, das wäre ein Himmelsgeschenk.
Seit im Juni 1940 die ersten Bomben aus der Luft auf Frankfurt gefallen waren, zitterte Amalie allein beim Gedanken an die Bunker, ihr Mann bot im Keller eisern den Angriffen die Stirn. „Was willst du denn machen, wenn hier eine Bombe einschlägt, dann ist doch sowieso alles kaputt, dann kannst du froh sein, wenn du noch lebst“, hatte sie ihren Heinrich angefleht mitzukommen in den Luftschutzkeller. Er war Beamter und ein Sturkopf obendrein.
Bis eines Tages ein besonders starker Angriff geflogen worden war, einer, der unvergesslich bleiben würde. Alle, die ihn überlebt hatten, konnten nur unter Mühen davon erzählen. Die Häuser der Schloßborner Straße waren getroffen worden, manche waren schwer beschädigt, andere leicht am Dach, oder sie hatten keine Fensterscheiben mehr.
Nur ein Doppelhaus stand gänzlich unberührt vom Bombenhagel, Heinrich hatte unfassbares Glück gehabt. Es war das Haus, in dem er mit Heinz im Keller gesessen hatte, beide vor Angst schlotternd. Sie hatten es überstanden, Else und Emma waren im Bunker gewesen. Emmas Vater war danach ein anderer Mensch, fand nur langsam zurück zur alten Zuversicht.
Heinrich hatte ihr gut zugeredet, ihr mehrfach versichert, dass sie sich keine Sorgen um ihre beiden Männer machen müsste, „jedenfalls keine wegen sauberer Wäsche oder deiner guten sparsamen Mittagessen“, das hatte er lachend gesagt. Amalie schämte sich, dass sie so ein Feigling war, hatte es versteckt hinter künstlicher Heiterkeit und gespieltem Optimismus.
Jetzt war sie wirklich am Ende ihrer Kräfte. Heinrich hatte recht: Sie musste ohne ihn zu ihren Leuten aufs Land. Sie würde sonst verrückt werden.
Schließlich sollte es losgehen. Obwohl es nur eine kurze Fahrt nach Bad Orb war, packte Amalie Butterbrote für sich und Emma ein, dazu selbst gemachten Apfelsaft. Im Zug essen, das mochten die zwei. Tagsüber, dachte Amalie, wird ja hoffentlich keiner auf den Zug schießen.
Weder Amalie noch ihr Mann, geschweige denn die beiden Kinder ahnten, dass sie bald hautnah dabei sein würden, wenn die Chronik ihrer Familie an einen Wendepunkt gelangte.
2
Der Fremde, der Freund
Arnold verschloss an diesem Tag guten Gewissens schon zu Mittag die Tür seiner Schreinerei. Er hatte für die Kommode der Postbotin, Frau Wendler, zwei neue Schubladengriffe gedrechselt, das war schnell gegangen, und viele Aufträge gab es nicht in diesen Tagen. Auf dem Heimweg würde er noch bei ihr vorbeigehen und die Griffe anschrauben. Dann konnte er sich gemächlich der nächsten Aufgabe widmen, denn heute wurde seine Schwester Amalie erwartet, das Malchen, die mit ihrer Tochter Emma aus Frankfurt heraus zu ihnen nach Bad Orb kommen wollte, ihre beiden Männer, der Heinrich und der Sohn Heinz, würden in Frankfurt bleiben. Sie mussten das Haus hüten und ihren Verpflichtungen nachkommen. Amalie fürchtete sich so entsetzlich vor den nächtlichen Bomben, soweit Arnold es verstanden hat, hatte ihr Mann sie aufs Land geschickt, damit sie wieder ein bisschen zur Ruhe kam.
Arnold knöpfte das karierte Arbeitshemd auf und ging damit, es lose in der Hand haltend, zu dem Blechwaschbecken in der hinteren Werkstattecke, das normalerweise zum Reinigen von Pinseln und zum Auswaschen von Lappen diente. Mit der ungeliebten Kernseife und dem eiskalten Wasser wusch er sich die Achselhöhlen, den Bauchnabel und den Hals. Er trocknete sich mit dem Ärmel seines gebrauchten Hemdes ab und entnahm seinem „Vorratsschrank“, Friedas geerbtem, aber ungeliebtem alten Küchenbüfett, ein frisch gestärktes weißes, eigentlich für den Sonntag, heute für den Empfang der Gäste.
Als er sich umdrehte, sah er vor dem Fenster einen äußerst gut aussehenden jungen Mann stehen, der ärmlich gekleidet war, die Jacke war für den trotz Sonnenschein recht kühlen Frühlingstag zu dünn, die Hände rieb er sich unentwegt, als wollte er sie wärmen. Eigentlich sah er aus wie ein Strauchdieb, ziemlich abgerissen. Mit einem merkwürdig lauernden und gleichzeitig friedlich wirkenden Blick schien er auszuspähen, ob jemand in dem Raum war, vor dem er sich herumdrückte. Er schien irgendetwas vorzuhaben, sich aber nicht zu getrauen, den Plan in die Tat umzusetzen.
Hastig zog Arnold sein gutes Hemd über. Er fragte sich, ob der Mann vor der Tür ein Einbrecher war, als sich der Unbekannte dazu aufraffte zu klopfen. Arnold vergewisserte sich kurz, dass Hammer und ein Holzstock in Reichweite lagen, falls er sich verteidigen musste, sah in den Spiegel, den er dieser Tage wieder in den Kleiderschrank vom Bauern Niedl setzen sollte, er selbst machte gegen den Kerl vor der Tür einen recht ansehnlichen Eindruck. Egal, Arnold ging zur Tür, um zu öffnen.
Als sich ihre Blicke zum ersten Mal trafen, wussten sie in einem Winkel ihres Bewusstsein bereits, was mit ihnen geschehen würde. Arnold erkannte Jakob, er spürte, ebenso wie der Fremde, dass er ein Geheimnis mit ihm teilen würde, in diesen Zeiten ein tödliches.
Arnold lässt den jungen Mann eintreten, die Nichte Emma und die Schwester, auf die er sich irgendwie immer freut, vergisst er für den Moment.
„Verzeihung, dass ich einfach so anklopfe, ich will auch nicht lang stören.“ Arnold antwortet erst mal nicht. Der andere wirkt schüchtern, und er spricht zögerlich weiter, der Mann in dem weißen Hemd vor ihm schaut misstrauisch. „Bitte, Sie können mir glauben, ich führe nichts Böses im Schilde. Ich stecke in Schwierigkeiten und weiß nicht weiter, ich will nur fragen, ob Sie vielleicht eine Kleinigkeit zu essen übrig hätten oder vielleicht sogar eine Arbeit, mit der ich es abgelten könnte. Ich komme aus Frankfurt, ich habe schon beim ersten Bombenangriff auf meine Stadt alles verloren, Sie wissen sicher, dass das die Engländer waren. Die Familie, die Wohnung, alles, sogar die Papiere, so schnell kamen wir nicht raus, das Haus brannte lichterloh. Und seither versuch ich, mich durchzuschlagen zu Verwandten – eher zu Geistesverwandten, andere hab ich wohl nicht mehr. In Frankfurt gibt՚s jetzt nirgendwo einen Ort für mich, und meine letzte Bleibe bei einer Freundin der Familie in der Dachkammer . . .“, nur wenig will der schöne Unbekannte preisgeben, er sagt es mit einem Hauch von Stolz in der Stimme und ohne erkennbare Verzweiflung, er beschreibt seine Lage nüchtern. Den Rest des letzten Satzes lässt er trotzdem weg.
Er klingt beim genaueren Hinhören sogar ein bisschen überheblich, die Bitte kommt mit einem drängenden Unterton, als hätte der Mann eine Gegenleistung zu bieten, vielleicht ist es auch nur die Angst vor der Aussichtslosigkeit seiner Bitte.
Arnold will ihn sofort, er würde ihm stehenden Fußes folgen in die Einöde, in den Urwald, in die Gefahr. Doch es gelingt ihm, die Form zu wahren, das hat er sein Erwachsenenleben lang gelernt.
Der junge Mann hat Mut, das imponiert Arnold. Einfach einen Unbekannten um Essen fragen und um Arbeit, er muss wirklich ziemlich am Ende sein, er kann schließlich nicht wissen, ob der Schreiner Freund oder Feind ist.
Arnold will ihn nicht wieder wegschicken, dafür gefällt er ihm zu gut. Er bittet den Fremden herein, er bietet ihm seinen einzigen Hocker als Sitzplatz an. Noch hat Arnold nicht geantwortet. Schweigend holt er aus dem Stoffbeutel zwei Scheiben Brot, und auch die Butter in der Dose auf dem Fensterbrett stellt er auf die Werkbank vor den Gast hin, nur etwas Salz in einem Holzschüsselchen kann er dazu anbieten.
„Ich danke Ihnen“, der seltsam vertraut erscheinende junge Mann lächelt Arnold dankbar an und beginnt mit eleganten schmalen Händen äußerst wohlerzogen die Butter auf das Brot zu streichen und das Salz darauf zu streuen. Arnold sieht ihm zu und lächelt den Mann freundlich an. Allmählich legt sich das innere Zittern, eine Mischung aus Angst vor einer enttäuschenden Wahrheit, wer weiß, was der Schöne vorhat, und einer ungeduldigen Vorfreude auf etwas, das Arnold noch nicht erlebt hat. Ohne Hast isst der andere Mann, bis Arnold nun doch das Wort ergreift.
„Kann es sein, dass Sie auf der Flucht sind? Vor der Polizei, oder sogar vor den Nazis? Will jemand Sie in ein Lager schicken oder ins Gefängnis stecken?“ Arnold ist fast erschrocken über seine eigene Unverblümtheit und verunsichert. Er hat das Gefühl, mit der Tür ins Haus gefallen zu sein. Der andere schaut auf den Boden. Arnold sieht ihm an, dass in seinem Inneren Aufruhr herrscht. Angst, Hoffnung, hastiges Suchen nach einer Ausrede für die Bettelei und noch etwas, das Arnold nicht entschlüsseln kann, spiegeln sich in dessen Gesicht. Und, Arnold kann es nicht leugnen, sein fein geschnittenes Gesicht hat etwas, das ihn anzieht. Als hätte der Mann etwas vor, etwas ganz anderes als einen Raubüberfall.
Arnold geht einen Schritt weiter: „Du bist Jude, nicht wahr? Du kannst es ruhig zugeben. Ich hab nichts gegen Juden.“ Das Du ist ihm gerade ziemlich leicht über die Lippen gekommen, nicht dass der junge Mann denkt, er wolle ihn herabwürdigen. Er entschuldigt sich. „Ist mir so rausgerutscht, ich wollte Sie nicht kränken.“ Fast unmerklich hebt der andere die Augen, sieht Arnold mit einem Blick an, der dem Schreiner durch Mark und Bein geht.
„Nicht nur das. Du hast recht, ich bin wirklich ein Jude“, antwortet der fremde Mann, „da ist aber noch was anderes. Ich habe den Eindruck, dass ich etwas Verbotenes mit dir teile?“ Ein Fragezeichen ist am Ende des neugierigen Satzes.
Ganz selbstverständlich hat der Fremde das Du übernommen, das Arnold zu spät aufgefallen war, als er selbst es gleich verwendet hat. Arnold versteht nicht sofort, was der junge Mann sagen will, dann die Einsicht: Das ist einer wie er selbst. „Ja, kann sein“, sagt er. Entschuldigend zuckt er mit den Achseln, die Bastion fällt, er gesteht: „Du hast mich durchschaut, du bist der Erste. Wir sind wohl beide so, ein bisschen anders als der Durchschnittsmann.“ Noch nie hat er das so offen zugegeben, schon gar nicht gegenüber einem, den er nicht kennt. „Aber wie kommt es, dass du es bis hierher geschafft hast, und wie kannst du hier sein, fragt dich denn niemand, warum du nicht an der Front bist, den Juden sieht man dir ja nicht an?“
„Und du? Gleich zwei Fragen, kaum dass wir uns kennenlernen. Du bist doch auch nicht an der Front. Hier weiß niemand etwas von deinem Geheimnis, das stimmt doch? Wie heißt die Frau, die mitspielt und dich unter ihrem Rock versteckt?“ Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen.
Sie erkennen sich immer, die Männer, die andere Männer begehren, und ganz besonders in solcher Zeit. Arnold muss lächeln, wie schnell fasst er nun ein unbegründetes Vertrauen zu diesem ungewaschenen Kerl, der gute Manieren zu haben scheint und jetzt, wo er sich anscheinend sicherer fühlt, eigentlich recht unverfroren auftritt.
Arnold antwortet unbesonnen: „Marie heißt sie, es ist ein Freundschaftshandel, ich schütze sie vor einem scheußlichen Kerl, mit dem ihre Eltern sie verkuppeln wollen. Die sind kurz vorm Ruin, und ohne einen Verlobten wie mich, der ein gutes Handwerk beherrscht, könnte Marie schlecht Nein sagen zu dem Grobschlächtigen. Meine allerbeste Freundin ist sie, seit ich in der Volksschule neben ihr gesessen habe. Wir stehen uns nah, hatten es immer fröhlich miteinander, haben als Kinder viel zusammen gespielt. Eine Zeit lang hat sie noch gedacht, sie könnte mich irgendwann rumkriegen, aber sie weiß Bescheid und freut sich beim Dorffest trotzdem über ihren schmucken Tänzer.“
„Gut, das ist gut. Das Gute mit dem Nützlichen zu verbinden. Ich hab die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass mir auch so was einfällt, wie ich mich verbergen und dennoch etwas als Ausgleich geben kann. Ich will nicht unverschämt sein. Danke für das Essen, ich geh besser gleich wieder. Aber vorher will ich dir noch sagen, dass du so etwas wie eine kleine Hoffnung in mir geweckt hast.“ Nachdenklich betrachtet der junge Mann seine abgekauten Fingernägel, bevor er weiterspricht. „Natürlich habe ich keine Ahnung, wie das aussehen könnte, aber wir könnten uns vielleicht gegenseitig beschützen?“
Arnold ist sich der uneinschätzbaren Bedrohung und der Gefahr bewusst, die hinter dem Vorschlag des Mannes lauert, dessen Namen er noch nicht mal weiß. Wie meint er das, sich gegenseitig beschützen? Bisher hat er ganz gut ohne eine Vertuschungsgeschichte gelebt, Maries Verlobung mit ihm hatte bislang gereicht, und er hatte sich ferngehalten von diesem „anderen Ufer“, wo der Volksmund die Männer und Frauen ansiedelt, die ihrem eigenen Geschlecht zugetan sind.
Er schiebt die hinderlichen Gedanken weg, verweigert sich dem mulmigen Gefühl, der Angst vor diesem Fremden, wer weiß, was der wirklich will? Vielleicht hat der ja auch jemanden umgebracht oder was geklaut? Wäre es für ihn nicht besser, wenn er ihn einfach wegschickte? Er könnte ihm ja etwas zum Essen mitgeben, damit er es nicht ganz so schwer hat.
Arnold hasst das anklopfende Misstrauen, ein unangenehmes Gefühl ist das. Er verbietet es sich selbst, verbannt es aus seinem Herzen. Er will der sein, der Vertrauen einflößt und Vertrauen hat. Also probiert er es von Neuem, er schaltet die hinderlichen Vorbehalte aus, die sind sowieso mehr Gewohnheit als durchdachte Entscheidung nach dem jahrelangen „Erlernen“ der Vorurteile gegen Juden, Zigeuner, gegen Männer und Frauen seines Schlages. Er kennt es nur so, schon immer waren die Menschen, die „anders“ waren, ausgeschlossen worden, wurden verfolgt, manchmal getötet. Heutzutage schickt man sie ins Lager. Die guten Christen sind ganz groß in so etwas.
Nachdenklich und ein wenig ängstlich beantwortet er den kühnen Vorschlag des Mannes, der ihm jetzt schon nahesteht, das spürt Arnold, den Grund kann er nicht genau bestimmen. „Ja, warum eigentlich nicht?“, sagt er. „Ein Versuch wäre es wert. Wir wollen einander beschützen, es wird uns Mut abverlangen, das weißt du. Ein schöner Gedanke ist es trotz alledem. Ich bin übrigens noch hier zu Hause und werde wohl auch bleiben, ich habe eine Behinderung. Ich kann vor dem Feind nicht wegrennen.“ Während er das sagt, hebt Arnold das linke Hosenbein an, zieht einen der handgestrickten Wollsocken aus und zeigt Jakob die Spuren seiner lange zurückliegenden Verletzung. Vom großen Zeh fehlt die Spitze, die zwei daneben sind halb weg, da ist ihm vor vielen Jahren ein mit neuen Eisen beschlagener schwerer Ackergaul draufgetreten und nicht wieder runtergegangen, die Zehen waren völlig zermatscht gewesen, keine Aussicht auf Rettung.
„Na ja, sieht nicht so schön aus, aber vielleicht rettet mir mein Fuß sogar das Leben, wenn sie nicht am Schluss noch die Krüppel an die Front zerren.“ Der Besucher grinst über das ganze Gesicht: „Was hab ich für ein Glück, dass dieses Pferd zur rechten Zeit auf dem richtigen Fuß stand. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine.“
Da gibt es auch für den Schreiner nicht mehr viel zu überlegen. Langsam nimmt Arnold die Butter und das Salzfässchen von der Werkbank, stellt alles wieder zurück an seinen Platz, wendet sich nicht ab, sieht dem immer noch Namenlosen tief in die Augen. Als er sich zur Fensterbank umdreht, spürt er dessen Blick im Nacken, auf seinem Hintern, auf seinem muskulösen Rücken. Und dann: das raue Flüstern an seinem Ohr: „Was meinst du, sollen wir es gleich hier tun? Oder sollen wir einander von Liebe sprechen? Obwohl, das wäre etwas verfrüht.“ Das Unverfrorene gefällt Arnold, der Mann ist kein bisschen genierig, ein echter Kerl ist das.
Arnold will alles, was der andere ihm so unverhohlen anbietet. Aber er hält sich zurück, geht etwas mehr auf Distanz. Er hat Angst davor, sich in seine Hände zu begeben. Was wäre, wenn der Mann ihm nur was vormachte und mit seinem Wissen zur nächsten Dienststelle rennen würde, um sich freizukaufen? Noch hat er – theoretisch – eine Wahl, Arnold kann versuchen, alles abzustreiten. Was weiß er denn über den Schönen? Er sieht wirklich fantastisch aus. Die fast schwarzen Haare, die markanten Wangenknochen, die drahtige Figur, dazu tiefblaue Augen. „Gott sei Dank, die Schwarzhaarigen haben meist braune. Da lässt sich der Jude schlechter leugnen“, so was schießt ihm durch den Kopf.
„Warte noch ein bisschen, ich weiß ja nicht mal, wie du heißt. Ich bin Arnold, freut mich, dich kennenzulernen, lieber . . . Lass uns erst mal überlegen, wo wir dich überhaupt unterbringen könnten. Es soll doch alles ganz selbstverständlich wirken, findest du nicht?“
„Was könnte natürlicher sein als das, lieber Arnold? Ich heiße Jakob.“ Er sieht Arnold mit dem Schalk im Nacken an und gibt ihm einen Kinderkuss auf den Mund.
Es gelingt Arnold nicht so richtig, jetzt schon alle Vorbehalte abzuwerfen, so gern er das möchte. Hat Jakob wirklich die Wahrheit gesagt? Es kommt dem Schreiner eigenartig vor, wie kann einer so charmant und offenherzig sein, wenn er solches Grauen erlebt hat? Ist er wirklich so mutterseelenallein auf der Welt? Könnte er gar ein Spitzel sein? Wer hätte ihn schicken sollen und warum? Mit den soliden, logischen Fragen beruhigt er sich selbst.
Jakob hat ihn schon wieder in Ruhe gelassen und reagiert besonnen, indem er sich erst einmal richtig vorstellt. „Ich heiße Jakob Rosenberger, aus bekannten Gründen lass ich die Rosen weg, also Jakob Berger. Hab keine Angst vor mir, ich tu dir wirklich nichts. Und wenn irgendwann doch, dann ganz sicher etwas Schönes, das dir gefällt.“
Jakob mag den Schreiner. Er ist ihm sympathisch, es gibt keinen Grund, den jungen Mann zu provozieren, also hört er damit auf, Arnold auf die Schippe zu nehmen, er wollte ihn ja nur ein bisschen necken. Vielleicht haben sie sogar eine Chance zusammen. Vielleicht leben sie länger als diese Irren in Berlin, als dieser böse widerliche Diktator und seine Helfer, die, wüssten sie von dieser neuen Verbindung, ihre Vernichtung betreiben würden.
Jakob sagt auch: „Du hast recht. Verzeih mir, lass uns erst mal ein bisschen kennenlernen. Ich schlage vor, wir bleiben beim Sie in der Öffentlichkeit, und du stellst mich deinen Leuten als einen flüchtigen Bekannten vor, vielleicht gibt es bei euch einen Cousin mit einem besten Freund oder etwas anderes in der Art, jedenfalls einen, der untauglich für den Einsatz an der Front ist, zum Beispiel wegen einer Verletzung nach den ersten Einschlägen in Frankfurt, oder ein Mann, der bei der Rückkehr sein Zuhause in Trümmern vorfand und jetzt bei dir in der Werkstatt nachgefragt hat, ob er aushelfen kann, wo doch alle Männer weg sind. Ich kann auch so tun, als wäre ich nicht mehr ganz klar im Kopf oder so was in der Art, ich ein Irrer, warum nicht?“
Arnold hält erschrocken die Hand vor den Mund. „Bloß nicht, die Irren werden auch abgeholt, sie müssen in die Heilanstalt, die kommen da lebendig nicht wieder raus.“
Sie verabredeten sich für den Nachmittag. Sie würden sich später wieder in der Schreinerei sehen, Arnold wollte ihn dort zurücklassen und ihm Decken und Kleidung zum Wechseln mitbringen, das fiele nicht auf heute, weil ja der Besuch aus Frankfurt auch frische Wäsche bekam. Jakob war ihm dankbar, sagte, und das meinte er aufrichtig: „Hab erst mal vielen Dank, für heute ist der Tag seit Langem wieder mal ein guter Tag für mich. Der Himmel, so es ihn gibt, hat mir dich geschickt. Vielleicht darf ich ja doch noch ein Weilchen am Leben bleiben.“
Er traut sich auch, sich Arnold noch einmal zu nähern. Jakob legt die Hand an Arnolds Wange, sanft fordert er von ihm den Blick in die Augen, Arnold gewährt die Annäherung, obwohl ihn eine Schüchternheit befällt, die er so gar nicht von sich kennt. Er wird rot. Mein Gott, wie blau Jakobs Augen sind! Mit süßer Zögerlichkeit legt er den Arm um seinen Schützling, vielleicht sein Geliebter schon bald, bis der andere seinen freien Ellenbogen mit der Linken umfasst und Arnold in die Umarmung zwingt, ein sanfter Druck nur, nichts Gewaltsames, sehr männlich ist das. Auch der Kuss ist so.
Bevor Arnold die Tür, diesmal von außen, abschloss, hatte er die Vorhänge vor den beiden Fenstern zugezogen und den Kasten mit dem Geld unter den Arm geklemmt. „Und führe uns nicht in Versuchung“, hat er gedacht. Der schöne Untermieter könnte genauso gut ein Dieb sein wie ein frommer Jude, so wirklich glauben wollte er das aber nicht, dazu gefiel er Arnold viel zu gut.
Er hatte ihm ja auch versprochen, sobald wie möglich wiederzukommen, wenn es dunkel war. Musste ja nicht gleich jeder was mitkriegen, man würde nur rumtratschen.
Im Augenwinkel meinte Arnold, eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Vorsichtig drehte er sich um. Es war nur der Schatten eines Unerkannten an der Wand gewesen, auf der anderen Straßenseite in einigen Metern Entfernung, ein Schatten, der für ein paar Sekunden in grotesker Verzerrung über die weiße Rückwand des Hauses schräg gegenüber geflogen war.
„Da war nichts“, sagte er zu sich selbst. Ganz langsam kam sein Herzschlag wieder in den ruhigen Takt.
Jakob blieb allein zurück. Als er hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss der Werkstatttür drehte, ging es wieder los. Mit aller Kraft versuchte Jakob, gegen die unkontrollierbare Panik anzukämpfen, die ihn fast unmittelbar erfasste. Eingesperrt sein, das war ihm unerträglich. Eingeschlossen war er sowieso, dafür brauchte es nicht mal ein Schloss. Er redete sich selbst gut zu. Und zum ersten Mal seit Langem wagte er ein Stoßgebet zum Himmel: „Vertrauen, Herr gib mir Vertrauen!“ Der Himmel schwieg wie immer. Wenn nur die Angst nicht wäre. Er schloss die Augen, bis er spürte, wie auch sein Herz allmählich in einen ruhigen, gleichmäßigen Takt überging. Der Herr hatte ihn erhört. Jakob schüttelte den Kopf, Unsinn, das hat er ganz allein geschafft.
3
Die „Mädchen“ aus der großen Stadt
Pünktlich zum Mittagessen saß der Schreiner Arnold mit zum Spaß rechts und links aufgestelltem Besteck und demonstrativ umgebundener Serviette um den Hals am Esstisch des Elternhauses und forderte: „Hunger, bitte gebt mir Essen!!“, rief er aus, schon öffnete sich die Tür, und seine Mutter betrat mit einer großen Schüssel voll Kartoffelsalat das Wohnzimmer mit dem gedeckten Tisch. „Also weißt du, benimmt man sich so, wer hat dir das nur beigebracht? Schließlich haben wir Gäste.“ Die folgten Frieda auf dem Fuß, Emma sauste auf Arnold zu, der abwehrend die Hände hob.
„Du bist schon viel zu groß zum Herumwirbeln und Kichern.“ Also gut, die Nichte beschränkte sich auf eine freundschaftliche Umarmung, sie freute sich sehr, ein paar Tage bei ihrem Lieblingsonkel verbringen zu dürfen, zu Hause in Frankfurt hatte sie sich nicht mehr wohl gefühlt, dauernd hatten die Leute Angst, und im Bunker war man zwar sicher, aber sie schlief kaum noch wegen der Sirenen in der Nacht.
Auch Arnolds Schwester, das Malchen, wurde liebevoll von ihrem Bruder begrüßt, bekam einen Kuss auf die Wange gedrückt und wurde aufgefordert, sich an der Tafel niederzulassen und mit ihm und seiner Mutter „das Brot zu brechen“. Arnold fragte noch, ob der Großvater im großen Haus nebenan schon versorgt war. Maria und Sophie, Emmas Cousinen, hatten dem Opa gute Suppe gebracht, ihm beim Löffeln geholfen und ein bisschen mit ihm geredet. Jetzt saß er wieder am Erkerfenster im Lehnstuhl, paffte seine Pfeife und schien zufrieden, was hatte er doch für goldige Enkelmädchen.
Arnold fühlt sich ungeheuer beschwingt, er ist bester Laune, sonst würde er nicht solchen Unsinn reden, „das Brot brechen“, man könnte grad meinen, er sei auf einmal fromm geworden. Er ist aufgedreht, könnte alle umarmen, das muss der berühmte, der siebte Himmel sein. „Nun übertreib nicht gleich“, denkt er, ich kenne den Kerl doch noch gar nicht richtig, wer weiß, was da noch dahintersteckt, es ging jetzt doch reichlich schnell mit dem Küssen.“ Es sind gemischte Gefühle, die ihn umtreiben. Er ist verknallt, keine Frage, aber er traut dem Objekt seiner Begierde nicht hundertprozentig über den Weg, trotz der unschuldigen blauen Augen. Kein Wunder, wem kann man denn vertrauen in solcher Zeit. Arnold kennt niemanden, der frei von der Leber weg sagt, was er wirklich denkt. Ganz selten kommt es vor, dass eine der Frauen auf „die Nazis“ schimpft, die ihre Söhne und Männer in den Krieg geschickt haben, was soll nur aus uns daheim werden, hatten sie gejammert. Dann waren sie wieder ruhig gewesen und hatten gehofft, dass niemand aus der Nachbarschaft etwas von ihrem Ausbruch mitgekriegt hat.
Arnold war noch nie wirklich verliebt gewesen, so viel Gelegenheit gab es in Orb ja nicht, ab und zu mal ein bisschen Gucken, ein paar zweideutige Blicke mit einem der uniformierten Soldaten-Wachmänner vom StaLag IX-B, dem Gefangenenlager.
Nie hätte Arnold sich getraut, hier im Ort etwas mit einem Mann anzufangen. Es hätte ihn, wenn sie ihn erwischt hätten, den Hals gekostet. In Orb gab es seines Wissens keine heimlichen Treffpunkte für die Männer von seiner Art, in Frankfurt inzwischen sicher auch nicht mehr, es war zu gefährlich. Wer erwischt wurde, teilte das Schicksal der Juden, kam ins Lager oder wurde gleich zum Tod verurteilt.
Aber er hatte schon immer eine große Sehnsucht, die er stets hatte unterdrücken müssen. Er wollte das Unaussprechliche mit einem, den er nicht nur begehrte, sondern auch liebte.
Manchmal hatten die Männer vom Lager Ausgang und streiften durch Orb, landeten dann im Café Müller, der Bäcker schickte jemanden zum Bierholen, wenn es irgendwo in einem Gasthaus in dem Städtchen welches gab. Die Leute der Lagermannschaft gaben sich dann besonders männlich, prosteten sich zu und lachten laut, übertrafen sich gegenseitig im Soldatengebaren.
Herr Müller sah zu. Und beobachtete aufmerksam. Arnold war per Zufall mitunter zur gleichen Zeit in dem Lokal, dann wusste er nicht, wohin mit sich selbst und seinem beherrschten, zurückgehaltenen Begehren. Das eine Mal, als er den Blick eines strohblonden jungen Mannes mit wasserblauen Augen und kräftigen Armen gestreift hatte, war etwas aufgeblitzt. Arnold hatte schnell weggesehen und kurz danach das Café verlassen. Hoffentlich hatte keiner was bemerkt, das war Arnolds größte Angst gewesen.
Inzwischen sah man die Wachmänner kaum noch in der Stadt, es gab keinen Ausgang mehr, zu viele Gefangene.
Das Lager war vor langer Zeit ein Kindererholungsheim gewesen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte es viele hungrige, arme Kinder gegeben, die krank und mager waren. Ab 1920 hat ein Mann, ein Veteran dieses mörderischen Krieges namens August Jaspert, im Verbund mit der Frankfurter Kinderhilfe aus den Hütten am alten Schießübungs- und Bombenabwurfplatz das Erholungsheim für solche Jungen und Mädchen eingerichtet, dort hatten sie genug zu essen bekommen, waren an der frischen Luft, bekamen wieder rote Bäckchen. Danach mussten sie alle wieder nach Hause in die Ärmlichkeit der Städte.
Das Gelände war 1939 an die Wehrmacht übergeben worden. Ein großes Standortlager errichteten die Soldaten an der Wegscheide, Gefangene wurden dort bei miserabler Versorgung wie die Tiere gehalten, schlimmer noch. So wurde zumindest gemunkelt, selten fand einer aus der Kurstadt, der hätte berichten können, den Weg dorthin, obwohl es nur viereinhalb Kilometer zum Lager waren. Die Russen, die Bolschewiken, also Untermenschen, wurden am schlechtesten behandelt, hieß es, viele verhungerten angeblich, den Polen erging es nicht viel besser. So war das im Krieg, keiner hätte sich getraut zu protestieren. Und sich dem Lager richtig zu nähern, war sowieso verboten für die Zivilen, bei den seltenen Gelegenheiten, wenn die Soldaten in den Ort kamen, hatte Arnold sie gesehen.
Er hatte sich Gott sei Dank keine Blöße gegeben, wenn ihm einer von ihnen gefiel. Es war ihm peinlich, deshalb hatte er niemandem davon erzählt, nicht mal Marie, aber er fand das zackige Gebaren, die schneidigen Uniformen, die akkuraten Haarschnitte, die markigen Sprüche, das heldenhafte, unbesiegbare Getue der Männer, die in Arnolds Fantasievorstellung so wunderbar in Reihen stehen und salutieren konnten, bedauerlicherweise ziemlich attraktiv. Als er so etwas mal zu sehen bekommen hatte, als die Burschen durch Bad Orb marschiert waren in Reih und Glied, mit dem Trommler vorneweg, da hatte er wegsehen müssen, nicht nur, damit niemand was merkte, auch weil er genau gewusst hatte, dass es nicht recht war, was er empfand, sie alle hätten ihn, ohne zu zögern, gleich mitgenommen ins Lager, vielleicht sogar gleich erschossen. Es war ihm bewusst: Das waren die, die das Böse bedienten. Es waren Männer, die das Morden gelernt hatten, die Gewalt ausübten, andere Männer straften, verspotteten, schlugen, quälten, verhungern ließen, erschossen. Sie hatten eingetrichtert bekommen, wie man auf Mitleid verzichtet, waren im Lauf der Zeit roh geworden. Sicher wollten nicht alle so sein, so herzlos, so unberührbar, aber wussten die denn, was sie wollten? Uniformen hin oder her.
Amalie lacht mit ihrem Bruder über seinen Scherz, so kennt sie ihn gar nicht, ein Ernster ist er sonst, und Arnold bemerkt ihren prüfenden Blick. Schnell verbietet er sich selbst den Überschwang, nimmt sich zurück, versteckt das Hochgefühl hinter Geschäftigkeit, verteilt Kartoffelsalat auf die entgegengehaltenen Teller. Er möchte viel lieber sein Glück zeigen dürfen, gerade hier, wo ihn gewiss keiner verraten würde. Sie lieben ihn ja alle, hier sitzen sie mit ihm am Tisch, aber es brächte sie vielleicht in Not, besser, sie wissen von nichts.
„Wie geht՚s Marie? Ich hab sie noch nicht getroffen, seit wir angekommen sind. Aber wir sind ja noch nicht lang da“, fragt Amalie vorsichtig ihren Bruder.
Arnold schaut von seiner Bratwurst auf, die nun neben dem Kartoffelsalat platziert ist. „Na ja, so wie immer, eigentlich geht es Marie ja meistens gut, sie ist eine Frohnatur. Natürlich macht auch ihr der Krieg zu schaffen, sie hat immer Angst, dass die Bomber die Apfelbäume auf der Schafswiese erschießen. Ich geh nachher zu ihr, wir wollen ein bisschen spazieren gehen, und vielleicht gibt᾽s ein Törtchen beim Café Müller, heute scheint ja auf einmal die Sonne so schön. Nun erzähl du doch bitte, wie das in Frankfurt war mit dem Angriff. Es muss furchtbar gewesen sein. Hier hört man nur bruchstückhaft im Radio was davon und kann nicht beurteilen, ob das so alles stimmt.“
Emma ist ganz aufgeregt, sie will dem Onkel so viel erzählen von Frankfurt, dass sie was gesehen hat, was Schreckliches: Da lag eine tote Frau auf der Straße, die hat jemand erschlagen, so sah es aus. Vielleicht war sie auch von selber umgefallen, vor Hunger vielleicht, allzu dünn hatte sie ausgesehen. „Einer“, sagt Emma, „hat nachgeguckt, ob die Frau zu retten ist. Der Mann, der danebenstand, hat die Frau abschätzig betrachtet und den Freund angeschnauzt. Und dann hat er gesagt: ,Schau dir die doch an, das ist keine Deutsche, die hat ganz dunkle Haare, wer weiß, wo die rausgekrochen ist.‘“ Emma hatte sich nicht getraut, was zu sagen, war noch einen Moment an dem Ort geblieben, bis ein größerer Pritschenwagen angefahren kam und ein Mann in Uniform ausstieg, der hatte den Puls der Frau gefühlt, ihr – endlich – die erloschenen Augen geschlossen und in die Runde gefragt, ob jemand die Tote kenne, weiß jemand, wer das ist? Als niemand antwortete, hat er dem Fahrer zugerufen: „Also gut, die kommt mit uns, wir werden schon ein Grab für sie richten.“ Sie hatten die Frau mit dem schwarzen Haar auf die Ladefläche gehoben. Emma konnte sich keinen Reim darauf machen, also schaute sie dem abfahrenden Laster hinterher, bis er nicht mehr zu sehen war. Dabei betete sie für die Unbekannte. „Lieber Gott, bitte lass sie zu Dir in den Himmel kommen, auch falls sie eine Jüdin ist, sie kann ja nichts dafür.“ Die umstehenden wenigen Frauen und ein alter Mann seien in verschiedene Richtungen weggegangen, der Alte habe noch gemeint: „Geh heim, Mädchen, das ist nichts für deine Augen.“
Arnold hat Emma zugehört, er ist erschüttert. So etwas passiert mitten in der Stadt am helllichten Tag? Unfassbar! Das junge Mädchen sieht so unglücklich aus. Er versucht, seine Nichte zu trösten. „Du hättest ihr nicht mehr helfen können, das ist das Schlimme am Krieg, die Leute sterben, auch solche, die keinen Krieg wollen, niemandes Feind sind. Wir sind doch alle nur ganz normale Leute, die eigentlich in Ruhe leben wollen. Oder will vielleicht einer von euch irgendwelche Russen, Polen oder Juden erschießen? Ich will das nicht und du, Emma, ganz gewiss gar nicht.“
„Bist du jetzt mal ruhig. Wenn das draußen einer hört!“ Das kommt von Frieda, doch sie sieht ihren Sohn an und nickt ihm zustimmend zu. „Es ist eine bittere Zeit, so ein Durcheinander, wer soll da noch durchblicken, warum wir wo einmarschieren und was wir erobern. Seid gewiss, irgendwann ist der Spuk vorbei, hoffentlich kommt dann kein anderer Schreihals, der den Saustall wieder aufräumt, sondern ein Engel, der uns aufrichtet.“ Die letzten Sätze hat Frieda ganz leise vor sich hin gesprochen. Arnold hat es trotzdem gehört, er blickt in die Gesichter der Tafelrunde, erkennt auf allen dreien Einverständnis.
Und doch bekommt er es mit der Angst zu tun, um Jakob fürchtet er und auch um sich selbst, wenn sie ihn erwischen, wie er dem Juden hilft und dass er den Schönen vielleicht sogar liebt, dann sind sie alle verloren. Was ist, wenn es immer so weitergeht, wenn keine Rettung für ihr geschundenes Land, ihre verstörten Seelen auf dem Weg zu ihnen ist? Der „Führer“ ist noch nicht so alt, wie lange sollen wir den noch ertragen?
Jetzt heißt es überleben, das muss gelingen! Oh Gott, ihm wird himmelangst, Arnold kann es nur mühsam verbergen, denkt sich lieber in das Gefühl zurück, das er beim ersten Kuss empfunden hat. Es wird gut gehen, ganz bestimmt, sei ein Mann, Arnold!
Amalie berichtet dann, was in Frankfurt geschehen ist, Gott sei Dank wurde bisher niemand ernsthaft verletzt, ihr „Wunder“-Haus war ohne Schrammen stehen geblieben. Trotzdem wird sie vom Erzählen ganz verzagt, sie sorgt sich um den Heinz, mit seinen nun bald achtzehn Jahren muss er womöglich im letzten Moment noch in den Krieg. Dann käme er bestimmt gleich an die Front. Sie erschrickt bei dem Gedanken, er ist doch noch ein halbes Kind.
Als Bub hatte Heinz die zwei Tage Hitlerjugend in der Woche überstanden, indem er meistens nichts sagte und versuchte, andächtig dem zu erlernenden Un- und Wahnsinn zuzuhören. Doch lesend hatte er mithilfe der Bücherei seinen Geist geformt und das selbstständige Denken gelernt. An der Grenze zum jungen Mann hatte er insgeheim die wahren Ziele dieses todbringenden Rudels der Hitler-Gläubigen erkannt. Er verachtete die Nazis, doch er musste an sich halten, wenn der sogenannte Diensthabende Führer vor Ort mit leuchtenden Augen vom Glanz des deutschen Volkes schwadronierte, von dessen natürlicher Überlegenheit. Zu Hause hatte er seiner Mutter davon erzählt und sich darüber lustig gemacht, während es Amalie angst und bange geworden war: Wenn er solche Sachen offen aussprach, nicht auszudenken.
Heinz hielt eisern die Klappe in den ungeliebten Stunden, zog auch mal schweigend und würdig blickend das NS-Banner am Mast hoch. Er machte halt mit, weil er musste. Aber er hatte keine Lust auf Fahnenschwingen und Trommelwirbel, auf Rassenkunde und Führeranbetung und sah auch keinen Sinn darin.
Außerdem: Eine Wiese war für ihn eine Wiese, Schluss, aus, fertig. Von wegen Feld der Ehre, auf dem ein echter Mann den heldenhaften Soldatentod freudig strahlend sterben durfte! Was für ein Wahnsinn!
Seine Wiese war der Fußballplatz gewesen, als Torwart der „Speuzer“, das war schon was, worauf er stolz gewesen ist. Den Traum vom Fußball-Erfolg als Torhüter freilich hatte der verdammte Krieg zunichtegemacht. Immerhin hatte Heinz schon einmal eine Erwähnung im Sportteil der Zeitung gegefunden, als er den schier sicheren Trefferball des Gegners gerade noch rechtzeitig gehalten hatte.
Dabei war er stets eher der Zarte gewesen, Emma war viel robuster, fühlte sich deswegen aber manchmal zurückgesetzt, weil die Eltern ihr mehr zutrauten, muteten sie ihr auch hin und wieder zu viel zu, dachten nicht an sie, wenn es um Vergünstigungen ging. Heinz bekam zum Frühstück Rührei und in den Tee Traubenzucker wegen seiner Blutarmut. Emma bekam die restlichen Bratkartoffeln vom Abend zuvor, sie maulte zwar, aber eigentlich, wenn sie ehrlich war, mochte die kleine Schwester die Aufgebratenen viel lieber als die glibbrigen Eier.
Amalie ist in ihre eigene Gedankenwelt abgetaucht, als sie bei ihrer Mutter am Esstisch sitzt, endlich kann der Geist ein wenig zur Ruhe kommen. Sie macht sich einfach zu viele Sorgen um ihre Kinder, sie kann ja nichts tun. Der elende Krieg, sie nimmt sich vor zu beten, dass ihr Sohn nicht mehr an die Front muss. Nicht dass es ihr so geht wie der armen Frau Schneider im fünften Stock: Ihr Seppi war gefallen, mit achtzehn, der würde nicht mehr heimkommen, nicht mal im Sarg, und er war doch noch so jung gewesen. Amalie hatte ihn schon als Kind auf dem Schoß sitzen, wenn er bei Heinz zum Spielen zu Besuch war, das ganze Haus hat mit Seppis Mutter getrauert, die ihr Kind verloren hatte.
Als die anderen am Tisch Amalies und Emmas Erzählungen gehört haben, ist es erst mal still in der Runde. Frieda schüttelt stumm den Kopf, was soll nur werden? „Der Krieg dauert nicht mehr lang, ist bestimmt bald vorbei“, sagt Arnold. Mehr Hoffnung als Glaube ist das.
Amalie erzählt auch von ihrem Mann, von Heinrich, der anscheinend endlich vernünftig geworden ist, nachdem er mit Mühe und Not noch mal davongekommen war, und dass er mit den Männern aus der Nachbarschaft, dem Kress und dem Weindl, inzwischen wenigstens in den Bunker geht – „Er hat es versprochen – das macht es mir ein bisschen leichter, aus der Stadt zu euch aufs Land wegzulaufen.“
Die Tischrunde hat viel zu bereden, sie sind sich einig, dass sie den Krieg nicht wollen, sie sind heimlich dagegen, gegen das, was die mit den Juden machen. Was eigentlich genau? Das mit den Juden ist nicht recht, aber so etwas sprechen sie nur hier zu Hause aus. In Orb weiß man jedenfalls nur, dass von den Gefangenen einige abtransportiert wurden, in ein anderes Lager, nach Buchenwald.
„Die Juden in Bad Orb sind jedenfalls alle verschwunden, wohin, das mag sich keiner ausmalen“, sagt Frieda. „Man hört Schlimmes, aber vielleicht sind das nur Gerüchte, das hofft man ja immer, nicht wahr?“
Einer von ihnen ist gerade erst angekommen.
*
Arnold hatte sich entschuldigt, war vom Tisch aufgestanden und kurz darauf auf dem Weg zum Dachboden, um nach den eingelagerten Kleidungsstücken seines Vaters zu suchen, der brauchte sie ja nicht mehr, vielleicht war das eine oder andere passend für den Schönen, merken würde das bestimmt niemand, dass der Dominikus eine ähnliche Manchesterhose (er hatte es immer halb englisch ausgesprochen: „Mänschesterhos“) gehabt hatte, wenn Jakob sie tragen würde.
Frieda rief ihrem Sohn gleich nach, er solle doch bitte, wenn er schon da oben war, die Betten im leer stehenden und jetzt als eine Art Gästezimmer dienenden ehemaligen „Bürozimmer“ seines Vaters beziehen. Das „Büro“ lag auch im Dachgeschoss, war durch eine dicke Holzwand vom sorgfältig sortierten Speicher abgetrennt. Emma und Amalie hatten jeweils ein Bett für sich, ein weiteres stand auch noch an der Wand. Es diente als provisorisches Sofa. Arnold überlegte, ob und wie er es in die Werkstatt bringen könnte, verwarf den Gedanken aber gleich, das wäre zu auffällig.
Er entnahm dem Kleiderschrank auf dem Dachboden drei Leintücher, drei Kissen- und drei Bezüge für die Plumeaus, die er noch schnell nebst Kissen aus der abgeschrabberten Truhe mit dem Bauernzierrat herausnahm. Voluminös bepackt, trug er das Bettzeug ins Bürozimmer, zog die Leintücher über die Matratzen, klemmte die Ecken in Krankenhausfaltung darunter, überzog Kissen und Decken mit den blau-weiß karierten Hüllen. Das Bettzeug für Jakob verstaute er erst mal in der Truhe. Nun musste ein Schlafplatz für ihn gefunden werden.
Dann rannte Arnold schnell runter, damit er auch noch etwas von dem Vanillepudding mit selbst gemachtem Himbeersirup abbekam.
4
Das glücklichste Paar der Welt
In Amalies ehemaligem Elternhaus hatte Arnold vor der Ankunft seiner Schwester und deren Tochter Emma noch einiges zu tun. Erst wollte er nach dem Großvater sehen, mit seinen neunzig Jahren lebte der alte Mann im Nachbarhaus allein, aber viel mehr als im Sessel sitzen und Pfeife rauchen konnte er nicht mehr, ein paar Schritte zum Haus raus und zwischen den Räumen im Erdgeschoss, das ging noch. Die drei Treppen hinunter auf die Holzbank vorm Haus schaffte er auch ganz gut. Die Sophie und die Maria, Großvaters Enkelinnen, gingen jeden Tag hin und brachten ihrem Opa sein Essen. Sophie war noch in Emmas Alter, die Verständigere war Maria, sie war sechzehn, musste manchmal schon ganz schön ran, ihrer Mutter helfen, war sie doch die Erstgeborene, und das Pflichtjahr hatte gerade begonnen.
Seit Arnolds vierzehn Jahre älterer Bruder Otto im Osten vermisst wurde, musste Arnolds und Amalies Schwägerin Katrin, die Tochter von ihrer aller Großvater, sich und ihre beiden Mädchen allein durchbringen. Am Abend halfen die Enkelinnen dem Opa Josef beim Zubettgehen und auch morgens nach dem Aufstehen.
Obwohl Josef nicht viel Abwechslung hatte, war er meistens guter Laune, war freundlich und erzählte ganz wach von früher, als er jung gewesen war und die Apfelernte und die Mosterei überwacht hatte. „Wie soll ich euch das erklären, aber das war unser einziges Vergnügen“, sagte er immer, „aber ihr könnt mir glauben, wir hatten unsern Spass.“ Mit zwei s.
Mit den jungen Dingern hatte er geschäkert, und es war richtig lustig geworden, wenn sie den ersten Most verkostet hatten, manchmal ein bisschen zu ausgiebig. Mit seinen schneeweißen Haaren und dem Schnurrbart war er der reinste Bilderbuchopa. Alle Jüngeren nannten ihn Großvater. Auch der Schreiner Arnold Reinelt, er hatte seine beiden „richtigen“ Großväter nicht mehr kennengelernt.
*
Arnolds Vater hatte es mit dem Weinanbau versucht, dafür hatte er ein echtes Händchen gehabt. Nun ruhte Dominikus schon seit vielen Jahren auf dem Gottesacker. Nun ja, er war bei Arnolds Geburt auch schon weit über vierzig gewesen. Die ein- undzwanzigjährige Frieda hatte der Vater zügig geheiratet, „weil ich meine drei künftigen Kinder noch aufwachsen sehen will“. Prompt kam erst mal ziemlich schnell die kleine Amalie, ein Achtmonatskind – „weil das erste Kind meistens ein bisschen früher kommt als die späteren“, hatte Amalie Emma erzählt, mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Emma hatte den Witz nicht gleich verstanden.
Ein Jahr nach der kleinen Amalie lag schon wieder ein Säugling in der Familienwiege, die vor Jahrzehnten die Mutter der Babys in den Schlaf geschaukelt hatte. Der neue Sohn, der auf den Namen Otto getauft wurde, war ein drolliges Kindchen, das alle anstrahlte. Und kurz vor Dominikus᾽ sechsundfünfzigstem Geburtstag erblickte vierzehn Jahre später überraschend noch der Nachzügler Arnold das Licht der Welt, wie groß war die Freude über den ganz besonders niedlichen Jungen mit der kräftigen Stimme gewesen.
Erst mit sieben, als Arnold „schon Verstand hatte“, wie Frieda meinte, hatte sie seiner Schwester und ihm erzählt, dass sie, die zwanzig Jahre jünger war als ihr äußerst ansehnlicher Gemahl, gleichermaßen schweren wie euphorischen Herzens den Geschiedenen und dazu auch noch Evangelischen geheiratet hatte. Das war eigentlich verboten in der katholischen Kirche, die Frau eines geschiedenen Mannes war eine Ehebrecherin und zur Hölle verdammt! Evangelische waren Ketzer, so hatte sie es gelernt.
Doch Frieda war unsterblich in Dominikus verliebt gewesen, schon im ersten Augenblick, als er auf der Wiese zu ihr gerannt war, was hätte sie tun sollen? Frieda gestand ihren Kindern, dass sie sich geniert hat und dass sie auch eifersüchtig gewesen ist auf die erste Frau, aber solange niemand Genaues von dieser Frau wusste, war es für Frieda erträglich gewesen, und Dominikus war Frieda ein guter und treu sorgender Ehemann geworden. Seine Geschiedene, die war wohl eine Halbseidene gewesen, abgehauen war sie mit einem anderen, hatte Dominikus, der aus dem Ersten Weltkrieg Gott sei Dank unversehrt zurückgekehrt war, einfach sitzen gelassen. Als er nach Hause zurückgekehrt war, hatte er die Wohnung leer vorgefunden, alle Möbel waren weg gewesen. Niemand hatte ihn bei dem Kriegsnachzittern, der nachlassenden Angst, den Albträumen, dem Aufschrecken in der Nacht im Arm gehalten, keine Frau war an seiner Seite gewesen für ein wenig Zuversicht.
Als er Frieda kennenlernte, stand sie gerade auf ihres Vaters Schafsweide und hatte einen Rechen in der Hand. Dominikus ist damals spontan eilig über die Wiese zu ihr gelaufen, er hatte Frieda vom Weg aus eingehend betrachtet, und als er vor ihr zum Stehen kam, hat er sie direkt gefragt, ob er sie später zum Spazierengehen abholen dürfe, vielleicht sogar auf ein Glas Wein? Er sah so gut aus, Frieda spürte so ein Ziehen im Bauch bei seinem Anblick, und sie dachte gleich: „Den will ich heiraten.“ Schon ein Vierteljahr danach hatte sie mit dem geschiedenen, evangelischen und so viele Jahre älteren Mann mit dem komischen Vornamen vor dem Altar der katholischen Kirche gestanden und sich einen Wimpernschlag lang gefragt, ob die Ehe denn auch gültig wäre vor Gott, auch wenn manches nicht so war, wie es sich normalerweise gehörte. Dann war sie nur noch glücklich gewesen, nachdem der frischgebackene Ehemann ihr vor allen den Hochzeitskuss gegeben hatte.
Dominikus hatte sich als Einziger in der Gegend an den Versuch herangetraut, Weintrauben anzubauen, einfach weil er bei aller Tatkraft ein Träumer war. Die Apfelbäume sollten an ihrem Platz bleiben. In gebührendem Abstand zu ihnen schlug Dominikus lange Holzpflöcke in den Boden, spannte Seile, künftige Rankhilfen dazwischen, baute alles wieder ab, weil zu wenig Platz für die benötigte Menge an Pflanzen entstand. Also noch mal von vorn: Pflöcke in den Boden, Seile, Rankhilfen, diesmal im Zickzackmuster, das hatte reichen müssen. Er hatte ein Händchen für seine jungen Reben, sie wuchsen und wuchsen und sollten im Herbst prächtige Trauben hervorbringen.
Bevor es mit dem Weinanbau losgegangen war, hatte Dominikus alles genau vorbereitet und einen Brief an einen erfolgreichen Winzer in Alzenau geschrieben, in dem er um den Kauf neuer Riesling-Pflanzen angefragt hatte. Der Mann hatte auch prompt geantwortet und ihm bereits angezüchtete Rebstöcke angeboten. An einem Sonntag hatte Dominikus die vorgezogenen ersten Reben dort abgeholt. Ein Tagesausflug, dachte er. Riesling würde er anbauen, der sollte besonders gut sein.
Der Weinbauer hatte ihm im Eilverfahren die Grundlagen des Weinbaus mit auf den Rückweg gegeben, hatte von „Organen des Rebstocks“ gesprochen, von den Sorten, wie man pflanzt und Reben vermehrt und schneidet, düngt und vor Schädlingen bewahrt, auch davon, dass es nützliche Insekten und andere kleine Tierchen gibt, die die Weinpflanzen schützen. Vor allem hatte der Winzer Dominikus erklärt, wie ein Weinberg angelegt wird.
Mit dem Pferdewagen vom Milchbauern Karlheinz Acker hatte Friedas Ehemann die Fahrt angetreten, wollte am frühen Abend wieder bei ihr in Orb sein. Wegen der Fütterungs- und Ruhepausen für den etwas älteren Hengst hatte er dann doch einen ganzen Tag gebraucht und darüber hinaus bis in die Nacht. Frieda war schon ein bisschen unruhig geworden und sehr erleichtert gewesen, als ihr Mann von seiner „Reise um die halbe Welt“ schließlich wieder bei ihr am Küchentisch saß und von seinem Abenteuer erzählte.
Es war Dominikus ungeheuer wichtig gewesen, von jedem künftigen Jahrgang mindestens zwei Flaschen so zu lagern, dass sie, wenn’s sein musste, auch Jahrhunderte überstehen konnten. Er hatte einen großen Plan, der weit über sein eigenes Leben hinausreichte: Dominikus hatte in seinem Testament festgelegt, dass seine Familie über die Generationen hinweg die guten Weine aufbewahren und pflegen sollte, sodass die gesamte Sippe dereinst am Jüngsten Tag dem Herrgott etwas mitbringen konnte in die Ewigkeit, etwas, was noch Zeugnis ablegte, wenn die Welt untergegangen war, wie schön sie einst gewesen war und was für wundervolle Früchte sie hervorgebracht hatte.
Dominikus hatte manchmal gesagt: „Der liebe Gott hat mir so viele gute Dinge geschenkt, eine sehr hübsche, liebe Frau und eine bildschöne Tochter, einen vielversprechenden Sohn und zum Schluss, so spät noch, das kleine Kerlchen, das mir sogar ähnlich sieht, da muss ich dem Himmel doch zeigen, was ich daraus gemacht habe. Natürlich weiß Er auch so alles von mir, aber Er freut sich bestimmt, wenn Er mal selber schmecken kann, wie ein guter Wein auf der Zunge liegt.“
Damit sich seine Nachkommen an seine Auflagen hielten, hatte Dominikus bestimmt, dass der kleine Weinkeller Gottes, den er im mittlerweile versiegelten Gewölbe des höhlenartigen ehemaligen Kuhstalls eingerichtet hatte und den alle den „Geheimraum“ nannten, gut verschlossen blieb und der Schlüssel dazu von Generation zu Generation weitergegeben werde. Derjenige, der beides erben würde, sollte schriftlich und mit Brief und Siegel versprechen, dass er niemals einen anderen reinlassen, niemals eine der Flaschen leeren und gut auf den Wein achten würde, damit er erhalten blieb. Zu gern gab er sich der Illusion hin: ein Wein für die irdische Ewigkeit.
Eine Ausnahme legte er aber fest: Wenn es „ein Fest der Liebe“ gäbe, dann, und zwar nur dann, dürfe die Familie den alten Kuhstall aufsuchen und eine Flasche des „Herrgottsnektars öffnen und das Glas auf die größte Macht der Welt, die Himmelsmacht, die Liebe erheben“. Dominikus bedachte auch, dass derjenige wiederum von seinen Nachkommen dieselbe Sorgfalt einfordern solle: wenn er dies alles versprach, sollte er dem Erbe das Haus vermachen, den zierlichen Weinberg und die Schafswiesen, wo die alten Apfelbäume mit den Früchten für den Äbbelwoi standen.
Dominikus lebte glücklich mit Frieda, die ihn schon bald Minkus genannt hat, sie fand, die Abkürzung passe besser zu seinem leicht „piratenmäßigen“ Äußeren, Dominikus, das würde sich ja anhören, als wäre er ein Mönch, und das sei er ja nun wahrlich nicht. Sie sagte: „Minkus und ich, wir sind das glücklichste Paar der Welt.“
Gewissenhaft hat das „kleine Kerlchen“, das auf den Namen Arnold getauft worden war, nach dem Tod seines Vaters, der sich viel zu früh auf den Weg in den Himmel gemacht hatte, vor dem Bad Orber Magistrat mit „Brief und Siegel versprochen“, sich an Minkus՚ Vorgaben zu halten.
Der Ältere, der Otto, hatte keine Lust auf Weinberg und schmutzige Stiefel gehabt, seine waren schon damals blank gewienert, er lachte laut, als er seinen viel jüngeren Bruder beobachtete, wie der schon als kleines Kind so sorgfältig die kleinen Ästchen der Weinreben mit feinem Draht an den Haltestangen befestigte, wenn er dem Vater half. Otto lernte Automechaniker, das Handwerk konnte er später beim Militär gut gebrauchen.
Arnold richtete sich, als er aus den Kinderschuhen fast gänzlich herausgewachsen war, in einem leer stehenden, aber geräumigen Holzschuppen mit vier Fenstern eine Werkstatt ein. Bevor die Bretterhütte zum Abstellraum für Rechen, Schaufeln oder auch Stoffballen und anderes Überflüssiges geworden war, hatte sie einem Schuster, dann einem Drechsler als Werkstatt gedient. Einer war bald nach dem Ersten Weltkrieg gestorben, der Drechsler hatte sein Handwerk aufgegeben, er sei in die Stadt gezogen, hatte es geheißen.
Ein Vermieter war nicht auszumachen gewesen, also hatte Arnold den verwaisten Schuppen ausgeräumt, ein neues Türschloss eingebaut, manches vom Inventar verschenkt und teilweise aufbereitet. Die Drehbank hatte er behalten und sich das Schreinern mithilfe eines zerfledderten Lehrbuchs, das er hinter einem alten Holzregal gefunden hatte, selbst beigebracht.
Arnold liebte es, schöne Dinge zu gestalten und herzustellen, schon als Kind hatte er lieber das Teeservice abgemalt, das er zuvor auf der bestickten weißen Tischdecke auf dem Wohnzimmertisch schön arrangiert hatte, als sich mit den Lausbuben im Ort zum Kräftemessen im Schlamm zu wälzen. So war es keine Frage gewesen, wer sich um des Vaters Auftrag kümmern würde, wenn der nicht mehr war. Der kleine Weinkeller Gottes würde unter Arnolds Hand keinem Fremden offen stehen. Niemand sollte den Wein trinken, ja nicht einmal einen Blick sollte einer darauf werfen dürfen.
Arnold hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Zeichnen und Schönschreiben bis zur Perfektion zu erlernen, um den ehrwürdigen Flaschen zu den schmuckvollen Etiketten zu verhelfen.
„Heutzutage, wo alles drunter und drüber geht, hat keiner mehr die Zeit und Muße, stundenlang am Küchentisch zu sitzen und Schildchen für die Flaschen zu malen, aber früher war das eins meiner Hauptvergnügen. Ihr habt halt eine andere Abwechslung, mir macht das immer noch Freude“, pflegte er zu den Töchtern seines großen Bruders, Maria und Sophie, zu sagen, wenn sie den Onkel mit seinem Hobby aufzogen.
Mit der „anderen Abwechslung“ meinte er die Filmaufführungen im Olympia. Maria und Sophie schluchzten mit Zarah Leander in „Heimat“ und schwärmten für Willy Fritsch und Dieter Borsche. Wenn Sophie beschreiben wollte, wie fantastisch der Kinoabend gewesen war, sagte sie eigentlich immer dasselbe in abgewandelten Worten: „Was war᾽s so schön, was ham wir geheult.“
Frieda hatte lang um ihren Mann getrauert. Arnold vermisste seinen Vater bis in die Gegenwart, er war ihm äußerlich sehr ähnlich geworden, in der Art von Humor und wie er den Kopf hielt, wenn er was überlegte, auch wie er im einzigen Wohnzimmersessel saß, die Beine übereinandergeschlagen, den linken Arm auf der Lehne aufgestützt, der Kopf in der Hand ruhend, genau wie Minkus.
Nur sein Vater hatte bereits früh eine Ahnung von Arnolds Geheimnis gehabt, eigentlich war er sich seiner Sache sicher, wollte den Jungen aber nicht in Verlegenheit bringen. „Du bist schon recht, so, wie du bist“, hat er einmal zu seinem Sohn gesagt. Und: „Mach dir keine Sorgen, auch du findest deinen Platz in der Welt.“
*
Nun ist es so weit. Arnold hatte, ohne lang zu überlegen, eine Entscheidung getroffen, die ihn den Kopf kosten konnte. Wie gern würde er ihm sagen können, dass er endlich den Platz gefunden hat, den ihm sein Vater verheißen hat.
Das frisch bezogene Plumeau duftet nach etwas Blumigem, seine Mutter hatte ein bisschen Rosenwasser auf ein Taschentuch geträufelt und zur Wäsche gelegt.
Arnold schwankt zwischen froher Erwartung, Zweifel und Misstrauen, Sehnsucht und Angst, ein böses Durcheinander. Das ist normal, wenn man verknallt ist, denkt er. „Ich lass mich nicht ausnutzen, das versprech ich mir und dir.“ Wenn Arnold durcheinander ist, redet er mit Dominikus, als wäre der Vater im Raum und könnte ihn hören.