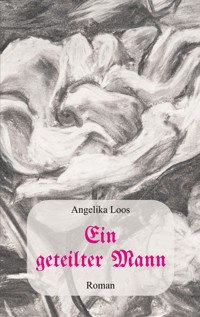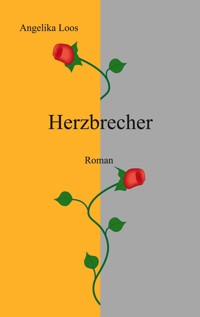
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach der ersten Begegnung in den frühen 1970er-Jahren ist es um sie geschehen: Hanna ist 17 Jahre alt und zum ersten Mal verliebt. Jonathan, "Jean", und Hanna erleben zusammen ein Jahr voller überschäumender Gefühle, erster Berührungen, Ängste und Zweifel. Als ihre Jugendliebe unvermittelt endet, verschwindet Jean für ein paar Jahre aus Hannas Leben, nur, um eines Tages wieder bei ihr anzuklopfen . . . Jahrzehnte später bittet Jean seine erste Liebe um ihre Sicht auf die gemeinsam verbrachten Zeiten, auf das große Glück wie auf die Kämpfe und Verletzungen. Jean schreibt ihr in einem kurzen Brief, er erinnere sich nicht an alles, er sei sich selbst auf der Spur, brauche ihre Hilfe. Hanna macht sich an die Arbeit und schreibt die gemeinsame Geschichte auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nach der ersten Begegnung in den frühen 1970er-Jahren ist es um sie geschehen: Hanna ist 17 Jahre alt und zum ersten Mal verliebt. Jonathan, „Jean“, und Hanna erleben zusammen ein Jahr voller überschäumender Gefühle, erster Berührungen, Ängste und Zweifel. Als ihre Jugendliebe unvermittelt endet, verschwindet Jean für ein paar Jahre aus Hannas Leben, nur, um eines Tages wieder bei ihr anzuklopfen . . .
Jahrzehnte später bittet Jean seine erste Liebe um ihre Sicht auf die gemeinsam verbrachten Zeiten, auf das große Glück wie auf die Kämpfe und Verletzungen. Jean schreibt ihr in einem kurzen Brief, er erinnere sich nicht an alles, er sei sich selbst auf der Spur, brauche ihre Hilfe. Hanna macht sich an die Arbeit und schreibt die gemeinsame Geschichte auf.
Angelika Loos, Jahrgang 1955, studierte Theaterwissenschaften, Neuere Deutsche Literatur und Philosophie. Sie arbeitete als Lektorin und Redakteurin. Außerdem war sie Übersetzerin und Herausgeberin der Liebesbriefe des französischen Königs Heinrich IV., die 1989 unter dem Titel „Ich küsse millionenmal Eure Hände. Die private und intime Korrespondenz des Königs Henri Quatre“ erschienen sind. Sie lebt in München. „Herzbrecher“ ist ihr erster Roman.
„Seither weiß ich, wie Menschen bis in ihre tiefsten Tiefen hinein miteinander verschränkt und ineinander gegenwärtig sein können, ohne davon die geringste Ahnung zu haben.“
Pascal Mercier, „Nachtzug nach Lissabon“
Ein Mann und eine Frau. Wie geht ihre Geschichte? Was macht sie besonders, was banal? Hanna muss auswählen, das Erinnerte sortieren. Das Richtige will sie erzählen, das hat ihr der Mann aufgetragen, er hat nichts weiter dazu gesagt, was er mit ihrem Wissen von ihrer beider Herzenswahrheit anfangen will.
Was erzählt man von der vergangenen Liebe? Was ist Fantasie, was Realität, was Interpretation, welche Episode ist Dichtung, welcher Kuss Wahrheit?
Jede Liebe hat ihren eigenen Takt, und jede Beziehung hat einen besonderen Schmerz, wenn sie zu Ende geht. Bis dahin ist sie in Bewegung, mal im Einklang, mal im Zwist.
Was war wirklich? Und spielt das eine Rolle?
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
1
2020
Keine Veränderung in seiner Stimme, sofort war er wieder präsent gewesen, das geraunte „Hartmann“ mit dem ansteigenden fragenden Ton am Ende, der noch immer so vertraut war. Hanna hatte den Telefonhörer sofort wieder auf die Gabel gelegt, verwählt hatte sie sich, statt der Tübinger Nummer der Freundin hatte sie versehentlich (?) eine Zahlenfolge in das Tastenfeld getippt, die sie bis heute nicht vergessen hat. Jean war am Apparat gewesen, der eigentlich Jonathan hieß, der dreimal in Hannas Leben Geliebter, Partner, Lebensinhalt gewesen ist. Damals hatte er ihr Briefe geschrieben, vor ein paar Tagen waren sie Hanna wieder begegnet, als sie beim Ausmisten aus der Büchse im Regal fielen. Sie hatte sie noch einmal gelesen, dachte daraufhin ohne Wünschen und mit nur wenig Sehnen viel an die vergangene Zeit voller heftiger Gefühle und Leidenschaften.
Vor ein paar Tagen war ein neuer Brief von Jean dazugekommen, er bat sie um Auskunft, fragte nach ihrer Wahrnehmung ihrer einstigen Beziehungen, drei seien es doch gewesen? Er wolle sie selbst noch einmal an sich vorüberziehen lassen, dabei nichts falsch machen. Er erkundigte sich nach ihrem gegenwärtigen Tun, fragte, ob sie jetzt, da sie vielleicht schon nicht mehr arbeite, wieder Zeit für die Kunst oder sogar fürs Theater habe. Er würde sich sehr freuen, wenn sie seiner Bitte nachkäme.
Hanna hatte sofort mit einem heftigen Impuls reagiert, wie im Taumel hatte sie ihre halb fertigen Schreib- und Malversuche hervorgeholt, häusliche Pflichten vernachlässigt. Mit fliegendem Stift hatte sie eine rasche, unausgeklügelte Antwort auf ein dennoch sorgfältig gewähltes weißes Briefpapier geschrieben, das Material erinnerte an das Büttenpapier mit dem Wasserzeichen, das der Vater für Briefe an ausgewählte, verehrte Empfänger benutzt hatte. Die Wörter waren wie selbstverständlich aus ihrem Herzen gesprudelt:
Lieber Jean,
ich muss es gestehen: Du fehlst mir manchmal enorm in meinem Leben. Warum? Ich fühlte mich selten so authentisch wie damals. Mit Dir als dem anderen Menschen in meinem Leben war ich richtig, tat, was ich tun musste, und wollte, was ich liebte ‒ das Theater, die Kunst, Tanz, Denken – , viel davon teilte ich mit Dir.
Ich weiß, ich weiß, manches habe ich vermisst. Du hast viel mehr als ich verstanden, dass die Alltäglichkeiten nichts zum Teilen sind. Warum sollte man sie teilen?
Es spielt keine Rolle, welche Fernsehserien ich mag, was noch eingekauft werden muss, dass das Bad geputzt werden sollte. Ich bin gern in den Urlaub ans Meer gefahren: lesen, ausruhen, im Meer schwimmen, ganz lang.
Du bist, meist allein, gereist. Hast gesehen, wahrgenommen, aufgenommen, Kunst und Menschen in Deinem Geist zu neuen Collagen zusammengesetzt, Personen und Dinge aus der Bedeutungslosigkeit herausgeschält. Ich nehme an, das hast Du gemeint, als Du sagtest, Du müsstest mit „Deinen“ Menschen etwas machen, um Intensität und Bezug herzustellen, wie ein Regisseur mit seinen Darstellern, wie ein Maler mit seinen Farben Kunst erschafft. Sie durchleuchten Motive, entwickeln Bilder, stellen nie da gewesene Zusammenhänge her – und irgendwann wird etwas Neues lebendig.
Ich wüsste gern, ob Du heute noch so arbeitest. In den Texten, die mir zugänglich waren, erkenne ich Deine Stimme, auch früher hast Du beim Sprechen zur Verstärkung des Gesagten gern das Wort „völlig“ eingesetzt.
Es ist mir schon passiert, dass ich beim Lesen eines Deiner Texte Deine Stimme dazu gehört habe.
Das ist der Brief, den ich Dir eigentlich schreiben müsste, der distanzlose, der ehrliche.
Vermutlich wirst Du ihn nicht bekommen. Er ist mir peinlich und würde auch Dich wohl auf diese Art berühren. Aber am liebsten möchte ich an jeden Baum von hier bis in Deine Stadt einen Zettel hängen, auf dem steht: Ich vermisse Dich in meinem Leben. Und mich selbst auch.
Beste Wünsche und Grüße Hanna
Den Brief hatte Hanna in einen Umschlag gesteckt und zugeklebt. In einer Schublade ihres Schreibtischs liegt er nun verborgen. Dann hatte sie sich aus einer spontanen Idee heraus an die Planung eines Kunstprojekts im Freien gemacht.
Jean hat sie eine Karte geschickt, ein paar Zeilen nur, es habe etwas angerührt in ihr. Und sie hatte versprochen, seine Bitte zu erfüllen, ein bisschen Zeit müsse er ihr für den Bericht lassen, das sei nicht ganz einfach.
Jetzt aber erst mal in den Park. Morgen wird Hanna ihren Plan verwirklichen.
Die beiden Silberreiher schweben elegant über dem gewundenen künstlichen See im vorderen Teil des Münchner Westparks. Der Altweibersommer hält sich, so sieht es aus, in diesem von einer weltweiten neuen Pest heimgesuchten Jahr bis weit in den November, durch die morgendlichen Dunstschwaden lugen bereits die ersten Sonnenstrahlen. Zielführend steuert das Vogelpaar den Uferteil des Sees an, den die Enten im Frühling zur Brutpflege nutzen. Nach einer Umrundung des Landeplatzes setzen sie sanft im noch immer grünen, taufeuchten Gras auf. Bald werden sie ihren Zug in den Süden fortsetzen, schon jetzt, am zweiten Tag ihres Erscheinens finden sie kaum noch einen Fisch in dem kleinen Gewässer.
Hanna beobachtet die anmutigen Tiere, freut sich über die seltene Gelegenheit, solchen Vögeln mitten in der Großstadt so nah zu kommen. Mit der alten Minolta-Spiegelreflexkamera macht sie Fotos von ihnen, im Flug, beim Umherspringen, wie sie die Flügel wie zum Tanz weit öffnen, wie sie versonnen einfach nur dastehen und übers Wasser in unbestimmte Ferne blicken. Die beiden sind wie die zwei Hälften eines einzigen Körpers, schwingen fast synchron.
Hanna denkt an den Mann, der ihr noch einmal den Weg gewiesen hat zu dem, was sie heute vorhat, der erneut hervorgeholt hat, was auf der Strecke geblieben war und das sie vor langer Zeit ganz selbstverständlich geteilt hatten. Damals, vor Jahrzehnten, als sie beide das Miteinandertanzen noch beherrscht hatten. Schließlich verstaut sie den alten Fotoapparat in ihrem reichlich großen und gut gefüllten Wanderrucksack, hieft ihn sich auf den Rücken, überlässt die Reiher ihrer Vogelwelt und macht sich auf den Weg zu dem Ahornbaum, den sie sich für ihre Aktion ausgesucht hat, er steht, nicht gleich für jeden sichtbar, knapp hinter dem oberen Ende des Sees.
Der Baum ist groß, am Stamm ist viel Platz.
Hanna lässt den Rucksack von ihrer Schulter auf die abgeschubberte Bank gleiten, sieht sich um. Noch niemand in Sicht, ein paar Jogger werden bald auftauchen. Zeit genug, um den Holzkasten mit dem metallgefassten Glasdeckel und den daran montierten Messinggriffen zum Aufklappen aus dem Rucksack herauszubugsieren und ihn, durch Lederband und Vorhängeschloss gesichert, am tags zuvor am Baumstamm befestigten Drehhaken aufzuhängen. Etwas größer als ein DIN-A4-Blatt ist der Kasten, und er enthält Papierbögen in dieser Größe, die an der rechten oberen Ecke gelocht und mit einem kurzen Text bedruckt sind:
„ICH VERMISSE DICH SO IN MEINEM LEBEN, . . .“
(entsprechenden Namen bitte einfügen)
„WEIL . . .“
(je nach Wunsch eine Begründung eintragen)
Hanna schraubt noch schnell einen kleinen Haken in das dafür vorgesehene Loch an der Vorderseite der kleinen Kiste und hängt zurechtgeschnittene Baumwollkordeln zum Befestigen der Zettel am Haken an der Seite des Kastens auf, dann noch den Aufkleber („Bitte bedienen Sie sich, schön, dass Sie Teil eines Kunstwerks werden wollen!“) draufkleben, ein paar Kugelschreiber in die Kiste legen, dann warten, was passiert. Hanna nimmt als Erste ein Blatt, sie muss nicht überlegen, welchen Namen sie aufschreibt. Ganz langsam und bedächtig malt sie jeden einzelnen Buchstaben in das Namensfeld, bis die vier Lettern dastehen, die einmal für sie eine ganze Welt, die Weiten ihres Horizonts bedeutet haben: JEAN.
Sie zögert, die Begründung will sie vorerst nicht öffentlich sichtbar machen. Sie fädelt eine Kordel durch das gestanzte Loch im Papier und hängt den Zettel gut sichtbar an einen der weit nach unten hängenden Äste des ehrwürdigen Ahorns.
Inzwischen hat sich eine Unbekannte genähert und Hannas Tun beobachtet, sie scheint nicht recht zu durchschauen, was sich hier gerade abspielt. Sie möchte wissen, was die ältere Frau – jedenfalls ist sie um einiges älter als sie selbst – da macht, sie sieht immerhin seriös aus, trotz der Jeans und der auch sonst saloppen Kleidung.
„Entschuldigen Sie bitte meine Neugier, ich heiße Nora, und ich hab jetzt eine Weile zugeguckt, ich komm nicht so recht dahinter, darf ich fragen, was Sie da machen?“, Nora ist wirklich gespannt, was jetzt kommt.
„Mein Name ist Hanna, und ich mache Kunst, so was Ähnliches wie Yoko Ono früher. Ich allerdings zum ersten Mal in der Form, ich wollte das schon immer tun, aber wie das so ist, Arbeit, Familie, jetzt brauch ich das. Das mit dem Sublimieren, das hat nicht recht funktioniert, vielleicht beruhigt das hier ein wenig meine Seele. Ich rede unverständliches Zeug, nicht wahr? Und eigentlich spielt das auch keine Rolle. Jetzt seid ihr dran.“ Hanna wendet sich in diesem kurzen Dialog intensiver der Fragenden zu, mustert sie, auf circa Ende zwanzig schätzt sie die Jüngere, das lange blonde Haar ist in einen dicken Zopf gezwungen, wache Augen, ein leidenschaftsgeeigneter Mund, Hanna mag sofort die zurückhaltende höfliche Art der Frau, die gerade eine Frage geäußert hat. „Darf ich lesen, was auf dem Blatt steht?“
Hanna lacht: „ Sie müssen es sogar lesen, durch Sie, die erste Leserin, wird es doch erst Kunst, ansonsten wäre es rein privat, so was wie Tagebuch. Es bliebe bei mir, und das soll es ja gerade nicht.“ Nora sagt: „Allmählich versteh ich, man soll oder besser darf draufschreiben, wer einem fehlt, auf einem steht: ,Ich vermisse dich so in meinem Leben‘ und in der Zeile darunter: ‚JEAN‘. Auf den anderen Zetteln steht kein Name, nur die drei Punkte. Vermissen Sie nicht noch mehr Leute, Ihre Mutter vielleicht?“ Hanna will nur ein eigenes Blatt von sich selbst an dem Baum hängen sehen. Was für eine Idee, fast inflationär wären mehrere. Andererseits: Hanna würde nicht verhindern wollen, dass andere Menschen, andere Zettelaufhänger, die Hilfskünstler, auch Banales hinterlassen, das ist ja das Spannende am Unabwägbaren, was passiert wirklich?
„Doch schon, natürlich fehlt mir meine Mutter manchmal, aber das ist der Lauf der Dinge, der Generationenwechsel, meine ich. Mir geht es so, und ich betone das ,mir‘, dass ich jemanden, wenigstens hier, festhalten wollte, der mir so fehlt in meinem persönlichen Leben, dass es mir schon manchmal das Herz zerrissen hat. Jeder kann natürlich hinterlassen, was er will. Und wie gesagt, das ist nur mein Ding.“ Nora hält sich nun nicht mehr zurück: „Ist er tot? Jean? Aber das ist Ihr Ding, erzählen Sie nur, wenn Sie möchten. Haben Sie einen Stift, ich weiß, was ich schreibe.“ Hanna schweigt, zeigt auf den Glaskasten: „Da sind Stifte, wie sollen die Leute denn sonst mein Werk vollenden?“ Die letzten drei Wörter stehen in Paranthese. „Und nein, tot ist er nicht, Gott sei Dank.“
Hanna sieht Nora zu, die eifrig gleich zwei Zettel ausfüllt und in das Blattwerk hängt. Hanna ihrerseits ist nun auch neugierig, sie liest „Michel“, noch ein französischer Name. „Wer ist das? Vielleicht möchten Sie ja was dazu sagen“, fragt sie die andere.
Und so kommen sie ins Gespräch, schlendern währenddessen zu der Bank mit Hannas Utensilien und dem Rucksack, lassen sich im verordneten Abstand darauf nieder.
Nora erzählt von sich aus von Michel, sie hatte mit sechzehn in Concarneau während eines Schüleraustauschs in der Bretagne am Abend in einer Disco mit dem ein Jahr älteren Jungen getanzt, sie waren drei Wochen lang unzertrennlich gewesen, danach Liebesbriefe, mindestens zehn im Monat, sie schrieben sich unentwegt, während er so etwas wie ein Jugendstar wurde. Eine Abenteuerserie auf Télévision Française 1. Sie schrieben sich weiter, er besuchte sie in Garching bei der Mutter, sie wollten, wenn die Schule zu Ende war, zusammen in Paris studieren, dann Kinder kriegen, sich lieben, bis sie tot waren. Michel heiratete schon mit 22 eine Madeleine, die bald darauf den ersten Sohn zur Welt brachte. Nora war erschlagen gewesen, nie wieder hatte sie Ähnliches empfunden, nie wieder jemanden so nah rankommen lassen. Sie konnte es einfach nicht. „Eine andere Frau lebt das Leben, das für mich vorgesehen war“, sagt Nora.
Dann der zweite Mann, ein „Vater“. Sie hat ihren nur einmal gesehen, als sie ungefähr elf oder zwölf gewesen ist, einen sehr schönen Mann hat sie in Erinnerung, seinen Geruch mit dem Hauch Pfeifentabak, noch etwas anderes war dabei gewesen, das roch zuckrig. Er hatte sie ein wenig getätschelt auf dem Kopf, zu Nora gesagt, er werde für sie sorgen und es täte ihm leid. Dann sei er wieder gegangen, er hatte dabei betroffen, beinahe traurig geguckt. Nora vermisste schmerzlich einen Vater, diesen schönen, fremden Mann nicht.
Hanna ist still geworden. Als Nora nun sanft noch einmal nach JEAN fragt, nach dem Mann in Großbuchstaben, sagt Hanna nur: „Was soll ich dazu sagen, seit ich siebzehn war, war er in drei Lebensabschnitten Dreh- und Angelpunkt für die größten, die intensivsten Gefühle und Gedanken, die ich bis dahin erlebt hatte, bis er für immer verschwand. Das war manchmal kaum auszuhalten. Er lebt, er ist nicht tot. Ich lebe ja auch und bin nicht tot.“
Ein Teenagerpaar schlendert entspannt an den beiden Frauen vorbei. Der junge Mann redet auf das Mädchen ein, erklärt seiner Freundin irgendwelche politischen Zusammenhänge. Sie wagt einen Einwurf, er reagiert unwirsch, belehrend, sie soll nicht so einen Unsinn reden, und „Lass uns hier verschwinden, wir gehen zu dir und machen’s uns nett.“ Sichtbar erleichtert die junge Frau: „Okay, das machen wir, ein bisschen chillen.“
Hanna weist auf das ansehnliche Paar: „Sehen Sie, so früh geht das schon los.“
„Was geht so früh los?“, will Nora wissen.
„Dass man sich beugt.“
Es gibt dann nichts mehr zu erzählen, sie haben ein Stückchen Gegenwart geteilt, sie haben Einblick gewährt, Berührung erlebt. Es ist genug.
Zum Abschied sagt Nora noch: „Es war schön, mit Ihnen zu sein. Wissen Sie, dass Sie die erste Person waren, mit der ich seit zwei Wochen über was anderes als Impfen und Masken und Einsamkeit geredet habe.“ Hanna nickt: „Das alles kann Kunst, also: mehr davon, oder?“
Es kommt Hanna so vor, als ballten sich die Schlüsselmomente ihres Lebens in den vergangenen Tagen irgendwo im Kosmos des Gegenwärtigen zusammen. Auch die Begegnung im Park war so etwas gewesen.
Seit sich alle an Homeoffice und täglich neue Todes- und Infektionsraten gewöhnt haben, besteht der Alltag aus Sich-Konzentrieren: auf die Einhaltung der Regeln, auf die 1,5 Meter im Edeka, auf gewaschene Hände und den korrekten Sitz der FFP2s.
Auch auf das eigene Ich. Es war nicht die Zeit für Blabla und Geblödel.
Hanna wollte die Tage nutzen, um der seltsamen und unerwarteten Bitte nachzukommen, die ein für sie gegenwärtig Fremder an sie gerichtet hat. Die Anfrage des Mannes zu erfüllen, den Hanna so lange vermisst hatte und der ihr jetzt noch immer fern ist, das würde sie vielleicht auch auf ihre eigene Fährte führen, sie sich selbst näherbringen. Sie hatte jetzt Muße dafür, durfte eh nicht raus ins ablenkende Leben, sie musste nur für gesunde Nahrung sorgen, das bisschen Haushalt erledigen, ansonsten: Ruhe für die Pflicht der Selbstfürsorge.
Die vergangenen Zeiten, die erfüllten wie die schmerzhaften, das Überwundene, das Geleistete, das Gescheiterte, das Geliebte und das Entdeckte, die Dummheiten und das Finden der „Wahrheit“, das alles würde sich in den Reflexionen spiegeln, nochmals geprüft und betrachtet werden, erörtert auch im inneren Monolog. Hanna wollte sich auf das Echte in der Wirklichkeit konzentrieren. Auf das, was vor mehr als 30 Jahren geschehen war.
Das Nachdenken über die halb vergessenen, halb verdrängten Erinnerungen, die Suche nach den Gedankenfetzen hatte vor drei Wochen damit begonnen, dass sie ‒ glücklicherweise nur mit normalem Schnupfen und Kopfweh ‒ ein paar Tage die Außenwelt gemieden hatte.
In der Zeit waren Bücher gelesen worden, Schriftliches erledigt, DVDs geguckt, Geschenke vom letzten Geburtstag, und sortiert, ausgesondert, aufgeräumt, ein Pullover war fertig gestrickt, ein Kleid geändert, Knöpfe angenäht worden. Alles, was so liegengeblieben war, wurde erledigt. Sogar das Testament war jetzt geschrieben und in einem Umschlag verpackt.
Schließlich war das achtstöckige, mit Bücherdoppelreihen gefüllte Regal drangekommen, Hanna wollte sich von ein paar Romanen trennen, um Platz für neue zu schaffen. Ein paar hatte sie rausgezogen zum Verschenken, davon wenige dann doch wieder zurückgestellt. Ganz unten, hinter dem Hegel-Weltgeist, war sie auf die goldfarbene rechteckige Teedose mit den verschnörkelten Buchstaben und den Rosenranken gestoßen, die sie seit Jahren dort versteckt hielt. Ihr Inhalt, so unspektakulär er war, bestand aus den wenigen Zeugnissen ihrer ersten Liebe.
Erst hatte Hanna gar nicht mehr an das Blechkästchen gedacht, doch als es aus dem Regal fiel beim Blättern in den leer gelesenen Romanen, deren Inhalt sie längst vergessen hat, hatte sie nicht widerstehen können: Sie hatte Seite um Seite der zahlreichen Briefe aus zwei Jahrzehnten gelesen, Vergessenes wiedergefunden beim Betrachten von Zeitungsausschnitten, Programmheften der Tanz- und Theaterereignisse, die sie mit ihm geteilt hatte, den Ausweis, der ihr Einlass in die Bibliothèque Nationale gewährt hatte. Und ein sehr kleines Gläschen mit einer ebenso winzigen Perle darin. Jonathans, „Jeans“, Stimme, die das Erlebte kommentiert hatte: „Eine Allegorie des Gelingens.“
Voller Wehmut war der Blick auf die wenigen Fotos gewesen, eines aus ihrer beider Jugend, drei andere, als sie schon längst darüber hinaus waren. Ihr fielen zu den bunten Karten, Briefumschlägen und Gegenständen all die Geschichten ein, die sie begleitet und die sie veranlasst hatten, sie in einem Schatzkästchen aufzuheben.
Alles war auf einmal wieder gegenwärtig, und die Trauer über das Ende, die sie vor Jahrzehnten empfunden hatte, schlich sich wieder, ein wenig nur, in ihr Herz, sanfter diesmal, war sie doch sicher auch Teil der Melancholie angesichts der Jugendschönheit, der vergeblichen Kämpfe um Selbstwahrheit. Und hatte sie nicht ein halbwegs ganzes Leben geführt, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Mann seit mehr als dreißig Jahren? Womöglich lagen noch viele beste Jahre vor ihnen, vor ihr.
Und dennoch musste Hanna an den folgenden Tagen nach dem Fund oft an ihn denken, an den Jungen, den Mann, an ihre erste Liebe.
Es kam zu der seltsamen Fehlschaltung, als sie die Schulfreundin anrufen wollte, eine, die ihr geblieben war. So etwas passiert ihr manchmal, wenn sie in Gedanken versunken ist. Ganz automatisch hatte sie Jeans Nummer gewählt, es erst gemerkt, als sie die vertraute Stimme ihres einstigen Gefährten seinen Nachnamen sagen hörte. Erschrocken hatte sie sofort wieder aufgelegt, musste sich danach erst mal beruhigen. „So tief erwischt er mich noch immer!“ Bestimmt hatte er ihre Nummer auf irgendeinem Display erkannt. Vielleicht auch nicht, vielleicht hatte sie Glück.„Hoffentlich ruft er nicht zurück“, hatte sie gedacht. Der Apparat vibrierte nicht.
Stattdessen kam ein paar Tage später dieser Brief mit seiner Aufforderung, eher einer Bitte an Hanna, der sie nachkommen wollte.
Jean hatte geschrieben, er habe kürzlich die bekannte Zahlenfolge auf seinem Telefondisplay gesehen, er habe sie natürlich sofort wiedererkannt. Er habe sich derzeit viel mit „seiner Jugend“ beschäftigt, und nun fürchte er, dass ihn „sein Hirn im Stich lasse“. Er wolle sich in dem Zusammenhang auch an die Einzelheiten ihrer gemeinsamen Zeiten erinnern, an Vergangenes, denke über ein schriftliches Resümee nach. Hanna möge ihm dabei helfen. Er hatte diesen Wunsch nicht weiter begründet. Hanna hatte ganz automatisch gedacht, dass er bedeutende Gründe für sein Anliegen anführen könnte. Alles, was Jean tat, war bedeutend. Sie ertappte sich bei dem Gedanken.
Und Jean hatte mit seiner Bitte noch etwas anderes in Gang gesetzt. Hannas allererster Impuls war gewesen, ihn anzurufen, ihm spontan zu erzählen, woran sie sich noch erinnerte. Als sie darüber nachdachte, was das sein könnte, was sie sagen sollte, hatte sie gespürt, wie die „Künstlerseele“, die lange versteinert in ihr vor sich hin gegrummelt hatte, zu klingen begann. Jean hatte eine Saite angeschlagen, die nicht mehr aufhören wollte zu schwingen. Was vermisste sie von all dem, was sie einst mit diesem jetzt so fernen Freund erlebt hatte? Was hatten sie geteilt in diesem Jahrzehnt, in dem sie einander an verschiedenen Lebenspunkten immer wieder zum Tanz aufforderten, miteinander schwebten, weinten, lachten, einander fern und nah gewesen sind?
Dann war Hanna aktiv geworden, hatte erst mal eine geeignete Kiste gesucht und dem Uhrmacher in ihrem Viertel den alten rechteckigen Schaukasten mit Glasdeckel abgekauft, der jetzt am Baum hing mit den von ihr beschrifteten und präparierten Zetteln, den Stiften und Bändern, war mit dem Ganzen in den Park gegangen, und nach über dreißig Jahren hatte sie endlich wieder so etwas wie Kunst nicht nur geplant, sondern auch umgesetzt.
Das Werk im Park will sie nun den anderen überlassen, sollen sie doch Wunderbares, Wichtiges, Spaßiges oder Irres damit anstellen. Vier Wochen will Hanna den Kasten hängen lassen und ihn dann entfernen, wenn er dann noch da ist.
Nun ist es so weit, nun ist die Stimmung richtig.
Hanna wird Jeans Bitte erfüllen: Sie kann und darf und muss sich selbst und ihm die Ballade von Jean und Hanna erzählen. Um Blick und Sinne scharfzustellen, wird sie schreiben, als sei es die Geschichte einer anderen Frau und eines anderen Mannes. Sie beginnt in den frühen Siebzigerjahren.
2
1972
Immer wenn Hanna an ihre Zeiten mit Jean in diesen längst vergangenen Tagen dachte, fragte sie sich, ob und wie Jean sich dieser Episoden seines Lebens erinnerte. Für sie hieß sich erinnern, an die Episoden der frühen Adoleszenz zurückzudenken, die voller Abenteuer gewesen waren, als alle rauchten und Wein tranken und an Lagerfeuern im Sommer globale Politik wie Selbsterkenntnis diskutierten. Als das Furchtbare des vergangenen Weltkriegs nur noch in den Erzählungen über die verdorbene Kindheit und Jugend der Eltern auflebte, persönliche Schicksale und Erlebnisse verschwiegen wurden, Spuren durchlebter Traumata kaum noch sichtbar waren und in allen Bereichen Aufbruchstimmung herrschte. SPD statt CDU, erste Proteste gegen Atomkraft, Ohsawas makrobiotische Ernährungsweise, Feste statt Partys, Lehrer duzen und Autoritäten infrage stellen.
Jede Generation hat so eine Zeit, in der das Intensive keine Grenzen kennt, das Erleben ein endloses Gegenwärtigsein ist, noch kennt keiner die Melancholie des Rückblicks auf Vergangenes, nur das Jetzt zählt. Die vielen Utopien, das unentwegte Kreativsein, Reden, Rebellieren.
Die Siebzigerjahre waren die ersten schönsten Jahre in Hannas Leben.
Eingebettet in ein dichtes Freundesnetz und der eigenen Begabungen gänzlich ungebrochen sicher, schrieb sie in der schulfreien Zeit am Nachmittag in ihrem Stuttgarter Mädchenzimmer Gedichte und philosophische Abhandlungen zu Hegel und Nietzsche und Beiträge für die Schülerzeitung. Über dem Bett hingen Plakate und Fotos aus den Programmheften der weltberühmten Ballettkompagnie, des „Ballett Miracle“, wie die New York Times nach dem ersten Gastspiel geschrieben hatte. Ihr kleines Reich mit den Dachschrägen auf zwei Seiten war dank einfacher Hilfsmittel in ein indisch anmutendes Lager verwandelt worden, bunte Seidentücher vom Flohmarkt verdeckten die Weinkisten darunter, die Tropfkerze auf der ausgedienten Korbflasche, in dafür vorgesehenen Halterungen steckende Räucherstäbchen, die sie eigentlich nicht mochte, manch selbst getöpferte schiefe Aschenbecherschalen und sonstiger Tand vervollständigten das Ambiente.
Hanna ging auf die Konzerte ihrer Bands, sofern sie sich ein Ticket leisten konnte, auf Demos auch, gegen die Erhöhung der Straßenbahnpreise und irgendwann für Willy-Brandt-soll-Kanzler-Bleiben. Und sie durfte Ballettstunden nehmen, um vielleicht doch noch Ballerina zu werden. Zu Hause hatte sie keine Probleme, die Eltern waren verständnisvoll, obwohl sich die Mutter immer sorgte, wenn sie erst nachts um drei vom Baggersee kam und sich in die Wohnung schlich, angeblich hatte die Mama kein Auge zugetan.
Im besten Mädchengymnasium der Stadt waren sie zu fünft, Marie, Rike, Nele, Mimi und sie selbst, Hanna, der Name abgeleitet von der eher langweiligen Johanna, nach der ihr selbst unbekannten Großmutter. Die Hanni war ihr wenigstens erspart geblieben. Die fünf waren aufs Engste befreundet, teilten alles, zählten zu den „Intellektuellen“, die im Raucherzimmer der Schule die Pausen verbrachten. Der geschätzte liberale Direktor vertrat die Ansicht, dass sie sowieso rauchen würden, ob mit oder ohne Erlaubnis, so wisse er wenigstens, was die Mädchen rauchten und wo sie das taten. Die fünf Freundinnen gründeten die Schülerpresse. Erste Schreibversuche, Marie lieferte die Illustrationen. Der Direktor prüfte die Schülerzeitung vor dem Druck, und wenn sie zu links ausgefallen war, mussten sie ihren Pelikan – benannt nach dem Schulfüller – eben vor dem Schulgelände verkaufen.
Geschmeichelt fühlten sie sich, wenn die beiden gut aussehenden Junglehrer in dem verqualmten Erkerzimmer über dem Speisesaal mit ihnen, scheinbar auf Augenhöhe, über Marxismus redeten und durchblicken ließen, dass sie auf ihrer Seite waren, ihnen recht gaben bei den Diskussionen über Marx, Hegel und die RAF. Einer machte mit bei der Schulzeitung und fuhr mit seinen Schutzbefohlenen nach der Redaktionssitzung manchmal in eine Linken-Kneipe, sie fühlten sich sehr wichtig, es kam zu Gesprächen, wie seine Schülerinnen sie von zu Hause nicht kannten.
Unmerklich formten die Teenager nebenbei ihren Geist. Im Unterricht ging das Nachdenken weiter, in Religion war statt Bibelkunde das Thema „Marxismus und Christentum“ zu beackern, (schul)klassenübergreifend. Hegel und Jean Paul lernten sie kennen. In der Englischstunde nahmen sie bei der Referendarin If They Come in the Morning von Angela Davis durch, neben der Sprache lernten sie vieles, auch Verbotenes über die schwarze Linkenbewegung, und dank der Pamphlete von Bernadette Devlin durchschauten sie den Irlandkonflikt ein bisschen besser.
Es gab Gerüchte, dass einer der jungen Lehrer auch in verbotener Hinsicht sein Interesse an einer Schülerin kundgetan hätte, das Mädchen sei ihm freudig entgegen- und schließlich sehr nahegekommen. Deren Mutter soll das sogar romantisch gefunden haben, ziemlich ignorant und verantwortungslos, diese Erziehungsberechtigte. Sie hatte sich keine Gedanken darüber gemacht, was an der Situation nicht richtig sein könnte.
Immerhin: Es geschah, wenn überhaupt, diskret. Sollten die Gerüchte einen realen Hintergrund gehabt haben, hatte Hanna nichts davon erfahren.
Jedenfalls waren die beiden umschwärmten Lehrkräfte mitgegangen, als die ganze Klasse gegen das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt demonstriert hatte, sie steckten sich selbst gemachte Sticker an, „Den Willy will i“, sie erhielten schulfrei für die Dauer der Demo.
Hanna teilte mit Freundin Nele die Schuljahre, die Ballettstunden, die Diskurse der Zeit und einmal sogar, ganz kurz, einen Jungen.
Von den Jungs und auch in den diversen Schulungsgruppen über Meditation und Marxismus ließ sie sich weismachen, dass man einem Jahrhundert entgegenginge, in dem weder Besitz noch Macht von Bedeutung sein würden, nur das Bewusstsein sollte zählen. Man wolle fröhlich die Zukunft gestalten, genährt von den mit eigenen Händen auf eigenem Boden produzierten ungiftigen Lebensmitteln und gewandet in selbst entworfene, gewebte und genähte Kleidungsstücke. Kein Kapitalismus, stattdessen das irdische Paradies.
Hanna lernte Lorenz in den Weihnachtsferien kennen. Noch war sie sechzehn und zum ersten Mal ohne Eltern auf Reisen, im Ferienlager mit Skifahren, organisiert von der evangelischen Jugend, fuhren sie ins eingeschneite Ofterschwang. Ute, ein Mädchen aus der Nachbarschaft, mit der Hanna schon seit frühester Kindheit befreundet war, hatte sie in diesen „Club“ genannten Zirkel für die christlichen Jungen und Mädchen mitgenommen, Hanna fühlte sich dort wohl, und die Freizeitgestaltung war auch gesichert, hatte allerdings eher sporadisch mit Protestantisch-Kirchlichem zu tun.
Lorenz, genannt Lenz, war zwar der beste Freund von Jonathan, nach dem Abi hatten die beiden vor, durch ganz Europa zu reisen, sie würden dann ein bald TÜV-freies Auto, den Opel von Lenz’ Vater zum Beispiel, in die Türkei zum Weiterverkaufen transportieren, von da aus sollte es zum Teil per Anhalter durch Nordafrika gehen. Über Marokko und Spanien würden sie irgendwann wieder in Stuttgart landen. Aber wer wusste schon, ob das wirklich so passieren würde, das lag noch in der Zukunft.
Dieser Jonathan war aber nicht zu überreden gewesen, auf Brettern im Schnee rumzurutschen, das wurde Hanna erzählt, und so erfuhr sie, dass es drei enge Freunde in einer Schulklasse des angeblich besten Jungengymnasiums der Stadt gab. Lenz und Jonathan waren mit Paul befreundet, der Dritte in diesem Bunde war gern mit Lenz in die Bergwelt des Allgäus gefahren, obwohl er wie Hanna dem Skifahren nicht wirklich etwas abgewinnen konnte. Die drei Buben gingen mit Neles Cousin und Reinhard, der ebenfalls mit ins Gebirge gekommen war, in dieselbe Klasse dieser Superschule.
Paul und Hanna, sie wurden ein kurzlebiges Pärchen. Auf dem Rückweg vom im Tal liegenden Dorf, wo sie versucht hatten, eine witzige Kneipe zu finden und schließlich eine Flasche Schnaps an der Tankstelle bekommen hatten, ohne Ausweis ‒ Paul war recht groß, man glaubte ihm gern die neunzehneinhalb Lebensjahre ‒, war es schneller als erwartet dunkel geworden. Und so fanden sie sich auf halber Strecke zurück zur Herberge im Mondschein über dem glitzernden Schnee in Hannas erstem Kuss.
Hanna galt nun als Pauls Freundin und hatte auch endlich die Erfahrung dieses ersten Geküsstwerdens hinter sich gebracht. Sie „ging“ mit jemandem. In gewisser Weise begann so ihr Leben als angehende Erwachsene.
Eine Woche lang blieben sie noch auf der Hütte. Für Hanna als Einzelkind war das anstrengend, ständig war man umgeben von Leuten, die man gerade erst kennengelernt hatte. Sie musste mithelfen beim Sketcheausdenken für die Abendunterhaltung, tagsüber quälte sie sich bei den Anfängern auf der Piste mit dem Pflug ab, bis einer der Buben, der schmale Heinrich, es nicht mehr mit anschauen konnte. Er meinte: „Wenn du den Berg runterfahren willst, stell die Ski nebeneinander, stoß dich ab und rutsch runter, los, mir hinterher!“ Sie gehorchte und schoss hinter ihm den nicht allzu steilen Hang hinunter, ohne Vorstellung, wie man anhielt. Und plötzlich, kurz vor Ende der Abfahrt ging sie in letzter Sekunde ganz automatisch in den Pflug, sie wurde langsamer und landete, deutlich abgebremst, in dem Schneehaufen am Fuß des Berges. Sie erkannte, dass ihr Skifahren keine Freude bereitete. Die Skifreizeit hielt sie aber, wieder am Idiotenhügel, durch.
Jedenfalls war in dieser kurzen Ferienzeit der Grundstock für eine neue Clique gelegt. Die Jungen aus dem Westen der Stadt, die fünf Mädchen aus Hannas Schule im Osten, außerdem ihre Kindergartenfreundin Ute, sie schlossen sich zusammen für ein Stück des Lebenswegs.
Gemeinsam erlebten sie die Zeit der ersten Schwärmereien, des moralischen Zauderns, der Unsicherheit. Bin ich schön? Sie verliebten sich, manche knutschten auf dunklen Partys, frühreif wurden sie von besorgten Eltern genannt, irgendwann ging man miteinander. Sie versuchten immer häufiger, der heimischen Fürsorge zu entgehen, den Verboten, Warnungen und Ermahnungen, die unausgesprochen irgendwie immer mit Sex, der „Unschuld“ der Mädchen, der Aufgeregtheit der Jungen, zu tun hatten und zu Schuldgefühlen und Ängsten führten.
Alle wollten ihre Erfahrungen mit diesem Unbekannten selbst machen. Sie lasen wie besessen, Hegel, Freud, Marx war langweilig, aber wichtig, den mystischen Animus C. G. Jung, den Hesse-Steppenwolf, Sri Aurobindos Werke, gebraucht, aus der Buchhandlung für Freies Geistesleben. Hanna interessierte sich für all das. Und war inzwischen mit einer Bibliothekarin in der Stadtbücherei per Du, die schon der kleinen Leseratte Hanna in Kindertagen gute Büchertipps gegeben hatte. „Ich hab was für dich, kennst du schon den Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, hab ich selbst gern gelesen, den musst du einfach mitnehmen.“ Hanna hatte den Roman eingesteckt und zu Hause gleich damit angefangen. Sie kam kaum hinterher mit der Lektüre, die vielen Ideen waren neu und spannend, brachten das Hirn in Bewegung. Die Suche nach so etwas wie Wahrheit erschien ihr enorm reizvoll.
Diskussionen, Jasmintee und Frizzantino, Rauchen und der passende Soundtrack ließen die Freunde Pläne für eine neue Welt erfinden, mit freier Liebe und echten Beziehungen, mit dem Glück in der Gemeinschaft, im Zusammensein.
Sie mussten nichts, durften fast alles. Übermüdet von nächtlichen Freiluftfesten mit Bongogetrommel und Gitarrenspiel am Lagerfeuer, saßen sie in den Schulstunden, ab fünf Uhr nachmittags begannen die Rundrufe, wer wann mitwollte ins Laboratorium, auf den „Monte Scherbellino“, den Stuttgarter Schuttberg, nach dem Krieg aus Trümmern aufgeschichtet und mittlerweile bewaldet. Den Hügel zierte ein ziemlich großes Kreuz auf dem „Gipfel“-Plateau, an Ostern Schauplatz sehr ergreifender Open-Air-Gottesdienste, die von dramatischen Himmeln überdacht waren. Im Sommer liebster Treffpunkt in der Nacht, dort waren die Leute fast immer unter Gleichgesinnten, sie saßen am Lagerfeuer, ereiferten sich über „die Gesellschaft“, den amerikanischen Imperialismus, unter dem Hanna sich erst viel später wirklich etwas vorstellen konnte. Sie meditierten, tanzten, sangen Bob-Dylan-Lieder zum Gitarrenspiel der Ältesten und die von Joan Baez.
Wie wunderbar war dieses freie Leben, dort oben durften sie Lärm machen ohne Nachbarschaftsgeschimpfe, hier konnten sie ihre festen Freunde treffen und mit ihnen zusammen sein, die Jungen sahen sich unter den Mädchen um, und manche blieben dann eine Weile ein Paar, wurden von den anderen beneidet. Die Frauen unter ihnen waren schön, ganz verschieden schön, sie trugen glitzernde Indien-Gewänder aus dem „Kleinen Muck“, dem einzigen Stuttgarter Laden für Hippiebedarf. Die Jungen sahen hinreißend aus in ihren engen Cordjeans, mit den langen Haaren, mal glatt, mal leicht gewellt, und mit dem Stirnband. Hanna fand die meisten ziemlich anziehend.
Mit Paul „ging“ Hanna seit den Winterferien, manchmal mit mehr Begeisterung, manchmal war es einfach nett mit ihm. Es kam zu ersten Berührungen körperlicher Art, die ihr nicht sonderlich angenehm waren. Paul machte schon ein knappes halbes Jahr später Schluss mit Hanna, mitten im Sommer. Er begründete seinen Schritt mit der Tatsache, er habe, wenn sie nicht zusammen waren, nicht ständig Sehnsucht nach ihr, und dies interpretierte er als Mangel an Liebe. „Wenn ich woanders bin, zu Hause oder bei Freunden, fehlst du mir nicht immer.“ Hannas erste Beziehung war kurz und ziemlich frei von Leidenschaft, dabei doch die erste Berührung mit dem anderen Geschlecht, Auftakt und Türöffner zum Frauwerden. Zum Abschied schenkte Paul Hanna eine Schallplatte von Edith Piaf, Je ne regrette rien war natürlich drauf. Der Liebeskummer hielt sich trotz dieser theatralischen Note bei beiden in Grenzen.
Den unausgesprochenen Reglements jener Tage folgend, wollten sie aber, ganz vernünftig, Freunde bleiben. Hanna war nur ein bisschen traurig, es war alles so schnell gegangen, der erste Kuss mit gerade noch sechzehn, der erste Freund, die erste Körperberührung, hilflos, suchend, auch ängstlich und widerwillig.
Als Hanna fünfzehn war, hatte sie sich hässlich und langweilig gefunden und gehofft, dass sich ihrer vielleicht ein Pfarrer erbarmen würde, die hatten in ihrer Vorstellung auch keine allzu große Auswahl: Wenn sie sich die Frau vom Gemeindepfarrer anschaute, die ihre Kindergarten-„Tante“ gewesen war, sie war nett gewesen, aber nicht sehr ansehnlich mit ihrem stets naturbelassenen Gesicht und dem strengen Dutt im Nacken, sie hatte sehr praktisch gewirkt.
Doch auch nach ihrer „Beziehung“ sahen sich Paul und Hanna noch, die neu formierte Clique hatte sich erweitert, manche waren einfach irgendwann dabei, keiner wusste mehr so recht, woher sie gekommen waren. Mit den ihr näher bekannten Jungs sah sie den ersten Kung-Fu-Film im Kino, Das Schwert des gelben Tigers, die Buben waren danach schier nicht zu zügeln gewesen und hatten die Filmszenen unter wildem Kriegsgebrüll nachgespielt, unterbrochen von albernem Rumgelache, lächerlich fand sie das, aber auch amüsant. Und sie durfte sich überlegen fühlen.
3
Hanna lernte diesen großen schönen Jungen noch im selben Sommer kennen, sah ihn am Rande des Freundeskreises auftauchen, er war noch nicht in Reichweite, sie hatten nie miteinander gesprochen. Er saß oft stumm bei den heftiger werdenden Gesprächen, verweigerte den Donnerstagsbesuch mit Paul und Lenz in ihrem Teenager-Club Spektrum in der Heslacher Kirche, zu spießig, zu kirchlich, Jean pflegte den Zweifel und sah dabei aus wie ein griechischer Statuenjüngling mit halb langem, leicht welligem Haar, edlen Pianistenhänden, leicht gebräunt, trotz der Größe nicht übermäßig muskulös, aber mit einem Körper voller Spannung und mit breiten Schultern.
Nie wird Hanna ihn vergessen. Ob er noch an sie denkt? Daran, wie fasziniert sie beide gewesen sind vom Reden, vom Anfassen, dem Küssen und Warten auf den nächsten Anruf? Als Hanna gerade siebzehn war, sind sie beieinander aufgetaucht.
Jonathan, der sich selbst inzwischen in Jean umbenannt hatte, Paul, Lenz und Reinhard – die Schulkameraden waren ein eingeschworenes Gespann. Und so brachte Reinhard seinen Freund eines Spätnachmittags auf seinem Vespa-Roller mit auf den Schuttberg zur geplanten nächtlichen Session, dann fuhr er noch einmal los, um Hanna am Killesberg an der Sraßenbahn abzuholen, das war nicht weit.
In der beginnenden Dunkelheit sind manchmal nur Schemen zu sehen, die Männer haben Holz aufgeschichtet, wer weiß, wer diese Unmengen von Ästen, kleinen Baumstämmen und in Scheite gehackten Holzstücke hier heraufgebracht hat und wo das alles „besorgt“ worden war. Das Feuer brennt inzwischen lichterloh, also muss es bereits gut getrocknet gewesen sein, Hanna will lieber nicht weiter über die Herkunft dieses Feuerholzes nachdenken.
Reinhard hatte Hanna hinten auf die Vespa gesetzt, und nun sind die beiden nach höchstens acht Minuten Fahrzeit wieder hier oben auf dem Schutthügel. Unterwegs hatten sie noch kurz am Kiosk angehalten und Nichtalkoholisches gekauft, wegen der Schule am nächsten Tag und wegen Reinhards Führerschein. Als Hanna von dem roten Roller steigt und Reinhard den geliehenen Helm zurückgibt, sieht sie Paul auf sich zukommen, hinter ihm dieser außergewöhnliche, attraktive Typ, den sie nur vom Sehen kennt.
Paul stellt ihr „Jean“ vor. Gut, dass es inzwischen fast dunkel ist, niemand sieht, dass sie rot wird, der gefällt ihr sehr. „Woher der französische Name?“, fragt sie nicht ganz unbefangen. Jean zuckt mit den Schultern, schaut ziemlich arrogant auf sie herab, die Schatten, die vom Lagerfeuer auf sein Gesicht fallen, verstärken den Eindruck des Besonderen, kaum kennt Hanna seinen Namen, schon ist sie verunsichert. Und dann lächelt er sie an, alles Kalte verschwindet aus seiner Miene. „Wer will schon Jonathan heißen, da ist Jean doch viel besser, oder? Nach Jean Paul Sartre. Aber ohne Paul, wegen dem Paul hier.“ Er zeigt auf Hannas Kurzzeit-Ex-Freund. Dann dreht Jean sich um, ruft einem Mädchen mit langen dunklen Haaren etwas zu, die eilfertig angerannt kommt. „Was meinst du, sollen wir bleiben?“ Sie schüttelt den Kopf, Jean schnappt sich eine auf dem Boden liegende Wildlederjacke, die aussieht, als würde er sie nur ungern ab und zu ausziehen. „Also, ciao dann, wir sehen uns sicher wieder“, sagt er noch mit einem irritierenden leicht spöttischen Lächeln in den Mundwinkeln und verschwindet mit dem Mädchen in der Nacht. Hannas erste Begegnung mit Jean.
Schon kurze Zeit später trafen sie sich tatsächlich wieder. Sie – das waren, außer Ute und Hanna, auch Marie und Reinhard – durften ein paar unbeaufsichtigte Tage bei Ute verbringen. Sie war in der Freundesgruppe eine Ausnahmeperson, Hanna und die Gastgeberin kannten sich, seit sie ungefähr vier waren. Sie waren zusammen in den Kindergarten gegangen, hatten bei Hanna im Hof in der Richard-Wagner-Straße oder bei Ute im Garten, in dem viele Imkerbienen herumschwirrten, in der Sackgasse namens Im Kienle oder am Waldrand nebenan gespielt. Sie hatten versucht, Utes pechschwarze Katze Mausi für den Zirkus zu domptieren und mit ihrem kleinen Bruder im Planschbecken gesessen, der immer gleich die Badehose auszog und ihnen mit Freuden sein kleines Schwänzchen zeigte.
Hanna hatte Ute weinen gesehen, wenn sie mit dem Kochlöffel geschlagen wurde, ihre Freundin wurde viel geschimpft, und das Wichtigste schien zu sein, dass Ute anständig wurde. Die überforderte Mutter verlor oft die Nerven. Ute hatte als kleines Kindergartenmädchen viel Kopfweh gehabt, um das Hanna sie damals manchmal beneidet hatte, das Kopfweh schien ihr sehr interessant. Sie wusste, in dem Glauben war sie immer noch, einfach alles von ihrer Freundin, obwohl Ute das Gymnasium schon in der zweiten Klasse hatte verlassen müssen. Die Eltern hatten es nicht ausgehalten, dass die Tochter nicht gleich die Beste war, Ute ging dann auf die Mittelschule. Ute war dem Dauerstress, der ständigen Qual des Lernens nicht gewachsen gewesen, war schüchtern, scheu und ängstlich geworden. Ihre schuldige Mutter ging danach Hannas verblüffter Mama aus dem Weg, sie schämte sich für das Scheitern der Tochter. Ute durfte Hanna nicht mehr besuchen. Die Mädchen trafen sich heimlich und blieben beste Freundinnen, sie waren einander wie verwandt, keine fragte noch, ob sie die andere wirklich mochte, sie waren einfach immer dabei, wenn eine der beiden etwas Neues erlebte, beim Spiel, später in der Liebe, im Wachsen.
Reinhard betätigte sich wie so oft wieder einmal als Chauffeur und beförderte Jean auf dem Rücksitz seines rostroten Motorrollers zu diesem Wochenendabenteuer. Jean trug, abgestützt vom Gepäckträger, einen prall gefüllten Seesack auf seinen starken Schultern, der eine Bundeswehr-Kote, Schlafsack und Camping-Kochzeug enthielt. Es kamen noch zwei, drei andere Typen, die Ute aus dem Laboratorium kannte und die den anderen fremd waren.
Ihre Eltern waren mit den Geschwistern verreist, und Ute hatte das Grüppchen, ohne um Erlaubnis zu fragen, zu sich eingeladen. Sie genoss die selbstbestimmte Zeit. Die Wohnung der Eltern im Kienle war sehr klein, und sie teilte das Zimmer mit der jüngeren Schwester und dem noch jüngeren Bruder, an einer Seite ein Stockbett, auf der anderen Utes Bett, dazwischen der einzige Schreibtisch mit Resopalplatte und Chrombeinen, an dem die Kinder im Schichtdienst Hausaufgaben machten, keine Rückzugsmöglichkeit. Ute war gern allein, sie zeichnete dann viel, gruselige „Herr der Ringe“-Figuren. Sie war in einen dunklen Sechzehnjährigen namens Reinhard verliebt, ein ganz anderer Typ als der hübsche Reinhard aus dem Club mit den schulterlangen blonden Locken. Ihrer erschien Hanna sehr verdüstert. Und er hatte noch keine eindeutigen Signale gegeben, was er von Ute wollte.
Oft hat Hanna mit Ute auf den Treppenstufen der Stafflenbergstraße gesessen, wo sie sich manchmal nach der Schule trafen, Ute heimlich, Hanna ohne Einschränkung. Mit ernster Miene haben die jungen Frauen darüber sinniert, wie die kleinen Zeichen, die „Utes“ Reinhard doch aussendete, zu deuten seien.
„Ich glaub, er hat Angst vor einer Beziehung, vielleicht könnt ich ihn sogar rumkriegen, aber er ist zu depressiv, der würde nicht mit mir gehen.“ Ute sieht bekümmert aus, der Junge beschäftigt sie sehr.
Hanna tröstet: „Wenn er dich gar nicht mögen würde, würde er dich bestimmt nicht dauernd anrufen, ob du mit ihm in den Wald gehst zum Vögelbeobachten, oder einfach bei dir vor der Tür stehen, um mit dir Platten zu hören.“
„Aber er hat noch nie versucht, mich zu küssen oder sonstwie anzufassen, das ist doch nicht normal, oder?“
„Vielleicht ist er schüchtern und traut sich nicht, den darfst du nicht überrumpeln, hab Geduld, das wird schon.“
Dass der Angebetete vielleicht noch zu jung, zu unerfahren war, kam den beiden jungen Frauen nicht in den Sinn, es gab durchaus Sechzehnjährige, die noch nie ein Mädchen geküsst, geschweige denn ein Liebesleben hatten. Dass er vielleicht selbst noch nicht wusste, ob er auf Junge oder Mädchen stand – diese Option kam gar nicht erst ins Blickfeld.
Hanna und Ute hielten sich selbst ja schon längst für reif genug. Zu gern hätten sie einen festen Freund gehabt, der unentwegt an sie dachte und nichts Besseres zu tun hatte, als sich ständig nach seiner Freundin, Ute, zu verzehren. Andererseits kannten sie die Liebesanforderungen der Zeit, dachten, dass sie die erfüllen zu müssten. Anforderungen, die Hanna beunruhigten. Da war viel von freier Liebe die Rede, und obwohl es zumindest den Freundinnen an Praxis mangelte, wollte Hanna unbedingt Teil dieser verlockenden Hippiewelt sein. Die, die dazugehörten, waren so schillernd und fantasievoll und künstlerisch und klug. Hanna las ziemlich viel, hörte angesagte Musik, Melanie, Leonard Cohen, die Doors, und allmählich zählte sie tatsächlich zum Kreis der ständigen Gäste im Laboratorium, der Rock-Konzert-Besucher, der Zuhörer bei Podiumsdiskussionen sowie der Aurobindo-Meditierenden und der Teilnehmer an Marxismus-Schulungen.
Paul hatte indirekt seinen Anteil daran gehabt, er hatte sie aus dem Gefühl herausgeholt, auf ewig ein langweiliges schwäbisches Mädchen zu sein, das nicht viel erwarten durfte. Die Eltern brachten ihren Töchtern unverdrossen trotz eigener Einschränkungserlebnisse weiterhin Unterwerfung, Bescheidenheit, Dankbarkeit, Anstand, Pflichtgefühl und Biegsamkeit bei. „Sei immer bescheiden, verlangt nicht zu viel, dann kommst du zwar langsam, aber sicher ans Ziel“, das hatten drei Mitschülerinnen dem Grundschulkind Johanna ins Poesiealbum geschrieben.
Mit Ute, die längst den Ausgang aus ihrem Kindergefängnis gefunden hatte, konnte Hanna die „andere Seite“ berühren. Ute würde, als Erste von allen, von zu Hause ausziehen, sobald sie siebzehn war, um das Abi nachzumachen, in Ruhe.
Der Aufenthalt der Clique bei Ute hatte taktische Hintergründe: Hannas Freundin ergriff die Gelegenheit, um den dunklen Reinhard in ihre Höhle zu locken und bot ihm versteckt neben den unbeaufsichtigten „Diskussionstagen“ auch ihren Körper an. Damit es für ihn und die anderen nicht allzu offensichtlich war, beschrieb sie das Treffen als mehrtägige Party und lud den Heißbegehrten ein. Aber der kam nicht. Stattdessen war nun der blonde, freundliche und Ute sehr zugeneigte Reinhard gekommen. Und er brachte Hanna jemanden mit, den sie seit dem ersten Wortwechsel nicht vergessen hatte.
Sie saßen in dem ordentlichen Wohnzimmer mit der beigefarbenen Couchgarnitur und der ockerfarbenen Schrankwand. Nach einer Weile stellten sie lieber eine umgedrehte Obstkiste auf den Boden, lagerten sich darum, die obligatorische Chiantiflasche mit der Tropfkerze obendrauf stand in der Mitte und verbreitete stimmungsvolle Atmosphäre, sie entzündeten Sandelholzstäbchen, legten eine Janis-Joplin-Platte auf, hörten Utes Ausführungen zu, über Reinhard, ihren Reinhard. „Ich habe Angst um ihn, manchmal habe ich den Eindruck, er hat Depressionen, ich mach mir Sorgen.“
Noch lange diskutierten sie über Beziehungen im Allgemeinen, obwohl sie gar keine hatten.
Jean und Hanna kennen ihre Namen schon von der kurzen Begegnung am Lagerfeuer, haben inzwischen hier in der Runde auch schon hin und wieder ein paar Sätze gewechselt, und sie können die Augen nicht voneinander lassen, ihre Blicke suchen sich gegenseitig, bleiben dann kurz hängen. Als Jean sich aus der Küche ein Glas Wasser holt, fragt er explizit Hanna, ob er ihr eins mitbringen soll. „Au ja, das ist nett von dir.“ Als er mit den zwei Gläsern zurückkommt, schiebt er Paul ein bisschen zur Seite und quetscht sich zwischen den Freund und Hanna. Sie strahlt ihm entgegen, sagt Danke.
„Und, was machst du so, wenn du nicht gerade bei Freunden bist?“, Jean ist neugierig, was das schöne Mädchen zu erzählen hat.
„Na ja, wahrscheinlich dasselbe wie die meisten in unserem Alter, ich geh zur Schule, treff da meine Freundinnen, ich bin im Marienhof, nur Mädchen. Ich geh in die Ballettstunden bei der Tanzschule Kottmann, so dreimal in der Woche. Ich lese gerade C. G. Jung und parallel Hegel, Philosophie der Weltgeschichte, zugegeben mit Unterbrechungen, das kann man nicht wie einen Krimi lesen. Das heißt nicht, dass es langweilig ist.“
„Schon klar“, sagt Jean und grinst erfreut.
„Was mach ich sonst noch? Viel lesen halt, ich mal auch gern Bilder, obwohl ich das nicht so gut kann, ich krieg nur Komplexe, wenn ich die Gemälde und Karikaturen von Ute sehe. Dann lass ich’s lieber bleiben. Und du, was treibt dich so um?“
„Im Großen und Ganzen kann ich dem nur zustimmen, ich bewege mich in ähnlichen Welten. Nur den Jung habe ich noch gar nicht gelesen, ich glaub auch, dass mir Freud näher steht, aber vielleicht kannst du mir das ja bei Gelegenheit erklären.“ Hannas Seele ist schon auf dem Weg, er hat so eine sanfte Stimme, er hat freundliche Augen.
Irgendwann verlassen die wenigen Fremden die Szenerie, sie müssen nach Hause zu ihren Eltern, wollen vielleicht noch woandershin.
Reinhard II, Ute, Marie, Jean und Hanna gehen in dieser Nacht in den Wald, um etwas zu erleben, sie wollen ganz nah an der Natur sein, es ist Sommeranfang, und die Abende sind wunderbar lau. Draußen zu sein im Dunkel des duftenden Waldes, entflohen dem Hellen der Alltagsgewissheit, ist an sich schon fantastisch, das birgt manches Versprechen. Keiner könnte sagen, was sie sich davon erwarten, aber schon die Planung dieser Nacht, mit den vertrauten Freunden auf engstem Raum, lässt das Herz pochen, den Geist fiebrig froh werden. Erfahrungen warten unter dem im Dämmerlicht schimmernden Grün der Buchenblätter, noch ist es hell. Alle sind sie gespannt, überspielen die sanfte Aufregung, die meterhohen Erwartungen. Manch Körper vielleicht an einen anderen sich schmiegend, wer weiß?
Jean hat die Kote vom Militär organisiert, von einem „Bekannten beim Bund“, in ihrem Inneren kann man Feuer machen, dort wollen sie schlafen, reden, rauchen, vielleicht meditieren, die Nacht verbringen. Marie und Reinhard gehen Holz sammeln, während Jean, Ute und Hanna die Kote an einem Baum aufhängen, Jean reicht mit den Händen an den Ast, wo er sie geschickt festbindet. Die Pflöcke rundherum hauen sie mit Steinen in den Boden. Als die beiden anderen mit dem Holz zurückkommen, errichtet Jean den kleinen Scheiterhaufen, der das Lagerfeuer werden wird. Er hat ohne Wissen der Eltern schon öfter allein im Botnanger Wald in diesem Zelt genächtigt, um nachzudenken, wie er sagt. Hanna will gleich wissen, worüber. „Über Gott und das Nichts, den Zweifel.“ Jean zündet den Haufen aus Ästen mit kleinen Zweigen und ein paar Blatt Klopapier an.
Reinhardt sieht Ute mit traurigen Augen hinterher. Er will sie so dringend wie hoffnungslos. Sie hat den anderen Reinhard im Sinn. Sie reden, kochen Dosenravioli auf dem Feuer, trinken Frizzantino, schön süß, liegen um das leicht qualmende Feuer herum. Ein bisschen Mondlicht scheint durch die Öffnung im Zeltdach. Die Flammen werden schwächer, Jean legt Holz nach, die anderen schlafen in ihren Schlafsäcken ein, die noch weit entfernt sind von den atmungsaktiven Hightech-Kunstfaserteilen der Jahrtausendwende. Kinder sind sie alle noch und trotz Weingenuss und gelegentlichen Zigaretten nicht gewöhnt ans Durchmachen. Es wird kalt in den ganz frühen Morgenstunden, Hanna kann nicht einschlafen, ihre erste Nacht allein weg von daheim und auch die erste in einem Zelt, sie ist gerade siebzehn. So jung und in ihrer Vorstellung schon eine echte erwachsene Frau, Erfahrung steht noch aus, auch Enttäuschung.
„So um drei, vier wird es am kältesten.“ Er ist plötzlich hinter ihr, hat sich, still seinen Schlafsack nachziehend, an ihren Rücken geschmiegt. „Erlaubst du, dass ich dich wärme?“, fragt er.
Nicht ihr erster Körperkontakt mit einem Jungen ist das, aber der erste mit einem Mann. So schnell geht das: Aus einem Mädchen und einem Jungen werden ein Mann und eine Frau. Hannas Herz gebärdet sich wie wild, und sie will sofort ganz viel davon, was immer es auch ist. Ihr ist angenehm schummerig zumute. Das Kind will sich so schnell wie möglich verstecken, sie kann es nicht, schon klopft das Herz in Vorfreude. Der Wald ist dunkel um das Zelt herum. Was hat sie sich nur gedacht. Wie war das? Das Schöne ist der Anfang von allem Schrecklichen? Unsinn, lass es geschehen. Sie ist noch Jungfrau, wie soll sie sich anstellen, er soll sie küssen.