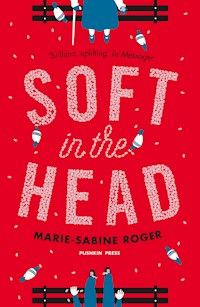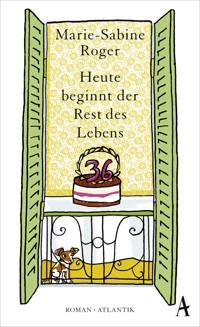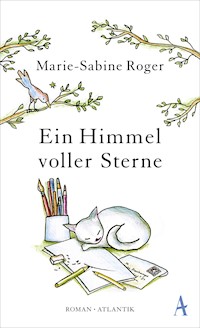
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Merlin ist Autor einer erfolgreichen Comic-Reihe. Mit seiner Frau Prune und dem Kater Pantoffel bezieht er ein Traumhaus auf dem Land. Zwar gibt es nach elf Uhr vormittags kein warmes Wasser, und der Klempner Herr Tjalsodann lässt sich nicht blicken, aber davon abgesehen ist ihr Glück perfekt. Bis eines Tages Merlins bester Freund Laurent stirbt, Vorbild für seinen Comic-Helden Wild Oregon. Laurents letzter Wunsch: Wild Oregon soll im nächsten Band endlich die Liebe seines Lebens finden und es bitte nicht – wie er selbst – verbocken. Doch Merlin will die Arbeit einfach nicht gelingen: Laurents hinterlistige Katze Zirrhose sorgt für Unruhe im Haus, vor allem aber will Merlin ohne Laurent einfach nichts einfallen. Ihm fehlt jegliche Inspiration – bis Laurents Onkel Albert mit 94 Jahren seinen zweiten Frühling erlebt und sich verliebt. Langsam geht Merlin auf, dass er sich ganz falsche Vorstellungen von der wahren Liebe gemacht hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Ähnliche
Marie-Sabine Roger
Ein Himmel voller Sterne
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
Atlantik
Für die, die ich liebe und die das wissen,
dieses unter der Linde geschriebene Buch.
Diese Welt ist groß genug,
um darin unsere Träume zu finden, Phoebe.
Man muss sich nur auf die Suche machen.
Jim Oregon
in Wild Oregon, Band 3
(Die Ballade der Phoebe Plum)
Baustelle
Darauf in buntem Durcheinander:
ein Traumhaus, eine renovierungsbedürftige Scheune,
eine echte Engländerin, ein inkontinenter Marder,
Trüffel und zwei Spaßvögel.
Prune und ich hatten das Haus vor einem knappen halben Jahr gefunden.
DAS Haus.
Das Haus, nach dem wir tage- und nächtelang das Internet durchforscht hatten – vor allem Prune, um ehrlich zu sein, denn die perverse Lust auf ruinöse Gemeindesteuern war eher ihre als meine.
Unser Haus. Home Sweet Home. Das Bilderbuchlandhäuschen, für das wir mehrmals quer durch Frankreich gefahren waren, Richtung Südwesten, um nach acht Stunden Fahrt und einem schlechten Sandwich vor irgendeiner komplett uninteressanten Bruchbude zu stehen und enttäuscht, ernüchtert, mit stumpfem Fell und hängenden Ohren heimzukehren.
Bis zu jenem Tag im Mai, an dem wir nach zweistündiger Irrfahrt über verlassene Landstraßen und ausgefahrene Schotterwege – auf der Suche nach einer Abkürzung, die wir nie fanden, wie David Vincent in der Serie Invasion von der Wega – endlich am Ende einer Sackgasse die seltene Perle fanden.
Es war ein alter Bauernhof, ein langgezogenes Gebäude »mit viel Charakter«, wie es in der Annonce hieß, die außerdem ungeniert »ausbaufähige Nebengebäude« versprach (zwei Scheunen, deren Dächer tiefer eingesunken waren als der Rücken eines Lastesels nach einem harten Arbeitsleben). Das Ganze wurde als »bewohnbar« bezeichnet, was nicht gelogen war, wenn man beschloss, über selbstmörderische Stromanschlüsse ebenso hinwegzusehen wie über eigenwillige Rohrleitungen (wie eigenwillig sie waren, wussten wir damals noch nicht), antiquierte Sanitäranlagen, eine Klärgrube aus der Römerzeit, Tapeten aus den siebziger Jahren mit halluzinogenen Motiven und einen verschlammten Tümpel, den die Dame vom Maklerbüro beharrlich als »Weiher« bezeichnete.
Aber Häuser haben mit uns Menschen gemein, dass sie uns anziehen, abstoßen oder gleichgültig lassen. Und manchmal sind wir plötzlich Feuer und Flamme für etwas, das in keinem Punkt, oder fast keinem, unseren Kriterien entspricht. Dasselbe könnte man von Liebesgeschichten sagen.
Denn sonst hätte Prune keinen Cent auf mich gesetzt – wissenschaftlicher Illustrator, Comiczeichner in meinen Mußestunden, welche bei weitem die zahlreichsten und die einzig lohnenden sind. Und ich hätte meinerseits keinen einzigen Blick an diesen mageren komischen Vogel verschwendet, der seit dreißig Jahren auf Flohmärkten alten Plunder verkaufte und zu Pink-Floyd-Klängen Yoga übte.
Während sie uns im Stechschritt durch das Haus führte, überschüttete uns die Maklerin, eine resolute Engländerin, mit einem fröhlichen Wortschwall, um unsere Aufmerksamkeit von diversen nicht ordnungsgemäßen Details abzulenken, so wie eine Katze ihre Hinterlassenschaften diskret mit Streu überdeckt.
Das war völlig zwecklos. Wir sahen genau, was alles nicht in Ordnung war. Unser Blick war dank der dreiundsechzig vorangegangenen Besichtigungen geschärft. Nichts oder fast nichts entging uns mehr, von Feuchtigkeitsspuren über gesprungene Ziegel bis hin zu Kältebrücken, fehlender Isolierung, altertümlichen Heizkörpern, einfach verglasten Fenstern und kaum vorhandener Fugen. Dieses Haus war ein Fass ohne Boden, und wir würden sehenden Auges in den Abgrund springen.
Prune sah mich mit diesem Blick an, der bedeutet, dass man nicht mal darüber nachzudenken braucht, ihr ein Nein entgegenzusetzen. Sie lief kreuz und quer durch die Räume, drückte die Nase an die Fenster, drehte sich mit geschlossenen Augen im Kreis und öffnete sie mit einem Schlag wieder, um sich selbst zu überraschen.
Sie sog die Atmosphäre in sich auf, baute Luftschlösser, und ich saß dicht hinter ihr auf dem gleichen fliegenden Teppich. Was hätte ich tun können? Ihr sagen, dass mein Talent in Sachen Renovierung sich darauf beschränkte, Glühbirnen auszuwechseln?
Ich mag zwar Merlin heißen – besten Dank an meine Eltern und Herrn Disney für dieses wunderbare Geschenk, das mir die Kindheit versaut hat –, aber ob es meiner Liebsten, die mir ohne zu zögern Fähigkeiten zuschreibt, die ich nicht besitze, gefällt oder nicht: Mit meinen Zauberkräften ist es nicht weit her.
Die Dame vom Maklerbüro, die potenzielle Käufer witterte, pries uns mit einem Akzent à la Jane Birkin »den Reize des Landlebens« an, »das entzückende Terrasse, die große Garten, der herrliche Aussicht, die kleiner wilder Tieren« (und sogar die »großer«, denn in den Wäldern ringsum gab es jede Menge Wildschweine).
»Und auch die Schlehe, Oh my …! So, so lovely!«, schloss sie mit einer Begeisterung, die uns einigermaßen übertrieben erschien in Bezug auf eine Pflanze, deren zarte Blüten im Frühling gewiss lieblich duften, die aber in unseren ländlichen Gefilden nicht besonders selten ist.
Als sie zu unserer großen Überraschung noch hinzufügte, dass wir diese lovely Schlehen oft an unseren Fenstern vorbeilaufen sehen würden, so cute, weil sie »in das untere Garten essen gehen«, zweifelten wir einen Moment lang an ihrer geistigen Gesundheit, bis wir (nach einem surrealistischen Dialog) endlich begriffen, dass sie Rehe meinte, von denen es in der Gegend tatsächlich wimmelt.
Prune bekam sofort ihren Liebestod-mit-Pailletten-Blick – wie sollte man sich so etwas entgehen lassen: Rehe in unserem Garten.
So lovely. So cute.
Wir waren in einem Traum gelandet.
Dabei hatten wir nach ausgiebigen, monatelangen Beratungen gute Vorsätze gefasst, die eines Neujahrs würdig waren: Wir würden unser Projekt durchkalkulieren, realistisch bleiben, jede Etappe planen. Lauter lobenswerte Ziele, von denen wir genau wussten, dass wir sie nie einhalten könnten.
Unsere Kriterien waren folgende: ein ebenerdiges Haus, nicht zu klein, nicht zu groß, ohne Renovierungsbedarf, abgesehen – wenn es unbedingt sein musste – von Malerarbeiten, auf dem Land, aber ganz in der Nähe einer großen Stadt. Vier, fünf Kilometer, mehr nicht.
Wir wollten die Kuh schlachten und weiter Milch haben, das Huhn braten und trotzdem die Eier essen, mit den Hunden jagen und mit den Hasen rennen.
Nun standen wir vor einer etwa dreihundert Quadratmeter großen Ruine, mit mehr Treppen als ein Bergfried in den Corbières und der Aussicht auf eine pharaonische Baustelle – sozusagen eine Perspektive mit Fluchtpunkt im Unendlichen.
Und das Ganze natürlich mitten in der Pampa, 8,7 Kilometer bis Kleinkleckersdorf (kein einziger Laden) und 32 Kilometer bis Posemuckel (Bäckerei, Café, reizender kleiner Supermarkt, von Samstagmittag bis Dienstag vierzehn Uhr geschlossen). Der nächste Nachbar war fünfhundert Meter entfernt, er lebte in Paris und kam nur im Juli, und bis zur nächsten »echten« Stadt fuhr man eine Stunde mit dem Auto.
Wir nahmen uns vor, unsere Wochenenden dort zu verbringen, sobald die ersten Entzugserscheinungen von Feinstaub und großen Läden auftreten würden.
Das Haus war originell geschnitten. Es wirkte wie das Ergebnis einer idiotischen Wette eines Großmauls im Vollrausch: »Um wie viel wettet ihr, dass ich mein – hicks – Haus ganz alleine in drei Wochen baue, ganz ohne – hicks – Plan?«
Trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen?) hatte es eine Menge Charme und insbesondere drei schöne, große, helle Räume, die nach Süden hinausgingen, darunter einer, der mir als Atelier dienen würde, und ich wusste schon genau, in welcher Ecke ich mein Zeichenbrett aufstellen würde.
Im zweiten Raum würden wir unser Liebesnest einrichten, mit Blick auf den Garten. Für den dritten, der bis über die Scheune reichte, stellte sich Prune ein riesiges Wohnzimmer auf mehreren Ebenen vor, mit großen Schieferplatten auf dem Boden, einem offenen Kamin mitten im Raum, in sanften Ockertönen gestrichenen Wänden. Bauen & Renovieren also.
Aber meisterlicher.
Der Garten wurde als »englisch« bezeichnet – im Gegensatz zu den »französischen Gärten«, die durch ihre strenge Symmetrie gekennzeichnet sind, ihren militärischen Schnitt, Nacken und Ohren frei, ihre Phantasielosigkeit und ihre leicht zwanghafte Ordnung.
Hier herrschte ein harmonisches, poetisches Chaos. Es gab eine wunderbare Aussicht, prachtvolle Bäume, und die Amseln sangen um die Wette, als wollten sie sich um die Aufnahme ins französische Nationalorchester bewerben. Ein laues Lüftchen ließ die Blätter der Linde und die Zweige der Weide im Chor säuseln, und entlang der alten Gemäuer wucherten schöne alte Rosenstöcke in allen Rottönen und Strauchpfingstrosen vom blassesten bis zum tiefsten Rosa.
Wir waren übermütig wie junge Fohlen, völlig aufgedreht.
Wir würden Fenster und Türen in die Mauern brechen, Gauben in die renovierten Dächer einfügen, Tauben fliegen lassen, wir würden Wände einreißen, eine Veranda bauen, Luft hereinlassen, Luft und Licht in Strömen. Die Nebengebäude würden die Wohnfläche verdoppeln, die sowieso mehr als ausreichend war.
In der ersten Scheune, keine Frage, würden wir einen Kinosaal einrichten, um endlich die zwei Reihen Klappsitze mit sternennachtblauem Samtbezug zu verwenden, die wir in einem Anfall von Wahnsinn bei einer Auktion ersteigert hatten und die seit über drei Jahren in der Garage eines Freundes lagerten, der nicht mehr lange unser Freund sein würde, wenn wir ihn nicht bald davon befreiten.
In die zweite Scheune käme ein Fitnessraum mit allem, was es braucht, um sich Muskeln zuzulegen, falls wir eines Tages durch irgendein Wunder sportlich werden sollten.
Darüber ein Halbgeschoss für Prunes Yogaübungen. In der Ecke ein kleines Appartement, um unsere Freunde unterzubringen.
Eine Sommerküche. Eine große Terrasse. Ein andalusischer Patio. Ein zisterziensischer Kreuzgang.
Die Maklerin nickte begeistert mit dem Kopf, dem Hals, dem ganzen Oberkörper, ein prothesenhaftes Lächeln schief über dem rosigen Gesicht, während sie uns mit beiden Händen auf die rutschige Bahn der Überschuldung schob.
Eine Sauna wäre gut. Oder vielleicht ein Schwimmbad?
Kunden von ihr hätten »ein kleines Sache« in diesem Stil gemacht, und das Ergebnis war … Oh dear! Oh my …! Ihr fehlten die Worte.
Mit stockendem Atem, die Augen voller Sterne, glaubten wir es vor uns zu sehen, oh ja!, wir sahen es, das Überlaufschwimmbecken in der kleinen Scheune mit dem schönen neuen Dach, den weiß gekalkten Mauern, der riesigen Fensterfront, die auf die Landschaft, die Wälder und die Hügel hinausging.
Ein Schwimmbad, genau das war es, was uns fehlte.
Prune hatte sich auf den ersten Blick in die riesige Küche mit dem honigfarbenen Holzboden verliebt. Sie war während der Besichtigung zehnmal dorthin zurückgekehrt. Sie, die Spezialistin für Omeletts, Fischstäbchen und klebrigen Reis, plante eine große Kücheninsel zu erwerben, inklusive eines Profiherds mit einem ganzen Arsenal von Töpfen und Pfannen. Sie nahm mit der Handspanne ungefähre Maße, fotografierte mit ihrem Telefon jede Wand und jede Ecke. Sie tänzelte herum, zappelte vor Freude, sang vor sich hin, ohne es zu merken.
Um mir diskret zu verstehen zu geben, dass ihr Entschluss feststand (dieses Haus oder gar keins – wenn ich einverstanden wäre natürlich, aber ich täte wohl daran), vollführte sie die Zeichen, auf die wir uns vor dem Besuch verständigt hatten – ein Blick an die Decke, gefolgt von einem Zupfen am Ohrläppchen –, auf die ich so unauffällig wie möglich antwortete – ein Reiben an der Nase, ein unterdrücktes Gähnen –, während die Maklerin mit ihrer britischen Diskretion so tat, als bemerke sie unseren Spaßvogelzirkus nicht.
Das Haus gefiel mir, und es gefiel meiner Liebsten. Es versprach uns Jahre des Glücks. Und ich liebe es so sehr, meine Liebste voller Begeisterung zu sehen, mit diesem Körnchen Salz und Pfeffer in ihrer Verrücktheit, wegen der ich sie brauche wie die Luft zum Trinken und das Wasser zum Atmen. In meinem persönlichen Atelier, gleich links neben dem Eingang in meiner Schädelhöhle, habe ich mindestens hundertfünfzehn Bände der Comicserie Meine Prune auf Lager, an der ich Tag für Tag, Nacht für Nacht weiterarbeite.
An jenem Morgen sah ich ihr zu, wie sie herumwirbelte, sich begeisterte, die Szenerie aufsog, bis sie sich in ihrem Kopf eingenistet hatte, ich hörte lauter Sätze im Konjunktiv, die eher wie Imperative klangen (hier würden wir den Geschirrschrank hinstellen, da kämen Regale hin). Ich war zugleich ganz nah und sehr weit von ihr weg, ich durchmaß mit großen Schritten die Zukunft und legte mir ein Flipbook zum persönlichen Gebrauch an.
Prune streift mit einem Weidenkorb am Arm
über die Märkte der Gegend,
um mit den Händlern mit stolzem Schnurrbart,
Hosen aus grobem blauem Tuch und Holzfällerhemden
um den Preis der Trüffeln zu feilschen.
Oder:
Prune in einer Schürze mit kleinen Vichy-Karos,
bewaffnet mit Schaumkelle und Holzlöffel,
rührt in einem Kupferkessel, der so groß ist wie sie.
Rings um sie herum riesige Regale
voller Gläser mit hausgemachter Marmelade,
auf denen, egal was für Früchte sie enthalten,
in alter Schreibschrift steht:
Confiture de Prune
Oder aber:
Prune, ein Riesenschälmesser in der Hand,
schält wie wild alles, was ihr in die Hände fällt.
Vor ihr auf dem Tisch ein Haufen Gemüse und Abfälle.
Der Kater Pantoffel
versteckt sich mit frisch geschältem Schwanz
beleidigt hinter den Regalen.
»Was meinst du?«
Prune schmiegte sich an meinen mächtigen Oberkörper und schaute zu mir auf (ich wüsste nicht, wie sie es mit ihrer lächerlichen Größe von eins siebenundfünfzig anders machen sollte, da ich es, als gutes Alpha-Männchen, mühelos auf eins achtundsechzig bringe). Sie kniff die Augen zusammen, lächelte mich an, flüsterte: »Es ist schön, nicht?«, während sie aus dem Augenwinkel die Dame vom Maklerbüro beobachtete, die gerade ganz nebenbei fallengelassen hatte, dass eine andere Interessentin diese Haus sehr wunderbar finde und das kleine Garten gorgeous, magnificent, superb, aber dass sie uns natürlich nicht unter Druck setzen wolle.
»Ja, wirklich schön«, flüsterte ich meiner Liebsten sanft und seidenweich zu, und meine Worte glitten wie eine ersterbende Welle in die geliebte Muschel ihres rosigen Ohrs, gesäumt von Tragus, Antitragus und Helix. (Vgl. Tafel 4 und 6 in »Abriss der Anatomie und Physiologie des Ohrs«, Kapitel 1, Außenohr, Illustrationen von Merlin Deschamps.)
Am nächsten Morgen sahen wir uns das Haus ein zweites Mal an. Vielleicht könnten wir uns, wenn wir es noch einmal sahen, rechtzeitig davon überzeugen, dass es sich um eine schlechte Wahl handelte?
Aber nein. Der Garten war ein Feuerwerk von bunt zusammengewürfelten Blumen, von Amseln auf LSD und betörend summenden Bienen. Die Sonne durchflutete mein zukünftiges Atelier.
Als wir wieder gingen, schlossen wir das Gartentor mit dem dämlichen, beglückten Gesichtsausdruck junger Eltern im Kreißsaal, bevor wir in unsere vollkommen zweckmäßige Wohnung mit Aussicht auf das trübe, städtische Leben zurückkehrten.
Drei Monate später unterschrieben wir den Kaufvertrag. In der Zwischenzeit hatten wir versucht, die Renovierungskosten zu kalkulieren, die den Preis des Hauses, bei vorsichtiger Schätzung, verdreifachen würden, was ein Wahnsinn war: Nach Begleichung der Notarkosten bliebe uns nichts mehr, oder fast nichts.
Wir hatten uns mit philosophischem Gleichmut getröstet: Es würde eben langsam gehen, man muss warten können, um zu genießen, nur weniges ist unverzichtbar, und dazu zählt ein Fitnessraum oder ein Kinosaal sicher nicht.
Ein Schwimmbad, wozu? Prune schwamm lieber im Meer, und ich mochte sowieso kein Wasser.
Nachdem wir die Qualen des Umzugs hinter uns hatten – die ungeheure Menge an Kisten und Kartons, die etwas späte Entdeckung, dass das Haus keinerlei Stauraum oder Einbauschränke hatte, dafür aber das Internet katastrophal langsam war, ein Marder auf dem Dachboden wohnte, der immer an dieselbe Stelle pinkelte, und eine Kolonie von hysterischen Mäusen bei Einbruch der Dunkelheit durch den Flur rannte und im Garten gefundene Nüsse vor sich her rollte – ganz abgesehen von einer Brut von Spinnenläufern, gemeinhin Hundertfüßer genannt, die Prune mindestens zehnmal am Tag spitze Schreie entlockten und sie in meine muskulösen Arme flüchten ließen (das Adjektiv zu den Armen ist nicht ganz korrekt) –, nachdem wir also das alles und den Rest hinter uns hatten, verausgabten wir uns einige Wochen lang fröhlich, wir strichen wie besessen Türen und Fenster, schrubbten Böden und Wände – man hätte meinen können, dass wir ein freudiges Ereignis erwarteten.
Aber Prune ist neunundvierzig, und ich bin acht Jahre älter. Sieht nicht so aus, als würden wir uns noch fortpflanzen.
Ich liebte die Zukunft, die uns hier erwartete.
In der Ecke meines Schädels, die mir als Wandtafel dient, kritzelte ich schon eine Menge Bildchen davon:
Der Künstler (ich) sitzt unter Bäumen,
versonnen und zerzaust,
ein Glas kühlen Muscat neben sich,
bekleidet mit einem Netzunterhemd,
das seine Aquarellisten-Brustmuskulatur
gebührend zur Geltung bringt, und zeichnet.
Im Hintergrund Prune in weißen Shorts und Sonnenbrille,
die den Kunstkritikern Rede und Antwort steht,
welche in ganzen Busladungen gekommen sind
und sich hinter dem Gartentor drängen,
um einen Blick auf den Künstler (mich) zu erhaschen
und die universelle Tragweite des Werks zu erfassen,
das dort, unter ihren staunenden Augen,
im Entstehen begriffen ist.
Ja, zum Teufel mit der Bescheidenheit, ich spürte es, meine Hand würde präzise sein, mein Strich sicher, ich würde der Welt endlich zeigen, was sich in meinem tiefsten Inneren seit jeher verbarg: eine kunstvolle, mächtige Alchemie der Talente von Leonardo1, Albrecht2, Jean3 und Michel4, sublimiert durch meine persönliche Handschrift.
Zwischen zwei Tafeln für die Große Enzyklopädie der Vögel Europas (Band 4: Die Sperlingsvögel – Meisen, Schwanzmeisen, Finken), an der ich seit fast zwei Jahren arbeitete, würde ich einen neuen Band meiner Comic-Serie Wild Oregon in Angriff nehmen.
Wild Oregon ist mein Hauptwerk. Es ist eine trostlose Utopie, oder eine fröhliche Dystopie, je nachdem, ob einem das Leben als ein halb volles oder halb leeres Glas erscheint. Eine völlig abgefahrene Welt zwischen traditionellem Western und reinster Fantasy, in der mein Held, Jim Oregon, unermüdlich alle möglichen Bösewichte jagt. In den Geschichten verbinden sich Burleskes und Krimielemente vor dem Hintergrund einer ökologisch angehauchten Science-Fiction. Es handelt sich um ein eigenständiges Genre, als dessen Erfinder ich mich ansehe und das ich ohne zu zögern als neu bezeichnen würde, ungeachtet einiger bequem urteilender Kritiker, die es als Mischgattung und alten Zopf betrachten, unter dem Vorwand, dass meine Arbeit hemmungslos Reales und Imaginäres mischt, ein wahrer Schmelztiegel, in dem man sogar Stoff zum Lachen und zum Weinen findet. Mir erscheint das im Gegenteil als stichhaltig und hellsichtig, ganz aus dem wirklichen Leben gegriffen, das uns, wie wir alle wissen, dabei ertappen kann, bei Beerdigungen zu lächeln und bei Hochzeiten und Taufen schwermütig zu werden.
Ich verwende verschiedene Zeichenstile, verschiedene Techniken, ein paar anatomische Tafeln (ich bin vor allem wissenschaftlicher Illustrator, hinter mir verstaubt ein ganzes Leben in Enzyklopädien). Ich recherchiere stundenlang über Details, die ich am Ende nur grob andeute, und arbeite mit der größten Genauigkeit obskure imaginäre Welten aus.
Ich bin Spezialist der vagen Präzision und der genauen Unschärfe.
Ich heiße nicht umsonst Merlin, ich glaube an meinen Auftrag: die Wiederverzauberung der Welt.
Wie dem auch sei, meine Serie Wild Oregon ist zu einem nahezu weltweiten Erfolg geworden, da ich, jenseits des französischen Mutterlandes und seiner Überseegebiete, inzwischen ins Monegassische und ins Luxemburgische übersetzt bin, des weiteren in Quebec und neuerdings auch in der Schweiz gelesen werde, in den Kantonen Waadt, Genf, Neuchâtel und Jura, sowie von Lesern in Benin, Gabun, Andorra, Togo, Senegal, Burkina Faso, Mali, Elfenbeinküste, Ontario, New Brunswick, Nunavut, Mauretanien, Tunesien, Louisiana, Zentralafrikanische Republik, Haiti, Tschad, Algerien, Kambodscha, Burundi, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Niger, Guinea-Conakry, Äquatorialguinea, auf den Seychellen, in Ruanda, Madagaskar, Mauritius, Dschibuti, auf den Komoren, in Laos, Marokko, im Aostatal, in Llívia, in den Nordwest-Territorien von Kanada, im Libanon, in Kamerun sowie in Vanuatu.
Wie viele französische Autoren können das von sich behaupten?
Wenn ich nicht gerade Bretter abschmirgelte, Regale anschraubte oder Estrich verlegte – immer angetrieben von der energischen Prune, die alsbald in die Rolle der Bauleiterin geschlüpft war –, wartete ich seit drei Wochen auf das Eintreffen meines letzten Opus, Ein Lied für Jenny Pearl, Band 13 von Wild Oregon. Ich will keine falsche Bescheidenheit vorschützen, ich war nicht unzufrieden damit.
Die Geschichte begann in Leaving Station, dem alten Weltraumbahnhof der Stadt Backwater für interstellare Reisen in die Entlegenen Welten. Jim Oregon, mein legendärer Held, sollte dort einen Gefangenentransport übernehmen und in die Straflager von Oblivion bringen, was eine mehrmonatige Expedition in die kalten Gefilde des Interstellarraums bedeutete, wie schon in Band 4, Kein Erbarmen für Ruthless John.
Wie immer hatte ich mich für englische Namen entschieden, in der geheimen Hoffnung auf eine Übersetzung, die auf sich warten ließ, und als Hommage an die zahllosen Western, die mich als Kind geprägt und die meine Phantasie genährt hatten.
In meinem letzten Album lernte man Jenny Pearl näher kennen, eine neue Frauenfigur, leicht psychopathisch angehaucht, die am Ende des vorigen Bandes schon mal kurz aufgetaucht war. Sie war sehr schön, Comic verpflichtet.
Sie überlistete den alten Jim Bear Oregon trotz all seiner Erfahrung und schaffte es, am Bahnhof von Nohope zu fliehen, nach nur sechs Seiten und der Ermordung dreier ihrer Mitgefangenen auf die allerabscheulichste Art – extra für die horrorlüsternen Leser, demnächst in jeder guten Buchhandlung.
Auf ihrer Flucht strandete sie im Farting Louse, einer zwielichtigen Bar, die auch als Puff diente, wo ihr Weg den des Sängers kreuzte, eines anderen Irren, der in Band 9, Hinter dir singt der Tod, aufgetaucht war und für seine Opfer nostalgische Balladen zu komponieren pflegte, ehe er sie mit einem Notenschlüssel erwürgte.
Ich war ungeduldig, die Farbqualität des Drucks zu sehen, wie immer. Die Farbe ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit des Illustrators. Ein missratener Druck kann die Arbeit von Monaten zunichtemachen. Ich hatte es geschafft, zum Andruck vor Ort zu sein, und war recht zuversichtlich wieder abgereist, es waren Profis, die Einrichtung war perfekt, das Ergebnis sah gut aus.
Und trotzdem war ich besorgt. Das kommt bei Künstlern öfter vor.
In der Zwischenzeit übte ich mich in Geduld und begann nach Ende meines Renovierungstages mit meinem eigentlichen Arbeitstag – von nichts kommt nichts.
Ich vertiefte mich wieder in meine Finken und andere Sperlingsvögel, um mit meinem Beitrag zum vierten Band der Großen Enzyklopädie der Vögel Europas (geplant waren acht Bände) voranzukommen. Ich verbrachte Stunden am Zeichentisch, die Nase tief in den Federn, und feilte akribisch an Farbvarianten, Flecken und Tüpfeln der Schwung-, Deck- und anderen Federn, die sich an den Flügeln der Vögel überlappen.
Prune respektierte meinen Rhythmus, sie war es gewohnt, dass ich allein durch den Dschungel meines Gehirns kreuzte. In den fünfzehn Jahren – schon? – unseres gemeinsamen Lebens hat sie meine verschiedenen Gesichter kennengelernt. Sie weiß, wann ich in meine Illustratoren-Rolle schlüpfe, sie erkennt es an den Unmengen von Unterlagen und Enzyklopädien, die sich dann im Atelier, auf dem Küchentisch und im Bereich zwischen meiner Seite des Betts und der bemalten Holzkommode stapeln, und an den Stunden im Garten, in denen ich Skizzen oder Fotos einer Kralle oder eines Flügels mache, an den Stunden vor dem Bildschirm, in denen ich unermüdlich alle Videos und Fotos sichte, die mir genau den dreifarbigen Streifen (schwarz, weiß und rötlich) zeigen könnten, der den Latz des Blaukehlchens (Luscinia svevica) säumt.
Ganz zu schweigen von den Tagen, an denen ich in Wald und Flur auf der Lauer liege – nur dafür bin ich bereit, im Morgengrauen aufzustehen, um dann bis zur Abenddämmerung in meinem Tarnzelt auszuharren, das Gesicht dicker mit Tarnfarbe bemalt als ein junger Rekrut beim Manöver, behängt mit einem lächerlichen Wanderponcho, meine Fotoapparate mit diversen Objektiven und meine Notizbücher griffbereit.
Sobald ich am Zeichenbrett sitze, bin ich für niemanden mehr zu sprechen, vor allem nicht für mich selbst. Ich bin dann hochkonzentriert, mein Herz schlägt langsamer, die Gedanken sind weit weg, die Feinarbeit findet tief im Inneren statt. Ich bin nur eine Hand, die nicht zittern, ein Auge, das nicht blinzeln darf. Wenn ich Illustrator bin, geht es um Millimeter, um einen Federstrich, einen Schatten, eine Leerstelle, es geht um höchste Genauigkeit des Aquarells, Präzision des Strichs, unbedingte Treue in Farben, Formen und Proportionen, um die sorgfältige Wahl der Pigmente, um alles, was Glanz, Geschmeidigkeit, Bewegung, Leuchtkraft und schließlich die Illusion von Leben entstehen lässt, alles, was dem, was ich zeichne und was ich bin – denn das ist es, was letztlich auf dem Spiel steht –, Glaubwürdigkeit verleiht, damit der Betrachter den Eindruck hat, der Vogel wäre wirklich da, bebend und warm, und er würde, berührte man ihn mit dem Finger, vielleicht zusammenzucken. Ich trage nicht den Namen eines Zauberers, um Vögel zu zeichnen, die flach sind wie ein Blatt Papier. Ich muss die Tiefe zeigen, alle Dimensionen wiedergeben, den Atem, die Präsenz. Ich will keine Papiervögel ausmalen. Der Vogel muss atmen, er muss davonfliegen.
Ich muss Gott sein.
Meine Liebste weiß auch genau, in welchem Moment Wild Oregon wieder das Ruder übernimmt und anfängt, in mir zu arbeiten und unterschwellig Gestalt anzunehmen. Sie nimmt meine Erregung wahr, auf die bald Niedergeschlagenheit folgen wird, dann hysterische Heiterkeit, Bedürfnis nach Stille und Ruhe und schließlich eine neurotische Aufräumaktion in meinem Atelier, die stets die Geburt ankündigt.
Sie kennt das alles in- und auswendig, die Phasen, in denen ich verstumme, die langen Tragzeiten, in denen ich mich im Kreis drehe wie eine ängstliche Elefantenkuh, die Wochen, in denen ich wie eine Kuh endlos wiederkäue, vermutlich mit dem gleichen sanften, leicht abwesenden Blick.
Wenn ich an einem neuen Band meiner Wild Oregon-Serie (für die Eingeweihten einfach nur »Wild«) arbeite, ist die Herausforderung nicht weniger groß. Eine Fiktion erschaffen bedeutet nicht, dass man jeden Quatsch aufs Papier wirft. Der Preis der Freiheit ist ein hoher Anspruch und absolute Kohärenz. Der Wahn muss plausibel sein, und die Spinnerei glaubwürdig. Das Leben erlaubt sich viel mehr Extravaganzen, Übertreibungen und Merkwürdigkeiten, als ein Autor sie sich je erlauben kann, so durchgeknallt er auch sein mag. Das ist einfach so, und man muss es akzeptieren. Alles ist schon geschaffen, alles ist schon gesagt worden.
Meine Arbeit besteht darin, meine Stimme zu finden. Ich bin zugleich Autor und Zeichner meiner Wild-Serie, was in der Branche eher selten ist. Ich habe das Glück, nur auf mich selbst angewiesen zu sein, ich erschaffe eine Welt nach meinem eigenen Maß. Doch genau dieses Privileg macht mir Angst, denn so bin ich zugleich Bergarbeiter, Pickel und Bergwerk.
Ich kann mich nicht tragen lassen vom Text eines Autors, der meinen Illustrationen als Grundlage dienen würde.
Ich kann die Schwierigkeiten der Darstellung von dieser oder jener Figur oder Szenerie nicht umgehen, indem ich das Problem auf den Zeichner abwälze, der sich schon irgendetwas dazu wird einfallen lassen.
Ich säe und ernte, ich trage mein Korn selbst zum Mahlen, bin Wasser und Wind für die Mühle.
Monate der Arbeit.
Monate.
Skizzen, Entwürfe, Konzepte, die im Müll landen, der Kater Pantoffel, der einen ganzen Tag Arbeit zunichtemacht, wenn er im falschen Moment auf den Tisch springt, das Leben eines Buchmalers, der an seine Pergamente gekettet ist, ganz gleich ob schönes Wetter ist, ob Freunde anrufen, die ein Glas mit mir trinken wollen, ob das Leben ohne mich weitergeht. Und dann meine Verleger, Philippe für die Comics, Alice für die Enzyklopädie, die mich hin und wieder anrufen, ohne mir je Druck zu machen, deren Namen auf dem Telefondisplay aber jedes Mal schreckliche Schuldgefühle in mir wecken.
»Wie sieht’s aus? Kommst du voran?«
Ich sage ja, ich lüge, mogle, schildere Seiten, die nicht einmal entworfen sind.
Ich möchte fertig sein, bevor ich auch nur angefangen habe. Ich mag es zu zeichnen, aber es ist so langwierig – eine Stunde Arbeit für eine einzige Feder eines meiner Sperlingsvögel. Ganze Tage für eine Seite, für manche Landschaften, für die Details eines Saloons oder eines Raumschiffs.
Ganz zu schweigen vom Cover, das alles sagen und alles verbergen soll, das sich prostituieren, sich an den Meistliebenden verkaufen soll. Damit sich die Hand des Lesers unwillkürlich nach dem Album ausstreckt, es unter all den anderen auf dem Büchertisch herausgreift.
Das ist der Teil, den ich nicht mag, der alle meine Kindheitsängste wieder aufleben lässt.
Und wenn niemand mich in seiner Clique haben und mitspielen lassen will?
Und wenn niemand mich liebt, was dann?
Erste Schläge ins Kontor
Worunter sich verbergen:
zwei Comic-Helden, ein Brüllaffe (weiblich),
Schüsse aus dem Hinterhalt und ein Junggesellenabschied.
Und natürlich, nicht zu vergessen, ein Schwingelmörserling.
Wir hatten das Haus seit fast sechs Monaten. Prune sprühte vor lauter poetischen und verrückten Ideen.
Ich schwamm in Glückseligkeit wie eine Pflaume im Armagnac.
Und da …
Man meint, den Hafen erreicht zu haben, man bereitet sich träge auf das Leben einer kleinen Jolle am Anlegeplatz vor, man überlasst sich endlich der Idee des Glücks, man akzeptiert die Aussicht darauf und freut sich insgeheim, und genau in dem Moment bricht der Sturm los. Ein Tsunami, der alle Dämme brechen lässt, oder ein bescheidenes Hochwasser, das die Kais überflutet, je nachdem. Jedem von uns seine eigene Katastrophe. Der Umfang des Schadens sagt nichts über das Ausmaß des Schmerzes aus. Ich habe Leute gekannt, die wegen des Verlusts eines Fotoalbums an Selbstmord dachten.
Aber das Seltsamste ist, dass uns die Prüfung oft genau dann ereilt, wenn uns das Glück sicher scheint. Mit der Präzision eines chirurgischen Angriffs.
Dabei würde man, wenn man sich die Zeit nähme, sich umzudrehen, die Welle schon von weitem anrollen sehen. Wie sie turmhoch auf uns zustürzt und anschwillt, wild entschlossen, über unsere Anlegerbrücken, die wackeligen kleinen Kais, auf die wir so stolz waren, hereinzubrechen und unsere Nussschalen mit einem Schlag zu zerschmettern, zu versenken oder auf ferne Inseln zuzutreiben.
Alles war in schönster Ordnung.
Und da starb Laurent.
Das Leben ist ein derart vorhersehbarer Fortsetzungsroman. Man weiß genau, was einen in der letzten Folge der letzten Staffel erwartet. Woher nimmt man nur die Unschuld, sich darüber noch zu wundern?
Ich hätte mir denken müssen, dass Laurent eines Tages sterben würde. Dieser schlechte Scherz wird recht häufig gemacht, vor allem ab einem bestimmten Alter.
Aber alles Wissen nützte mir nichts, ich war nicht darauf gefasst.
Laurent und ich waren über zehn Jahre lang Nachbarn gewesen, bevor ich in die Hauptstadt zurückzog, um mich ein paar lange Jahre, denen unser Hauskauf glücklicherweise ein Ende gesetzt hat, wie ein Stück Lachs räuchern zu lassen.
Ich habe ihn kennengelernt, als ich bei ihm nebenan einzog. Ich hatte gerade die Hälfte einer ehemaligen Postkutschenstation gemietet, mitten in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen war und in die ich in einem trennungsbedingten Anfall nostalgiegetönter Regression zurückkehrte.
Dank frisierter Unterlagen konnte ich die Eigentümerin überzeugen, dass ich der ideale Mieter war. Wären ihr meine Bankprobleme bekannt gewesen, hätte sie mich mit dem Besen hinausgejagt. Vade retro, Illustrator. Ein Künstler? Nicht bei uns.
Als mich Laurent eines schönen Morgens aufkreuzen sah, lag genauso viel Liebe in seinem Blick wie in dem von Clint Eastwood, wenn er in Gran Torino seine Hmong-Nachbarn sichtet. Dabei hatte ich nicht vor, ihm sein Auto zu klauen, und außerdem hatte er gar keins.
Er war über fünfzig, und man spürte, dass er eine Menge erlebt hatte. Ich war Anfang dreißig, Prune hatte sich noch nicht mein Herz unter den Nagel gerissen und ihre Koffer in meinen Flur gestellt, und ich schlug mich seit über sieben Jahren mehr schlecht als recht durch, auch wenn ich schon zwei Comics veröffentlicht hatte.
Zwei hübsche kleine Achtungserfolge, wie man Bücher zu nennen pflegt, die sich nicht verkaufen.
Ich kleidete mich sehr schlicht, fast ein bisschen mormonisch. Ich trank nur Wasser, oder zumindest fast (ich stelle mich gern in einem günstigen Licht dar). Von uns beiden sah eher Laurent verwegen aus wie ein Comic-Zeichner: Pferdeschwanz, Stirnglatze, enge Lederhose um die langen, mageren Beine, Lederjacke, spitze Stiefel – beschlagen, wie es sich gehört – und Dreitagebart.
Ich hatte gerade einen ausbeuterischen Vertrag mit einer neuen Zeitschrift unterschrieben, die mich mit einem Comicstrip mit wiederkehrenden Helden beauftragt hatte, Zielgruppe: Jungs von acht bis dreizehn. Mit anderen Worten, von den letzten Chupa Chups bis zu den ersten Wichsorgien. Da würde ich breit streuen müssen.
Laurent und ich sahen uns manchmal durch die Gartenhecke hindurch. Ein Kopfnicken, wenn er auf der Treppe vor seiner Haustür Zeitung las, auf der Stufe unter sich ein Glas, und ich zu Vampirzeiten aus meiner Höhle kroch, um im einzigen verrauchten Pub der Stadt etwas Luft zu schnappen. Die übrige Zeit blieb ich zu Hause, zog die Vorhänge zu und schwitzte pausenlos über meinen Aquarellen und Tuschzeichnungen, um mich nicht ganz meinem Liebeskummer zu ergeben.
Eines windigen Morgens, als ich meinen Fiat 127 aufschloss, entglitten mir die letzten Seiten, die ich der Zeitschrift liefern wollte, und da stand er plötzlich vor mir. Er war lieber durch unsere Hecke geschlüpft, statt außenrum über die Straße zu gehen. Aber die Hecke war löchrig, und ich konnte seine Hilfe brauchen. Er half mir, meine Blätter aufzusammeln, die schon über den ganzen Weg verteilt waren, dann hockte er sich wortlos hin, die Lippen fest um eine gelbliche Kippe geschlossen, und legte sie zu willkürlichen Stapeln zusammen, wobei er sie in aller Ruhe studierte.
Schließlich stand er wieder auf, drückte mir seine Ausbeute in die Hand und fragte: »Machst du das alles?«
»Ja«, sagte ich mit einigem Stolz auf meine jüngste Produktion. »Gefällt es Ihnen?«
»Nicht besonders, nein. Fängst du gerade an?«
Laurent war immer mörderisch ehrlich.
Noch am selben Abend habe ich ihn gezeichnet, um mich abzureagieren.