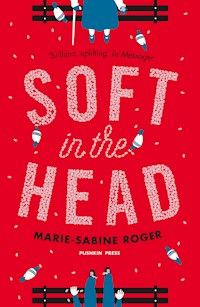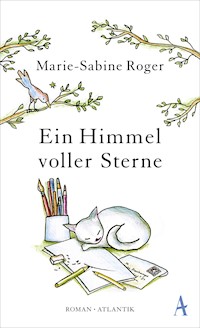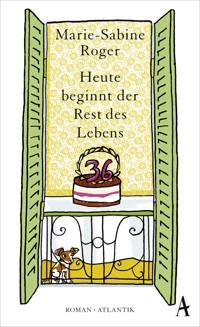10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
»Das Glück wird sich wenden, das heißt es wird mir endlich lachen, statt mich mit verschränkten Armen zu ignorieren.« Harmonies Leben ist alles andere als harmonisch. Die junge Frau hat Tourette, ihre vulgären Ausbrüche machen ihr das Leben schwer. Doch sie hat sich vorgenommen, sich aus der Abhängigkeit von ihrem Freund zu befreien und sich endlich einen Job zu suchen. So begegnet sie der ängstlichen älteren Dame Fleur, die außer ihrem russischen Therapeuten und ihrem übergewichtigen Hündchen jedem misstraut. Nichts spricht dafür, dass aus den beiden Freundinnen werden könnten. Doch als Fleur Harmonie versehentlich den Arm bricht, geschieht genau das. Gemeinsam entdecken sie die Welt, den Stepptanz und ein selbstbestimmtes, lustvolles Leben. Ein warmherziger, humorvoller Roman über die Macht der Freundschaft und das Geschenk gegenseitiger Toleranz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Ähnliche
Marie-Sabine Roger
Wenn das Schicksal anklopft, mach auf
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
Atlantik
1Kleinanzeige
Ich finde die Anzeige an einem Freitag am schwarzen Brett des Lebensmittelladens, wo ich auf Diegos Rat hin nachschaue, ob nicht zufällig jemand den Regenschirm wiedergefunden hat, den ich am Dienstag verloren habe, das heißt vor drei Tagen, was leicht zu erinnern ist, weil es seitdem nicht geregnet hat und ich sonst nirgendwohin gegangen bin. Umso leichter, als ich noch am selben Tag, eben letzten Dienstag, zurück in den Laden gegangen bin, um zu schauen, ob ich meinen Regenschirm nicht dortgelassen hatte, was logisch erschien, da er nicht bei mir zu Hause war.
Wu-Hu-Ha-Ha.
Montag, 26. Juni, 16:38 Uhr
Um 18 Uhr 15 bin ich mit der jungen Frau verabredet, die wegen der Anzeige angerufen hat. Leider ist mir erst nach dem Telefongespräch eingefallen, dass ich sie nicht mal nach ihrem Namen gefragt habe. Wie dumm von mir und wie unaufmerksam! Ich habe mich nicht getraut, sie zurückzurufen. Ich habe mir heftige Vorwürfe gemacht, auch wenn ich eine gute Entschuldigung habe, telefonieren ist für mich wirklich sehr anstrengend. Doktor Borodine würde mich zu der Art von Übung ermuntern, da bin ich mir sicher. Und er hätte gewiss recht. Trotzdem, wenn ich es vermeiden kann, mich in mir verhasste Situationen zu bringen, dann tue ich es. Therapie hin oder her.
Ich weiß nicht, wie die junge Frau mein mangelndes Interesse wohl gedeutet hat. Ich möchte in ihren Augen nicht als eine dieser arroganten Personen dastehen, für die eine Haushaltshilfe so austauschbar ist, dass man ihren Namen nicht zu kennen braucht.
Zumal sie einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht hat, auch wenn sie manchmal etwas schwer zu verstehen war. Aber das ist das Übel des Jahrhunderts: Die Leute artikulieren nicht mehr. Sie artikulieren überhaupt nicht mehr. Sogar Schauspieler nuscheln heutzutage, es ist unglaublich. Dabei ist es doch das Mindeste, was man von einem Schauspieler erwarten kann, dass er deutlich spricht, oder? Aber nein, man könnte meinen, dass manche beschlossen haben, sich nur noch in Vokalen und Wortfetzen auszudrücken. Noch schlimmer ist es bei den jungen Sängern: Die einen schreien sich ohne erkennbaren Grund die Lunge aus dem Hals, die anderen flüstern ins Mikro, wieder andere scheinen es abzuschlecken wie ein Eis in der Tüte, unmöglich jedenfalls, den Text zu verstehen. Abends in meinem Sessel neige ich mich immer weiter dem Fernseher entgegen, bis ich fast umkippe wie eine alte Tanne, die Ohren gespitzt im vergeblichen Versuch, die Worte von den Lippen abzulesen.
Nun ja, ich nehme an, es ist an mir, mich anzupassen, denn die Chancen stehen natürlich schlecht, dass die Gesellschaft sich ihrerseits ändert, um es mir recht zu machen.
Wie Josiane sagen würde, »man muss sich weiterentwickeln« – wenn man davon ausgeht, dass es eine Weiterentwicklung darstellt, in einer Welt zu leben, in der die Leute sich nur noch fetzenweise verstehen, wenn sie überhaupt miteinander reden. Wie dem auch sei, das ist die Realität, die Leute strengen sich kein bisschen mehr an, um sich verständlich zu machen.
Josiane würde sagen, ich sei eben taub, und tatsächlich beweist nichts, dass sie sich irrt.
Nein, das Einzige, was mich in dem Gespräch mit der jungen Frau – ich sage jung, aber letztlich weiß ich es nicht, ich schließe das nur aus ihrer Stimme – unangenehm berührt hat, ist ein belangloses Detail, das ich aber doch vermerken muss, denn ich soll ja, gemäß den sehr klaren Weisungen von Doktor Borodine, meine Tage schildern, ohne irgendetwas auszulassen (oder jedenfalls so wenig wie möglich).
Also, was mich gestört hat: Während diese junge Frau und ich uns unterhielten, hörte ich ab und zu ihren Hund in den Hörer bellen. Mit einer hohen Stimme, wahrscheinlich eine kleine Rasse. Um zu bestimmen, welche, hätte ich ein besseres Gehör gebraucht, wie Josiane bemerkt hätte, die keine Gelegenheit auslässt, meine Schwächen hervorzuheben. Malteser, King Charles Spaniel, Jack Russel, Coton de Tuléar? Es war fast das Timbre von Mylord, wobei Mylord nie derart hartnäckig insistieren würde. Obwohl ich zugeben muss, dass er manchmal stur ist, mein herzallerliebster kleiner Buddha. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt er auf seinem Kissen und schaut mich unschuldig an, die Schnauze auf die Vorderpfoten gebettet. Man möchte schwören, er weiß, dass ich von ihm rede. (Natürlich weiß er das. Ohne jeden Zweifel.)
Ich habe nichts gegen Hunde, ganz im Gegenteil, sonst hätte ich ja Mylord nicht adoptiert (wenn es nicht umgekehrt war. Ich habe es immer so gesehen, dass er mich auserwählt hat). Aber nur weil man seine Kinder liebt, ist man nicht unbedingt bereit, die der anderen zu ertragen, zumal sie selten so gut erzogen sind wie die eigenen. Ich kenne das nur vom Hörensagen, ich habe keine Kinder, das ist eine der wenigen Prüfungen, die mir erspart geblieben sind. Kurz und gut, es kommt nicht infrage, dass irgendein dahergelaufener Köter die Ruhe meines Fröschleins stört. Mylord ist tolerant, aber er ist genauso hochsensibel wie ich. Ich wage mir nicht auszumalen, was er empfinden würde, wenn diese junge Dame, mit den aggressiven Düften eines unbekannten Zerberus behaftet, zu uns käme, was für mich wahrscheinlich nicht wahrnehmbar wäre (hoffentlich zumindest!), für Mylord mit seiner feinen Nase jedoch eine wahre Provokation darstellen würde.
Ich habe mich nicht getraut, die junge Frau zu fragen, was sie mit ihrem Hund zu tun gedenke, wenn sie zu mir käme. Für mich liegt es auf der Hand, dass man anderen Leuten sein Haustier nicht aufdrängt, aber gute Erziehung ist nicht allgemein verbreitet, bei weitem nicht, die Erfahrung mache ich leider oft genug. Neulich erst hat sich eine junge Dame in der Apotheke vorgedrängelt, unter dem Vorwand, sie sei schwanger. Ich weiß wirklich nicht, wo das Problem war: Sie stand offensichtlich nicht kurz vor der Niederkunft, sie wirkte im Gegenteil frisch und munter, während ich trotz drei Serenix und einem halben Placidon Höllenqualen litt. Ich hatte derartige Angstzustände, dass ich nie einen Schritt vor die Tür gegangen wäre, wenn mir nicht ausgerechnet an dem Tag das Zenocalm ausgegangen wäre. Und das Schlimmste war, dass die Apothekenhelferin, als ich (nur ganz schwach) protestiert habe, leichthin – oder vielmehr etwas unverschämt – geantwortet hat, es würde nur eine Minute dauern, um sodann eilfertig diese junge Person zu bedienen, ohne mich weiter zu beachten.
Ich will nicht egoistisch erscheinen und auch nicht alles auf mich beziehen, aber ich fand das ziemlich respektlos, immerhin kaufe ich seit über fünfzig Jahren in dieser Apotheke ein. Früher, zu Monsieur Pradals Zeiten, hätte es so etwas nicht gegeben. Das war noch ein echter Apotheker, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübte. Ich will ja nicht überkritisch sein, aber die jungen Leute, die den Laden übernommen haben, sind nichts als Krämer. Seit sie die Apotheke erworben haben, geht es dort zu wie im Supermarkt, und wenn sich alles nur noch um den Profit dreht, fällt der Service natürlich hinten runter, von Notfällen ganz zu schweigen.
Das ist vielleicht eine Abschweifung, aber da ich aufschreiben soll, was mir wichtig erscheint, wollte ich dieses Beispiel anführen. Das wäre übrigens ein gutes Gesprächsthema mit Doktor Borodine: Wer ist denn der echte Notfall, die gesunde junge Frau, die nur ein bisschen schwanger ist, oder die Patientin, die wie ich krank, alt und in medikamentöser Behandlung ist und kurz vor einer Panikattacke steht? Ich wäre wirklich neugierig, seine Meinung dazu zu erfahren. In der Zwischenzeit frage ich mich, ob ich nicht einfach abwandern sollte, wie Josiane sagen würde, und mich in der Delgado-Apotheke eindecken, neben der Post. Seit sie die Fußgängerbrücke eröffnet haben, ist der Weg dorthin für mich kaum weiter.
Kurz und gut, zurück zur Sache, ich habe mich also nicht getraut, die junge Frau zu fragen, was sie an den Tagen, an denen sie zu mir kommen würde, mit ihrem Hund zu tun gedenke. Wenn wir uns überhaupt einig werden, denn bis jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, ist noch nichts entschieden. Ich habe mich geärgert, dass ich ihr die Frage nicht gestellt habe, aber da ich sie ja auch nicht nach ihrem Vornamen gefragt hatte, habe ich mich nicht getraut, sie zurückzurufen. Mit dem Ergebnis, dass ich seit diesem Gespräch zweifle und unaufhörlich daran denke. Zweifeln ist nicht gut für mich, die Frage verfolgt mich. Doktor Borodine würde mir raten, mich nicht darin zu verbeißen, was leichter gesagt ist, als getan. Entweder man ist ein Zwangscharakter oder nicht. Und ich bin einer, ihm zufolge, auch wenn diese Diagnose mich wundert. Aber ich habe blindes Vertrauen zu diesem Mann. Trotzdem, »Zwangscharakter« finde ich etwas heftig. Ich würde diesen Charakterzug eher als Beharrlichkeit bezeichnen: Wenn ich eine Idee habe, halte ich daran fest, das ist alles. Es sei denn, meine Idee hält mich fest? Unglaublich, wie ich unablässig über mich selbst nachdenke, seit ich zu Doktor Borodine gehe. Jedenfalls kommt es nicht infrage, dass ein anderer Hund die Wohnung betritt, das steht fest. Von einer Hündin ganz zu schweigen. Mylord weiß nicht einmal, dass es Weibchen gibt (ich habe ihm jede Konfrontation mit dem anderen Geschlecht erspart), und ich habe nicht vor, das Risiko einzugehen, ihm ihre Existenz mit dreizehneinhalb Jahren zu offenbaren, vor allem in seinem Zustand. Seine Chancen wären viel zu mager und der Schock zu heftig.
Ich bin besorgt, das ist es. Besorgt. Ich werde mit Doktor Borodine darüber reden müssen.
Über einen Monat habe ich gebraucht, um mich zu dieser Anzeige durchzuringen, und jetzt, wo ausgemacht ist, dass diese Person, deren Namen ich nicht kenne (und warum nicht, dumme Kuh?), am heutigen Montag zu mir kommen wird, fühle ich mich wie in einer Falle, die Aussicht darauf ängstigt mich im höchsten Maß. Doch ich habe keine Wahl, ich brauche jemanden, es geht nicht anders. Seit bald vier Jahren gehe ich ein- bis zweimal in der Woche für zwei Stunden aus dem Haus, je nach meinen Terminen, wie ich es in der Anzeige erklärt habe, aber ich kann Mylord seit seinem Herzanfall nicht mehr alleinlassen, obwohl er mich vorher immer gern begleitet hat und die ganze Stunde lang brav im Wartezimmer sitzen blieb, mein armes Baby.
Um ehrlich zu sein – und das bin ich immer, aus Prinzip, denn ohne eine einwandfreie Moral kann nichts Gutes entstehen –, muss ich zugeben, dass ich nie selbst darauf gekommen wäre, in einer Anzeige nach einer Putzfrau zu suchen. Josiane hat mir die Augen geöffnet über die Risiken, die ich eingehen würde, wenn ich meine Wohnung regelmäßig, wenn auch nur kurz, leer stehen ließe, denn das würde einem einigermaßen geschickten und erfahrenen Einbrecher, der meinen Wochenablauf beobachtet hätte, genügen. Ganz zu schweigen von dem armen Mylord, der sich selbst überlassen bliebe. Nicht dass Josiane misstrauisch wäre, aber sie ist nicht gutgläubig. Ich weiß nicht viel über das Leben, das merke ich immer wieder. Josiane ist viel gescheiter als ich, das ist sicher, und so befolge ich ihre Ratschläge fast ebenso blind wie die von Doktor Borodine.
Ihre Idee kam mir jedenfalls nicht so schlecht vor, sie würde mich vor eigennützigen oder zwielichtigen Gestalten bewahren. Wenn ich offen einen Hundesitter für zu Hause suchte, könnten skrupellose Menschen meine Gutherzigkeit ausnutzen, um mir wer weiß was abzuluchsen. Wer Tiere liebt, liebt auch die Menschen, das ist allgemein bekannt, selbst wenn ich diese Erfahrung nicht persönlich gemacht habe.
Zu behaupten, ich suchte eine Putzfrau, kam mir zwar unehrlich vor, denn das war ja nicht der tatsächliche Grund meiner Anzeige, und ich lüge nicht gern, aber Josiane hat mich davon überzeugt, dass Lügen manchmal notwendig sind und dass im Übrigen nicht wirklich von Lüge oder Schwindel die Rede sein könne, solange es glaubwürdig sei.
Denn letztlich, wie sie so schön sagt – auch wenn ich finde, dass sie ein bisschen übertreibt –, könnte eine Frau meines Alters und meiner Leibesfülle auf jeden Fall eine punktuelle und zugleich regelmäßige Hilfe gebrauchen.
Kann man sagen, dass etwas zugleich »punktuell« und »regelmäßig« ist? Ich werde das Problem Doktor Borodine bei unserem nächsten Termin unterbreiten, das wird ein guter Einstieg sein. Ich komme gerne mit Fragen zu ihm. Diskussionen sind nicht meine Stärke, Scherze, Bonmots, Wortwechsel liegen mir nicht, ich habe nicht Josianes Talent, tausend amüsante und fast immer neue Anekdoten zu erzählen, ich bin keine Stimmungskanone. Natürlich gehe ich nicht zu Doktor Borodine, um Konversation zu machen; wir sprechen über meinen Fall. Das heißt, vor allem ich spreche darüber, ungefähr zehn Minuten lang, was normal ist, denke ich. Doktor Borodine macht sich dabei Notizen in ein großes schwarzes Heft (ich habe fast das gleiche im Zeitungsladen der Rue Montlajoie gefunden und nehme seitdem nur noch dieses Modell, das gibt mir ein angenehmes Gefühl von geheimem Einverständnis). Ich rede also von mir, bis Doktor Borodine den Moment für gekommen hält, um seinen Kugelschreiber wegzulegen, meinen Sessel in die Entspannungsposition zu bringen, Musik anzumachen und vorzugehen wie gewohnt, und dann breitet sich Wohlbehagen in mir aus.
Manchmal (der Ablauf ist nicht immer gleich) kommen wir am Ende der Sitzung auf eine bestimmte Frage zurück oder auf meine allgemeinen Gefühle in Bezug auf die vergangene Woche. Doktor Borodine nennt das ein »Debriefing«, und wenn er diesen Begriff gebraucht, fühle ich mich immer wie die Heldin eines Spionagefilms.
Tatsächlich trägt alles zu dieser romantischen Illusion bei (Doktor Borodine denkt sicher, dass ich eine Menge »romantische Illusionen« habe): die gedämpfte Atmosphäre seiner Praxis, das sanfte Licht, die orientalische Musik im Hintergrund, der schwere Räucherstäbchenduft, die leise, sinnliche Stimme von Doktor Borodine, sein weicher slawischer Akzent. Wie soll man sich da nicht für eine Doppelagentin halten, die von einer geheimnisvollen, im Sold der Russen arbeitenden Organisation gefangen gehalten wird? Ich lache selber über meine Dummheiten. Ich schreibe wirklich Unsinn.
Trotzdem, ich wäre wirklich gern Spionin gewesen, glaube ich, wenn ich mutig und schlau wäre und nicht solche Schwierigkeiten hätte, aus dem Haus zu gehen. Ich erinnere mich nicht, schon einmal daran gedacht zu haben, Doktor Borodine davon zu erzählen. Vielleicht würde das meine Persönlichkeit in ein neues Licht rücken?
Frage: Kann man Geheimagentin werden, wenn man unter Agoraphobie leidet?
Montag, 26. Juni, 17:07 Uhr
Dieses Treffen beunruhigt mich. Ich komme darauf zurück, während mein Kräutertee zieht, denn der Gedanke daran verfolgt mich, und Doktor Borodine war in diesem Punkt sehr entschieden: Ich muss Fragen, die mich verfolgen, unbedingt loswerden. Und dazu muss ich sie aufschreiben. Wie er so oft sagt: »Schreiben Sie, schreiben Sie. Das Schreiben erlaubt es Ihnen, etwas von Ihrer Last abzuladen, liebe Madame Suzain.«
Ich hatte mein Heft an seinen Platz unter dem Foto von Mylord auf meinem Nachttisch zurückgelegt und mich wieder an mein Kreuzworträtsel gemacht (elf Buchstaben mit einem n an fünfter Stelle: Will Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ohne im Mittelpunkt zu stehen), aber ich habe es nicht ausgehalten, ich musste weiterschreiben.
Die Besorgnis wirkt auf mich wie ein Insektenstich, zuerst ist da fast nichts, dann wird es deutlicher, es kratzt, es juckt, breitet sich allmählich aus, am Ende würde man sich am liebsten die ganze Haut vom Leib reißen. Denken ist ein Juckreiz. Schreiben erleichtert mich.
Doktor Borodine hat recht: Sobald ich vor meinem Heft sitze, lade ich meine Last ab. Ich spüre, wie die Gedanken in meinem Kopf herumschwirren, manchmal sind sie so schnell, dass mir ganz schwindelig wird, aber ich muss nur anfangen zu schreiben, dann beruhigt und besänftigt sich alles, die Sätze stellen sich in Reih und Glied auf, so wie die Schüler früher, als ich klein war, bevor sie in ihre Klassenzimmer gingen.
Das Thema des Tages: Diese junge Frau wird in etwas über einer Stunde hier sein, und es gibt nichts, was ich mehr hasse, als wenn ein(e) Unbekannte(r) in meine Wohnung eindringt, da bekomme ich sofort das Gefühl zu ersticken und falle beinahe in Ohnmacht. Was tun?
Ich war schon immer ängstlich, das ist meine Konstitution (oder sollte ich sagen »mein Naturell«? Mir ist der Unterschied nicht ganz klar. Ich werde Doktor Borodine fragen.) Ich brauche eine Menge Zeit und Energie, um mich an ein neues Gesicht zu gewöhnen und keine Panik oder Bedrängnis mehr zu empfinden. Ich habe über zwei Jahre gebraucht, um mich an den neuen Hausmeister zu gewöhnen, Monsieur Bénévat (oder Bénavant oder Banévant, ich habe seinen Namen nicht genau verstanden, er murmelt mit starkem Dialekt in seinen Schnurrbart, und ich werde mich hüten, ihn noch mal danach zu fragen. Das wäre unhöflich, als Wohnungseigentümerin müsste ich ihn eigentlich kennen.) Zwei Jahre … Darauf bin ich nicht stolz. Noch länger habe ich gebraucht, um mich an den Briefträger zu gewöhnen. Allerdings kommt er zum Glück nur sehr selten. Und ich werde es nie wagen, irgendjemandem zu gestehen, wie lange ich gebraucht habe, um mich an die Gegenwart meines Mannes zu gewöhnen. Ich bin das, was man eine Agoraphobikerin nennt, oder, laut einiger der vielen Ärzte, die ich aufgesucht habe, eine Sozialphobikerin. Sie scheinen sich in diesem Punkt nicht einig zu sein, wie in vielen anderen. Das Einzige, worauf sie sich problemlos und in schönster Harmonie einigen können, ist ihr Honorar. Wie auch immer, dank Doktor Borodine habe ich große Fortschritte gemacht, denn ich wage es inzwischen, von meinen Schwächen zu reden. Viele Jahre lang habe ich jeden noch so winzigen oder unwahrscheinlichen Vorwand beim Schopf ergriffen, um mich nicht einladen zu lassen, nicht zu Feiern zu gehen, nicht mit Menschen zu verkehren. Ich hatte den Ruf, eine eingebildete Person zu sein, dabei bin ich das nun wirklich nicht. Jede fremde Gegenwart und jede soziale Verpflichtung belasten mich ganz furchtbar, ich habe das Gefühl, dass man mir die Luft zum Atmen nimmt, dass der Raum sich verengt, dass ich strohdumm bin und jeder meine Dummheit bemerkt, dann überkommt mich entsetzliches Unbehagen, verschärft durch die Gewissheit, dass ich bald unter entsetzlichen Qualen sterben werde. Für mich gibt es Ruhe und Frieden nur in der Einsamkeit – erklären Sie das mal jemandem!
Als Mylord seinen Herzanfall hatte, hätte ich es beinahe nicht geschafft, der Tierärztin die Tür aufzumachen, dabei lag mein armer Schatz röchelnd und mit herausquellenden Augen – was bei einem Mops sehr erschreckend ist – auf dem Teppichboden, und ich wusste nicht, wie ich ihm helfen sollte. Aber die bloße Vorstellung, eine Unbekannte in meine Wohnung zu lassen, versetzte mich in Panik, ich fühlte mich schrecklich, und als die Tierärztin schließlich geklingelt hat, habe ich zehn Minuten gebraucht, um mich dazu durchzuringen, ihr zu öffnen. Zehn Minuten!
Zum Glück hatte sie Geduld und einen wichtigen Anruf zu erledigen, während sie im Treppenhaus wartete.
Natürlich erzähle ich mir nichts Neues, indem ich das alles aufschreibe, denn ich kenne mein Leben ja schon. Ganz am Anfang meiner Therapie war ich von dieser Tagebuchgeschichte ehrlich gesagt nicht besonders überzeugt, ich verstand nicht, warum ich mich besser fühlen sollte, wenn ich mich derart entblößte. Trotzdem habe ich mich gezwungen, meine Gedanken aufzuschreiben, wie sie kamen, im Wissen, dass nie jemand außer mir sie lesen würde, denn ich kann mir nicht recht vorstellen, sie Mylord vorzulesen. (Das ist ein Scherz, der Josiane gefallen hätte. Sie Mylord vorlesen! Was bist du doch dumm, armes Ding!) An manchen Tagen würde ich gern darauf verzichten, aber dann ist mir, als würde ich Doktor Borodines Stimme hören, in diesem etwas strengen, väterlichen Ton, den er anschlägt, wenn er mit mir schimpfen muss: »Schreiben Sie alles auf, Madame Suzain! Schreiben Sie alles auf, Ihre Ängste, Ihre Träume, Ihre Fragen, Ihre Stimmungsschwankungen, all Ihre geheimsten Gedanken, all die Gefühle, die Ihre Seele bedrängen.«
All die Gefühle, die Ihrrre Seele bedrrrängen. Dieses gerollte R ist einfach zauberhaft. Und dieser Mann drückt sich so vollendet aus! Ihn sprechen zu hören ist ein Genuss. Ich würde mich gern an jedes seiner Worte erinnern, aber kaum hat die Sitzung begonnen, verfalle ich jedes Mal selig in einen seltsamen, etwas wattigen Zustand.
Ich werde Josiane nie genug dafür danken können, dass sie mir seine Adresse gegeben hat. Ohne sie hätte ich Doktor Borodine nie kennengelernt. Ich weiß nicht, was dann aus mir geworden wäre.
Ich schreibe also seit einiger Zeit mein Leben auf, ich bin schon beim dritten Heft, und zu meiner großen Überraschung muss ich sagen, dass diese Tätigkeit mich mehr und mehr entspannt. Es sieht so aus, als fände ich Geschmack daran.
Exzentrisch. Endlich habe ich das Wort mit den elf Buchstaben gefunden! »Will Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ohne im Mittelpunkt zu stehen: exzentrisch.«
Um auf diese junge Frau zurückzukommen, ich hätte ja Josiane gefragt, ob sie Mylord hüten könnte, während ich bei Doktor Borodine bin, schließlich hat sie ihn mir empfohlen. Aber einerseits hätte ich sie nicht damit behelligen wollen, und andererseits, und das ist der Hauptgrund, ist sie vor über sechs Monaten weggezogen. Sie lebt jetzt bei Cannes in einer Luxusresidenz für Senioren. Sie kann es sich leisten, muss man sagen. Als Rosario nach nur acht Ehejahren gestorben ist – manche haben eben Glück –, hat er ihr ein solches Vermögen hinterlassen, dass sie angesichts ihres Alters nicht genug Zeit haben wird, es durchzubringen, so verschwenderisch sie auch sein mag.
Sie hat mir angeboten, sie einmal dort zu besuchen, was sehr liebenswürdig von ihr ist. Natürlich werde ich es nicht tun. Außer, wenn sie mir in zehn Jahren nie wirklich zugehört hat – was durchaus möglich ist –, weiß Josiane, dass ich tausend Tode sterbe, sobald ich das Haus verlassen muss. Eine lange Zugfahrt und eine Nacht im Hotel sind für mich einfach undenkbar. Aber ihre Einladung hat mich doch gerührt. Schließlich verpflichtete sie nichts dazu.
Josiane ist eine treue Freundin, die einzige Freundin, die ich habe. Wir stehen uns sehr nahe, ich rufe sie jeden zweiten Mittwoch um 12 Uhr 15 an, direkt nach ihrem Mittagessen. Außer wenn Feiertag ist, versteht sich. Vor dem Mittagessen ist es zu früh, sie ist kein Morgenmensch. Und danach hat sie ihr Canasta. Sie sagt das so leichthin, »Ich habe mein Canasta«, als hätte sie ihr Leben lang gespielt. Wenn Rosario nicht beim Lotto die richtigen Kreuzchen gemacht hätte, würde sie mit ihrer mickrigen Rente immer noch in ihrer Wohnung im fünften Stock ohne Aufzug leben. Wohlgemerkt, ich bin nicht neidisch: Wenn ich so viel Geld gewonnen hätte, hätte ich nicht gewusst, was ich damit anfangen sollte. Ich habe mal eine Sendung über einen Milliardär gesehen, der jahrelang ganz oben in einem Turm gelebt hat, weil er panische Angst vor Bakterien und Krankheiten hatte. Es gibt schon komische Leute.
Kurz, mir scheint, reich zu sein ist nur dann interessant, wenn man es ein bisschen zeigen kann. Gutes tun, zum Beispiel, wie dieser andere amerikanische Milliardär (ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber jeder kennt ihn), der sein Geld für lauter gute Zwecke verschwendet.
Wenn ich reich wäre, würde ich auch gern für einen guten Zweck spenden, wenn ich dafür ein bisschen Anerkennung bekäme. Für einen humanitären Zweck, genau! Ich hätte zum Beispiel sehr gern ein Krankenhaus mit meinem Namen. Die Leute würden sagen: »Lässt du dich im Suzain-Krankenhaus operieren? Recht hast du, das ist eine sehr gute Einrichtung.«
Nun ja, das sind alles Träume.
Alles Träume.
Wie wär’s, wenn ich auf den Grund meiner Besorgnis zurückkäme, statt vom Hundertsten ins Tausendste zu geraten?
Nachdem ich also im Lebensmittelladen die Anzeige ans Brett gepinnt hatte, fühlte ich mich fiebrig, zutiefst beunruhigt und sogar aufgewühlt. Ja, aufgewühlt, das ist das richtige Wort. Ich fragte mich, was nur in mich gefahren war, einen solchen Wahnsinn zu wagen. Ich bin manchmal wirklich lächerlich … Ich wäre fast zurückgegangen, um die Anzeige wieder abzuhängen, und musste einen furchtbaren Kampf gegen mich selbst durchstehen. Eine große Hilfe war mir dabei der Umstand, dass ich schon wieder in der Wohnung war, und am selben Tag ein zweites Mal hinauszugehen hätte meine Kräfte überstiegen. Ein- oder zweimal in der Woche, das ist mein Rhythmus, denn seit vier Jahren erledige ich meine Einkäufe immer auf dem Rückweg von Doktor Borodine.
Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Aber trotzdem, der Gedanke an diese Anzeige, die ich gerade vor aller Augen aufgehängt hatte, verstörte mich derart, dass ich meine Zenocalm-Dosis verdoppeln musste und mitten in der Nacht ein zweites Noctisom nahm, was selten vorkommt. Ich habe es Doktor Bodrodine bei meinem nächsten Termin gestanden, ich verheimliche ihm nichts. Im Übrigen bin ich mir sicher, dass er es merken würde, wenn ich ihm etwas verheimlichen wollte. Dieser Mann liest in mir wie in einer Kristallkugel, auch wenn ich, während ich das schreibe, finde, dass es nicht sehr schmeichelhaft ist, mich mit einer Kugel zu vergleichen, und sei sie aus Kristall. Ich habe dieses zweite Noctisom also Doktor Borodine gestanden. Er hat mich scharf angesehen, mit dem Zeigefinger gewackelt, wie um »nein, nein, nein« zu sagen, und geschimpft, diese Pillen werfe man nicht ein wie Erdnüsse, bevor er von sich aus hinzufügte, dass der Ausdruck schlecht gewählt sei, weil man Erdnüsse natürlich nicht »einwerfe«.
»Sonst würden eine Menge Leute daran ersticken!«, hat er noch hinzugefügt und gelacht, und wenn er lacht, geht mir sein schelmischer Blick durch und durch. Würrrden eine Menge Leute darrran errrsticken …
Es ist 17 Uhr 20, ich muss mich für das Treffen mit der jungen Frau bereitmachen.
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie pünktlich sein wird. Ich habe gestern und den ganzen heutigen Vormittag Großputz gemacht. Sie soll nicht denken, dass ich eine Putzfrau nehme, weil ich nicht in der Lage bin, selbst aufzuräumen und zu putzen. Man muss immer einen guten Eindruck machen, vor allem, wenn es der erste ist. Und ich bin noch sehr agil, was Josiane und Doktor Borodine auch sagen mögen, die völlig auf mein Gewicht fixiert sind.
Aber ich erwidere jedes Mal, wenn das Thema wieder aufs Tapet1 kommt: Etwas Übergewicht schließt weder Wendigkeit noch Vitalität aus, da braucht man sich nur die Sumo-Ringer anzuschauen.
Ich hoffe, der Geruch nach dem Hund dieser jungen Frau wird meinem Mylord nicht zu sehr zusetzen. Er ist seit seinem Herzanfall so anfällig geblieben, mein süßer Kurzhaarbonsai, meine kleine Liebeskröte. Jede Kleinigkeit verstört oder reizt ihn.
Am Abend seines Anfalls hat mir die Tierärztin gesagt, es wäre sehr knapp gewesen, er würde jetzt viel Ruhe brauchen, und vor allem – das hat sie stark betont – müsse er dringend abnehmen.
Sie hat mich dabei auf eine Art angeschaut, dass ich mich mitgemeint gefühlt habe, und natürlich haben daraufhin meine Finger sofort zu kribbeln begonnen, mein Mund wurde trocken, meine Hände verkrampften sich in Pfötchenstellung, meine Ohren fielen zu, mein Sichtfeld verengte sich wie in einem Tunnel, und da habe ich sie etwas plötzlich zur Tür gebracht, muss ich gestehen, denn ich hatte nicht die geringste Lust, in ihrer Gegenwart einen Tetanie-Anfall zu bekommen.
Es stimmt schon, dass ich ein bisschen abnehmen müsste.
Aber so schlimm ist es auch wieder nicht.
Ich finde die Anzeige an einem Freitag am schwarzen Brett des Lebensmittelladens, wo ich auf Diegos Rat hin nachschaue, ob nicht zufällig jemand den Regenschirm wiedergefunden hat, den ich am Dienstag verloren habe, das heißt vor drei Tagen, was leicht zu erinnern ist, weil es seitdem nicht geregnet hat und ich sonst nirgendwohin gegangen bin. Umso leichter, als ich noch am selben Tag, eben letzten Dienstag, zurück in den Laden gegangen bin, um zu schauen, ob ich meinen Regenschirm nicht dortgelassen hatte, was logisch erschien, da er nicht bei mir zu Hause war.
Wu-Hu-Ha-Ha.
Die Dunkelhaarige, die auch bei schönem Wetter immer einen Flunsch zieht, antwortet mir dreimal nein, weil ich ihr die Frage auch am Mittwoch und am Donnerstag noch mal stelle. Bis zu diesem Freitag, an dem Diego der Chef mir auch nein antwortet, aber in freundlichem Ton, nachdem er mich beiläufig gebeten hat, nicht zu nah an die Gemüseauslage ranzugehen, weil die ein bisschen wackelig ist, und bevor er hinzufügt: »Hast du schon am schwarzen Brett nachgeschaut? Mach das mal. Wenn ich du wäre, würde ich da nachschauen, man weiß ja nie! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.« Ich traue mich nicht, ihm zu antworten, wenn er ich wäre, wie er gerade gemeint hat, dann wäre sein Leben so was von anders, das kann er sich gar nicht vorstellen, ich habe schon lange aufgehört, solche fruchtlosen Diskussionen vom Zaun zu brechen. Wenn ich die Perspektive von all denen, die ihre Sätze mit »Wenn ich du wäre« beginnen, geraderücken wollte, bräuchte ich mehr Stunden am Tag, mehr Tage im Monat, mehr Monate im Jahr, mehr als ein einziges Leben. Bis zum Beweis des Gegenteils ist außer mir niemand ich, und wenn man die Plätze tauschen könnte, würde sicher niemand Schlange stehen, um meinen zu übernehmen. Ich verzichte also auf eine Diskussion und gehe die Kleinanzeigen studieren. Diego ruft mir noch nach: »Pass auf den Obst- und Gemüsewagen auf, vor allem auf die Melonen bitte, ich habe eine Stunde geschwitzt, um sie so aufzuschichten, der Stapel ist nicht sehr stabil.« Ich mache ein Zeichen, dass es okay ist, zwischen all meinen anderen Zeichen und meinen Wu-Hu-Ha-Has.
Ich lese also die Kleinanzeigen, obwohl ich bei mir denke, wie man in alten Romanen sagt, falls eine Kundin meinen Regenschirm zwischen den Konservendosen oder Milchtüten gefunden hätte, hätte sie ihn sicher an der Kasse abgegeben, statt ihre Zeit für eine Anzeige zu verschwenden. Wer würde sich die Mühe machen, für einen Regenschirm eine Annonce zu hinterlassen, es sei denn Wu-Ha er oder sie wollte Finderlohn dafür so wie manche für einen Hund oder eine Katze, völlig absurd, es gibt tatsächlich Leute, die eine Belohnung verlangen, weil sie eine Katze gefunden haben Ta Tadaaa ich weiß, es scheint idiotisch, Kleinanzeigen zu studieren, um einen Regenschirm wiederzufinden, wenn man weiß, was so ein Ding kostet, vor allem made in China, aber meiner ist nicht made in China Ha er stammt aus dem Haus Piganiol in Aurillac. Und vor allem habe ich ihn von meiner Mutter geerbt, die ihn von Oma Paula hatte, die ihn wiederum von Uroma Albertine hatte, nicht aus Sparsamkeit, sondern als Familienandenken. Und ja, ich weiß, es ist nur ein Regenschirm, wie Freddie so schön gesagt hat: »Du wirst dir doch nicht von einem Regendeckel an der Leber fressen lassen, Schätzchen!« Ich frage mich, wo er solche Ausdrücke hernimmt. An der Leber fressen. Regendeckel. Außer Freddie, der siebenunddreißig ist, redet kein Mensch mehr so, außer vielleicht Hundertjährige. Klar, es ist nur ein Regendeckel, aber ich kenne ihn schon mein Leben lang, er ist schön er ist groß er ist stabil, mit einem weichen Griff aus Ahorn und feinen Speichen aus Binsen, wir haben ihn mehrmals neu bespannen lassen, zweimal meine Mutter, einmal ich, und es ist gar nicht einfach, jemanden zu finden, der das noch kann, ich habe eine ganze Weile gesucht. Und er hat meiner Mutter gehört, die vor drei Jahren gestorben ist Ta Ta Ta sie fehlt mir in jedem Augenblick meines Lebens, vor allem an den Tagen, an denen es mir schlecht geht Ta Tadaaa das heißt an den meisten, dieser Regenschirm ist nicht irgendein gewöhnlicher Gebrauchsgegenstand, sondern tatsächlich eine Verlängerung meiner selbst, der mir zwar vor allem bei Regen dient, okay, aber trotzdem. Er hat mir gedient, der Beweis ist, dass ich ihn tatsächlich verloren habe. Dieser Regenschirm ist meine Kindheit und meine Mutter zugleich, er ist die Materialisierung ihrer beruhigenden Gegenwart, er beschützt mich beschützte mich, es gibt nichts Schmerzlicheres, als in der Vergangenheitsform von Dingen reden zu müssen, an denen man hing, vor allem wenn sie einen an Menschen erinnern, an denen man noch mehr hing. Ganz generell ist nichts schmerzlicher, als in der Vergangenheitsform reden zu müssen, außer wenn es sich um schlechte Erinnerungen handelt, und in dem Fall wäre es am besten, überhaupt kein Gedächtnis zu haben. Ich habe diesen Regenschirm gekannt, solange ich auf der Welt bin, also nicht seit Urzeiten, wie Freddie sagen würde, weil ich in einem Monat erst neunundzwanzig werde, und mein ganzes Leben im Vergleich zu dem von Jeanne Calment mit ihren hundertzweiundzwanzig Jahren keine besondere Leistung ist, aber es war doch mein Regenschirm, und ich hänge daran, auch wenn Freddie sagt, ich sei damit echt eine Gefahr für die Öffentlichkeit Wu-Hu-Ha und für die Leute aus der Nachbarschaft wäre es eine gute Nachricht, wenn ich ihn ein für alle Mal verloren hätte. Worauf ich ihm antworte, dass die Leute, die mir entgegenkommen, sowieso sehr schnell kapieren, dass sie besser die Straßenseite wechseln sollten, wenn sie ein Mindestmaß an Beobachtungsgabe haben, und im Übrigen tun sie das auch oft ganz spontan, vor allem, wenn sie mir vorher schon mal begegnet sind, weil.
Am schwarzen Brett hängt jedenfalls keine einzige Anzeige, in der von einem Regenschirm die Rede wäre, es bricht mir das Herz. Es ist der einzige alte Gegenstand, den ich besitze, zusammen mit einer Goldkette, die Mama mir zwei Wochen vor ihrem Tod gegeben hat, als hätte sie etwas geahnt. Eine sehr hübsche Kette, nur der Verschluss ist kaputt, und ich habe kein Geld, um ihn reparieren zu lassen. »Man sollte sein Herz nicht an materielle Dinge hängen, mein Schatz«, sagt Freddie oft, wenn er mich das Leben lehren will, »man sollte sein Herz an nichts hängen, was man verlieren kann. Eigentum ist die Quelle allen Unglücks, jeder Besitz trägt die Möglichkeit des Verlustes schon in sich.« Er muss das in einem seiner Ratgeber über persönliche Entwicklung gelesen haben, und ich bin ganz seiner Meinung, wobei ich ihn an dem Tag, als ich beim Schuheausziehen seinen Bildschirm zerdeppert habe, viel weniger entspannt fand, da hing der gute Freddie plötzlich sehr an seinen Besitztümern und war überhaupt nicht verlustbereit.
Ich lese alle Kleinanzeigen noch einmal durch, dabei spüre ich zwischen meinen Schulterblättern den angespannten Blick von Diego, der wahrscheinlich Todesängste um seine Melonenpyramide aussteht, und die Blicke der Kinder, die ihre Mutter ungläubig lachend am Ärmel ziehen, »Mama, hast du die Frau gesehen? Guck mal die Frau da, hast du gesehen?«, und die erstickten Stimmen der Mütter: »Hör auf, das gehört sich nicht! Hörst du wohl auf!« Bei der zweiten Durchsicht fällt mir die mit zittriger Hand verfasste Anzeige auf, eine aus einem Notizbuch herausgerissene Seite, wie an den Zacken am Rand unschwer zu erkennen ist, mit einer Telefonnummer auf kleinen Streifen, die man nur abzureißen braucht. In der Anzeige wird eine Putzhilfe gesucht, für zwei Stunden, ein- oder zweimal pro Woche, je nachdem. So steht es da, je nachdem, aber je nach was Ta Tadaaa Ungenauigkeiten machen mich immer nervös. Vielleicht sind es Leute, die gern feiern oder die kleine Kinder haben, sodass die Unordnung irgendwann überhandnimmt. Es gibt so viele Gründe für Unordnung. Bei mir sieht es jeden Wochentag aus wie in Syrien, alles ist zu reparieren aufzukratzen zusammenzuflicken oder wegzuwerfen je nachdem, ich übertreibe natürlich, in Syrien ist es viel schlimmer, da weinen Leute um andere Leute, die sterben, so ist es bei mir nicht Wu-Ha bei uns, bei mir reicht die Spanne eher von Blechschäden bis Tontaubenschießen. Freddie sagt immer, wenn ich eines Tages nicht mehr weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll, könnte ich mich selbstständig machen und ein Abbruchunternehmen gründen. Genau deshalb bin ich wahrscheinlich mit Freddie zusammen, seine Art, über mich zu lachen, tut mir unheimlich gut, zumindest an den Tagen, an denen ich es aushalte, in meiner Haut zu leben. Warum Freddie mit mir zusammen ist Wu-Hu-Ha-Ha das weiß ich allerdings nicht.
Ich entschließe mich, als ich die Adresse in der Anzeige sehe, sie liegt nämlich in meiner eigenen Straße, in der Rue des Soupirs Nummer 57, ich kenne das Haus, ein alter Kasten mit einer schönen Steinfassade, Balkons mit Blumenkästen und in Stein gehauenen Blätterornamenten. Seit ich hier lebe, bald fünf Jahre, frage ich mich, wie die Wohnungen in dem Haus wohl aussehen. Die bloße Aussicht auf einen Besuch genügt, um mich zu überzeugen, also reiße ich eine der Telefonnummern ab, so ordentlich wie möglich, fast hätte ich es geschafft, als natürlich Hu-Hu zwangsläufig Hu-Ha. Egal, ich brauche diese Arbeit, ich kann nicht noch einen Fehlschlag noch eine Absage wegstecken. In Freddies Ratgebern über persönliche Entwicklung, die ich in den letzten Monaten nebenbei ziemlich zerknittert und zerfetzt habe, steht, dass man sich in positiver Visualisierung üben muss. Sich sagen muss, dass das, was man unbedingt will, gerade schon geschieht oder ohne jeden Zweifel bald geschehen wird. Ich werde diese Arbeit bekommen verfluchte Scheiße also muss ich die Anzeige auch nicht am schwarzen Brett lassen, der Job gehört mir Tadaa eine Perspektive, zwei Stunden Putzen ein- oder zweimal in der Woche, das wird meine Herausforderung sein, man kann es nennen, wie man will, die Idee ist, etwas zu schaffen, von dem niemand und nicht einmal man selbst geglaubt hätte, dass man es schaffen kann, um nicht allmählich zugrunde zu gehen an einer übergroßen Verletzung des Selbstwertgefühls. Diego schaut zu, wie ich einen Teil des schwarzen Bretts verwüste, und als ich mich bücke, um die Magneten die Heftzwecken die Anzeigen für Fahrräder Autos Kätzchen, die Flyer für Yoga- und Zumba-Kurse, die Werbung für den nächsten Sonntagsflohmarkt aufzuheben, sagt er eilfertig: »Lass nur, schon gut! Ich habe eh gerade nichts zu tun, das wird mich eine Weile beschäftigen.« Ich sage: »Okay, danke« und winke ihm ausladend zu, ich sehe ihn zusammenzucken, sich die Augen zuhalten, meine Hand ist nicht weit von seiner Cheops-Pyramide aus perfekt gereiften Melonen vorbeigefegt. »Bist du fündig geworden?«, fragt Diego und meint meinen Regenschirm. Ich sage: »Nein, nichts Neues, was soll’s.« Ich sage: »Aber man weiß ja nie, wenn du etwas hörst, gib mir Bescheid.« Ich füge hinzu: »Ich habe gerade Wu-Ha eine Ha-Ha eine Anzeige gesehen, die mich interessiert, ich nehme sie mit, wenn du nichts dagegen hast Blödmann Affenarsch.« Er nickt, verkneift sich jeden Kommentar, was ungewöhnlich ist, er ist eher der Typ für gnadenlose Witze und ironische Kommentare. Als er mich das erste Mal gefragt hat, ob ich nicht zu den Zeiten kommen könnte, wo im Laden nichts los ist, um für ein bisschen Stimmung zu sorgen, hätte ich ihm beinahe eine geknallt, und ich hätte es auch getan, wenn ich irgendeine Aussicht gehabt hätte, sein dickes rundes Melonengesicht mit dem grauen Drahthaarschnurrbart zu treffen, aber keine Chance, außer mit sehr viel Zeit, weil zielen Ta Ta Tadaaa.
Freddie und Diego sind die Einzigen, die sich offen über mich lustig machen, der eine aus Liebe, der andere aus Sympathie, ich sage offen, denn der Rest der Welt tut es hinter meinem Rücken, mit genauso viel Schwung, aber etwas weniger Achtung. Ich bin nicht paranoid, aber ich bin auch nicht taub. Nur meine Mutter, und dabei hatte sie Humor, der Beweis ist, dass sie es geschafft hat, meinen Vater attraktiv zu finden, nur meine Mutter hat es nie gewagt, über mich zu lachen, über meine Störgeräusche über mein Rauschen in der Leitung, sie hat nie über alldas lachen können. Das ist schade, sie hätte lieber spotten sollen, um mich etwas abzuhärten. Wenn man im Leben eines lernen sollte, dann über sich selbst zu lachen, bevor die anderen es übernehmen Wu-Hu-Hu Ha-Ha-Ha.
Als ich nach Hause komme, erzähle ich Freddie von der Anzeige, ich sage: »Ich habe einen Job gefunden ich will ihn ich werde ihn bekommen«, aus all den Gründen, die ich mir unterwegs vorgesagt habe, wobei der wichtigste der mit der Selbstachtung ist. Freddie verzieht den Mund, wiegt den Kopf und sagt: »Willst du deine Selbstachtung wirklich davon abhängig machen, ob du bei einem wildfremden Menschen putzen gehst, der dir einen Hungerlohn dafür bezahlt, dass du seinen Dreck wegmachst?« Dann korrigiert er sich: »Entschuldige, das war blöd von mir, mein Schatz. Natürlich ist das eine gute Idee. Ich meine nur, na ja, ich weiß nicht recht, weil du und putzen … Aber wenn es jemand ist, der seine Wohnung leerräumen will, dann bist du wirklich die ideale Person dafür. Achtung, meine Tasse, mein Häschen, bitte. Nein, ist nicht schlimm, lass nur.« Er nimmt mich in die Arme, was nicht so leicht ist, wie es klingt, nicht, dass ich dick wäre, ich bin dünn wie ein Hering, alles andere wäre auch erstaunlich, in Anbetracht all der Energie, die ich verbrauche, aber mich in die Arme zu nehmen ist kein leichtes Unterfangen, mein Guter, wie die Baronin in einem zweitklassigen alten Film mit spitzen Lippen sagen würde. Er hält mich eine ganze Weile an sich gedrückt, was entweder seinen Mut oder seinen Leichtsinn beweist. Freddie ist nicht sehr groß, eher unter dem Durchschnitt, aber er hat stählerne Muskeln, die er jeden Tag im Studio trainiert, »Für den Fall, dass dir was passiert, mein Schatz, und ich dich im Bombenhagel durch Ruinenfelder ganz allein ins Krankenhaus tragen muss und das Krankenhaus zweiundzwanzig Kilometer entfernt liegt und es schneit und ich einen offenen Schienbeinbruch habe, aber ich bin kein Waschlappen, ich trage dich in dieses verdammte Krankenhaus, das versichere ich dir. Was meinst du wohl, warum ich jeden Tag Hanteln stemme? Man müsste bescheuert sein, um das gern zu machen.« Freddie und ich denken uns gern wilde Geschichten aus, in denen er der Held ist, denn ich als Heldin wäre nicht plausibel, immer rettet er mich aus den Flammen aus Orkanen aus Schneestürmen aus Tsunamis Kriegen Flugzeugabstürzen und so weiter, und ich lasse es mir gefallen, ich mag es, von ihm gerettet zu werden. Ich mache mich sanft los, wobei Sanftheit bei mir immer relativ ist, ich sage: »Nein, ich mache meine Selbstachtung nicht davon abhängig, ob ich zwei Stunden in der Woche putzen gehe, aber davon, ob ich damit aufhöre, in dieser Wohnung im Kreis herumzulaufen, ohne Ziel Ha und ohne irgendeine Hoffnung.« »Wenn du wenigstens wirklich im Kreis herumlaufen würdest«, meint Freddie, »dann bräuchten wir nur eine Sicherheitszone abzustecken, in der wir alles wegräumen, da würden wir eine Menge sparen.« »Hör auf«, sage ich, »hör auf, heute nicht Blödmann Affenarsch weißt du, ich habe nicht immer Lust, darüber zu witzeln.« »Aber im Ernst«, setzt Freddie wieder an, »putzen, mein Schatz? Ich will dich ja nicht entmutigen, weißt du, aber ist dir klar, was putzen bedeutet?« Das sagt er, ohne mich direkt anzuschauen, während er den Kaffee auf dem Tisch aufwischt, und in solchen Momenten möchte ich heulen wie ein Hund. »Ich versuche es trotzdem«, sage ich zwischen zwei Störgeräuschen. »Ich rufe gleich an.« »Warte, mein Küken, ich halte dir das Telefon.« »Nein. Nein, ich mache das alleine, ich brauche niemanden und vor allem nicht dich Hu-Ha«, sage ich, was alles andere als die Wahrheit ist, aber die Verzweiflung ähnelt manchmal der Wut, man kann beißen, weil einem etwas wehtut. »Und ich bin kein Küken verflucht, ich bin eine erwachsene Frau und ich bin selbstständig«, sage ich zwischen zwei Rucklern. Denn ich weiß, dass das wahr ist, wenn man von alldem mal absieht.