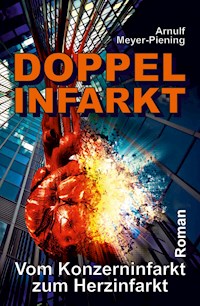1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte rankt sich um die wirtschafts- und sozialpolitischen Probleme der Hansestadt Bremen Anfang der 60er-Jahre. Durch Überkapazitäten gerät die Schifffahrtsbranche in einen Abwärtsstrudel, mit der Folge, dass auch die Banken ins Straucheln geraten. Schließlich droht die gesamte industrielle Landschaft in der Hansestadt im Abgrund zu versinken. Herrmann Schwarzer entwickelt ein Steuersparmodell, mit dessen Hilfe potente Kunden von ihrer Steuerlast befreit werden, wodurch zugleich die Werften Aufträge erhalten und die Not leidenden Banken lukrative Kredite vergeben können. Eine Win-win-Situation auf der ganzen Linie. Schwarzer befindet sich auf dem Höhepunkt seines Ansehens und wird zum Präses der Handelskammer gewählt. Sein Abstieg beginnt mit einer unbedachten Bemerkung seiner Frau, wegen der er der Steuerhinterziehung angeklagt wird. Er lässt sich scheiden. Schwarzer setzt alles auf eine Karte und beginnt eine gewagte Spekulation an der Warenterminbörse. Es bedient sich dabei seines Sohnes, der in einer seiner Tochtergesellschaften tätig ist. Die Spekulation geht schief, er muss den Konkurs seiner gesamten Firmengruppe erklären. Er steht von dem Nichts und sucht Zuflucht bei seiner Sekretärin, doch die Beziehung endet tragisch. Die polizeilichen Ermittlungen zu seinen Todesumständen führen zu der Begleitagentur, über die Schwarzer seine Sekretärin ursprünglich kennenlernte. Man stößt auf einen Drogenring …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Arnulf Meyer-Piening
Ein leuchtender Stern verglüht
Roman
Copyright: © 2023 Arnulf Meyer-Piening Umschlag & Satz: Erik Kinting – buchlektorat.net peshkova (333634186 / depositphotos.com)
Verlag und Druck: tredition GmbH An der Strusbek 10 22926 Ahrensburg
Softcover
978-3-347-82616-8
Hardcover
978-3-347-82618-2
E-Book
978-3-347-82626-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Begegnung am Abend
Kartenspiel unter Freunden
Zwischenfall im Konzert
Bremer Vulkan
Unheilvoller Konzertabend
Blume Bank in Schieflage
Glückliche Genesung
Entspannung am Kaminfeuer
Fahrt zur Mosel
Zukunftspläne
Berauschende Ideen
Business as usual
Hochmut kommt vor dem Fall
Der große Auftritt
Der Absturz
Kooperation statt Konfrontation
Riskante Entscheidung
Wachsende Sorgen
Neubeginn in Worpswede
Der Reitunfall
Die Schein-Hochzeit
Die Fehlspekulation
Der Zusammenbruch
Weihnachtsoratorium im Kloster Corvey
Gestörtes Weihnachtsfest
Das Mosel-Projekt
Suche nach der Wahrheit
Eventmarketing
Das Komplott
Ein neuer Stern erscheint
Vorwort
Dieser Roman entspringt meiner Phantasie und hat nur geringen Bezug zur Realität, die schon viele Jahre zurückliegt, wobei viele Details durch eine veränderte Perspektive bis zur Unkenntlichkeit verwischt wurden.
Die handelnden Personen und deren Namen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.
Sofern Namen von historischen Persönlichkeiten, von existierenden Firmen
oder Orten verwendet werden, stammen sie aus allgemein zugänglichen Quellen.
Begegnung am Abend
Wie benommen und leicht zögernd stieg Sylvia Wohlgemuth in ihrem schwarzen Satin-Kleid die mit rotem Teppich belegten Stufen hinunter, ehrerbietig begrüßt von den Besuchern, die ins Foyer des Konzertsaals drängten, um ihre Garderobe zu holen. Eilig strebten sie zum Ausgang, weil sie noch eines der wenigen Taxis erwischen wollten, denn es hatte zu regnen begonnen. Flüchtig erwiderte sie die Grüße mit freundlicher Gelassenheit, ohne dabei jedoch kalt oder gar abweisend zu sein. Vielmehr schien sie die Lobbezeugungen zu genießen, denn sie war sich ihrer positiven Ausstrahlung durchaus bewusst.
Unten am Fuße der Treppe wurde sie von einem Herrn erwartet, der sich zielstrebig einen sicheren Platz in der Menge erobert hatte, von dem aus er die Szene beobachten konnte, ohne von dem Menschenstrom mitgerissen zu werden. Seine Bewegungen verrieten eine gewisse Erregung, denn er war auf der Suche nach einer Frau, die er kürzlich kennengelernt hatte. Er mochte wohl so etwa Anfang vierzig sein, sein Gang war aufrecht, elastisch, federnd, wie eine Raubkatze zum Sprung bereit, und zugleich auch irgendwie gebremst, während sein Blick suchend umherstreifte als hätte er Sorge, sie in dem Strom der Menschen zu verpassen. Jedenfalls nahm er seine Umgebung nur schemenhaft wahr. Kaum registrierte er die freundlichen Grüße, die sein Bewusstsein nicht erreichten.
Seine Gedanken kreisten um die Sopranistin, die ihn irgendwie in ihren Bann gezogen hatte, ohne dass er hätte sagen können, was ihn so faszinierte. War es ihre Interpretation des religiösen Werkes oder ihr ansprechendes Äußeres? Vielleicht beides, obwohl nicht alles vollständig zusammenzupassen schien. Jedenfalls wollte er mit ihr ins Gespräch kommen, denn sie hatte in ihm viele Saiten zum Schwingen gebracht, und das fand er beunruhigend, vielleicht sogar verwirrend. Während er auf sie wartete, hatte er sich überlegt, wie er das Gespräch am besten eröffnen sollte: „Meine Gnädigste, Sie waren wundervoll, oder hinreißend, oder grandios!“ Würde sie ihm die Hand zum Handkuss reichen, sollte er ihr einfach seine Hand reichen oder sollte er, wie es heute gang und gäbe ist, sie mit einem freundschaftlichen Kuss auf die Wange begrüßen? Das jedoch schien ihm zu aufdringlich zu sein. Schließlich waren sie sich bisher nur flüchtig begegnet, und hatten nur ein paar freundliche Worte gewechselt. Die Sache schien nicht so einfach zu sein, weil er in der „Glocke“ kein Unbekannter war und als geachteter Wirtschaftsprüfer auf seine untadelige Reputation achten musste. In der alten Hansestadt Bremen, vor allem in den Kreisen der langjährigen Konzert-Abonnenten, war er durchaus eine Respektsperson, gegründet auf alten Traditionen und anerkannter Kompetenz.
Sie aber war nicht von hier, hatte aushilfsweise die Partie für die erkrankte Sopranistin übernommen, das wusste er, denn er war als freiberuflicher Moderator mit der aktuellen Musikszene hinreichend vertraut. Unschlüssig wartete er auf ihre Begrüßung, denn er wollte nicht aufdringlich erscheinen. Vielleicht ein flüchtiges Lächeln, ein leichtes Nicken mit dem Kopf oder ein erkennendes Zeichen mit der Hand. Nichts dergleichen geschah, sie blickte ihn nur erstaunt an, als er ihr ein paar Schritte entgegenkam. In diesem Augenblick wirkte sie wie erstarrt, gleichsam entrückt. Das verunsicherte ihn. Hatte sie ihre vorherigen Begegnungen vergessen oder wollte sie ihn nicht wiedersehen? Er war durchaus nicht der Typ des germanischen Helden, dem die Frauen zu Füßen lagen. Kein Regisseur hätte ihm die Rolle des Siegfried angeboten, ganz abgesehen von der Tatsache, dass er nicht singen konnte. Eher glich er dem weithin geachteten Dirigenten vergangener Zeiten: Wilhelm Furtwängler in seinen besten Jahren. Jedenfalls bestand mit ihm eine gewisse Ähnlichkeit: Schlanke Figur, kerzengerade aufgerichtet, durchaus selbstbewusst zu nennen. Zudem hatte auch er leicht gewelltes dunkles Haar und trug einen kleinen Schnurrbart. Besonders aber zog er mit seinen strahlenden Augen, die forschend nach dem Kern der Dinge suchten, die Aufmerksamkeit seiner Gesprächspartner in seinen Bann.
Endlich löste sie sich aus ihrer Erstarrung: Zielgerichtet schlängelte sie sich durch die Menge. Je näher sie kam, desto unsicherer fühlte er sich, denn sie erschien ihm plötzlich wie verwandelt, jetzt war sie nicht die verzweifelte Frau in tiefer Trauer, die er vor wenigen Augenblicken auf dem Podium erlebt hatte. Vielmehr schien sie ihm eher wie Carmen, die sich mit anmutigen Bewegungen ihrer betörenden Wirkung durchaus bewusst war. Wer also war diese widersprüchliche Frau in Wirklichkeit, das wollte er herausfinden. Ich müsste sie näher kennenlernen, dachte er. Und genau dieser Gedanke ließ ihn in seiner professionellen Rolle als erfahrener Moderator und Interviewpartner in ungewohnter Weise verstummen. Er musste ihre Aufmerksamkeit gewinnen, ohne aggressiv zu erscheinen. Jedenfalls wollte er keinen Fehler machen, der eine künftige Beziehung schon im Ansatz zerstören könnte. Nun standen sie sich Auge in Auge gegenüber. Wie sollte er beginnen? Was sollte er sagen? Er wusste es nicht.
Als ob sie seine Verunsicherung erkannt hätte, überbrückte sie die peinliche Situation: „Guten Abend“, sagte sie ganz schlicht. „Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich glaube, wir sind uns schon ein paarmal über den Weg gelaufen. Wenn ich mich nicht irre, dann habe ich Sie kürzlich in der Abendschau gesehen. Sie moderierten eine Sendung über die Perspektiven der Norddeutschen Küstenregion. Dabei waren Sie auch auf die wirtschaftliche Bedeutung der klassischen Orchester-Musik eingegangen.“
„Ach, die Sendung haben Sie gesehen?“, fragte er überrascht und freute sich über diesen unkomplizierten Einstieg in das Gespräch. „Sie haben sich nicht geirrt, mein Name ist Martin Degenhardt. Gelegentlich arbeite ich freiberuflich für das Fernsehen und manchmal auch für den Rundfunk. Hauptberuflich bin ich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.“
„Das trifft sich gut. Dann könnten Sie mir vielleicht helfen, Steuern zu sparen.“
„Mal sehen. Ich bin beruflich ziemlich eingespannt“, sagte er ausweichend.
„Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Zumal, wenn Sie neben Ihrer beruflichen Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer noch Zeit finden, im Fernsehen mit prominenten Gästen über aktuelle Fragen der kommunalen Politik zu diskutieren. Jedenfalls haben Sie mich als Moderator mit Ihrem profunden Wissen und freundlichem Umgang mit den Gästen sehr beeindruckt. Möchten Sie mich zu ein einem Interview gewinnen?“
„Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin nur als schlichter Musikliebhaber hier und wollte Ihnen für diesen wundervollen Abend danken.“
„Es freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat.“ „Sehr sogar! Es passiert mir nicht häufig, dass mich ein Konzert so stark berührt. Sie waren hinreißend. Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich in der Musik vollkommen aufgelöst hätten, gleichsam als ob Sie Ihre Umwelt verlassen hätten, und sich in höheren Sphären jenseits der irdischen Niederungen befänden.“
„Da ist etwas dran. Sobald ich auf der Bühne stehe, bin ich voll auf das Werk konzentriert und blende alles Störende aus. Nicht einmal das Klingeln eines Telefons erreicht mein Bewusstsein.“ „Darum beneide ich Sie, ich wünschte, ich könnte das auch.“
„Man kann das lernen. Es ist nur eine Frage der Fokussierung der Energie auf das Wesentliche. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann verschmelze ich mit der Musik. Wir bilden sozusagen eine unzertrennliche Einheit, losgelöst von Zeit und Raum.“
„Sie scheinen darin ein Meister zu sein. Ich würde dazu gerne noch etwas mehr von Ihnen erfahren. Darf ich Sie zu einem Glas Wein einladen, oder soll ich Ihnen ein Taxi besorgen?“
„Ich würde mich gerne noch etwas mit Ihnen unterhalten, aber morgen habe ich einen anstrengenden Tag, da sollte ich gut ausgeschlafen sein. In jedem Fall wäre es nett, wenn Sie mir ein Taxi besorgten.“
Er half ihr in ihren Mantel, sie gingen zur Straße, verharrten noch etwas im geschützten Ausgangsbereich, denn der Regen hatte sich plötzlich verstärkt. „Wohin soll die Fahrt gehen?“
„Ich wohne im Radisson Blue Hotel in der Wachtstraße.“
„Das Hotel liegt nur ein paar Schritte entfernt von hier. Es lohnt sich kaum, für die kurze Strecke ein Taxi zu nehmen. Sie könnten dorthin zu Fuß gehen, wenn Sie der Regen nicht stört.“
„Gute Idee! Das bisschen Regen macht mir nichts aus. Im Gegenteil, er erfrischt mich, und ich komme wieder auf die Erde zurück.“
„Ich könnte Sie begleiten, wenn Sie wollen.“ „Das wäre nett. Ich gehe bei der Dunkelheit nicht gerne allein auf die Straße.“
Vorsorglich hatte er den Schirm aufgespannt. Sie hakte sich bei ihm unter. Es gefiel ihm, denn seit geraumer Zeit hatte er die Begleitung einer attraktiven Frau vermisst. Arm in Arm gingen sie die paar Schritte über den Marktplatz, grüßten den steinernen Roland vor dem alten Rathaus und überquerten den zu dieser späten Stunde fast menschenleeren Platz.
„Von hier ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem Hotel, es sind nur noch ein paar Schritte“, sagte er mit einem gewissen Bedauern. Seine Stimme ließ deutlich erkennen, dass er etwas enttäuscht war, denn er hätte den Abend gerne noch mit ihr und einem Glas Wein ausklingen lassen.
Sie spürte sein Zögern: „Nach dem Konzert habe ich immer das Bedürfnis, etwas Erfrischendes zu trinken und den Abend in angenehmer Atmosphäre ausklingen zu lassen“, sagte sie vorsichtig und half ihm aus seiner Verlegenheit.
„Gerade so geht es mir. Dann schlage ich vor, wir gehen in den Schütting. In den Kellerräumen des ehrwürdigen Hauses der Bremer Kaufmannschaft gibt es einen gediegenen Club, in dem ich seit vielen Jahren Mitglied bin.“
„Das hört sich gut an.“
Die Dom Uhr schlug zehn, als sie den Marktplatz verließen und dem „Roland“ einen freundlichen Nachtgruß zuwarfen. Mit ein paar Schritten, vom Regen beschleunigt, erreichten sie das spätgotische Gebäude, stiegen die paar Stufen hinunter und betraten die historischen Kellergewölbe. Ein paar bequeme Sessel standen locker gruppiert um kleine Tische, jeweils beleuchtet von massiven Stehlampen aus Messing mit Schweinslederschirm, die dem Raum eine fast feierliche Stimmung gaben. Aber um diese Zeit saßen dort nur wenige Herren und lasen Zeitung oder Magazine. Es herrschte gedämpfte Stille in dem Gewölbe, wo der weiche Teppich jedes störende Geräusch verschluckte. Sie warfen nur einen flüchtigen Blick auf die Bilder an den Wänden mit historischen Seglern und gingen in den Nebenraum mit Tischen zum Essen eingedeckt. Er wurde vom Kellner Johann zuvorkommend begrüßt.
„Herr Dr. Degenhardt, herzlich willkommen, wo möchten Sie sitzen?“
„Mein angestammter Platz unter dem Gewölbebogen scheint frei zu sein, vielleicht haben Sie noch eine Kleinigkeit zum Essen für uns. Und servieren Sie mir bitte den Wein wie immer!“
Zielgerichtet wählte er den Tisch, an welchem vor Jahren die Skatrunde seines Vaters gesessen hatte und erkundigte sich bei seiner Begleiterin, ob ihr der Tisch recht sei.
„Ja, alles gut“, sagte sie und fuhr fort: „Entscheiden Sie, denn Sie sind hier zu Hause.“
„Nun, nicht wirklich, aber es ist mir hier alles sehr vertraut.“
Sie setzten sich, indem er ihr den Stuhl zurechtrückte. Sie schien es zufrieden zu sein und blickte ihn aufmerksam an: „Erzählen Sie doch etwas von sich, und was Sie mit dem Raum und diesem Tisch verbindet.“
„Da gibt es nicht viel zu erzählen. Mein Leben ist ziemlich geradlinig verlaufen. Nur die üblichen Höhen und Tiefen. Sie wissen schon … behütete Kindheit, Schule, Studium, Berufseinstieg. Dann das tägliche Einerlei. Nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, nichts von großer Bedeutung. Ich will Sie nicht mit unwesentlichen Dingen langweilen. Stattdessen möchte ich lieber Ihnen zuhören, denn Sie wollten mir erklären, wie Sie das mit der Fokussierung der Energie gemeint haben.“
„Ach, das ist eine schwierige Angelegenheit, nicht mit wenigen Worten zu erklären. Aber was verbindet Sie mit diesem Tisch?“, lenkte sie das Gespräch erneut in die neutrale Richtung. Wahrscheinlich wollte sie in keine komplizierten Themen einsteigen, schließlich wollte sie sich nur bei einem Glas Wein entspannen. Zugleich interessierte sie ihr Gesprächspartner, vielleicht in seiner Eigenschaft als Moderator oder nur als Mann, der ihre Sympathie erweckt hatte, wie auch immer … Instinktiv spürte sie, dass dieser Tisch eine geheimnisvolle Geschichte enthielt und der Beginn einer ernsthaften Beziehung werden könnte. Ihre Neugier war geweckt. Sie wollte wissen, wer dieser Mann an ihrer Seite war, und außerdem wollte sie sich aus der Rolle des gefeierten Stars befreien, jedenfalls für den Augenblick.
„Mit diesem Tisch hat es tatsächlich eine besondere Bewandtnis“, begann er zögernd, weil er wusste, dass er kritische und auch unerfreuliche Ereignisse aus seinem Leben und dem seiner Eltern preisgeben würde, was ihm zu diesem Zeitpunkt noch zu indiskret war. Deshalb versuchte er, auszuweichen: „Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich ihnen später mal ausführlich davon.“
Sie schien enttäuscht zu sein, blickte ihm aufmerksam in die Augen und neigte ihren Kopf leicht fragend zur Seite. Aber sie schwieg und ließ ihren Blick zum Nachbartisch gleiten, obwohl die Frage ihr auf den Lippen brannte. Mit einem kurzen Ruck hatte sie sich wieder gefangen, denn sie wollte nicht neugierig erscheinen. „Im Übrigen“, sagte sie unvermittelt, „der Kellner hat Sie eben mit Dr. Degenhardt angesprochen, Sie sind also promoviert? Entschuldigen Sie, das konnte ich nicht wissen.“
„Kein Problem. Im privaten Rahmen mache ich nie Gebrauch von meinem akademischen Titel. Aber Johann stammt aus Österreich und ist noch von der alten Schule, und beharrt auf den Titel in der Anrede. Am wohlsten fühlt er sich, wenn er jemanden mit Herr Kommerzienrat oder Herr Direktor ansprechen kann.“
Inzwischen hatte der Kellner die ihm seit Jahren so vertraute Flasche Graacher Himmelreich von der Mosel auf den Tisch gestellt, entkorkte sie und goss ihm einen Schluck zum Verkostern ein, er nickte zustimmend, dann füllte er beiden die Gläser. So tauschten sie Belanglosigkeiten aus, die ihnen halfen, peinliche Gesprächspausen zu überbrücken.
Sie ließen die Gläser erklingen, blickten sich in die Augen, und es schien, als sei zwischen ihnen ein Funken übergesprungen. War das die „fokussierte Energie“, von der sie gesprochen hatte? Vielleicht, jedenfalls irgendetwas in dieser Art war mit ihnen geschehen. Sie sprachen nicht darüber.
„Möchten Sie etwas essen?“, erkundigte sich Johann.
„Nein, vielen Dank. Wir möchten nur den schönen Konzertabend gemütlich mit einem Glas Wein ausklingen lassen.“
„Sehr wohl. Wünsche weiterhin einen angenehmen Abend“, sagte er und verbeugte sich ehrerbietig, indem er sich entfernte.
„Diesen Wein trinke ich besonders gern“, sagte sie. „Der stammt nämlich aus meiner Heimat.“ „Ach, Sie stammen von der Mosel? Das wusste ich nicht.“
„Dort habe ich meine Jugend verbracht. Meine Eltern sind Weingärtner in Cochem.“
„Das trifft sich gut. Ich schätze den Moselwein ganz besonders.“
„Das freut mich, denn irgendwie fühle ich mich noch immer dieser Gegend mit seinen Weinlagen an den südlichen Hängen der Mosel verbunden.“ „Kann ich verstehen. Auch ich verbinde mit diesem Fluss sehr schöne Erinnerungen aus meiner Jugendzeit“, fügte ich hinzu und war froh, dass ich den richtigen Wein ausgewählt hatte.
„Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Mosel?“
„Vor vielen Jahren machte ich als Schüler mit ein paar Freunden meine erste Faltboottour an der Mosel, die damals noch nicht kanalisiert war. Wir hatten unsere Boote in Trier zu Wasser gelassen und wollten uns mit der Strömung gemächlich bis nach Koblenz treiben lassen.“
„Das muss schon sehr lange her sein, denn heute ist sie mehrfach mit Staustufen versehen, um auch für größere Schiffe befahrbar zu sein.“
„Ja, ist es auch. Ich war damals so etwa um die siebzehn oder knapp achtzehn, trotzdem erinnere ich mich noch lebhaft daran, als wäre es erst gestern gewesen. Wir schlugen an den Ufern unser Zelt auf, kauften uns beim örtlichen Winzer eine oder zwei Flaschen Wein, ließen den lieben Gott, Gott sein und genossen unser unbeschwertes Leben. Gelegentlich gingen wir zum Tanzen. So zum Beispiel in Piesport, Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach, Cochem, Bullay und Zell.“
„Das hört sich wunderbar an. Sicher haben Sie damals vielen Mädchen den Kopf verdreht.“
„Nein, dazu ergab sich keine Gelegenheit.“ „Trotzdem scheint es sehr schön gewesen zu sein, denn Ihre Augen haben plötzlich einen besonderen Glanz erhalten.“
Tatsächlich hatte ich wohl einen roten Kopf bekommen, was sie sofort bemerkt hatte, und mir peinlich war. Auch aus heutiger Sicht weiß eigentlich nicht, warum mir das passiert war. Vielleicht begannen sich während meiner Erzählung die Konturen zwischen dem jungen Mädchen an der Mosel und der charmanten Frau an meinem Tisch zu verwischen. In jedem Fall wurde mir in diesem Augenblick meine Maske der professionellen Distanzierung vom Gesicht gerissen.
Und so kam es, wie es kommen musste, denn sie sprach mich ganz direkt und ungeniert an:
„Sie müssen keine Scheu vor mir haben. Ihre intimen Geständnisse sind bei mir sicher aufgehoben, ich werde sie wie einen kostbaren Schatz bewahren und nicht weitergeben. Vielleicht sollten wir uns Duzen, wenn wir schon so offen über intime Dinge sprechen.“
„Gerne. Darauf sollten wir anstoßen.“
Wenn mich ihr Vorschlag zunächst befremdete, so kam er mir in diesem Augenblick sehr gelegen, denn auch ich hatte den Wunsch, die kritische Distanz zwischen uns aufzuheben. So kam es wie es kommen musste, wir wechselten zum freundschaftlichen Du, wenigstens in den Augenblicken, in denen wir uns unbeobachtet fühlten. Anfänglich verlief der Wechsel in der Anrede noch etwas holperig, schließlich waren wir nicht vertraut miteinander, und sowohl meine Stellung in der Stadt als auch meine puritanische Erziehung verlangten eine gewisse Distanz. Dennoch verleitete uns beide die intime Atmosphäre des Raumes zu einer Überwindung der trennenden Grenzen. Der Wein tat sein Übriges, und folglich begann sie fast schüchtern mit der Frage:
„Was ist es denn gewesen, das dich plötzlich so irritiert hat?“
Die direkte Frage war mir peinlich, und schon fürchtete ich, dass ich erneut erröten könnte. Daher wich ich aus und suchte nach einer unverfänglichen Antwort:
„Wirklich nichts von Bedeutung, jedenfalls nichts, das sich in Gegenwart einer Dame erzählen ließe.“
„Du machst mich neugierig.“
„Es lohnt sich wirklich nicht. Da ist nichts Kritisches geschehen, was der Erwähnung wert wäre. Vielleicht sollten wir noch ein Glas Wein trinken“, sagte ich zur Ablenkung.
„Du weichst aus. Nun sag schon: Hattest du dich in ein Mädchen verliebt?“, fragte sie etwas schalkhaft.
Ich antwortete nicht, weil es mir peinlich war. Ich fühlte mich irgendwie ertappt und nippte verlegen an meinem Glas.
Natürlich bemerkte sie mein Zögern und fuhr unbeirrt fort:
„Ich verstehe. Du hast sie geliebt und bist anschließend deiner Wege gegangen und fühlst dich jetzt schuldig?“, forschte sie unbeirrt weiter.
„Nein, so war es nicht“, sagte ich sichtlich verlegen.
„Also, nun rück schon heraus mit der Sprache, wie ist es denn gewesen? Da muss doch etwas Bedeutsames passiert sein.“
„Nein, ist es nicht.“
„Ich merke schon, du möchtest nicht darüber reden.“
„Ja, so ist es. Es ist mir peinlich.“
„Ihr habt euch geküsst?“
„Nein, wir haben nur miteinander getanzt, sonst nichts. Ich weiß weder wie sie heißt noch wo sie wohnt.“
„Das kann nicht alles gewesen sein, sonst hättest du die Begegnung nicht so viele Jahre in Erinnerung behalten.“
„Du bist eine aufmerksame Zuhörerin und zudem etwas neugierig.“
„Nun gib es doch zu: Du hattest dich in das Mädchen verliebt!“
„Nicht wirklich, aber ich glaube, ich begehrte sie.“
„Wo ist da der Unterschied?“
„Vielleicht sollten wir es dabei lassen. Bedenke, dass ich damals noch sehr jung war. In der Jugend ist die Unterscheidung zwischen reiner Liebe und körperlichem Begehren noch viel schwerer zu treffen als mit reiferen Jahren.“
Jetzt errötete auch sie leicht und blickte mir forschend in die Augen: „Mag sein, aber du möchtest sie wiedersehen, wenn du wüsstest, wo sie lebt?“ „Nein, die Sache fand ein ungutes Ende.“ „Erzähle, wenn es dich nicht zu sehr belastet.“
„Du gibst ja doch keine Ruhe, also sage ich es einfach: Wir hatten uns nach dem Tanz vor dem Lokal getrennt. Der Abschied war kurz und herzlich. Sie schmiegte sich an mich und gab mir einen intensiven Kuss auf den Mund. Ich war verwirrt und wusste nicht, was ich tun sollte, stand wie angewurzelt. Wonach mir der Sinn stand, das konnte ich nicht tun, denn die Freunde waren bei mir. Daher wandte ich mich ziemlich abrupt und wortlos von ihr ab und ließ sie stehen. Ich glaube, ihre Tränen gesehen zu haben. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein,
Wir Freunde folgten der Straße am Ufer der Mosel, die junge Frau ging über die Brücke auf die andere Seite des Flusses – angeblich zu ihrer Mutter nach Hause.“
„Das war’s? Du verheimlichst mir etwas Wichtiges. Du bist ihr gefolgt und hast sie geliebt.“
„Nein, in meiner Verwirrung ging ich wie ein Schlafwandler zu meinem Zelt. Die Freunde zwängten sich in ihre Schlafsäcke und legten sich zum Schlafen. Ich aber saß noch etwas verloren am nächtlichen Fluss, der still vorbeizog. Meine Gedanken weilten bei ihr und ich wünschte, dass sie neben mir säße. Nichts regte sich, nur das Schnarchen der Freunde durchdrang die Stille. Da tauchte sie plötzlich auf der anderen Flussseite auf, rief mich an und fragte mich, ob ich keine Angst hätte, die Nacht so allein am Fluss zu verbringen.“
„Ich verneinte.“
„Es könnten aber böse Geister kommen, die dich ins Wasser ziehen.“
„Ich antwortete ziemlich forsch, ich hätte keine Angst vor Gespenstern.“
„Doch sie ließ nicht locker: Es könnte ein weiblicher Geist sein.“
„Soll sie doch kommen, wenn sie jung und hübsch ist wie du, dann ist sie mir recht.“
„Ich bin kein Geist, bin lebendig und kann nicht kommen, denn meine Mutter wartet auf mich. Sie wird sehr böse, wenn ich zu spät nach Hause komme. Dann sperrt sie mich im Hause ein und lässt mich nicht mehr zum Tanzen gehen.“
„Na dann geh zur Mutter und schlafe gut“, rief ich ihr zu.
Damit schien das peinliche Wechselspiel der Worte über den Fluss beendet, doch so war es nicht. Unschlüssig wandte sie sich zum Gehen, kehrte aber noch einmal zurück, als ob sie in den Fluss überqueren wollte, doch sie zögerte, blieb stehen, schaute sehnsuchtsvoll zu mir (wenigstens bildete ich es mir ein, denn ich konnte es wegen der Dunkelheit nicht erkennen) und rief mit lauter Stimme, so dass es alle hören konnten:
„Gib Acht auf die Hexe, dass sie dich nicht vernascht!“
„Hat sie wirklich vernascht gesagt?“, fragte meine Begleiterin, die mir gegenübersaß und aufmerksam zuhörte.
„Nein, sie verwendete ein Wort, dass ich hier nicht wiederholen will, (und das sonst nur schwadronierende Männer am Stammtisch in ihrer Bierkneipe benutzen). Damit entfernte sie sich.“
„Verstehe, dann lass es so im Raume stehen wie es ist. Jedenfalls hat es deine Phantasie geweckt, und vielleicht auch mehr. Hättest du sie lieben wollen?“
„Wahrscheinlich. So genau erinnere ich mich nicht mehr an die Situation.“ Ich sagte das, weil ich mich nicht in weiteren Peinlichkeiten verlieren wollte.
Doch Sylvia ließ nicht locker, offenbar wollte sie mich aus der Reserve locken: „Und was weiter?“
„Nichts. Die Nacht schlief ich unruhig, denn ein Traum von bösen Geistern plagte mich.“
„Also doch! Waren sie weiblicher Gestalt?“
„Das erinnere ich nicht mehr.“
„Und das war’s?“, fragte sie sichtlich enttäuscht. Außerdem glaubte sie mir nicht so recht.
„Ja, das war’s.“
„Am nächsten Tag hast du sie gesucht und gefunden.“
„Nein, leider nicht. Es endete ganz prosaisch: Ich ging zum Ufer und sprang ins Wasser, um mich abzukühlen. Als ich aus dem Wasser stieg, zog ich eine Blutspur hinter mir her. Offenbar war ich in eine Scherbe getreten. Gestützt auf meine Kameraden humpelte ich mühsam zum Ort. Ein Arzt klammerte meine tiefe Schnittwunde am Fuß, und ich wurde mit einem Krankenwagen nach Hause gebracht. Dort verheilte sie in wenigen Tagen.“ „Und was geschah mit deinen Kameraden und deinem Boot?“
„Sie beendeten die Tour ohne mich, was mich noch heute schmerzt.“
„Aber nun ist die Wunde offenbar nicht vollständig verheilt, denn du musst noch immer an das Mädchen denken“, sagte Sylvia hintergründig lächelnd und zugleich auch etwas spöttisch.
„Nein, so ist es nicht, aber ich möchte die damals abgebrochene Tour beenden.“
„Das hättest du doch jederzeit machen können“, sagte sie und fuhr fort: „Du hattest genügend Zeit und Geld.“
„Aber keine geeignete Partnerin.“
„Du siehst plötzlich sehr traurig aus. Die Sache mit der jungen Frau am Ufer geht dir offenbar doch näher, als du zugeben willst. So etwa nach dem Motto: Ich möchte noch mal zwanzig sein …“
„Nein, vorbei ist vorbei.“
Es entstand eine kurze Gesprächspause. Mir war es unangenehm, dass ich die kostbare Zeit mit meiner charmanten Begleiterin, von der ich eigentlich Wissenswertes über Gesangskunst und Musik erfahren wollte, und die mir inzwischen nähergekommen war, mit belanglosen Geschichten aus alter Zeit vertan hatte.
Aber dann geschah es: Sie begann ganz leise das alte Lied über die Sehnsucht nach der verlorenen Jugend zu summen und leise zu singen. Die Herren am Nachbartisch waren aufmerksam geworden, kamen an unseren Tisch und baten um eine Zugabe. Meine Begleiterin schien zuerst etwas irritiert, dann aber merkte sie die positive Resonanz, und sie überwand ihre Scheu. Sie blickte mich verlegen an, ich nickte ihr aufmunternd zu, und sie fasste sich ein Herz, erhob sich und begann ungeniert und wie von einer Last befreit zu singen und bewegte sich dabei anmutig wie eine Tänzerin. Ihre kraftvolle Stimme erfüllte den gewölbten Raum. Weitere Herren aus dem angrenzenden Salon waren herbeigekommen und stimmten in den Gesang ein.
Der Raum schien plötzlich wie verwandelt, er wurde zu einer Bühne. Die honorigen Herren wurden zu Statisten und Chormitgliedern. Eine frohgestimmte Runde war entstanden. Plötzlich, ganz unvermittelt, verstummte meine Sängerin, als sei sie aus einem Traum erwacht. Sie setzte sich, lächelte mich verschämt an und sagte: „Es tut mir leid, ich habe vergessen wo ich war und habe mich unmöglich benommen. Können Sie mir verzeihen?“
Unbeabsichtigt waren wir wieder zum Sie zurückgekehrt, was mir in diesem Augenblick lieber war.
Ihre letzten Worte waren unbeabsichtigt laut gesprochen, so dass ich mich zu einer Antwort genötigt sah.
„Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Sie waren wunderbar und haben uns allen hier einen sehr schönen Abend beschert.“
In diesem Augenblick war es uns passender erschienen, zum distanzierten Sie zurückzukehren. Offenbar war es auch ihr so ergangen, denn sie nickte mir verständnisvoll und zugleich anerkennend zu.
Die umstehenden Herren unterstrichen meine Worte mit freundlichem Applaus. Nach und nach kehrten sie zu ihrem Plätzen zurück und nahmen ihre gewohnten Beschäftigungen wieder auf. Wie auf wunderbare Weise standen plötzlich ein paar mit Wein gefüllte Gläser auf unserem Tisch. Man ließ uns hochleben.
Ich verharrte in Gedanken, wusste nicht, was ich denken sollte, denn ich war tief bewegt.
„Du siehst sehr traurig aus“, sagte sie, „bist du mir böse?“
„Nein, im Gegenteil, du hast mit deinem Lied viel Positives in mir zum Klingen gebracht und zugleich manches Unerfreuliches in den Hintergrund verdrängt.“
„Dann sollten wir es dabei belassen. Aber wenn du mal das Bedürfnis hast, mit mir darüber zu sprechen, dann solltest du es tun, vielleicht löst sich dann dein innerer Knoten.“
„Einverstanden.“
Wir ließen es dabei, und warteten auf das, was uns der weitere Abend bringen würde. Dabei waren wir keine passiven Zuschauer wie in einem Theaterstück. Nein, ganz im Gegenteil. Wir waren die Akteure, die allerdings keinem Drehbuch folgten. Es glich einem Suchen, einem gegenseitigen emotionalen Abtasten, das seinen eigenen Gesetzen folgt.
„Ich hoffe, du bist mit der Wahl dieses Raumes einverstanden“, sagte ich, um etwas von dem heiklen Thema abzulenken. „Ich esse hier gelegentlich eine Kleinigkeit.“
„Es ist hier sehr gemütlich“, sagte sie. „Ich fühle mich hier gut aufgehoben, fast schon heimisch, obwohl mir hier alles fremd ist.“
„Hier sind die Club-Mitglieder unter sich und geben sich ganz zwanglos. An diesem Tisch spielten vor Jahren einige unserer Honoratioren Skat, darunter auch mein Vater. Das taten sie einmal pro Monat, rauchten Zigarren und tranken ein Glas Wein – oder manchmal auch zwei.“
„Das hört sich ganz relaxed aus.“
„War es auch. Sie hatten viel Spaß miteinander, spielten sogar um Geld. Keine großen Beträge, aber es stachelte ihren Ehrgeiz an. Irgendwie geht es doch immer ums Geld und ums Gewinnen. Jeder will gewinnen, und keiner mag der Verlierer sein.“ „Möchtest du mir davon erzählen?“, fragte sie.
Sie brachte mich in Verlegenheit, denn ich war nie dabei gewesen. Doch reizte es mich, denn mein Vater hatte oft von den Skatabenden mit seinen Freunden berichtet, wenn er am Samstagabend mit seinen Söhnen, also mir und meinem älteren Bruder, Skat spielte. So kam es, dass ich Johann um seine Unterstützung bat.
Kartenspiel unter Freunden
„Johann“, wandte ich mich an den Kellner, der stets bereitstand, seine Gäste zu bedienen, „bringen Sie mir bitte das Jahrbuch, welches zum 125jährigen Bestehen unseres Clubs erschienen ist.“
„Kommt sofort.“
Wenige Augenblicke später brachte er das gewünschte Buch. Ich blätterte ein paar Seiten und suchte das Bild mit den vier Skatspielern.
Sylvia rückte etwas dichter zu mir heran. Das war mir angenehm. Ich spürte ihre Wärme und atmete ihr dezentes Parfüm. Sie hatte eine betörende Ausstrahlung. Ich fand das Bild und drehte es ihr zu, damit sie es besser erkennen könnte.
„Nenne mir bitte die Namen der Spieler“, bat sie mich.
„Fangen wir mit dem Herrn an, der eben die Karten gegeben hat und sich nun entspannt zurücklehnt. Es ist mein Vater. Er ist bei dieser Runde der sogenannte Kiebitz, der nur zuschaut (und gelegentlich den anderen in die Karten schaut), denn es gibt bei jedem Spiel nur drei Spieler. Wenn sie aber zu viert sind, so wie jetzt, dann spielt einer nicht mit und gibt die Karten. Beim nächsten Spiel folgt der nächste und so fort reihum.“
„Das geht immer so weiter?“
„Ja, bis zum Ende des Abends, der sich über mehrere Stunden erstrecken kann. Also der Reihe nach im Uhrzeigersinn:
● Anton Degenhardt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, mein Vater
● Herrmann Schwarzer, Inhaber der Firma: Schwarzer, Getreide Großhandel
● Klaus Niehoff, Vorstandsvorsitzender der Neptun-Werft
● Hinrich Salzmann, Teilhaber der Blume-Bank.“
„Ich weiß nicht, ob ich mir alle Namen merken kann“, sagte sie. Die Herren sind einheitlich gekleidet mit Anzug, weißem Hemd und Schlips. Sehr konservativ. Fast alle rauchen Zigarren und trinken Wein, nur einer trinkt Bier. Kein großer Unterschied zwischen ihnen. Keine auffälligen Merkmale, die ich mir merken könnte.“
Doch plötzlich stutzte sie und zeigte sie auf den Herrn mit dem dichten schwarzen Haar, der die anderen Herren an Größe und Statur überragte: „Wer ist dieser Mann?“, fragte sie fast ängstlich, jedenfalls schien es mir so, aber ich ging darüber hinweg.
„Das ist Herrmann Schwarzer. Er ist sozusagen der Primus interePares. “
„Was heißt das? Ich habe kein Abitur und auch nicht studiert. Ich spreche kein Latein, habe nur die Mittlere Reife geschafft. Meine Eltern hatten kein Geld für eine höhere Ausbildung ihrer Tochter. Sie besorgten mir eine Lehrstelle bei einem Orgelbauer, wo ich für meinen Unterhalt selber sorgen musste.“ „Daher also deine Liebe zur Kirchenmusik.“ „Wahrscheinlich. Vielleicht ist sie auch angeboren.“
„Aber zurück zu Herrn Schwarzer auf dem Foto. Warum interessierst du dich so für ihn? Hast du ihn schon mal gesehen?“
„Nein, nicht in Wirklichkeit. Aber er scheint mir irgendwie vertraut, als ob ich ihm schon mal begegnet sei.“
„Möchtest du mir sagen, wo das war?“
„Das kann ich nicht, denn er existiert nicht in der Wirklichkeit. Er ist ein Phantom, eine Figur aus einem Märchenbuch, aus dem mir meine Mutter vor dem Schlafengehen vorlas.“
„Um welches Märchen handelte es sich? Jedenfalls muss es dich sehr beeindruckt haben.“
„Es war das Märchen von der verlorenen Seele: Ein Mann hatte beim Kartenspiel seine Seele für Wein oder Geld an den Teufel oder Dämon verspielt. Sein Gesicht ist mir unauslöschlich in Erinnerung geblieben, es glich dem von diesem Mann auf dem Bild“, und dabei zeigte sie auf Herrn Schwarzer.
„Ich kenne das Märchen“, sagte ich betroffen, „es ist von Hauff. Die Szene wurde mehrfach in Bildern wiedergegeben, unter anderen von Dannemann. Du kannst es im Ratskeller als Fresko sehen.“
Damit gab sie sich zufrieden und wandte sich erneut dem Foto zu.
„Wer ist dein Vater?“, fragte sie und kehrte damit wieder zu dem vertraulichen Du zurück.
„Dieser“, und ich zeigte auf den Herrn, der gerade die Karten an seine Mitspieler verteilt.
„Der sieht nett aus“, sagte sie. „Er hat ein schalkhaftes Lächeln. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen.“
„Das wird sich nicht einrichten lassen, er verstarb vor einigen Jahren ganz plötzlich an Herzversagen.“
„Entschuldige, das konnte ich nicht wissen.“ „Natürlich nicht, aber ich bin sicher, ihr beide hättet euch gut verstanden.“
„Sicher, ich kann gut mit älteren Herren umgehen, wenn sie höflich und gebildet sind.“
„Nun, dann muss ich wohl noch etwas warten.“ „Nicht zu lange, schließlich werde ich auch nicht jünger.“
Johann hatte unser Gespräch aus respektvoller Distanz verfolgt. Ich hatte das bemerkt und bat ihn an unseren Tisch: „Ich glaube mich zu erinnern, dass Sie damals hier schon tätig waren.“
„Ja, ich erinnere mich gerne an jene Zeit und die Skatabende der vier Herren. Es ging bei ihnen immer sehr zivilisiert zu, nicht zu vergleichen mit Skatgruppen, die man gemeinhin in Bierkneipen findet, wo es meistens zu lärmenden Trinkgelagen kommt. Hier im Club achteten sie sehr auf angemessene Formen. Stets nahmen sie Rücksicht auf die anderen Gäste, die in Ruhe ihr Essen verzehrten und nicht gestört werden wollten. Die Herren nahmen ihr Spiel sehr ernst, vergaßen aber nicht, sich gegenseitig auf die Schippe zu nehmen, wenn sich dazu die Gelegenheit bot. Sie tranken nicht viel, weil sie sich auf ihr Spiel konzentrierten. Jeder wollte gewinnen, obwohl es nicht um große Beträge ging. Es ging wohl mehr um die Ehre, den Abend als Gewinner zu beenden. Für mich bedeutete es ein ordentliches Trinkgeld, denn Herr Schwarzer, der meistens die Rechnung beglich, war immer sehr großzügig und ließ sich nie lumpen.“ Während Johann das erzählte hatte sich sein Gesichtsausdruck verändert, er schien irgendwie verjüngt. Sylvia hatte es bemerkt und bat ihn, noch mehr von den alten Zeiten zu erzählen.
Fragend sah er mich an, denn er war es nicht gewohnt, mit seinen Gästen private Gespräche zu führen, es widersprach seiner Erziehung und den Gepflogenheiten. Zudem würde er die Grenze der sozialen Schichten überschreiten, was er als unstatthaft empfand. In diesem Fall aber fühlte er sich ermuntert, die unsichtbare Grenze zu überschreiten, die zwar nirgendwo festgelegt war, aber doch vorhanden war. Möglich, dass die unmittelbare Nähe zu der charmanten Frau ihn verleitete, sich Freiheiten zu gestatten, die ihm nicht zukamen. Deshalb wandte er sich erneut mir zu und bat mich dezent um meine Einwilligung.
„Erzählen Sie uns von alten Zeiten, als der Club noch ein reiner Herrenclub war und Damen nur in begründeten Fällen Zutritt hatten. Auch ich würde gerne mehr darüber erfahren. Schließlich war ich damals noch kein Club-Mitglied, allenfalls als Gast meines Vaters geduldet.“
„Mit Ihrer Erlaubnis“, sagte er mit einer leichten Verbeugung.
Johann begann also von den Skatabenden zu erzählen. Er berichtete anschaulich, und ohne Scheu. So war es unterhaltsam, und die Zeit verging wie im Fluge.
„Es hatte sich ein Ritual herausgebildet“, begann er, „das sich stets in gleicher Weise wiederholte. Die Herren nahmen ihre angestammten Plätze ein, bestellten den Wein und zündeten sich ihre Zigarren an. Sie waren bereit, denn freundlichen Wettstreit zu beginnen.
Das Spiel verlief jeden Abend im Prinzip ziemlich gleich – oder wenigstens ähnlich. Man mischte und verteilte die Karten nach vorgeschrieben Regeln. Die Herren ordneten ihre Karten, prüften ihre Werte, blickten ernst und begannen mit dem Reizen. Irgendwann hatte einer das meiste geboten, nannte irgendeine Farbe, und das Spiel begann, indem einzelne Karten der Reihe nach auf den Tisch geworfen wurden. Dann wurde gezählt und der Sieger ermittelt. Herr Schwarzer dokumentierte das Ergebnis betont umständlich und theatralisch. Dann ging alles wieder von vorne los. Und so ging es immer weiter, bis zum Schluss addiert, gerechnet und der Gewinner des Abends ermittelt wurde.“
Es folgten noch einige mehr oder weniger bedeutsame Begebenheiten, die sowohl das Spiel betrafen als auch die Randerscheinungen. Er versuchte sich auf das Wesentliche zu beschränken, weil er sich als Alleinunterhalter in diesem Umfeld und mit diesen besonderen Gästen nicht so recht wohl fühlte.
Damit schien er seinen Bericht beenden zu wollen, vielleicht auch aus Furcht, sich in intimere Details zu verlieren.
Sylvia hatte ihm aufmerksam zugehört und war sichtlich enttäuscht, nichts Aufregendes erfahren zu haben. Daher bat sie ihn, noch etwas hinzuzufügen, das ihre Phantasie anregen könnte, vielleicht sogar etwas Intimes, das ihm im Gedächtnis geblieben sei. Möglich, dass der Wein die Ursache war, ihre Scheu zu überwinden. Mit einem flüchtigen Blick, schien sie sich bei mir für ihre mangelnde Zurückhaltung zu entschuldigen, denn sie hatte wohl das Gefühl, mit ihrer Bemerkung etwas zu weit gegangen zu sein. Ich aber nickte ihr aufmunternd zu, vielleicht sogar, weil es mir ähnlich ergangen war. Auch ich hätte gerne mehr Details erfahren, die mir sonst nicht zugänglich waren.
So setzte Johann, solchermaßen ermuntert, seine Erzählung fort. Er hätte noch viele Episoden hinzufügen können, weil die Szene unter einem Gewölbe stattfand, das gleichsam als verborgene Schallbrücke diente. Das wussten nur wenige Eingeweihte, in Sonderheit die Bedienung, nicht aber die Gäste. Es wurde als geheime Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch – behandelt.
Zu diesem engen Kreis der Eingeweihten zählte natürlich auch Johann, der nun freimütig von dem Ende eines Skatabends berichtete, an dem Herr Schwarzer seine Freunde zum Aufbruch mahnte:
„Meine Freunde, für heute muss ich mich leider von euch verabschieden, denn ich habe noch eine Verabredung, bei der ich nicht zu spät kommen darf. Johann soll alles auf meine Rechnung setzen.“
„Geht in Ordnung“, sagte Hinrich, „es trifft ja keinen Armen.“
„Wie verabredet“, sagte Herrmann, bevor er den Raum verließ, „treffen wir uns mit unseren Damen nächste Woche am Samstag um viertel vor elf Uhr am Hauptbahnhof, Gleis drei zu unserem geplanten Ausflug ins Blaue. Ich habe zwei Abteile erster Klasse für uns reservieren lassen.“
„Wir werden pünktlich sein“, sagte Klaus, und alle anderen nickten zustimmend.
„Also bis dann“, fuhr Herr Schwarzer fort, „ich hoffe, dass alle unsere Damen mit von der Partie sein werden. Und vergesst nicht, eure Kinder mitzubringen. Meine Tochter kommt in jedem Fall.“ „Das freut mich“, sagte Anton. „Dann lernt sich auch die nächste Generation kennen. Ich hoffe, dass auch mein Sohn kommt. Er steckt allerdings mitten im Studium und ist sehr fleißig. Er wird wohl absagen müssen. Meine Frau ist mit Sicherheit von der Partie, denn sie freut sich auf das Wiedersehen mit euch.“
„Meine Frau kommt auch“, sagte Herrmann, und nickte seinen Mitspielern freundlich zu. Ich glaube, sie bereitet irgendetwas Geheimnisvolles vor, aber sie spricht nicht darüber. Lassen wir uns überraschen. Damit verließ er den Raum durch den Hintereingang.
Als die restlichen Skat-Brüder unter sich waren, begannen sie mit etwas gedämpfter Stimme das Resümee des Abends zu ziehen:
„Was Herrmann wohl so eilig nach Hause drängt?“, erkundigte sich Klaus.
„Vielleicht hat er eine Freundin, die auf ihn wartet“, meinte Anton.
„Seine Frau kann’s wohl nicht sein, sie ist ein rechter Besen. Ich wundere mich, dass er sie so lange ertragen hat. Ich hätte sie schon lange in die Wüste geschickt.“
„Es ist ja nicht nur, dass sie in den letzten Jahren so unmäßig auseinandergegangen ist, es ist viel mehr, dass sie so indiskret ist“, sagte Hinrich. „Oft ist es mir richtig peinlich, wenn man hört, was sie so alles an intimen Details aus seinem beruflichen Umfeld ausplaudert.“
„Wir werden sie am nächsten Wochenende genießen dürfen. Ihr kommt doch alle mit euren Frauen?“ „Klar. So eine Einladung lassen wir uns nicht entgehen. Meine Frau ist schon ganz gespannt, wohin diesmal die Reise geht.“
„Lassen wir uns überraschen. Wir sehen uns in ein paar Tagen in alter Frische und ich wünsche euch einen guten Heimweg.“ Über Johanns länglichen Bericht war die Zeit vergangen. Offenbar hatte er Zeit und Ort vergessen und war vollkommen in seiner Erzählung aufgegangen. Dann schlug die Dom Uhr und weckte ihn abrupt aus seinen Gedanken.
Sichtlich verlegen und zugleich auch etwas verwirrt blickte er auf seine Uhr: „Herr Dr. Degenhardt, entschuldigen Sie die Störung, aber ich muss Sie auf die polizeiliche Sperrstunde hinweisen. Sie kennen die Bestimmungen. Leider müssen wir vor Mitternacht schließen. Ich möchte Sie daher bitten, die Clubräume zu verlassen. Ich bekomme sonst Schwierigkeiten.“
„Ich kenne die Gesetze und respektiere sie. Setzen Sie den Betrag auf meine Rechnung“, erwiderte ich. Auch ich hatte die Uhrzeit vergessen und war gespannt seiner Erzählung gefolgt. Nur allzu gerne hätte ich gewusst, was Herren Schwarzer an diesem Abend so dringlich zum Abschied genötigt hatte.
„Geht in Ordnung.“
Wir verließen den Club durch den Hinterausgang, durchschritten die Böttchergasse und erreichten nach wenigen Augenblicken ihr Hotel. Dort verabschiedeten wir uns in der Lobby. Ich gab ihr meine Visitenkarte mit dem Bemerken, dass ich mich um ihr steuerliches Anliegen kümmern würde, sofern sie es wünsche. Und wenn sie sonst meiner Hilfe bedürfe, solle sie nicht zögern, mich anzurufen.
Sie dankte mir für den anregenden Abend und gab mir zu verstehen, dass auch sie mich gerne bei passender Gelegenheit wiedersehen würde. Das müsse nicht nur zum Zweck der Steuererklärung sein, setzte sie vielsagend hinzu. Es klang überzeugend.
Wir wünschten uns gegenseitig eine gute Nacht.
Nachdenklich und innerlich bewegt lenkte ich meine Schritte nach Hause. Es war nicht weit. Nur über die „Große Weserbrücke“ dann zum „Teerhof“, einer kleinen Insel mitten in der Weser.
Beim Abschied hätte ich sie gern in den Arm genommen, ihr vielleicht sogar einen freundschaftlichen Kuss gegeben, aber das wäre für einen angesehenen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in seiner Heimatstadt unpassend gewesen, vielleicht ein andermal, wenn wir uns besser kennengelernt hätten, was durchaus meinen Wünschen entsprach.
So ging ich die paar Schritte zu meinem Apartmenthaus, nahm den Fahrstuhl in den dritten Stock, öffnete die Tür und streichelte meine Katze, die mich kläglich miauend begrüßte. Nachdem ich ihr etwas zum Fressen gegeben hatte, schnurrte sie behaglich auf meinem Schoß. Sie war die einzige, die auf mich wartete. Im Grunde machte mir das Alleinsein nicht viel aus, denn ich war es gewohnt, und außerdem war ich immer der Meinung gewesen, dass ich mir ein guter Gesellschafter und Gesprächspartner sei. Und doch musste ich zugeben, dass ich mich zuweilen nach einer Partnerin sehnte. Das war immer dann der Fall, wenn ich Lust hatte, irgendwo lecker zum Essen oder ins Konzert zu gehen. Auch zum Reisen hätte ich gerne eine Begleitung gehabt, um Empfindungen und Gedanken auszutauschen und sich gegenseitig anregen zu lassen. Vielleicht hätte ich Sylvia fragen sollen, ob sie nicht am Wochenende mit mir einen Spaziergang durch die Wallanlagen machen wollte. Nein, das wäre zu aufdringlich gewesen. Außerdem würde ich sie ohnedies am nächsten Tag im Konzert sehen, dann könnte ich sie bei passender Gelegenheit fragen. Jedenfalls wollte ich nichts überstürzen. Die Dinge würden ohnedies ihren schicksalhaften Lauf nehmen.
Ich gönnte mir ein Glas Rotwein aus der angebrochenen Flasche vom Vortag, ließ mich genüsslich auf dem Sessel am Fenster nieder und versank in sehnsuchtsvollen Träumereien: Das war wirklich ein herrliches Weib. Bestimmt hätte Richard Wagner ihr zu Füßen gelegen und eine grandiose Arie für sie komponiert. Und ich? Was könnte ich für sie tun? Ich konnte nicht komponieren, konnte nicht einmal richtig singen, und was sonst? Ich war ja nichts anderes, als ein besserer Buchhalter, sicher ein gut situierter angesehener Steuerberater, Inhaber einer ererbten Anwalts-Kanzlei, aber auch nicht mehr.
Mein Blick fiel auf die Altstadt, die von den beiden Domtürmen sicher bewacht wurde. Ich liebte diesen Blick auf meine Vaterstadt, denn von hier aus hatte ich alles im Griff, bildete ich mir ein, was natürlich nicht stimmte. Außerdem hätte ich es nicht so haben wollen, denn ich hatte keinen ausgeprägten Hang zu Macht. Im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl, dass die Macht die Menschen korrumpiert. Und das wollte ich auf garkeinen Fall an mir selbst erleben. Eigentlich wollte ich nur ganz bescheiden in gewissem Wohlstand leben, wollte weder bewundert noch beneidet werden.
Wie dem auch sei: Dort unten vor meinem Fenster schien alles still und wohlgeordnet zu sein: Kein Lärm, kein Streit. Nur wenige Menschen auf der Straße, kein Hasten und Jagen. Nur von den Domtürmen hörte ich zwölf Glockenschläge, die den alten Tag verabschiedeten und den neuen Tag ankündigten. Alles lag im tiefen Schlaf. Aber das täuschte, denn nicht alle schliefen zu dieser späten Stunde. Einige Straßenbahnen fuhren über die Große Weserbrücke, vereinzelte Fußgänger schlenderten am gegenüberliegenden Tieferufer. Entweder befanden sie sich auf dem Heimweg oder auf dem Weg zur Arbeit. Was auch immer sie trieb, sie folgten ihrem vorgeschriebenen Weg. Ich aber fühlte mich in diesem Augenblick verlassen und einsam. Wie das?
Diese Frau: Sie konnte einen schon zum Träumen verleiten, mancherlei Gefühle wecken. Was würde uns die Zukunft bringen? Ich war davon überzeugt, dass wir sie irgendwie gemeinsam für uns gestalten würden. Warum eigentlich? Nur wegen eines harmonischen Abends in gepflegter Umgebung? Da musste noch mehr sein. Man würde sehen.
Schon nach kurzer Zeit begannen sich meine Gedanken zu verwirren, ich versank in einem Halbschlaf: Wir saßen wieder im Club gerade wie vordem. Erneut vollzog sich das Ritual, jedoch nur in meinen traumähnlichen Bildern. Jetzt begannen sich bei mir die beiden Welten gegenseitig zu durchdringen. Hier Erinnerung, dort Realität. Die Bilder hatten unscharfe Konturen. Vielleicht kann man es am besten verstehen, wenn man sich in die Welt der Bilder von Michelangelo versetzt, insbesondere in seinem monumentalen Jüngsten Gericht, das er für die Sixtinische Kapelle im Vatikan