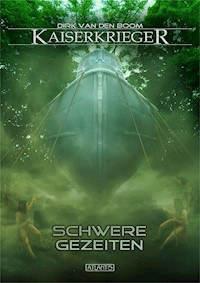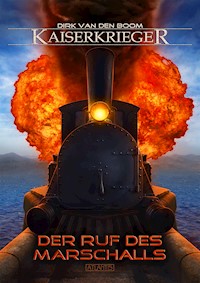Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Hauptmann Geradus Kathain war ein Held, der seinem Reich in einem schier endlosen Krieg treu gedient hat. Als er nach dem Sieg seinen verdienten Lohn erwartet, wird er ein Opfer jener Kräfte, die in dem berühmten Helden eine Bedrohung ihrer politischen Ziele sehen. Statt mit Reichtümern überhäuft zu werden, schiebt man den Hauptmann in die entfernteste, kleinste und ärmste Provinz ab, in der Hoffnung, dass er dort versauern möge. Resigniert und nur noch vom Bedürfnis nach Ruhe und Frieden beseelt, akzeptiert Geradus Kathain diesen kargen Lohn. Doch als er antritt, der Lord zu Tulivar zu werden, merkt er rasch, dass die Vergangenheit ihn nicht los lässt - und dass sein neues Amt seine ganz eigenen Herausforderungen bereit hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ein Lord zu Tulivar
Prolog
1 Beim Grafen
2 Floßheim
3 Die Brücke
4 Nach der Brücke
5 Tulivar
6 Mehr als eine Brücke
7 Nach Norden
8 Der kleine Endo
9 Das Versteck
10 Der Weg nach oben
11 Besuch in Tulivar
12 Die Schlacht um Tulivar
13 Rückkehrer
14 Das Fest
15 Handelshemmnisse
16 Dorfschulzen
17 Die Wahl
18 Der Zehnte
19 Eine andere Form der Leidenschaft
20 Das große Theater
21 Ein Winter
22 Neja, die Sprecherin
23 Vorbereitungen
24 Skoberg
25 Nach Norden
26 Loka, der Späher
27 Der Krieg um das Gold beginnt
28 Die Schlacht um das Kastell
29 Ernsthafte Gespräche
30 Ein Graf zu Bell
31 Strategie des Gleichgewichts
32 Das Netz
Epilog
Weitere Titel im Atlantis Verlag
Dirk van den Boom
Ein Lord zu Tulivar
Eine Veröffentlichung des
Atlantis-Verlages, Stolberg
Dezember 2012
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses eBook ist auch als Hardcover direkt beim Verlag erhältlich und als Paperback überall im Handel (ISBN 978-3-86402-058-2).
Titelbild: Tony Andreas Rudolph
Umschlaggestaltung: Timo Kümmel
Lektorat und Satz: André Piotrowski
eBook-Erstellung: www.remscheid-webdesign.de
Besuchen Sie uns im Internet:
www.atlantis-verlag.de
Prolog
Und so wurde Hauptmann Geradus Kaitan für seine Dienste im Großen Krieg belohnt.
Der Herzog von Farnmoor, der ihm einst für eine Summe von 1000 Dukaten ein Offizierspatent verkauft hatte, verzichtete auf die drei letzten Raten des Preises, weil Kaitan bei der Schlacht von Helk mit seinen Männern die drohende Einkesselung durch die Elitegarde der Dramanen verhindert hatte.
Die Lady Biela, Witwe des Herzogs von Storn, überreichte ihm ein Pfand der Verbundenheit als Dank dafür, dass er ihr die Leichname ihres Mannes, ihrer beiden älteren Söhne, ihres Onkels, ihrer beiden Brüder sowie ihres Liebhabers zurückgebracht hatte.
Imperator Sansor der Gütige, siegreich in den Trümmern seiner eigenen Hauptstadt stehend, wollte Geradus Kaitan für seine Tapferkeit und seinen zehnjährigen Dienst den Titel eines Herzogs und die Ländereien zu Lormar als Lehen überlassen.
Die üblichen Intriganten im Kronrat, die die Beliebtheit des Kriegshelden fürchteten, wussten dies zu verhindern. Dennoch, daran war nichts zu ändern, dem Hauptmann musste etwas gegeben werden, denn in militärischen Diensten konnte man ihn nicht belassen. Das Imperium war bankrott, der insgesamt 23 Jahre währende Krieg gegen Draman hatte es völlig ausgelaugt. Man hatte gesiegt, dank Männern wie Kaitan.
So erhielt der Hauptmann den Titel eines Barons sowie die Baronie Tulivar, ganz im Norden des Imperiums gelegen, schon seit fast fünfzig Jahren verwaist und lustlos verwaltet vom benachbarten Grafen von Bell. Nördlich von Tulivar gab es nur noch ein Gebirge und die Küste. Westlich gab es Wasser. Östlich gab es Wasser. Südlich gab es den lustlosen Grafen und seine Ländereien. Es war der gottvergessenste Ort des Imperiums.
Aber es war ein Titel.
Notwendigkeiten jeder Art war Genüge getan.
Dreißig Soldaten aus Hauptmann Kaitans Truppe fanden, es sei an ihnen, ihrem Anführer durch weitere Gefolgschaft zu danken. Die Heimatdörfer in Flammen, die Familien von Dramanen entführt oder hingeschlachtet, beschlossen sie, ihr Glück bei jenem zu suchen, der sie durch diesen Krieg geführt hatte. Und da der Hauptmann ihr Schicksal teilte, nahm er sie alle gerne auf und in seine Dienste.
Jeder von ihnen brachte eine Mitgift: ein Pferd, eine Rüstung, Waffen, ein Beutel Gold und den Willen, sich jetzt nicht unterkriegen zu lassen.
Geradus Kaitan hatte sich selbst auch gedankt. Gedemütigt vom Kronrat, brachte er aus den Trümmern der Hauptstadt drei Eselskarren mit, sorgsam abgedeckt durch schweres Tuch. Darin fanden sich Kunstwerke, Schmuck, Möbel, Silber- und Goldmünzen, in den Wirren des langsam beginnenden Wiederaufbaus verschwunden aus den Palais jener, die dafür gesorgt hatten, dass er Baron wurde anstatt Herzog.
Der Weg von der Hauptstadt des Imperiums, dem rauchenden und brennenden Sidium, bis nach Tulivar betrug über eintausend Meilen.
Hauptmann Kaitan und seine Gefährten benötigten dafür sechs Monate. Das Imperium war im Aufruhr. Marodierende Banden, meist entlassene Soldaten, machten die Landstriche unsicher. Kaitan suchte den Kampf nicht. Er hatte genug Blut vergossen, zumindest fürs Erste. Und je weiter sie nach Norden kamen, desto friedlicher und ruhiger wurde es. Selbst zu seinen besten Zeiten war Drogor der Schreckliche, Herr von Draman, nicht so weit nach Norden vorgedrungen. Sie trafen nicht mehr auf verbrannte Dörfer, aber auf Armut, erzeugt durch die brutalen Kriegssteuern, mit denen der Imperator seinen Moloch, seine gigantische Armee finanziert hatte. Auf diese Weise hatte er den Sieg davongetragen. Die Steuern waren nicht gesenkt worden. Das herrliche Sidium musste neu errichtet werden. Die Paläste waren rauchende Ruinen. Das war ein teures Unterfangen.
Sechs Monate dauerte die Reise und die Männer hielten sich aus allem raus. Sie rasteten an einsamen Orten, gestählt durch die Erfahrungen des Krieges. Sie umgingen gefährliche Wegkreuzungen, die beliebtesten Orte für Wegelagerer. Sie mieden Städte, um allzu gierigen Lords zu entgehen, die ihre Steuerschuld auf die einfache Art zu begleichen gedachten. Es dauerte lange, aber niemand starb, keiner hungerte, kein Schwertarm hob sich, kein Pfeil wurde verschossen. Eine willkommene, geradezu wohltuende Abwechslung.
Zwei Männer schätzte Geradus Kaitan als seine Freunde ganz besonders.
Da war zum einen Woldan vom Berg, ein Bogenschütze, der als junger Sohn eines Bauern vor zwölf Jahren in den Militärdienst gepresst worden war. In jener Schlacht vor Sidium, als die Kriegsmagier der Dramanen Kaitans Leute dazu brachten, spontan ihre Eingeweide zu erbrechen, erlegte ein wohlgezielter Pfeil Woldans den Magier, der direkt über Kaitans Einheit geschwebt hatte.
Hauptmann Kaitan hatte es gerne, wenn seine Eingeweide da blieben, wo sie hingehörten.
Zum anderen war da Selur aus dem Dorf Bolnheim. Er war ein schön anzusehender, junger Mann mit feinen Gliedern und engelhaftem Gesicht. Er hatte während der Belagerung von Thornholm mit gleich zwei Pagen des Imperators eine Liebschaft begonnen. So kam es, dass unter dem verrotteten Fleisch und schlechten Zwieback der Verpflegung immer einige gut verpackte Stücke Braten und frisches Brot lagen.
Hauptmann Kaitan schätzte es sehr, gut zu speisen.
Dass er diese zwei Männer seine Freunde nannte, erhob sie lediglich unwesentlich über die verbliebenen neunundzwanzig Soldaten, die sich ihm auf dem Weg nach Tulivar angeschlossen hatten. Sie alle hatten sich mehrfach gegenseitig das Leben gerettet, waren durch Blut und Tränen gewatet, hatten den Verrat von Offizieren, die Torheiten von Generälen und die Zufälle der Schlacht gemeinsam durchlitten. Und sie waren zusammen gewesen, als der Triumph, schon nicht mehr erhofft, sicher nicht erwartet, am Ende der ihre gewesen war. Gemeinsam hatten sie auf den Mauern des brennenden Sidium gestanden und beobachtet, wie der Angriff der Gegner brach und die Reste der Streitmächte des Drogor davonrannten so schnell es nur ging – und dabei vorzugsweise über die Leiche ihres verrückten Königs trampelten, selbst wenn es einen kleinen Umweg bedeutete.
Sie alle, Hauptmann Kaitan vorneweg, meinten, es gebe nichts, was sie nicht gesehen, keine Tat, die sie nicht vollbracht, kein Gefühl, das sie nicht durchlebt hatten. Tulivar, das Ende der Welt, die ärmste aller Provinzen, seit Jahrzehnten vernachlässigt, mit nichts als Grenzen und einem lustlosen Nachbarn, erschien ihnen wie eine sehr geringe Herausforderung. Ja, so mancher erhoffte sich Ruhe und Entspannung, vielleicht die Gunst einer einfachen Maid, die simplen Freuden des Lebens, zumindest für eine Weile.
Kurz vor Ende ihrer Reise kamen sie in der Grafschaft zu Bell an, einem lang gestreckten Gebiet, regiert aus der Stadt Bell, dem Sitz von Burg Bell und dem Grafen zu Bell. In dieser kargen Gegend des Nordens, in der es kaum Straßen gab und die Bevölkerung dünn gesät war, herrschte an allem Mangel, und das offenbar auch an Einfallsreichtum.
Die Geschichte des Barons von Tulivar, Geradus Kaitan, begann, wenn überhaupt ein fester Beginn zu finden war, hier, im Audienzraum von Feltus Graf von Bell.
1 Beim Grafen
Ich war mir nicht sicher, was von dem ältlichen Mann zu halten war. Normalerweise verließ ich mich auf meine Menschenkenntnis, und diese hatte mir im Verlaufe meines Lebens bereits gute Dienste geleistet. Wie sollte man sonst eine Truppe von gut 200 Mann führen, mit den ständigen Neuzugängen, die die Lücken auffüllten, ohne Zeit für lange Gespräche und Übungen? Feltus Graf von Bell war vom Äußeren her unscheinbar, ein hagerer Mann, an dessen Leib das etwas abgerissene, aber sorgfältig geflickte gräfliche Gewand aus Samt und Baumwolle hin und her schlackerte. Sein Blick war wässrig und seine Bewegungen langsam, aber keinesfalls schwächlich, wie ich beim Händedruck feststellen durfte.
Seine Stimme war sanft, dünn. Das konnte täuschen. Ich wechselte einen kurzen Blick mit Woldan und Selur, die mich begleitet hatten. Woldan deutete ein Achselzucken an. Selur war, wie immer, alles egal. Mit seinem bezaubernden Lächeln tänzelte er durch den Audienzsaal und verzauberte die wenigen anwesenden Damen; die wussten nicht, auf was sie sich da einließen.
»Ihr seid also Baron Tulivar?«, fragte der Graf zur Begrüßung.
»So sieht es aus.«
»Willkommen auf Burg Bell. In gewisser Hinsicht habe ich Eure Ankunft sehnlich erwartet.«
»Ist das so?«
»Setzt Euch an meinen Tisch. Gorbarn, bediene uns!«
Wir wurden an einen schweren Eichentisch vor dem thronähnlichen Sessel des Grafen geführt, und als wir uns setzten, wurde bereits aufgetragen. Ich war hungrig und ließ mich nicht zweimal bitten. Es gab kaltes Geflügel, frisches Brot, Käse, Bier und Wein. Eine einfache Mahlzeit, doch in ihr bewegte sich nichts und sie hatte keine interessanten Färbungen angenommen. Damit war ich bereits zufrieden.
»Ihr habt mich erwartet, Graf?«
»Ja, Baron Tulivar. Und das nicht nur deswegen, weil Euer Kommen unausweichlich war, seitdem ich durch einen Boten die Ernennungsurkunde des Imperators erhalten habe, sondern auch, weil ich sehr darauf gehofft habe, dass mir jemand die Last Tulivar abnimmt. Ich bin seit meiner Jugend Sachwalter der Baronie, und diese Arbeit habe ich niemals genossen.«
Ich stopfte mir eine kalte Hähnchenkeule in den Mund.
Meiner Aussprache tat dies nicht gut, aber da dem Grafen das Bier den dünnen Bart entlangtropfte, vermutete ich, dass das kein Problem war.
»Tulivar ist ein problematischer Landstrich?«
Der Graf zu Bell wischte sich über den Mund und sah mich direkt an. In seinen Augen stand so gar keine Müdigkeit, als er antwortete.
»Baron, ich darf offen sprechen. Daran müsst Ihr Euch ohnehin gewöhnen, denn das ist hier üblich, weitab vom Hofe und der feinen Gesellschaft.«
Ich grinste. »In den letzten zwölf Jahren bestand meine feine Gesellschaft aus Männern mit Schwertern, aber ohne Manieren – sowie aus Männern mit Schwertern, die mich umbringen wollten. Ich werde an klarer Sprache keinen Anstoß nehmen.«
»Wunderbar. Baron, man hat Euch ganz gründlich verarscht.«
Ich nickte und nahm einen Schluck Wein. Einfacher Landwein, aber nicht mit Pferdepisse gestreckt. Mir mundete er.
»Ich weiß, Graf. Ich sollte ein Herzog werden.«
»Mir ist zu Ohren gekommen, Ihr habt das Leben des Kronprinzen gerettet.«
»Des damaligen Kronprinzen, ja. Ich konnte nicht verhindern, dass er sich anschließend bei einer Hure die Syphilis holte und jämmerlich verreckte.«
Der Graf lächelte nachsichtig. »Und dennoch …«
»… wurde ich verarscht. Ich hatte mir den Adel verdient, das wusste jeder, bloß war ich zu talentiert und fähig, um mich in der Nähe des Imperators zu lassen. Der Kronrat musste sein Gesicht wahren und mich gleichzeitig aus dem Weg räumen.«
Graf von Bell rülpste. »Man hätte Euch besser umbringen sollen. Ist das nicht die bevorzugte Lösung bei Hofe?«
»Wer sagt Euch, dass man es nicht versucht hat?« Ich grinste immer noch.
»Wie oft?«
»Dreimal. Dann musste man etwas tun, denn die Wartezeit bis zu meiner Ernennung zu … irgendwas … zog sich zu sehr in die Länge.«
»Also Tulivar.«
»Das Zweitbeste nach dem Tod.«
»Seid Euch nicht so sicher.«
Ich stellte meinen Weinkelch ab und tupfte mir mit dem Ärmel den Mund ab. Ein wenig wollte ich als Mann von Adel doch auf die Etikette achten.
»Ihr seid der Herr von Tulivar«, stellte der Graf fest. »Ich selbst bin nur ein einziges Mal dort gewesen und es ist kein Besuch, an den ich mit Freude zurückdenke.«
»So schlimm war der Empfang?«
Der Graf zuckte mit den Achseln. »Es gab keinen Empfang. Baronie Tulivar besteht aus drei Dörfern: Felsdom, ganz im Norden, direkt am Gebirge. Tulivar selbst, die, nun ja, Hauptstadt. Sollte wohl mal eine Stadt werden, hat es in den vergangenen hundert Jahren aber nie so richtig hinbekommen. Und dann wäre da Floßheim, direkt am Fluss Wul, der die Grenze zwischen Eurem und meinem Gebiet darstellt. Gerüchteweise verirrt sich sogar hin und wieder mal ein Reisender bis dahin. Aber das sind wirklich nur Gerüchte.«
»Das ist alles? Drei Dörfer?«
Der Graf nickte. »Bewohnt mit eher grantigen und geistig etwas zurückgebliebenen Zeitgenossen, bettelarm dazu. Ich habe, glaube ich, zweimal versucht, dort Steuern einzutreiben. Meine Männer haben mehr für das Futter ihrer Pferde bezahlt, als sie in barer Münze eingetrieben haben. Und die Naturalabgaben haben sie unterwegs als Wegzehrung verspeist. Das Einzige, was ich erfolgreich eingetrieben habe, waren Rekruten für den Krieg. Ich hoffe, Ihr seid furchtbar reich, mein Baron.«
Ich schürzte die Lippen und dachte an meine Karren. »Es geht so.«
»Ihr werdet jedes Kupferstück bitter nötig haben.«
»Wer verwaltet das Land in Eurer Abwesenheit?«, fragte ich.
»Es gibt einen Kastellan in Tulivar, den alten Frederick. Er ist so etwas wie mein Repräsentant.«
»Ein Kastellan? Es gibt also eine Burg?«
Graf zu Bell lachte meckernd und ließ sich Wein eingießen. »Einen alten, baufälligen Turm. Sollte wohl mal eine Burg werden, hat es in …«
»… den vergangenen hundert Jahren aber nie so richtig hinbekommen, ja, ich verstehe.« Meine Laune war durch die Schilderungen des Grafen nicht besser geworden. Ich wollte jetzt auch mehr Wein haben und winkte dem Diener, der mir beflissen einschenkte.
Der Graf sah mich wissend an und lächelte. »Wein trinkt man da oben ebenfalls nicht viel. Es gibt einen brutalen Schnaps, habe ich mir sagen lassen.«
Der Graf warf einen Blick auf Selur, der immer noch mit einigen Leuten aus seinem Gefolge parliert hatte, aber nun zu uns kam. »Viele ansehnliche Frauen gibt es dort auch nicht. Ich hoffe, Eure Männer sind nicht allzu wählerisch.«
Selur grinste, als er das hörte.
»Was ist mit hübschen Knaben?«
Der Graf zu Bell runzelte die Stirn.
»Die werden Euch die Kehle aufschneiden«, sagte er dann.
Selur war unbeirrbar. »Ziegen? Schafe?«
Der Graf schaute meinen Freund mit leerem Blick an, doch ich lachte. Ein Astloch würde dem Unersättlichen bereits genügen, wenn es denn nichts anderes gab.
»Ihr seid mein Oberherr als Graf des Reiches«, sagte ich nun und spielte dabei mit dem Weinkelch. »Welche Dienste erwartet Ihr von mir?«
Der alte Mann sah mich überrascht an, als hätte er sich darüber noch nie Gedanken gemacht.
»Baron Tulivar, ich bin froh genug, dass Ihr mir dieses Stück Dreck vom Leibe schafft. Es gibt nichts, womit Ihr mir werdet helfen können. Und kommt nicht auf die Idee, mich um irgendwas zu bitten. Zum einen ist Tulivar noch einmal vier Tagesreisen von hier entfernt. Dazwischen liegen auf meiner Seite nur das Dorf Goviar, ein kümmerlicher Haufen renitenter Holzfäller und Flussfischer, und Euer Floßheim, ein ebenso kümmerlicher Haufen renitenter Holzfäller und Flussfischer. Was auch immer Ihr von mir wollt: Fragt nicht! Wir lassen uns in Ruhe.«
»Was ist mit den Steuern? Der Imperator ist, nun ja …«
»Pleite.«
»Das beschreibt es ganz gut.«
Der Graf hob die Schultern. »Ich bin arm. Meine Leute sind arm. Im Vergleich zu Tulivar leben wir aber im Luxus. Versucht mal, die Steuern einzutreiben. Ihr werdet blaue Flecken bekommen, glühende Ohren aufgrund sehr einfallsreicher Beleidigungen sowie allgemeine Verachtung erleiden. An Gold glaubt bitte nicht.«
Ich verstand. Meine Laune wurde daraufhin noch ein gutes Stück schlechter. Ich winkte Gorbarn, dem Diener. Er lächelte verständnisvoll und schenkte ein.
»Es tut mir leid, Euch nichts Besseres berichten zu können«, sagte der Graf ohne jedes Bedauern. »Ich bekomme einmal im Jahr so etwas wie einen Bericht des Kastellan, selten mehr als eine Schriftrolle voll, in dem er mir über die Anzahl der Ziegen in Tulivar berichtet.«
Aus irgendeinem Grunde warf er dabei Selur einen Blick zu, den dieser lächelnd und voller Vorfreude erwiderte.
»Ich weiß im Grunde nicht, was sich dort abspielt, Baron. Es bleibt Euch nichts übrig, als sich vor Ort ein Bild zu verschaffen.«
Ich schaute in den erneut geleerten Kelch und freute mich über das warme Gefühl in meinem Magen.
»Das werde ich tun. Ich bin der Baron«, brachte ich hervor.
»Ihr seid der Herr von Tulivar«, bestätigte der Graf erneut und er war sichtlich erleichtert darüber, diese Aussage machen zu dürfen.
Ich erhob mich.
»Herzlichen Dank für Eure Gastfreundschaft«, sagte ich und verneigte mich. »Ihr habt mir gesagt, was es zu sagen gab. Ich bin jetzt möglicherweise nicht besser auf mein neues Amt vorbereitet, aber ich weiß zumindest, dass ich alles erfahren habe, was ich im Vorfeld habe herausfinden können.«
Auch der Graf stand auf.
»Ihr seid herzlich eingeladen, die Nacht in meinen Gästequartieren zu verbringen, Baron Tulivar.«
»Das Angebot ehrt mich. Aber es ist gerade Mittag geworden. Wir werden aufbrechen und versuchen, die genannten vier Tagesreisen so gut wie möglich hinter uns zu bringen. Der Weg bis Floßheim dürfte nicht zu verfehlen sein.«
»Es gibt eine Straße von hier bis Plum, der letzten Stadt im Norden, die diesen Namen verdient. Von Plum bis Goviar gibt es … Feldwege ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Wir haben ordentliches Wetter, ich bin mir sicher, man wird sie erkennen können. Die Reise wird dann beschwerlich werden.«
Mich kümmerte das nicht. Ich hatte endlose Meilen zurückgelegt, ohne auch nur in die Nähe eines Weges zu kommen.
»Kann man nicht auf dem Fluss reisen?«
»Ab Plum, ja, denn der Wul macht einen weiten Bogen bis zur Stadt. Aber gerade weil er so einen großen Bogen macht, werdet Ihr einen gigantischen Umweg reisen. Angenehmer sicher, bei guter Strömung und passenden Winden auch recht schnell, aber es wird sicher mehr als vier Tage dauern, bis Ihr in Floßheim seid. Von Tulivar, Eurer … äh … Hauptstadt, seid Ihr dann noch einen weiteren Tag entfernt, vielleicht zwei. Es ist Eure Entscheidung.«
Natürlich fiel es mir leicht, diese zu treffen. Ich hatte keine Lust auf weitere Verzögerungen und wollte mein neues Lehen so bald wie möglich antreten. Vielleicht gerade deswegen, weil ich genau wusste, dass mich der Kronrat damit hatte hereinlegen wollen. Tulivar war nach allem, was ich bisher gehört hatte, eine Strafe, nicht eine Anerkennung für außergewöhnliche Dienste.
»Wenn Ihr es wünscht, werde ich Euch einen meiner Grenzsoldaten als Begleitung mitgeben«, schlug der Graf vor. »Er kennt den Weg gut und kann Euch in Plum helfen, eine anständige Unterkunft zu organisieren.«
»Nein danke. Der Weg scheint keine Herausforderung zu sein und wir ziehen es vor, so lange zu reiten wie möglich. Die Nächte sind in dieser Zeit sternenklar. Wir benötigen nicht viel Schlaf und nächtigen im Freien.«
Der alte Mann nickte. »Der Krieg gewöhnt einen an so manches.«
Ich zögerte. »Euer Sohn … er ist, wie ich hörte, in der Schlacht vor Rork gefallen.«
Ein Schatten legte sich auf das Gesicht des Grafen, nicht aus Wut, sondern aus Trauer. Er neigte den Kopf und blickte für einen Moment ins Leere. Dann seufzte er, sehr leise und verhalten.
»So ist es. Mein einziger Sohn. Wenn ich nicht mehr bin, wird der Imperator diese Grafschaft neu vergeben.«
»Eure Familie regiert hier schon lange.«
»Seit über 300 Jahren, schon vor Beginn des Imperiums.«
Ich verbeugte mich und zog mich zurück. Selbst Selur fand keine kecken Abschiedsworte.
Der Krieg hatte überall seine Spuren hinterlassen.
Tulivar aber schien ein Ort zu sein, bei dem gute Chancen bestanden, dass er dort nur eine Geschichte aus weiter Ferne geblieben war.
2 Floßheim
Die Brücke, die Goviar, das Flussdorf auf der Seite der Grafschaft zu Bell, mit Floßheim, dem Pendant aufseiten von Tulivar, verband, war eine Katastrophe. Ich schaute auf die angeschimmelten und träge in der Strömung schaukelnden Pontonflöße aus Holz, verbunden durch morsche Taue, an beiden Ufern festgebunden. Mit etwas Glück konnte man diese Brücke zu Fuß überqueren. Viele Pferde würden vor dem wackelnden und losen Übergang scheuen. Unsere Pferde sicher nicht, denn sie hatten schon einiges mitgemacht und gehörten sicher zu den Reittieren im Reich, die fast nichts mehr erschrecken konnte. Wir würden sie über die Brücke führen können.
Aber unsere Eselskarren waren eine ganz andere Geschichte.
In einer windschiefen Kate direkt vor der Brücke saß der Brückenwärter, ein wettergegerbtes Männlein, das trotz der frühen Stunde – oder möglicherweise gerade deswegen – heftig an einer Pfeife nuckelte. Als sich unsere Karawane der Kate näherte, stand er auf und trat uns entgegen. Wenn er von der Truppe hochgerüsteter Reiter beeindruckt war, zeigte er es nicht.
»Hmjahm?«
Ich wertete das als Frage und Aufforderung zugleich. Würdevoll entstieg ich meinem Ross und baute mich vor dem Mann auf.
»Ich bin Geradus Baron Tulivar.«
»Ha!« Das Männchen kicherte. »So, haben die Verrückten jetzt einen Baron?«
Ich versuchte meinen strengen Blick, doch der Brückenwärter war weiterhin unbeeindruckt.
»Ich muss übersetzen. Meine Männer, meine Karren.«
Das Männchen warf einen beiläufigen Blick auf meine Karawane und zuckte mit den Schultern.
»Versuchen könnt Ihr es ja.«
»Das ist nicht ganz die Antwort, die ich erwartet habe.«
»Welche hättet Ihr denn gerne? Dass ich Euren hochwohlgeborenen Arsch persönlich hinübertrage?«
Es waren diese Momente, in denen ich dankbar dafür war, ganz und gar nicht hochwohlgeboren zu sein und auch solchen Umgang nicht dauerhaft zu pflegen.
»Meine Karren werden ein Problem haben.«
»Das werden sie.«
»Wie alt ist die Brücke?«
»Zwanzig Jahre. Oder dreißig. Weiß nicht.«
»Wann wurde sie das letzte Mal instand gesetzt?«
»Zwanzig Jahre. Oder dreißig. Weiß nicht.«
»Seit wann bist du der Brückenwärter.«
»Zwanzig Ja…«
»Ja, ich habe es verstanden.«
Der alte Mann erschöpfte mich und ich hatte sowieso nicht gut gefrühstückt.
»Gibt es eine andere Möglichkeit, den Fluss zu überqueren?«, fragte ich.
»Schwimmen!« Wieder das Kichern. Einer von uns beiden amüsierte sich offenbar.
»Eine flache Stelle vielleicht?«
»Der Wul ist tief und hat eine starke Strömung. Wir fischen nur vom Ufer«, beantwortete der Mann eine Frage, die ich nicht gestellt hatte.
»Eine Fähre?«
Der Brückenwärter kratzte sich am Kopf. »Nö.«
»Wie passieren Schiffe die Brücke?«
»Ich binde sie los. Wenn die Schiffe durch sind, hole ich das Seil wieder ein und binde sie an.«
»Und das passiert wie oft?«
»Na ja … nicht oft.«
»Wie oft?«, beharrte ich.
»Ein- oder zweimal im Monat.«
Ich wandte mich ab. Meine Männer waren derweil alle abgestiegen und hatten den fruchtbaren Austausch mit dem Brückenwärter mit großem Interesse verfolgt. Selur und Woldan grinsten breit und freuten sich, dass die Bürde der Führung auf meinen Schultern lag und nicht auf den ihren.
»Diese Brücke ist lebensgefährlich!«, bequemte sich Woldan schließlich zu einem Kommentar. »Ich traue ihr nicht.«
»Sie wird offenbar nicht viel genutzt«, meinte ich nachdenklich. »Viele Reisende in beide Richtungen wird es nicht geben.«
»Das hört sich nicht gut an. Ich wusste, dass Tulivar wirklich am Rande der Welt liegt, aber bei den Göttern, es muss ein dermaßen abgelegener Ort sein … Mich schüttelt es!« Selur wirkte aufrichtig erschüttert. Er war am ehesten derjenige von uns, der die Annehmlichkeiten des imperialen Hofes genossen hatte – inklusive jener, die er gar nicht hätte genießen dürfen. Ich warf ihm einen strafenden Blick zu. Solche Kommentare halfen mir jetzt nicht weiter.
»Wie bekommen wir die Karren hinüber?«, fragte Woldan und sah den Brückenwärter misstrauisch an, der den seltsamen Reisenden offenbar auch nicht über den Weg traute, soweit man dessen Gesichtsausdruck entnehmen konnte.
»Das ist das eine Problem«, murmelte ich. »Das andere Problem lautet: Wie bekommt überhaupt jemand etwas nach Tulivar?«
Selur nickte. »Jeder fahrende Händler muss über den Fluss. Tulivar hat keinen Seehafen. Und dies ist die einzige Brücke. Wenn es keine Fähre gibt, dann muss man eines der großen Flussschiffe aus Plum nehmen, was einen riesigen Umweg bedeutet und vor allem eine höchst unberechenbare Anbindung. Tulivar hat nichts zu verkaufen.«
»Tulivar hat nichts zu verkaufen, weil niemand etwas heraus- oder hineinbringen kann«, widersprach ich. Selur machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Hauptmann«, sagte er dann, »ich erinnere mich an die Mission vor Eltheim, im Sommer vor zwei Jahren.«
»Der Vorstoß über den Flask?«
»Genau der.«
»Ich ahne, was du meinst.«
Woldan stöhnte. »Es hat uns drei Tage gekostet sowie aufgerissene Hände, furchtbaren Muskelkater und mir eine böse Fleischwunde am Arm eingebracht.«
Ich lächelte ihn an. »Du warst nie gut mit der Axt.«
Der massige Bogenschütze erwiderte meinen Blick und lächelte zurück. »Ich habe die Axt aber noch, Hauptmann.«
»Und wir waren damals nur unwesentlich mehr als 40 Mann«, ergänzte Selur.
»Du warst dabei«, meinte Woldan. »Also 39 Mann und eine Schwuchtel.«
Selur grinste. »Ich habe keine Fleischwunde davongetragen, mein großer Freund.«
»Tatsächlich hat uns Selur genau gezeigt, wie wir in kürzester Zeit eine stabile Holzbrücke konstruieren können«, meinte ich.
»Kurz?«, echote Woldan. »Wir haben drei Tage und Nächte durchgeschuftet! Wie die Tiere!«
»Wie echte Männer«, spottete Selur. »Mit echten Fleischwunden!«
Der Bogenschütze warf einen anklagenden Blick gen Himmel.
»Wir würden mehrere Ziele gleichzeitig erreichen«, meinte ich, als die erhoffte Reaktion der Götter ausblieb. »Wir kämen über den Fluss. Wir hätten einen festen Zugang nach Tulivar geschaffen. Und wir hätten ein Zeichen gesetzt.«
»Tolles Zeichen«, murmelte Woldan. »Ich dachte, ich bin im Ruhestand.«
»Ich arbeite dein Pensum mit«, bot sich Selur an. »Ich will nicht, dass alte Männer sich verletzen!«
»Ich hole meine Axt.«
Die Begeisterung der Männer war nicht groß, andererseits waren sie schnell davon überzeugt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Außerdem war allen klar, dass Selur genau wusste, wie man eine Brücke baute – das damals über den Flask errichtete Bauwerk stand immer noch – und man daher kein großes Risiko einging.
Ich trat auf den Brückenwärter zu.
»Wir werden die Brücke für eine Weile besetzen. Als Arbeitsplattform.«
»Eh … was?«
»Wir werden eine Holzbrücke bauen. Eine richtige.«
»Das ist … das darf …«
»Ich bin der Herr von Tulivar.«
»Aber diese Seite des Flusses gehört dem Grafen zu Bell.«
»Er wird es verschmerzen, dass ich ihm eine neue Brücke baue.«
»Aber das Holz …«
»Die Bewohner von Goviar werden mir helfen.«
»Sie müssen Euren Befehlen nicht gehorchen!«
»Ah.« Ich griff an meinen Gürtel, zog den Beutel hervor, öffnete ihn und ließ den Brückenwärter einen Blick auf die darin enthaltenen Goldmünzen werfen. »Schätzt man in Goviar die klingende Münze oder begnügt man sich mit Fisch?«
Der Brückenwärter stieß etwas Unverständliches aus. Doch das Funkeln in seinen Augen verriet ihn.
Ich beschloss, eine erste Investition zu tätigen, fingerte ein Silberstück heraus – für den Mann sicher mehr, als er in einem Monat verdiente – und überreichte es ihm. Misstrauen oder nicht, seine Hand streckte sich schnell nach vorne und die Münze verschwand ebenso schnell unter seinem Hemd.
»Du kannst mir helfen, mit dem Dorfschulzen zu reden«, schlug ich vor. »Das dürfte für alle Seiten ein gutes Geschäft darstellen.«
Der Brückenwärter war offenbar geneigt, seine Meinung über uns zu revidieren. Er lächelte plötzlich und zeigte die Ruinen seiner Zähne in all ihrer Pracht.
»Das trifft sich gut«, meinte er schließlich. »Ich bin der Dorfschulze. Mein Name ist Gerik.«
Ich hob die Augenbrauen.
»Und ich werde Euch helfen.«
Ich erwiderte nichts und sah ihn abwartend an.
Er streckte die Hand aus.
Wir waren uns einig.
3 Die Brücke
Viele ausgestreckte und mit Münzen unterschiedlichen Wertes gefüllte Hände später hatte sich eine bunt gemischte Mannschaft aus Helfern bereitgefunden. Ich war mir nicht sicher, was diese Männer – und einige Frauen – eigentlich antrieb, sich unserer Baumannschaft anzuschließen, denn das Geld allein konnte es nicht sein. Ich wollte mit unseren Mitteln haushalten und zahlte keine übertriebenen Summen. Ein paar Kupferstücke für jene, die uns frischen Fisch besorgten und zubereiteten, damit wir uns stärken konnten. Ein paar weitere Kupferlinge für jene, die uns beim Holzhacken halfen. Silber für die Besitzer oder Verwalter der Waldstücke, in denen wir die Bäume schlugen, die wir für den Brückenbau benötigten. Gold für den Dorfschulzen, damit er sein Wohlwollen über uns erstrahlen ließ.
Wir hatten bereits einen ganzen Tag gearbeitet und es war später Nachmittag. Die Stützbalken der Brücke waren geschlagen und vorbereitet, mächtige, massive Eichenstämme, die lange halten würden. Es gab zwei Zimmerleute im Dorf, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen. Auch sie waren bereits mit ein paar Kupferstücken zufrieden, sie schienen sich darüber zu freuen, an einem für sie ungewöhnlichen und einmaligen Projekt mitarbeiten zu dürfen.
Ich stand mit Selur und dem Dorfschulzen Gerik vor dem, was wir geschafft hatten. Der Brückenbau würde länger als drei Tage in Anspruch nehmen – wir gedachten, die Nächte in tiefem Schlummer zu verbringen, da ja keine feindlichen Truppen nach uns suchten. Lediglich einige ältere Damen, die, nicht völlig zu Unrecht, die Unschuld ihrer Enkelinnen in Gefahr sahen, beäugten uns mit misstrauischen Blicken.
Dann kam jemand über die Brücke.
Gerik sah es zuerst und ihm schien die ansonsten mit seinem Mund verwachsene Schmauchpfeife fast herauszufallen. Dann folgten andere unserer Helfer seinem Blick und großes Erstaunen machte die Runde. Ich wollte schon fast zum Schwert an meinem Gürtel greifen, ehe ich mich eines Besseren besann. Manche Reflexe waren gut und retteten einem das Leben, aber die eine oder andere spontane Reaktion sollte ich künftig überdenken. Ich war hier unter Freunden. Es waren hinterwäldlerische und misstrauische Freunde, aber sie wollten uns nichts Böses und wir ihnen schon gar nicht.
Über die Brücke marschierte der Zwilling von Gerik.
Er war klein, verhutzelt, alt, gebeugt, mit wettergegerbter Haut, schlechten Zähnen und einer gigantischen Pfeife im Mundwinkel. Er trug die gleiche, oft geflickte, aber ordentliche Kleidung wie der Dorfschulze und hatte den gleichen gereizten Blick.
Er glich Gerik wirklich sehr.
Als er schnaufend über die wackelnde Pontonbrücke gegangen war, stand er, aufgestützt auf einem knorrigen Holzstock, direkt vor dem Schulzen und würdigte mich und meine Männer nicht eines Blickes.
Er starrte nur Gerik an und der Blick war nicht freundlich. Mit betonter Verachtung holte er seine Pfeife aus dem Mund, spuckte zu Boden und fragte: »Gerik, du verlaustes Stück Dreck, was glaubst du, was du hier anstellst?«
Der Dorfschulze, der seine erste Überraschung gut überwunden hatte, vermied es, mich Hilfe suchend anzuschauen. Das hing sicher damit zusammen, dass die Hälfte seiner Dorfbewohner sich um ihn geschart hatte und freudige Erwartung sich breitmachte. Ich deutete die Zeichen richtig. Man erwartete einen Konflikt und dieser würde sich zu einer Attraktion entwickeln. Offenbar war der Besucher allgemein bekannt, wenngleich er nicht allzu oft die Brücke zu überschreiten schien.
Ich nahm Selur am Arm und zog mich ebenfalls einen Schritt zurück. Es gab keinen Grund, die Vorführung zu stören. Ich wollte mich keinesfalls aufdrängen.
Gerik sah den Neuankömmling durchdringend an. Dann sagte er: »Lorn, du weißt, ich bin hier der Dorfschulze. Bring mir gefälligst Respekt entgegen.«
»Scheiß drauf. Was macht ihr hier?«
»Wonach sieht es aus?«
»Ihr baut eine verdammte Scheißbrücke.«
Zumindest mir kam es so vor, als würde sich der beständige Gebrauch der immer gleichen Schimpfwörter etwas abnutzen. Aus den Gesichtern der Umstehenden schloss ich jedoch, dass das Gespräch für diese an Unterhaltungswert keineswegs eingebüßt hatte.
»Wir bauen eine richtige Brücke.«
»Wozu soll das gut sein?«
»Damit man leichter über den Fluss gehen kann.«
»Wozu soll das gut sein?«
Selur gab mir den Weinschlauch. Ich nahm einen tiefen Schluck. Das Gespräch schien sich um etwas zu drehen, was gar nicht ausgesprochen wurde. Ich fühlte, dass der Zeitpunkt einzugreifen gekommen war. Ich reckte die Hand nach hinten. Selur drückte einen leeren Holzbecher hinein. Er wusste genau, was zu tun war.
Ich machte einen Schritt nach vorne, reichte Lorn den Holzbecher, den dieser etwas überrascht ergriff, und goss sogleich Wein hinein. Das Gluckern der Flüssigkeit fixierte Lorns Aufmerksamkeit lange genug, dass ich das Wort ergreifen konnte.
»Lorn, ich freue mich über Euer Interesse an meinem Bauwerk.«
Der Alte sah mich böse an. »Ihr seid verantwortlich für diese verd…«
»Jaja. Das bin ich. Trinkt doch nur. Es wäre schade um den guten Tropfen.«
In der Tat war der Landwein, der hier verköstigt wurde, gar nicht übel. Etwas säuerlich, aber erfrischend.
Lorn entschied sich, eine Aufforderung zum Trinken nicht zu ignorieren.
»Ihr kommt aus Floßheim, mein guter Freund?«, fragte ich freundlich.
»Ich bin der Dorfschulze!«, warf sich Lorn in die Brust und hielt mir den geleerten Becher entgegen. Ich ließ mich nicht bitten.
»Das freut mich sehr. So seid Ihr der erste Offizielle der Baronie von Tulivar, dem ich begegne.«
»Ich bin der Dorfschulze«, erklärte Lorn berichtigend. Das Wort »Offizieller« hatte für ihn offenbar keine Bedeutung. Er trank.
»Nun, ich werde Euch beizeiten gerne in Eurem Amt bestätigen«, erklärte ich gemessen.
»Was für ein Scheiß …«
»Lorn«, mischte sich nun Gerik ein. Ihm war anzusehen, dass er es nicht schätzte, vom Ausschank ausgeschlossen zu sein. Ehe ich etwas sagen konnte, hatte ihm Selur einen zweiten Becher gereicht.
Ich goss ein.
Die Männer tranken. Wer wusste schon, wann es wieder etwas gab.
»Lorn«, wiederholte Gerik. »Das ist der Baron von Tulivar.«
Lorn verschluckte sich, hustete, spritzte Speichel und Wein auf mich.
Ich bemühte mich um Fassung.
Der Alte sah mich an. »Das kann jeder behaupten.«
»Ich habe eine Ernennungsurkunde.«
»Ich kann nicht lesen.«
»Ah. Aber was ist damit?!«
Ich holte die Urkunde hervor, entrollte sie und wies auf das große, kaiserliche Siegel. Es war, wie alle kaiserlichen Siegel, vom Hofmagier besprochen worden und wirkte auf jeden, der für Magie empfänglich war, ausgesprochen überzeugend. Eine effiziente Methode, um Missverständnisse zu vermeiden und Gespräche abzukürzen. Ich hatte darauf bestanden, bevor ich aus der Hauptstadt aufgebrochen war.
Lorn warf einen Blick darauf und machte ein abschätziges Geräusch. Er schien über meine Autorität nicht sonderlich begeistert zu sein. Beeindruckt war er auch nicht. Wenn das so weiterging, sah ich sehr schweren Zeiten entgegen.
»Hm, na gut«, murmelte er schließlich. »Das ändert nichts daran, dass diese Brücke eine Schnapsidee ist. So ein Blödsinn!«
»Sie macht den Handel leichter.«
»Wir haben nichts zu handeln. Unser Fisch ist genauso gut wie der auf dieser Seite des Flusses.«
»Es gibt noch andere Handelsgüter außer Fisch.«
»Wir brauchen nichts.«
Gerik kicherte. »Lorns Leute hätten auch nichts, womit sie handeln könnten. Bettelarm sind sie alle da drüben in Floßheim.«
»Musst du gerade sagen, Dorfschulze!«
Gerik winkte ab. »Wärst du mal besser hiergeblieben.«
Ich konnte nun nicht mehr an mich halten. »Lorn ist Euer Bruder, Dorfschulze?«, fragte ich Gerik.
Dieser nickte und zeigte dann anklagend auf Lorn. »Der Undankbare ist wegen einer Frau auf die andere Uferseite gewechselt und hat Heim und Hof verraten und verlassen.«
Lorn blickte halb schuldbewusst, halb rebellisch drein. Offenbar galt hier jemand, der dem jahrhundertealten Inzest zu entkommen trachtete, bereits als Hochverräter.
»Sie war hübsch und wollte mich«, murrte Lorn leise.
Seinem Gesichtsausdruck war zu entnehmen, dass sich mittlerweile das eine oder andere daran verändert hatte.
Geriks Grinsen wiederum entnahm ich, dass dies vermutlich auf beides zutraf.
Ich hatte von diesem Geplänkel jetzt genug. Ich hatte Autorität beansprucht, jetzt war es an der Zeit, sie auch durchzusetzen. Ich holte tief Luft.
»Ich geh dann mal«, sagte Lorn, wandte sich ab und marschierte über die schwankende Pontonbrücke wieder zurück.
Ich stieß die Luft aus und sah ihm nach.
»Er wird darüber hinwegkommen«, meinte Gerik.
»Über den Bau der Brücke? Ist das so eine Katastrophe?«
Gerik sah mich verwirrt an, dann schüttelte er den Kopf. »Nein, dass er uns wegen einer Schlampe aus Tulivar hat sitzen lassen und wir ihn nicht mehr zurückhaben wollen.«
Dann wandte sich auch Gerik ab und spazierte auf sein Brückenwärterhäuschen zu.
Ich warf Selur einen langen, Hilfe suchenden Blick zu, den dieser ignorierte.
»Dann bauen wir jetzt eine Brücke!«, befahl ich unter Aufbietung aller Restautorität, die ich in mir finden konnte.
Ob es diese war oder das Versprechen weiterer Zahlungen: Alle machten sich an die Arbeit.
Ich aber sah der kleiner werdenden Gestalt von Lorn, dem Dorfschulzen von Floßheim, nach und fragte mich, was mich an meinem Amtssitz, in Tulivar selbst, erwarten würde.
Ich hatte diesbezüglich keine Hoffnungen mehr.
4 Nach der Brücke
Der Brückenbau lief ohne weitere Zwischenfälle ab. Die Bewohner Floßheims erwiesen sich als friedliche, wenngleich misstrauische Beobachter, von denen jeden Tag eine Abordnung von drei oder vier unserem Treiben zusah. Die Tatsache, dass diese Abordnung im Regelfall nur aus neugierigen Kindern bestand, bestärkte mich in meinem Glauben, dass das Thema ausgestanden war. Als wir die Pontonbrücke nutzten, um die Stämme in den Flussboden zu treiben und die Verbindungsplanken zu montieren, waren wir ohnehin viel zu beschäftigt, um uns viele Gedanken über das Verhältnis der beiden Brüder zu machen. Nach einer Woche, sieben harten Arbeitstagen, stand die Brücke, und sie sah hinreichend vertrauenswürdig aus, dass ich die Überquerung mit unseren Karren zu riskieren trachtete.
Gerik ließ sich nicht davon abhalten, den örtlichen Priester um seinen Segen zu bitten, damit die Brücke zünftig eingeweiht werden konnte. Ich hielt eine Menge von den Göttern, vor allem dann, wenn sie sich in ihrer unendlichen Weisheit dazu entschlossen, sich aus allem herauszuhalten. Sollte der Priester dazu einen Beitrag leisten können, so war ich der Letzte, der dagegensprechen würde. Die Zeremonie war in der Tat kurz, da auch der Gottesmann ein erkennbares Interesse daran hatte, dem vom Dorfschulzen ausgerichteten und selbstverständlich von mir bezahlten Festmahl beizuwohnen. Wir verabschiedeten uns freundlich, denn wir wollten das Tageslicht nutzen, um so weit wie möglich zu kommen.
Die Brücke hielt. Wir überquerten den Fluss.
Von Festivität war auf der anderen Seite wenig zu spüren. Als wir nach etwa einer halben Stunde in das kleine Örtchen Floßheim kamen, war dennoch Neugierde zu spüren. Obgleich Lorn nichts vom Brückenbau gehalten hatte, musste die Urkunde ihre Wirkung nicht verfehlt haben.
Floßheim als Dorf zu bezeichnen, war eine Schmeichelei. Ich hatte im Verlauf meiner Feldzüge viele Orte kennengelernt, kleine wie große, aber diese klägliche Ansammlung windschiefer Katen, verteilt über ein unregelmäßiges Muster gestampfter Wege, war erbarmungswürdig. Es gab nicht einmal so etwas wie einen Marktplatz, auf dem die hier ansässigen Fischer ihre Fänge feilbieten oder Bauern aus dem Umland andere Nahrungsmittel verkaufen konnten. Offenbar führte man hier ein genügsames, isoliertes Leben, eine Existenz am Rande der Not. Die Menschen, die hier lebten, entsprachen in allem dem Zustand ihrer Behausungen. Sie wirkten heruntergekommen, die Kleidung voller Flicken und Fetzen, die Gesichter verhärmt. Die Kinder wirkten klein und unterernährt, waren aber die Einzigen, die noch wirklich Leben in sich zu haben schienen. In Geriks Dorf hatte es auch viel Armut gegeben, aber, so wollte ich im rückblickenden Vergleich sagen, etwas mehr Würde und Selbstachtung. Recht betrachtet, wirkte selbst Lorn neben Gerik wie eine schwächere, ärmere Version des Dorfschulzen aus Goviar. Dies waren meine Untertanen, und sie erschütterten mich. Mein Schrecken war vor allem deswegen so groß, weil der Krieg mit all seinen Fährnissen niemals so weit in den Norden vorgedrungen war. Hier hatte es nicht einmal Scharmützel oder Überfälle marodierender Plünderbanden gegeben. Sicher, auch hier waren die Söhne rekrutiert worden, ob nun freiwillig oder nicht, und viele davon würden niemals zurückkehren. Es fehlte an Arbeitskräften, hatte der Krieg den Familien doch eine ganze Generation geraubt. Ich hoffte, dass einige im Laufe der Zeit den Weg zurückfinden würden, wusste aber aus eigener Erfahrung, dass es Gegenden im Imperium gab, die für einen jungen Mann weitaus attraktiver waren, als die Aussicht, hierher zurückzukehren.
Ich konnte es niemandem verübeln.
Irgendwo in der Mitte Floßheims stieg ich vom Pferd. Vor mir versammelte sich eine Art Abordnung. Lorn war dabei und mit ihm eine Gruppe älterer Männer und Frauen. Ich vermutete, es mit dem Dorfrat oder dem zu tun zu haben, was in Floßheim als Honoratioren durchging. Sie standen da, unschlüssig, unwillig, ganz sicher nicht unterwürfig, aber auch nicht sicher, was jetzt von ihnen erwartet wurde und wie sie sich zu verhalten hätten.
Ich spürte, dies war ein wichtiger Moment. Ich hätte einfach weiterreiten und dieses arme Drecksloch hinter mich lassen können. Lorn hätte das wahrscheinlich nicht einmal besonders geärgert. Im Grunde wurde von einem hohen Herrn wie mir gar kein anderes Verhalten erwartet.
Aber ich wollte nicht.
Bei allem Zorn über dieses Geschenk des Kronrates, über die Art und Weise, wie man mich losgeworden war: Dies waren meine Leute.
Ich war ihr Baron, ihr oberster Herr, der Mann, der für sie zu sorgen und sie zu regieren hatte. Und das konnte mir nicht gelingen, wenn ich einfach wieder auf mein Pferd stieg und davonritt.
Es war albern, aber ich war aufgeregt, sogar nervös, als ich auf die heruntergekommenen, abgerissenen alten Menschen zuschritt.
Lorns Stimmung hatte sich seit unserem letzten Aufeinandertreffen nicht gebessert. Er sah mich mit einer Mischung aus Trotz und Unwillen an, und seine Haltung schien sich auf die anderen Ältesten übertragen zu haben. Da war kein freundliches Lächeln, kein Kopfnicken, nicht einmal die Unterwürfigkeit gegenüber dem Herrn, wie man sie vielerorts vorfand und deren Falschheit ich auch nicht sonderlich schätzte.
Augenscheinlich wurde erwartet, dass ich als Erster das Wort ergriff.
Ich holte tief Luft.
»Ich bin der neue Baron Tulivar. Ich grüße Lorn, den Dorfschulzen von Floßheim. Ich habe ihn bereits kennenlernen dürfen, als wir begonnen haben, die Brücke zu errichten. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich vermute, den Dorfrat vor mir zu haben.«
Schweigen antwortete mir. Eine alte Frau spuckte etwas aus, wahrscheinlich Kautabak. Die glitschige Masse landete recht zielsicher vor meinen Füßen – nicht nah genug, um sofort als Beleidigung durchzugehen, aber auch nicht weit genug entfernt, um zufällig dort aufzutreffen. Sehr subtil.
»Was soll das mit der Brücke?«, ergriff einer der Alten das Wort. Es bestand offenbar kein Bedarf daran, sich mir vorzustellen.
Ich ging darauf ein. »Die Brücke wird helfen, leichter über den Fluss setzen zu können. Wir haben sie so gebaut, dass sie in der Mitte aufgeklappt werden kann, damit Flussboote leicht hindurchfahren können.«
»Was für Boote? Hierher kommen keine Boote.«
»Das liegt dann wohl an der fehlenden Anlegestelle«, vermutete ich. Nach einer solchen hatte ich in der Tat vergeblich Ausschau gehalten.
»Wir brauchen keine Anlegestelle«, meinte die kauende Frau.
»Und keine Brücke!«, bestätigte Lorn.
Ich machte eine theatralische Geste, die die gesamte Umgebung umfasste.
»Ich bin der Ansicht, dass Ihr beides benötigt«, erklärte ich. »Floßheim ist arm. Handel könnte etwas Reichtum in das Dorf bringen. Die wichtigste Voraussetzung für Handel ist eine gute Verkehrsverbindung. Eine Brücke und eine ordentliche Anlegestelle also.«
Die Frau spuckte zu Boden und sah Lorn auffordernd an. Dessen bedurfte es aber nicht.
»Wir wollen keine Fremden«, fasste der Dorfschulze das Grundproblem zusammen. »Handel bringt Fremde. Wir wollen das nicht.«
»Na ja, das ist in der Tat nicht zu vermeiden. Andererseits könntet Ihr ja auch die Brücke selbst benutzen und Eure Waren woanders …«
»Wir reisen nicht«, meinte die Frau.
»Wir haben keine Waren«, ergänzte Lorn.
»Woanders wollen wir nicht hin«, schloss der Mann ab, der zuerst das Wort erhoben hatte.
Dann herrschte wieder Schweigen. Es war wie eine undurchdringliche Mauer. Da war nicht einmal Feindseligkeit in der Haltung dieser Menschen – aber so eine tiefe Verbohrtheit und Verschlossenheit, die hoffentlich nicht charakteristisch für die ganze Baronie war. Andererseits war Floßheim die Siedlung, die dem »Ausland« am nächsten war, und wenn die Leute hier schon so mauerten, wie mochte es dann im Rest meines glorreichen Herrschaftsgebietes aussehen? Ich wollte es mir gar nicht ausmalen.
Ich musste erneut tief Luft holen. Jetzt legte ich allen Ernst in meine Stimme und etwas wohldosierte Schärfe.
»So funktioniert das nicht! Ich habe als neuer Baron eine Entscheidung getroffen. Ich bin viel in der Welt herumgekommen und habe keineswegs die Absicht, meine neue Herrschaft anzutreten und genauso sauertöpfisch und heruntergekommen zu enden wie ihr. Mir ist klar, dass das Leben hier schwer ist. Manchmal richtet man sich in seinem eigenen Leid wunderbar ein und weiß gar nicht mehr, dass es auch anders und besser werden könnte. Allerdings beabsichtige ich, Dinge zu ändern, vornehmlich zu verbessern. Wer mitmachen will, ist dazu herzlich eingeladen. Wer nicht, wird dazu getrieben. Ich habe eine Brücke erbaut, mit meinen eigenen Händen. Das war erst der Anfang. Ich bin der Baron von Tulivar, und es ist meine verdammte Pflicht und Aufgabe, etwas für meine Untertanen zu tun. Akzeptiert es oder nicht, aber so wird es sein.«
Schweigen.
Die Frau spuckte auf den Boden und schnäuzte sich, bestimmt nicht vor Rührung.
»Wir brauchen keine Verbesserungen«, meinte sie schließlich.
Zustimmendes Kopfnicken.
»Wir brauchen auch keinen Baron«, ergänzte Lorn ohne jede Scheu. Er sah mich an und in seinen Augen stand keine Angst, nur eine tiefe, sorgsam gepflegte und über Jahre erarbeitete Bockigkeit.
Ich seufzte.
Es gab hier viel zu tun.
5 Tulivar
Ich verschob diese Arbeit aber auf später.
Nach weiteren ergebnislosen Gesprächen brachen wir auf, die dreckige und kaum als solche erkennbare Landstraße – mehr ein etwas breiterer Trampelpfad – in Richtung meines künftigen Herrschersitzes. Zum Schluss hatte ich den Ältesten von Floßheim noch etwas versprochen: dass ich hierher zurückkehren und am Markttag Gericht halten würde, wie es meine Pflicht als Herr über Tulivar war.
»Wir haben keinen Markttag«, hatte die Alte gesagt.
»Wir brauchen auch keinen«, ein weiterer.
»Gericht brauchen wir auch nicht«, hatte Lorn ergänzt.
Wir waren dann abgereist.
Der Weg nach Tulivar war lang und ereignislos. Ich schätzte Letzteres. Nach drei Tagen hatten wir den Gipfel eines Hügels erklommen und erkannten im strahlenden Sonnenschein zwei Dinge: zum einen vor uns im Tal ein nur wenig größeres Häufchen armseliger Behausungen, das ich mit großen Schrecken als meine Hauptstadt erkannte, zum anderen im Norden, nur von etwas Dunst verhangen, das ferne Gebirge, die nördliche Grenze meines Gebietes. Ich wusste, dass dort die dritte Siedlung meiner Baronie lag, am Fuß der unwirtlichen und unbewohnten Berge, in die sich die Herrschaft des Imperiums nicht mehr erstreckte. Nördlich der Gebirgszüge wiederum, so sagte man, liege nur noch die Küste.
Es war warm, fast heiß, und mein suchender Blick verharrte auf einem weiteren Hügel unweit der … Stadt. Auf diesem war ein windschiefer Turm zu erkennen. Wenn mich nicht alles täuschte und obgleich ich mir Besseres gewünscht hätte, handelte es sich dabei um das, was einmal Burg Tulivar hätte werden sollen, meinen Amtssitz.
Mein Seufzen hörte man bis zum Nordgebirge. Und dort löste es sicher gerade eine Lawine aus.
Auch meine Kameraden sahen wenig glücklich drein. Sie alle hatten nach den Erfahrungen in Floßheim die Hoffnung bewahrt, dass Tulivar – die Hauptstadt, bei den Göttern! – etwas mehr sein würde als ein weiteres armseliges Nest. Besonders Selur stand die Enttäuschung deutlich ins Gesicht geschrieben. Ich beschloss, den Zweckoptimismus fahren zu lassen und ebenfalls deprimiert zu sein.
Ohne einen weiteren Kommentar trieb ich mein Pferd an. Unser Ziel war der Turm.
Immerhin, das eine oder andere, das wir auf den Weg dorthin beobachteten, war nicht ganz so mitleiderregend. Ich sah wohlbestellte Ackerflächen, auf denen Landwirte mit der Arbeit beschäftigt waren. An einem Bach stand eine etwas klapprige, aber funktionstüchtige Wassermühle, deren Mühlrad sich träge im dahinplätschernden Nass drehte. Uns kamen Bauern entgegen, die uns weniger feindselig, dafür neugierig ansahen. Einer grüßte uns sogar recht freundlich. Meine Stimmung hob sich.