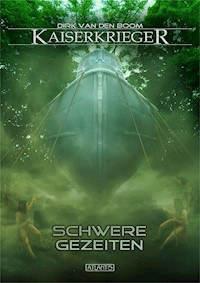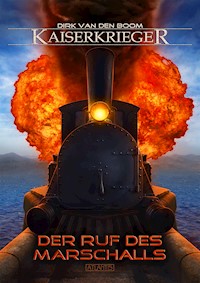2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Rettungskreuzer Ikarus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Eine Konferenz, ein Captain und sein Verschwinden: Die Crew der Ikarus ist verzweifelt. Was wie ein harmloser Besuch begann, entwickelt sich allmählich zu einer Katastrophe. Die weiteren Zutaten: ein Sternensysteme umspannender Medokonzern, der große Pläne hat, eine Agentin des Raumcorps, eine Widerstandsbewegung und die Frage, ob die Vergangenheit den Bordarzt der Ikarus ein weiteres Mal einholt. Am Ende geht es offenbar nur um eines: den Added Value.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Ähnliche
Inhalt
Impressum
Endnoten
Weitere Atlantis-Titel
Impressum
Eine Veröffentlichung des Atlantis-Verlages, Stolberg April 2018 Alle Rechte vorbehalten. © Dirk van den Boom & Thorsten Pankau Druck: Schaltungsdienst Lange, Berlin Titelbild und Umschlaggestaltung: Timo Kümmel Endlektorat: André Piotrowski ISBN der Paperback-Ausgabe: 978-3-86402-570-9 ISBN der E-Book-Ausgabe (EPUB): 978-3-86402-592-1 Besuchen Sie uns im Internet:www.atlantis-verlag.deProlog
Der Rettungskreuzer Ikarus des Freien Raumcorps wird dafür eingesetzt, in der besiedelten Galaxis sowie jenseits ihrer Grenzen all jenen zu helfen, die sich zu weit vorgewagt haben, denen ein Unglück zugestoßen ist oder die anderweitig dringend der Hilfe bedürfen. Die Ikarus und ihre Schwesterschiffe sind dabei oft die letzte Hoffnung bei Havarien, Katastrophen oder gar planetenweiten Seuchen. Die Crew der Ikarus unter ihrem Kommandanten Roderick Sentenza wird dabei mit Situationen konfrontiert, bei denen Nervenstärke und Disziplin alleine nicht mehr ausreichen. Man muss schon ein wenig verrückt sein, um diesen Dienst machen zu können – denn es sind wilde Zeiten …
»Das ist keine zufriedenstellende Antwort!«
Der Mann in dem einteiligen Anzug schlug zu, hart und mit Schwung. Er hatte offenbar Freude an seiner Arbeit, hoffte möglicherweise auf weitere nicht zufriedenstellende Antworten, die ihm die Möglichkeit zu weiteren Schlägen geben würden.
Der andere Mann, mit zerrissenem und blutigem Oberhemd, saß auf dem Metallstuhl, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Er starrte glasig zu Boden, nachdem sein Kopf wieder nach vorne gefallen war. Aus dem halb geöffneten Mund zog sich ein langer, blutiger Speichelfaden, der in Zeitlupengeschwindigkeit zu Boden fiel. Er hustete und verzog schmerzverzerrt das Gesicht, da der Husten ihm offenbar Pein bereitete.
Der Anzugträger wartete einen Moment, schaute auf sein Opfer hinunter, dann wippte er auf den Zehenspitzen, einmal, zweimal, als sei er voller ungebändigter Energie und Vorfreude, was ja durchaus möglich war. Er betrachtete seine geballte Hand, entspannte die Finger langsam, bewegte sie prüfend.
Er trug einen Handschuh, der die Haut davor schützte, aufgerissen zu werden, und er würde sich keine Knochen brechen, denn er wusste ganz genau, was er da tat. Die Finger bewegten sich einwandfrei. Auf dem Handschuh waren Blutflecken: neue und alte, eingetrocknete. Ein Werkzeug, das oft benutzt worden war. Er passte dem Mann sehr gut.
Doch anstatt erneut zuzuschlagen, setzte er sich nun unweit des Gepeinigten auf einen zweiten Stuhl, schlug die Beine übereinander. Er stutzte, zog ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und tupfte damit Blut von der Stiefelspitze, das er missbilligend betrachtete. Auf dem Handschuh war das kein Problem. Seine Halbstiefel aber, sorgfältig poliert und sündhaft teuer – nein, das ging gar nicht.
»Sauerei!«, murmelte er halb zu sich selbst. »Sehen Sie, was Sie hier anrichten! Die Stiefel sind maßgefertigt, von Antonio Stravari, dem besten Schuhmacher des ganzen Planeten. Wissen Sie, was die kosten? Und Sie tropfen einfach so darauf ab?« Der Anzugträger schien nun ernsthaft erbost. »Sie haben keinen Sinn für den Wert des Eigentums anderer Menschen, oder?«
Der Gefesselte hob ein wenig den Kopf, starrte auf den nun wieder makellosen Stiefel. Es fehlte ihm die Kraft, etwas zu sagen oder auch nur eine Geste des Widerstands zu machen. Er hustete erneut, vor Schmerzen gefolgt von einem jaulenden Seufzer. Die Haare standen wirr auf seinem Kopf, im Gesicht trug er blutige Krusten, Zeichen früherer Verletzungen. Sein Oberkörper war kräftig, nicht übermäßig muskulös, aber trainiert, und an den Handgelenken, umfasst von Stahlfesseln, war die Haut aufgerissen und schabte an den Klammern. Er litt mit Sicherheit bereits Qualen, wenn er einfach so dasaß, die Arme nach hinten gereckt, mit ständigem Druck auf den Schultern. Die Wunden mussten brennen.
»Wir können Sie von Ihren Leiden erlösen«, schlug der Schläger mit den schönen Stiefeln vor. »Sie müssen reden, meine Fragen beantworten, und alles ist vorbei. Keine Fesseln. Frische Kleider. Ich schicke Ihnen einen Medoroboter, der Ihre Wunden behandelt. Sie bekommen Schmerzmittel, und davon nur die besten, eine gute Mahlzeit, ein sauberes Bett und Ruhe. Wenn die ganze Sache bereinigt ist, lassen wir Sie sogar gehen, das ließe sich bestimmt einrichten. Sie müssen nicht so leiden. Wir sind nicht zuständig für Leiden, wir sind Heiler.«
Der Verletzte zog eine Grimasse.
Der Anzugträger tat, als würde er sich über diese Reaktion wundern, ein mokantes Lächeln auf den Lippen. Er legte den Kopf zur Seite wie ein Hund, der seinem Herrchen zuhört, aber er wirkte dabei absolut nicht niedlich, sondern auf eine perverse Art gefährlich. Nicht, dass sein Opfer noch von der Gefährlichkeit seines Peinigers überzeugt werden musste. Das sicher nicht.
»Sie glauben mir nicht? Oh, doch, das ist doch unsere Mission. Sie sollten das besser wissen als ich! Wir heilen. In diesem Moment heile ich Sie von dem Irrglauben, hinter uns herschnüffeln zu können, und dann vielleicht von der falschen Annahme, wir hätten irgendwas mit dunklen Machenschaften zu tun. Sie haben sich da in etwas verrannt. Ich denke, das wissen Sie mittlerweile auch. Sie wollen es nur aus falsch verstandenem Stolz nicht zugeben. Störrisch sind Sie. Und dafür müssen Sie jetzt leiden. Und dafür, dass Sie die falschen Leute kontaktiert haben. Aber auch in diesem Falle ist Heilung möglich.« Er beugte sich nach vorn, in seiner Hand ein Datenträger. »Wer hat Ihnen diesen Speicher überlassen? Sie haben ihn doch nicht auf der Straße gefunden! Und sagen Sie mir nicht wieder, ein anonymer Bote hätte ihn überreicht und sei gleich wieder verschwunden! Das beleidigt meine Intelligenz – und die Ihre doch im Grunde genauso! Schließlich hat sein Inhalt dazu geführt, dass Sie hier auf diesem Stuhl gelandet sind. Und völlig egal, was Sie von mir denken: Dieses Schicksal widerfährt nur den ganz, ganz bösen Jungs!«
Der Anzugträger wartete einige Augenblicke, doch sein Gefangener machte keine Anstalten, auch nur ein Wort von sich zu geben.
Er atmete rasselnd, das Atmen fiel ihm schwer. Er schaute nicht einmal mehr hoch, sondern ließ den Kopf hängen.
Der Mann mit dem blutigen Handschuh schüttelte missbilligend den Kopf. »Sie sind wirklich sehr hartnäckig in Ihrer Verweigerung. Das ist ein großer Fehler. Schauen Sie, was ich hier habe.«
Der Anzugträger wies auf einen kleinen metallenen Rolltisch an der Wand des Verhörraums. Darauf lagen allerlei Gerätschaften, gut zu erkennen war aber vor allem eine Reihe von Injektoren. Der Mann erhob sich und ging zum Tisch, griff prüfend einen der Injektoren und hielt ihn gegen das kalte Neonlicht an der Decke. Eine Flüssigkeit wurde im Tank des Geräts sichtbar, farblos und ohne Blasen. Er tippte mit dem Zeigefinger dagegen, eine von diesen unnötigen, theatralischen Gesten, die man aus schlechten Holofilmen kannte, die der Anzugträger aber sehr zu genießen schien.
»Veritas ist eine potente Droge«, sagte er dann zum Gefesselten. »Das muss ich Ihnen deswegen sagen, weil uns der Medscan verraten hat, dass Ihr Körper voller Impfungen sowie implantierter Medodepots ist, was angesichts Ihrer Profession auch niemanden überrascht. Ihr Körper wird kämpfen und dabei sehr belastet. Veritas ist speziell für diese Fälle entwickelt worden. Wie gesagt, sehr potent. Am Ausgang dieses Ringens kann es eigentlich keinen Zweifel geben.« Er schaute den Gefangenen prüfend an. »Manchmal aber ist die Droge zu stark und es gibt den Fall, dass das Herz aussetzt. Das wäre dann sehr fatal. Gehirnschlag passiert auch. Auch fatal. Sie sind schon recht geschwächt. Wenn ich Ihnen dies hier injiziere … Nun ja. Ich möchte besser keine Prognose abgeben, wenn Sie verstehen.«
Er hatte einen beinahe mitfühlenden Tonfall benutzt, wie ein Arzt, der sich für seinen Patienten engagierte. So weit war das nicht von der Wahrheit entfernt. Engagiert war er zweifelsohne.
Vielleicht verstand sein Gefangener, vielleicht aber auch nicht. Er befand sich irgendwo zwischen Wachsein und Bewusstlosigkeit. Der Schläger schien das ebenfalls zu bemerken, denn er beendete den Monolog mit einem kritischen Blick auf sein Opfer, seufzte und schüttelte den Kopf. Dann drehte er sich um, sah auf die Wand, hinter der er Beobachter wusste, und hob die Schultern.
»Wir machen später weiter«, ertönte eine kalte Stimme aus einem versteckten Lautsprecher. »Bringen wir ihn in eine Zelle. Säubern lassen. Die Wunden sollen versorgt werden. Er soll etwas Hoffnung schöpfen, dass es vorbei ist und wir aufgeben. Wenn wir dann weitermachen, wird ihn das umso mehr demoralisieren. Außerdem muss er für die Gabe von Veritas Kraft schöpfen. Wir haben kein Interesse daran, dass er sofort stirbt.«
Die Betonung lag auf sofort.
Der Anzugträger machte eine grüßende Handbewegung zur Bestätigung. Die Tür öffnete sich, zwei vierschrötige Männer in vergleichbarem, aber offenbar nicht maßgeschneidertem Anzug kamen herein, sahen den Mann abwartend an.
»Subdirektor Kahl?«, fragte einer unterwürfig.
»Sie haben es gehört: in die Zelle, waschen und Wunden versorgen. Wir lassen ihn zwölf Stunden in Ruhe. Stellen Sie Konzentratwürfel und Wasser in die Zelle. Ich möchte, dass er bei vollem Bewusstsein und ausgeruht ist, wenn ich mich wieder um ihn kümmere.«
»Wird erledigt, Direktor … Komm, Bursche. Du hast dir etwas Ruhe verdient!«
Sie lösten die Fesseln und zogen den Gefangenen hoch. Sie gingen nicht allzu grob vor, durchaus in dem Wissen, dass nichts und niemand ihr Opfer noch mehr bestrafen konnte als eine Stunde allein mit Subdirektor Kahl.
Der Gefangene wehrte sich nicht, half aber auch nicht dabei. Er hatte wohl nichts von alledem mitbekommen, wirkte positiv deliriös, benebelt von Schmerzen, Durst und Hunger. Gute Voraussetzungen, um ihn etwas aufzupäppeln und dann noch effektvoller in den Abgrund zu stoßen.
Als die beiden Wachen den Gefangenen hinausgezogen hatten, erklang wieder die kalte Stimme.
»Subdirektor, in der Zwischenzeit richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte auf die Gesamtsituation. Seine Freunde könnten beginnen, Fragen zu stellen. Wir möchten keinen Aufruhr. Die Vorsitzende wäre nicht erfreut.«
Kahl deutete eine Verbeugung an. Er beherrschte sich gut, aber die bloße Nennung der Vorsitzenden ließ ihm kalten Schweiß auf die Stirn treten.
»Ich kümmere mich sofort darum!«
»Ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Wir tun, was wir können. Und wir melden uns dann bei Ihnen. Ich verstehe ja Ihre Sorge, wir teilen Ihre Besorgnis. Aber es nützt wirklich nichts, wenn Sie hier stündlich anrufen. Wirklich nichts.«
Sonja DiMersi war nicht erfreut. Nein, das beschrieb ihre Gefühlslage nicht vollständig: Sie war in höchstem Maße erbost, enttäuscht und vor allem, obgleich sie das nicht zugeben wollte, fast panisch vor Angst.
Der Inspektor der Staatspolizei von Nevatka sah sie mit dem Ausdruck echten Bedauerns an und sie nahm es ihm auch ab. Niemand in der Regierung von Nevatka wollte Ärger mit dem Raumcorps, Ärger, den man zweifelsohne heraufbeschwor, wenn man sich nicht um das Wohlergehen sehr berühmter Gäste kümmerte.
Dass die Besatzung der Ikarus mittlerweile unter diese Kategorie fiel, daran konnte kein Zweifel bestehen. Die Umstände hatten sie zu Stars gemacht. Der Beamte wusste genau, mit wem er sprach. Und die Polizei hatte tatsächlich alles getan, was in ihrer Macht stand, und die Ermittler würden sich weiterhin anstrengen.
Aber auf wen sollte Sonja ihre Frustration richten, wenn ihr Gatte seit einer Woche spurlos verschwunden war und niemand auch nur den geringsten Hinweis darauf hatte, warum eigentlich? Und wohin? Und wann genau? Zu viele offene Fragen und viel zu wenige Antworten. Daher die andauernden Anrufe, die wachsende Ungeduld und die Angst um den Mann, den sie liebte – auch wenn er ihr das nicht immer einfach machte. Wie jetzt gerade.
Er hätte ihr vorher sagen sollen, dass er verschwinden würde. So viel Respekt hätte sie von ihm erwartet.
»Sie müssen doch zumindest eine Ahnung haben«, insistierte sie und rechnete Devan Golak, dem Inspektor, hoch an, dass er gleichbleibend höflich und respektvoll blieb.
Sie kam mit den immer gleichen Fragen und er hätte mittlerweile genauso gut gereizt oder zumindest ein wenig genervt reagieren können. Er war entweder ein sehr guter Diplomat oder er hatte kleine Kinder. Er lächelte sogar sanft, fast wie zu einem ungezogenen Minderjährigen. Ja, er hatte wohl Kinder.
»Seit Captain Sentenza das Konferenzzentrum vor sechs Tagen verlassen hat, um etwas Luft zu schnappen, ist er nirgends mehr gesehen worden. Die DNA-Spürer haben nichts entdeckt. Wir haben die Leute befragt und es gibt keine klaren Antworten. Wir haben Ihren Mann zur Fahndung ausgeschrieben, Platz 1 auf der Vermisstenliste, und ich versichere Ihnen, dass wir jedem auch nur kleinsten Hinweis nachgehen. Der Botschafter des Corps hat uns erst vorgestern ganz ausdrücklich ans Herz gelegt, in unseren Bemühungen nicht nachzulassen, und wir haben es ihm versprochen. Ich verspreche es Ihnen. Erneut.«
Inspektor Golak betonte das letzte Wort nur ganz leicht, aber die Nachricht kam bei ihr gut an. Er hatte ja recht. Sie selbst – die ganze Mannschaft – hatte nach Sentenza gesucht, die Gassen und Straßen, die Boulevards und Passagen um das Hotel abgegrast und bestimmt genauso viele Passanten und Geschäftsinhaber der Gegend befragt wie die Polizei. Mit exakt dem gleichen Ergebnis.
Der ganze Aufenthalt auf Nevatka hatte unter keinem guten Stern gestanden.
An Konferenzen teilzunehmen, gehörte zu den Pflichten, denen die Crew der Ikarus höchst ungern nachging; es hielt sie von viel wichtigeren Dingen ab. Diesmal aber war eine Sektorkonferenz zum Thema Raumsicherheit und medizinische Notfallversorgung einberufen worden, hochkarätig besetzt, und das Thema Rettungsdienste und Havarie war ein zentraler Bestandteil des Treffens. Experten trafen sich, um, basierend auf den bisherigen Aktivitäten, eine engere interstellare Zusammenarbeit zu forcieren und die vielen schwarzen Flecke ohne Hilfsdienst in der bekannten Galaxis zu füllen.
Langfristig konnte das auch zur Entlastung der Ikarus beitragen und so hatte sich Sentenza breitschlagen lassen, dieser Zusammenkunft beizuwohnen – mit der Aussicht auf ein paar zusätzliche bezahlte Urlaubstage für den Rest der Crew, für die es auf der Konferenz eigentlich nichts zu melden gab.
Dann aber war das Wetter schlecht gewesen, da die Klimakontrolle Nevatkas gewartet wurde, und Darius Weenderveen hatte auf einer Kneipentour die falschen Leute getroffen und war in eine Schlägerei verwickelt worden. Thorpa hatte sich im feuchtwarmen Wetter eine Pilzinfektion geholt und Anande hatte Stunden damit verbracht, ihn mit antibiotischen Salben einzureiben. Die stoische Gegenwart von Arthur Trooid fehlte. Der Android war zum Zwecke einer Generalinspektion auf Vortex Outpost zurückgeblieben.
Die Stimmung war also allgemein auf einem Tiefpunkt angelangt, als am zweitletzten Konferenztag Roderick Sentenza spurlos verschwand.
Und überhaupt: Diesmal hatte Sonja gar nicht angerufen. Sie war persönlich gekommen.
Der Inspektor sah sie halb bittend, halb bedauernd an. Darin lag vor allem eine Botschaft: Mrs. DiMersi, verschwinden Sie! Sie stören. Wir können nichts weiter tun. Melden Sie sich nicht, wir melden uns. Guten Tag!
DiMersi rang sich einen Gruß ab, als sie ging.
Draußen vor dem Gebäude der Polizei blieb sie einen Moment stehen, versuchte, ihre Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Es war leicht, ungerecht zu sein. Es war noch leichter, anderen die Schuld zu geben, vor allem wenn man sich selbst schon so angestrengt hatte. Doch die eigene Anstrengung war kein Grund dafür, Verantwortung von sich zu schieben, als habe man damit alles getan. Sie musste sich vielmehr überlegen, ob es noch andere Wege gab, das Problem zu lösen, nachdem all ihre bisherigen Bemühungen nichts erbracht hatten. Gut, die Polizei mochte es sicher nicht, wenn sie sich einmischte.
Aber das war ihr jetzt herzlich egal.
Sie sah auf, als sie den Lärm hörte.
Es war gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Einige Bürger hatten sich versammelt, sie trugen ganz altmodische Spruchbänder und Plakate, die sie wippend in die Höhe hielten, als würde die ständige Bewegung es den Passanten erleichtern, sie zu lesen. Zwei Dutzend Demonstranten, die sich langsam den Bürgersteig entlangbewegten, hin und wieder etwas riefen, was Sonja von hier aus nicht hören konnte. Weitgehend ignoriert, auf ungewollte Weise komisch, ein verlorenes Häuflein aufrecht Empörter.
Normalerweise hätte Sonja sie auch ignoriert, aber sie befand sich nicht in einer normalen Gefühlslage. Sie erkannte das Symbol auf zweien der Plakate, das mit blutroten Streifen durchgestrichen worden war:
Es gehörte zum Dardarus-Konzern, einem der Sponsoren der Konferenz, die für sie ein so unrühmliches Ende gefunden hatte. Eines der großen interstellaren Konglomerate, mit dem auch sie als Rettungsabteilung öfters zu tun gehabt hatten, allein schon deswegen, weil es im Rahmen seiner CSR-Politik immer wieder großzügig gespendet und damit die Ausrüstung der Ikarus verbessert hatte. Vor allem sehr teure Medikamente für seltene Krankheiten gehörten zum Portfolio von Dardarus und so manches davon hatte kostenfrei seinen Weg in Anandes Medizinschränke gefunden, wenn es sich als nötig erwies.
Die Leute da drüben hatten aber offenbar eine etwas andere Einstellung. Sonja beobachtete die kleine Prozession. Pharmakonzerne waren auf Nevatka wichtig. Sie gehörten zu den zentralen Wirtschaftsakteuren. Die Dschungel und Tiefseegebiete dieser schönen Welt stellten die Basis ihrer Arbeit dar, die dortige Vielfalt an chemischen und biologischen Grundzutaten war mit nur wenigen anderen Welten vergleichbar. Nevatka war ein evolutionärer Brutkasten, ein Augapfel der himmlischen Mächte, um allerlei auszuprobieren und kreativ zu sein. Auch wenn vieles synthetisch hergestellt werden konnte, es war vor allem die Innovationskraft der Evolution, die nicht zuletzt die Forschungsabteilungen der großen Firmen immer wieder inspirierte.
Wogegen die Menschen dort auch waren, viele interessierte es nicht. Gelegentliche Blicke, ein Kopfschütteln, viel Ignoranz, aber ganz bestimmt keine Begeisterung. Die Demonstranten bewegten sich am Rand der Straße ebenso wie am Rand der Gesellschaft; dieser Eindruck drängte sich Sonja DiMersi auf. Keiner nahm sie ernst. Es reichte oft nicht einmal für ein abschätziges Lächeln. Dann war man wirklich ganz unten angekommen. Und aus irgendeinem Grunde, einem Impuls folgend, machte Sonja das neugierig. Vielleicht war sie einfach nur verzweifelt. Aber wen kümmerte das schon?
Sie überquerte die Straße und folgte den Demonstranten, die keine Flugblätter verteilten – so altmodisch waren sie dann doch nicht.