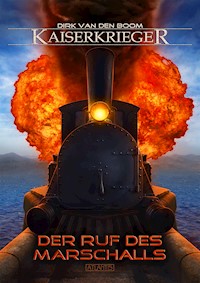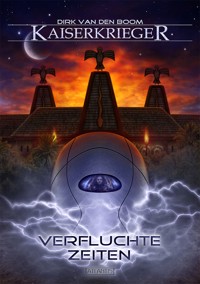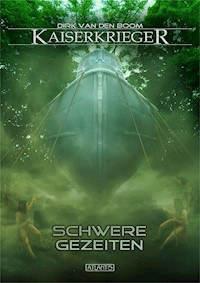
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kaiserkrieger
- Sprache: Deutsch
Das Imperium von Mutal wächst, und damit auch die Zahl seiner Gegner. Während sich eine große Allianz freier Mayastädte bildet, um im Einklang mit dem mächtigen Teotihuacán der Expansion der Götterboten einen Riegel vorzuschieben, versucht die Expedition der Römer, Kontakt mit den Festlandmaya aufzunehmen und Näheres über die Zeitreisenden aus Japan zu erfahren. Doch schnell überschlagen sich die Ereignisse und mancher, der noch meinte, das Heft des Handelns in der Hand zu halten, wird eines Besseren belehrt. Konflikte eskalieren, Geschehnisse geraten außer Kontrolle und Römer, Japaner wie auch Maya geraten in schwere Gezeiten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Personenverzeichnis
Weitere Atlantis-Titel
Dirk van den Boom
Kaiserkrieger: Schwere Gezeiten
1
»Was bedeutet das?«
Aritomo Hara war sich nicht sicher, ob es sich dabei um eine rhetorische Frage handelte. Er stand am mit dünnen Lederhäuten verhangenen Fenster, aus dem nur ein schummriges Licht in den Raum trat. Draußen regnete es und diesmal war es nicht die donnernde Sintflut eines Tropensturms, sondern die andauernde Monotonie eines Schauers, der vor einer Stunde begonnen hatte und nicht aufzuhören gedachte. Für die Bewohner der Stadt Mutal, Hauptstadt des Neuen Reiches der Maya, war das eine gute Nachricht. Der Regen füllte die Wasserreservoirs und bewässerte die zahlreichen, in Terrassen die Stadt umgebenden Felder. Eine weitere Maisernte war zu erwarten, eine gute dazu, und das war angesichts der stetig wachsenden Bevölkerung eine positive Entwicklung.
Kapitän Inugami saß hinter einem breiten Schreibtisch, den er sich von fähigen Handwerkern hatte herstellen lassen. Beide Männer befanden sich im Büro des Offiziers, dem wahren Machtzentrum von Stadt und Reich, eine Tatsache, der sich alle bewusst waren, unabhängig davon, welche Formen ritueller Ehrerbietung Chitam, dem König von Mutal, noch erwiesen wurden.
»Ich habe es zweimal übersetzen lassen, von Itzanami und von Sawadas besten Schülern. Die Texte wichen kaum voneinander ab.«
Inugami nickte. Linien zeichneten sich scharf auf seinem Gesicht ab. Er war schon immer ein verbissener Typ gewesen, aber die Strapazen der letzten Wochen hatten ihre Spuren hinterlassen. Als er nach Mutal zurückgekehrt war, als siegreicher Feldherr und Erschaffer eines Imperiums, hatte er sich keine Ruhe gegönnt. Das Eintreffen des Schreibens von der fernen Insel Cozumel hatte sie in Verwirrung gestürzt. Dort war die Rede von eingetroffenen Reisenden, die eine seltsame, unverständliche Sprache pflegten, aber über Wunder an Schiffen verfügten, fremdartige Kleidung trugen und von sich behaupten, die große See überquert zu haben, direkt aus dem Osten her. Mutal wurde gebeten, einen der Ihren als Dolmetscher zu entsenden, denn die fremden Besucher verfügten über Götterwaffen wie die neuen Herren Mutals und daher seien sie sicher miteinander bekannt.
Wie konnte das sein?
»Kolumbus wird es nicht sein«, erwiderte Hara schließlich, nur um überhaupt etwas zu sagen. »Dafür ist es zu früh, davon können wir ausgehen. Wir wissen zwar nicht, welches Jahr genau wir in Europa oder in Japan schreiben, aber ich bin mir sicher, für Kolumbus ist es zu früh.«
»Der Brief spricht von Schloten, aus denen Dampf tritt. Kolumbus hatte so etwas nicht. Das passt alles nicht zusammen«, meinte Inugami.
»Der Hinweis auf die Sprache ist wichtig«, erklärte sein Erster Offizier. »Eine Expedition aus Japan käme nicht aus dem Osten. Gab es so früh eine Westexpedition der europäischen Mächte? Mir ist darüber nichts bekannt. Handelt es sich unter Umständen um ein gescheitertes Vorhaben, das in den Annalen der Geschichte verloren gegangen ist?«
»Die Vermutung ist so gut wie jede andere. Wir wissen nicht einmal, welche europäischen Mächte derzeit dominieren. Ich habe so eine Vermutung, dass das alles gar nicht zusammengehört … Dampfmaschinen um diese Zeit? Die Welt war doch längst vollständig erschlossen und unter den großen Mächten aufgeteilt, als es Dampfschiffe gab! Das ist ein Anachronismus.«
»Wie wir.«
»Ja, wie wir.« Inugami schaute weiter stirnrunzelnd auf den Brief, den er bereits mehrmals gelesen hatte. »Das dürfte der wichtigste Aspekt sein. Wie wir. Was, wenn wir nicht die Einzigen sind, die einen Anachronismus darstellen – oder einen ausgelöst haben? Vielleicht haben wir damit einen Hinweis, der uns hilft, unsere eigene Anwesenheit zu erklären. Oder könnte ich mich irren?«
Aritomo schüttelte den Kopf, zum einen als Antwort auf die Frage des Kapitäns, zum anderen aus stiller Verwunderung darüber, dass dieser auch nur andeutungsweise zugab, möglicherweise einen Fehler zu begehen. Inugamis Gesicht war härter geworden, er sah älter aus, aber es gab nicht nur äußere Spuren all der vergangenen Ereignisse, sondern auch innere. Es war bemerkenswert.
»Nein, Herr Kapitän«, sagte Aritomo. »Ich denke in eine ähnliche Richtung.« Er seufzte. »Ich habe Nachforschungen angestellt. Mehrere Frauen sind vor einiger Zeit nach Cozumel aufgebrochen, weil sie keine Kinder bekommen können – oder das zumindest annahmen. Dort gibt es einen Tempel einer für Fruchtbarkeit zuständigen Göttin, eine Art Wallfahrtsort, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Reise ist üblich und nicht übermäßig beschwerlich, sie wird regelmäßig von mutalesischen Frauen wahrgenommen. Alle zuletzt aufgebrochenen Frauen haben zumindest unsere Ankunft miterlebt und, vielleicht nur passiv, einige unserer Sprachlektionen. Wir müssen davon ausgehen, dass das ihr Vergleichsrahmen ist. Welche Sprache haben sie von uns mitbekommen? Japanisch und Englisch.«
»Das ist alles nur durch eine Sache zu erklären«, sagte der Kapitän und legte den Brief zur Seite. »Sie denken das Gleiche wie ich?«
»Weitere Zeitreisende.«
Inugami nickte langsam und erhob sich. Er trat neben Aritomo und schlug die dünne Lederhaut zur Seite. Wasserspritzer benetzten ihr Gesicht, als der Schutz verschwand, doch Aritomo beschwerte sich nicht. Der schwere, erdige Geruch der feuchten Stadt wirkte nun frischer und erträglicher als noch zur Mittagshitze, der Regen reinigte die Luft und die Temperaturen kühlten ein wenig ab. Die Feuchtigkeit auf seinem Gesicht bestand nicht mehr nur aus Schweiß und das war durchaus willkommen.
»Wie reagieren wir darauf?«, fragte er, laut genug, um den immer noch beharrlichen Schauer zu übertönen.
»Zwei Dinge«, sagte Inugami leise, nahe an Aritomos Ohr. »Wir müssen sofort den Feldzug fortsetzen und unsere Machtbasis erweitern, auch wenn ich zugeben will, dass wir langsam vorsichtig sein müssen, um uns nicht zu überdehnen. Und wir müssen eine Expedition nach Cozumel schicken, um uns in den Besitz der Machtmittel zu bringen, über die die Fremden verfügen. Wir werden sie noch brauchen.«
Aritomo presste die Lippen aufeinander. Inugami dachte weiterhin nur in den Kategorien der eigenen Macht. Er hatte nicht einmal erwogen, mit den Fremden friedlichen Kontakt aufzunehmen, anstatt sie sich sofort zu Feinden zu machen.
»Nach den Berichten verfügen sie über eine Flotte großer Schiffe. Es ist anzunehmen, dass sie diese Reise gut vorbereitet haben. Sie sollten Soldaten mit sich führen und Waffen.«
Aritomo sagte dies in der Absicht, Inugami zu bremsen. Er erreichte damit das Gegenteil.
»Die will ich. Muss ich Sie erneut auf die Referenz hinweisen, den schwarzen Schornstein, die Fähigkeit der Schiffe, ohne Wind zu segeln?«
Der Brief war in der Tat relativ detailliert in seinen Beschreibungen gewesen.
»Nein«, sagte Aritomo nur.
»Dampfkraft, Unterleutnant Hara! Dampfkraft! Wer Dampfkraft hat, hat Schusswaffen. Gewehre, Kanonen, vielleicht nicht so gut wie unsere – die Schiffe der Fremden sind offenbar generell aus Holz gefertigt, also etwas älter, von unserer heimatlichen Epoche aus betrachtet –, aber gut genug, besser als alles andere, was die Maya auch mit unserer Anleitung in Bälde fertigbringen könnten. Fertig konstruiert, mit Vorräten an Munition und Triebmittel, Schwarzpulver wahrscheinlich. Ich will das haben. Ich brauche es. Unsere Waffen sind wenige und wir haben kaum noch Patronen. Wir müssen jetzt sofort handeln. Es wird noch sehr lange dauern, bis wir mit den Maya die notwendige Industrie aufgebaut haben. Wir haben noch nicht einmal eine gute Quelle von Eisenerz gefunden! Dies ist ein Geschenk, eine Gabe des Schicksals.«
Inugami sprach mit zunehmender Leidenschaft. Aritomo wusste, was er sagen konnte und was nicht, wenn der Kapitän in dieser Stimmung war. Dessen Augen glänzten, auf einen fernen Punkt in der Zukunft gerichtet, wo seine Vision eines noch größeren, stetig wachsenden Imperiums auf ihn wartete. Jetzt mit Frieden zu argumentieren, würde wieder genau das Gegenteil hervorrufen.
»Wie wollen wir eine solche Streitmacht – vorausgesetzt, es gibt sie überhaupt – effektiv angreifen? Mit Ruderbooten und kleinen Seglern? Von mit uns wahrscheinlich mittlerweile verfeindeten Küsten aus? Mit wenigen Gewehren und wenigen Patronen?«
Ein sachlicher Einwand, und für einen solchen war Inugami zu haben. Er streckte den Arm aus und zeigte auf den mächtigen Leib des U-Bootes, das, zum Schutz vor der Witterung mit großen Planen abgedeckt, immer noch auf seinem Ruheplatz auf der niemals fertiggestellten Ruhestätte des Vaters von König Chitam ruhte.
»Damit, Unterleutnant Hara. Damit.«
»Aber …«
Inugami machte eine wegwischende Handbewegung.
»Wir haben nun die Arbeitskraft von vier Städten in unserer Hand – und bald von weiteren. Die Dieseltanks des Bootes sind voll und Sarukazaki hat sich seit unserer Ankunft aufopferungsvoll um die Anlagen gekümmert. Sagen Sie mir, dass das Boot im Wasser nicht mehr einsatzbereit ist?«
Aritomo musste gegen seinen Willen mit dem Kopf schütteln.
»Nein. Der Verfall ist nicht so weit fortgeschritten und ja, Sarukazaki und die Männer arbeiten hart. Wenn wir das Boot ins Wasser lassen, werden wir es auch einsetzen können. Aber …«
»Kein aber«, herrschte Inugami ihn an und sein Blick war aus der Ferne zurückgekehrt, erfasste Aritomo mit eisernem Willen, der keinen weiteren Widerspruch duldete. »Wir müssen das Boot zur Ostküste schaffen, auf direktem Wege. Das ist die wichtigste Aufgabe für Sie, Hara. Ich plane den nächsten Feldzug, Sie planen den Einsatz des Bootes. Und wenn wir so weit sind, holen wir uns, was das Schicksal für uns bereitet hat.«
Aritomo schwieg. Er wusste, dass jedes Gegenwort sinnlos war, wenn er es nicht durch weitere Argumente untermauern konnte. Fürs Erste war zu hoffen, dass sich dieses Vorhaben als unmöglich umzusetzen erwies. Doch er musste eingestehen, dass es tatsächlich nicht unmöglich war. Inugami hatte vollkommen recht. Ihnen standen zahlreiche Arbeitskräfte zur Verfügung, darunter intelligente Männer, die wussten, was schwere Lasten bedeuteten, was Statik war, wie man Dinge mit Muskelkraft bewegte, die um einiges schwerer und größer als Menschen waren. Die Ägypter hatten gigantische Pyramiden erbaut, allein mit einfachen Werkzeugen, ihrem Verstand und einer großen Anzahl an Muskeln. Die grandiosen Bauten der Maya standen dem in nichts nach. Der Weg zur Küste war lang und beschwerlich. Aritomo schätzte auf der Basis der nur groben Karten der Region, die das U-Boot mit sich führte, dass die Distanz fast 200 Kilometer betrug. Einen guten Teil würden sie auf einem Fluss zurücklegen können, aber bis dahin … Und der Weg dorthin war nicht ohne Gefahren. Die Feinde Inugamis würden sich sammeln, tatsächlich mehrten sich die Anzeichen einer Allianz, die sich gegen sie zusammenschloss. Eine solche Expedition würde nicht unbeobachtet bleiben, und ihr Schutz zu gewährleisten, war eine mindestens genauso schwierige Aufgabe wie der logistische Aspekt, sollte man die Gegner nicht anderweitig beschäftigen können.
Er verließ den Raum Inugamis und begann sofort, Lengsley und Sarukazaki zu suchen. Diese beiden Männer wären am ehesten imstande, sich ein realistisches Bild von den Möglichkeiten zu machen. Sarukazaki würde sich nicht laut beschweren, er führte Befehle aus, im Zweifelsfalle auch eher unsinnige. Lengsley aber war von unabhängigerem Geiste und diese Unabhängigkeit hatte sich durch seine Beziehung zur Schwester Chitams noch verstärkt. Würde er dieses wahnsinnige Projekt zum Anlass nehmen, mit den Japanern zu brechen und sich offen auf die Seite der Maya zu schlagen? Aritomo hielt das Risiko für gering, aber gänzlich ausschließen konnte er eine solche Entwicklung leider nicht.
Als er das Haus verließ, in dem die Japaner untergebracht waren, ließ der Regen etwas nach. Feuchtigkeit dampfte über der Stadt und die Menschen kamen aus den Gebäuden hervor, um die verlorene Zeit für ihr Tagwerk nachzuholen. Mutal war voll. Neben den zurückgekehrten Soldaten gehörten auch die Sklaven von Inugamis Janitscharenarmee zum Stadtbild. Zwar wurden diese weiterhin getrennt in eigenen Unterkünften untergebracht, aber das war im Grunde nur noch eine Frage der Effizienz, nicht der Sicherheit. Viele hatten sich mit ihrem Schicksal nicht nur arrangiert, sie trugen sogar stolz die Abzeichen ihres Status zur Schau. Inugami hatte seine Versprechen gehalten. Er hatte die Tapferen belohnt, ihnen Frauen gegeben und Besitztümer. Er hatte ihre Reihen durch neue Rekruten – Sklaven wie Freiwillige – verstärkt und damit Kommandoposten geschaffen, die von frisch Beförderten ausgefüllt wurden. Ein stehendes Heer, eine für die Maya ungewohnte Einrichtung, eine professionelle Armee, die den ganzen Tag nicht mehr tat, als zu trainieren, die eigene Ausrüstung zu verbessern, Disziplin einzuüben und den Körper zu stählen. Um die Vorbehalte der Stadtbevölkerung zu minimieren, setzte Inugami die Armee derzeit auch für Saat und Ernte ein, für das Sammeln von Pflanzen und das Schlagen von Holz, den Transport von Steinen, den Bau von Straßen. Es gab keine ruhige Minute für die Janitscharen, doch alle ertrugen das Los, ohne zu klagen, denn für jeden von ihnen gab es das Versprechen auf Aufstieg, auf Ehren und Ämter, auf Ansehen und Einfluss. Und, das Gefühl hatte Aritomo auch, sie fühlten sich durch ihre direkte Gefolgschaft für den Götterboten befreit von allen anderen Loyalitäten, ja sogar von der Pflicht, sich der Willkür unberechenbarer Gottheiten zu unterwerfen. Inugami gab ihnen Sicherheit, ein klares Weltbild, eine eindeutige Orientierung. Es gab keine Ambiguitäten mehr, kein Sowohl-als-auch, keine sich widersprechenden Botschaften. Sie gehorchten und er sorgte für sie. Sie bewahrten die Disziplin und eiserne Loyalität, und ungeahnte Wege zu höchstem Ruhm standen ihnen offen. War nicht einer von ihnen sogar Herr über eine der eroberten Städte geworden? Wie sonst wenn nicht auf diesem Wege konnten einfache Männer wie sie jemals von einem so rasanten Aufstieg an den traditionellen Hierarchien vorbei denken? Die Janitscharen, so rigide und straff sie auch organisiert waren, stellten für viele einen Weg der Befreiung und Entfaltung dar und es sprach für Inugami, dass er das sofort erkannt und klug befördert hatte. Damit schuf er ein Machtinstrument, gegen das seine Gegner erst einmal ein Kraut finden mussten.
Und sollte ihm in der Tat das Undenkbare gelingen und er würde seine Hand auf nicht ganz so moderne, aber möglicherweise viel leichter zu kopierende Technik legen, auf effektive Waffen, die ihren zwar sicher unterlegen, aber in dieser Zeit einfacher herzustellen waren – wer oder was sollte sich dem Götterboten dann noch entgegenstellen?
Das war für Aritomo keine akademische Frage und er legte sie sich erneut vor, als er über den Hauptplatz schritt, in Richtung der Baustelle für die Stadtmauer, bei der er die Gesuchten vermutete.
Eine Frage, die er sich selbst stellte, weil er auch zu jenen gehören konnte, die eines Tages vor die Macht der Kriegersklaven treten mussten.
Als ihr Feind, nicht als ihr Anführer.
2
Köhler war sehr entspannt. Der alte Mann vor ihm, ein Mayapriester in einer bunten Tracht, hatte eine große Steinplatte aufgebaut, auf der er mit einem Pinsel Schriftzeichen festhielt. Es war faszinierend zu sehen, mit welcher Leichtigkeit und Geschwindigkeit er die komplexen Glyphen auf den Stein zauberte. Köhler hatte eine Art Pergament vor sich liegen, offenbar aus Holzrinde gemacht, und hielt einen kleinen Pinsel in Händen. Eigentlich war es seine Aufgabe, das abzumalen, was der alte Mann ihnen allen – sieben Besatzungsmitgliedern der Gratian – soeben beizubringen versuchte. Er hatte bereits nach dem ersten Symbol weitgehend aufgegeben. Seine Reproduktion der Glyphe hatte mit einiger Fantasie vielen Dingen geähnelt – der Wolkenformation, die gerade über sie hinwegzog, einem zufälligen Muster im Sand, in dem sie saßen –, der Vorlage jedoch eher nicht. Es gab andere Schüler, die eifriger bei der Sache waren, und Köhler fühlte ein ganz sanftes Zwicken von Schuld, weil er dem Standard der Klasse heute nicht entsprach.
Wie so oft.
Man musste das aber auch verstehen.
Es war ein warmer Tag, wie meistens in diesen Breiten, und die Sonne schien mit einer beängstigenden Intensität vom Himmel. Sie saßen unter einer Plane, aber der Schatten vertrieb die schwüle Hitze nicht und die Brise vom Meer her war heute lau und kaum zu spüren. Köhler trug nur die nötigste Kleidung am Leib, doch er schwitzte bereits den ganzen Morgen und er hatte sich früh bei dem Gedanken ertappt, ein kühlendes Bad zu nehmen. Natürlich würde ihn niemand aufhalten, wenn er jetzt aufsprang und sich eine schöne Stelle suchte, um ins Wasser zu springen – er war einer der höchsten Offiziere dieser Expedition. Andererseits war Langenhagen der Ansicht, dass er auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen habe, und zwar sowohl, was die Selbstdisziplin anging, als auch, was seine Sprachkenntnisse anbetraf. Sie waren nun schon einige Wochen auf Cozumel und es hatte sich als ergiebig und sicher erwiesen, mit den Maya hier Kontakt aufgenommen zu haben. Es gab endlos viel zu lernen, und obgleich man sicher über kurz oder lang weiterreisen würde, war man hier noch nicht am Ende angekommen. Vor allem hatte Langenhagen intensive Sprachstudien befohlen, für jeden Einzelnen, und das umfasste leider auch Trierarch Köhler, der für viele Dinge Talente hatte, aber für Sprachen eher nicht.
Er quälte sich.
Oder eben auch nicht, denn es gab andere Arten der Ablenkung, wenn er schon nicht ins Wasser springen durfte. Anstatt es doch noch einmal mit der Glyphe zu versuchen, widmete er sich lieber dem zweiten Grund neben der brütenden Hitze, der ihn von seinen Sprachstudien abhielt. Schräg vor ihm hockte Terzia auf dem Boden und sie war hoch konzentriert und hatte wunderbare Kopien der Vorlagen auf ihr Papier gezeichnet, Ausdruck sowohl ihrer zeichnerischen Fähigkeiten – damit war es bei Köhler auch nicht weit her – wie ihrer Auffassungsgabe. Sie war versunken in die Welt der Mayaschrift, die sie aufsog wie ein Schwamm. Daher bemerkte sie auch nicht, dass Köhler sie von hinten intensiv musterte: die Rundung ihrer ausladenden Hüften, wie sie im Sitzen deutlich zu erkennen war, die nach vorne hängenden Brüste, wenn sie sich über das Papier beugte, der sanfte Schwung von Hals und Schultern, halb entblößt in der dünnen Tunika, die sie trug. Der feine Schweißfilm, der sich natürlich auch auf ihrer Haut abzeichnete, schimmerte leicht und wirkte ungemein … interessant. Köhler stellte sich vor, den salzigen Geschmack auf seiner Zunge zu spüren, während er …
Er war definitiv abgelenkt.
Der alte Mayapriester kümmerte sich nicht. Er hatte es nicht mit Kindern zu tun, die der Zurechtweisung bedurften. Er spulte sein Programm mit der Routine eines Lehrers ab, der diese Lektionen schon oft in seinem Leben vermittelt hatte. Wer aufpasste, würde davon profitieren. Wer auf den sanften Schwung von Schultern und elegant schwingende Brüste starrte, hatte sicher auch seine Freude. Es kümmerte ihn nicht. Er begann mit der nächsten Glyphe, die, das immerhin hatte Köhler mitbekommen, für »Haus« stand. Er malte sie auf, geschickt, schnell, aber nicht zu schnell, und Köhler starrte auf sein weitgehend leeres Stück Papier und begann, sich ein klein wenig zu schämen.
Er malte »Haus«, und was dabei herauskam, hatte möglicherweise auch eine Bedeutung in der Mayaschrift, aber ganz sicher nicht die, die sie haben sollte. Dass Terzias »Haus« ein ganz klares und eindeutiges »Haus« wurde, war ebenfalls nicht verwunderlich. Köhler kam die Idee, die Wissenschaftlerin um private Stunden zu bitten, um seinen Lernrückstand aufzuholen. Er war bereit, dies selbstlos auf sich zu nehmen, um seine Pflicht vor den Augen Langenhagens zu erfüllen.
Es dauerte noch etwa eine halbe Stunde, dann war die Lektion beendet und die Schüler erhoben sich, sprachen die Dankesworte für den alten Priester – eine der ersten Formeln, die dieser ihnen beigebracht hatte – und verabschiedeten sich von ihm. Jeden Tag würden sich diese Lektionen wiederholen und Köhler hoffte für den Erfolg ihrer Expedition, dass andere wirklich aufmerksamer waren als er. Nachdem er seine Sachen in den Rucksack gepackt hatte, den er für diesen Zweck mit sich führte, sah er auf und stellte zu seinem Bedauern fest, dass Terzia sich bereits davongemacht hatte, wahrscheinlich, um ihre botanischen Studien fortzusetzen, denen sie sich mit einigen Ixchel-Priesterinnen zusammen seit ihrer Ankunft intensiv widmete. Köhler beneidete sie um diese Aufgabe, die sie ganz und gar zu erfüllen schien. Sein Alltag drohte monoton zu werden. Ehe Langenhagen nicht den Aufbruch gen Festland befahl, würde für den seemännischen und militärischen Arm ihrer Truppe nicht allzu viel zu tun sein.
Das konnte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Gerüchte um die sogenannten Götterboten hatten zu viel Neugierde geweckt. Und es gehörte zum Kern ihrer Reise, andere Zeitenwanderer ausfindig zu machen und die Gefahr einzuschätzen, die von ihnen möglicherweise für Rom ausging. Köhler zog es durchaus vor, weiterhin Freunde zu machen. Hier auf Cozumel war ihnen das bisher ganz gut gelungen. Er hatte beschlossen, diesbezüglich zuversichtlich zu bleiben.
Er hörte einen Ruf und kniff die Augen zusammen, erkannte einen der älteren Priester, der sich ihm näherte. Es handelte sich um D’aak, einen der ersten Männer der Maya, die mit Sprachstudien begonnen hatten. So wie Köhler ein widerwilliger Schüler war, so hatte D’aak eine Gruppe von Maya, darunter eine Reihe von Kindern, zusammengestellt, die sich den lateinischen Sprachstudien widmeten, bis zu sechs Stunden am Tag und mit Ehrfurcht gebietender Intensität. Es war daher nicht verwunderlich, dass der alte Herr die logische und nachvollziehbare Grammatik des Lateinischen schneller begriffen hatte als Köhler das Äquivalent der Mayasprache. Vor allem der schriftliche Ausdruck stellte ihn weiterhin vor schier unüberwindliche Hürden, vor denen D’aak bei der lateinischen Schrift nicht stand. Tatsächlich, so hatte Terzia ihm erzählt, war der alte Priester dazu übergegangen, die Mayasprache in lateinische Schriftzeichen zu transkribieren, nicht allein, um ein Wörterbuch zu erstellen, sondern auch deswegen, um es den Fremden generell leichter zu machen. Leider war diese Innovation, die sich sicher noch im Anfangsstadium befand, noch nicht bei Köhlers Lehrmeister angekommen.
»Trierarch!«, rief D’aak und lächelte ihm freundlich zu, als er näher gekommen war. »Langenhagen sucht Euch!«
Die Art der Aussprache war immer noch gewöhnungsbedürftig und es gab Laute, bei denen sich D’aaks Herkunft nicht verleugnen ließ. Aber auch hier war das, was der alte Mann von sich gab, besser zu verstehen als alles, was der Offizier auf Maya hervorbrachte.
Er unterdrückte ein Seufzen. Ob er wollte oder nicht, er musste seine Studien intensivieren, wollte er nicht übel abgehängt werden. Und sei es nur, damit er nicht in den Augen Terzias wie der allerletzte Trottel aussah, eine Notwendigkeit, die in seinem Denken einen bemerkenswert breiten Raum einnahm.
»Wo?«, fragte er auf Maya. Die einfachen Fragen waren nicht sein Problem. Die komplizierten Antworten waren es.
D’aak, der die sprachlichen Begrenzungen Köhlers durchaus kannte, wies mit einem langen Arm in Richtung Lager. Dieses war von den Römern nahe dem Hafen errichtet worden, ganz im Stile einer traditionellen militärischen Befestigung, wenngleich etwas kleiner. Die Mayabaumeister Cozumels hatten nicht nur Arbeitskräfte bereitgestellt, sie hatten die Bauweise der Gäste auch mit größter Aufmerksamkeit beobachtet und sich einige Notizen gemacht. Es war nicht so, dass sie sehr viel von den Römern lernen konnten – dass die Maya beeindruckende und sehr stabile Gebäude errichten konnten, war mit bloßem Auge in jeder Richtung ersichtlich –, aber in Bezug auf die Details war man offenbar bereit zu lernen. Gerade auch der mächtige Palisadenzaun, auf dem Langenhagen bestanden hatte, fand große Aufmerksamkeit. Die Maya hatten ihre Städte nicht befestigt. Es war nicht so, dass ihnen das Konzept völlig fremd war, sie taten es einfach nicht. Für Köhler ein ähnliches Rätsel wie die Tatsache, dass die Einheimischen zwar die Idee des Rads kannten, es aber nicht zur Konstruktion von Wagen einsetzten.
Köhler wusste, dass dies der Grund war, warum Langenhagen ihn suchte. Seit einigen Tagen bereiteten sie eine Demonstration vor, zu der die Notabeln der Insel geladen worden waren. Die Vorbereitungen mussten nun abgeschlossen sein.
Als Köhler eintraf, wurde er bereits von einer illustren Gruppe erwartet. Die beiden wichtigsten Persönlichkeiten waren Ik’Naah, die Oberste Priesterin der Insel und de facto Regierungschefin, soweit er das hatte beurteilen können, sowie Navarch Langenhagen. Sicher ebenfalls von zentraler Bedeutung waren zwei weitere Anwesende: Lucius Aemilius Sater, der für die Pferde der Expedition die Verantwortung trug, ein Mitglied der römischen Kavallerie mit langjähriger Erfahrung, sowie Optimus, der älteste der mitgebrachten Hengste. Optimus war wie alle Pferde für seine Gelassenheit ausgesucht worden, was ihn nicht zum spritzigsten Reittier machte. Er war aber alt genug, um sein Interesse am anderen Geschlecht nicht verloren zu haben, und alle Tiere hatten die Freiheit des Landganges nicht nur genossen, sondern auch produktiv genutzt. Jedenfalls meinte Sater, dass Fohlen zu erwarten seien, und dies wiederum bedeutete, dass sie dies bei ihrer Planung für weitere Expeditionen einzukalkulieren hatten. Jetzt aber war Optimus hier nicht in seiner Funktion als künftiger Vater oder spritziger Kavallerist tätig, sondern in einer dritten: als Zugtier.
Die Legionäre, die keinen Dienst hatten, waren mit einer Reihe von Handwerkern aus der Stadt übereingekommen, ein gemeinsames Projekt zu starten: den Bau eines einachsigen Wagens, wie er die Straßen des Römischen Reiches seit Jahrhunderten bevölkerte. Auch heute gab es noch viele davon, oft gezogen von Eseln oder Ochsen, beides Tierarten, die die Expedition nicht mit sich führte. Köhler stellte mit Kennerblick fest, dass die Männer ordentlich gearbeitet hatten. Der Wagen bestand aus einer flachen Pritsche, gut zwei Meter lang, mit einem kleinen Kutschbock am vorderen Ende. Die Wagenräder waren groß, aus Holz gebaut, und mit jeweils sechs Speichen versehen. Die Fahrt würde sehr rumpelig werden, denn es fehlte an jeder Federung. Ehe sie keine gute Quelle für Eisenerz oder Kupfer fanden, würden sie auch keine Federn bauen können, obgleich man sich eine Konstruktion mit festen Seilen vorstellen konnte, die aber ständiger Wartung bedurfte. Für Demonstrationszwecke war dieser Prototyp aber ausreichend und die festgestampfte, trockene Straße, die vom Hauptplatz hinaus in die Insel führte, war beinahe völlig eben und würde dem Wagen daher nicht allzu viel Widerstand entgegensetzen.
Optimus stand bereits im Zuggeschirr und schaute Köhler aus seinen großen braunen Augen an. Ein Reitpferd war nicht notwendigerweise auch ein gutes Zugtier, doch Sater hatte bereits darauf hingewiesen, dass dem Hengst alles egal war, solange er genug zu fressen bekam und ansonsten seinen Spaß hatte. Da für beides gesorgt worden war, blieb Köhler zuversichtlich. Ebenfalls zugegen war Magister Andochos, dessen umfassende Sprachtalente sich in den vergangenen Wochen als unschätzbar positiv erwiesen hatten. Er begrüßte D’aak, mit dem er viel zusammensaß, und die Tatsache, dass sie beide sich angeregt zu unterhalten begannen, wies darauf hin, dass ihrer beider Sprachstudien weit gediehen waren.
Langenhagen nickte Sater zu. Er stellte eine kleine Treppe, die gleichfalls von den Legionären aus Holz gezimmert worden war, neben den Kutschbock und machte eine einladende Bewegung in Richtung Ik’Naah, die sich, ohne zu zögern, in Bewegung setzte. Es war keinesfalls so, dass die Maya die Vorzüge eines Wagens nicht zu begreifen mochten oder irgendwelche anderweitigen Vorbehalte gegen diese effektive Nutzung des Rads hatten. Bisher aber hatten sie das geeignete Zugtier vermisst und aus irgendwelchen Gründen auf Menschen als Zugmaschinen nicht zurückgreifen wollen. Das, was die versammelten Maya viel erstaunlicher fanden als den Wagen, war das Pferd. Auch Ik’Naah schaute immer noch mit einem gewissen Misstrauen auf Optimus, den das aber nicht kümmerte. Er schnaubte und wackelte mit dem Kopf. Langenhagen half der alten Frau auf den Kutschbock und setzte sich daneben, ergriff die Zügel und wartete, bis Sater die Treppe fortgenommen hatte. Dann knarrte es und der Wagen holperte los, langsam, um die Priesterin nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, aber beständig, und Optimus zeigte sich willig und gehorsam und war sehr damit einverstanden, nur eine eher behäbige Geschwindigkeit an den Tag zu legen. Köhler beobachtete weniger den Wagen, sondern mehr die Maya, die sich für die Demonstration versammelt hatten: Passanten, die beteiligten Handwerker, einige Notabeln der Stadt. Manche staunten einfach nur, einige wenige schienen vor dem Apparat eher Angst zu haben – möglicherweise aus grundsätzlichen Erwägungen, weil es schlicht eine Neuerung war, und Neuerungen waren einfach schlecht –, aber andere hatten einen nachdenklichen Gesichtsausdruck. Sie überlegten sich möglicherweise, was der breitflächige Einsatz dieser Wagen für den Transport von Waren und Menschen bedeuten würde und welche Auswirkungen er auf die Ökonomie – und die Kriegsführung – hatte. Da gab es eine Menge zu bedenken. Sollte ihre kleine Pferdeherde anwachsen, verfügte Cozumel in vielerlei Hinsicht über einen Vorteil und über ein Handelsgut, das von großer Bedeutung war, zumindest kurzzeitig. Ik’Naah war dies sicher nicht entgangen, und wie Köhler einschätzte, auch so manchem anderen hier nicht. Die Römer konnten die Pferde nicht alle wieder mit heimnehmen und der Fortpflanzungstrieb würde dafür sorgen, dass sich ihre Zahl rasch erhöhte. Allein dadurch begann eine ökonomische Revolution auf der Insel und damit potenzell für die ganze Mayazivilisation. Und dies hier war der historische Anfang.
Ein besonderer Tag.
Ein heißer Tag, wie Köhler fand, der einige weitere Augenblicke dem rumpelnden Gefährt zusah, wie es bedächtig die Straße entlangfuhr und den Maya die unbestreitbaren Vorzüge demonstrierte, bei diesem Wetter ohne die Kraft der eigenen Beine eine Strecke zurückzulegen.
Köhler selbst fand sich aber schnell unter der aufgestellten Plane mit einem Tisch darunter wieder, die neben dem Spektakel errichtet worden waren, um den Durstigen Labsal zu bereiten. Hinter dem Tisch standen zwei junge Priesterinnen und kredenzten Fruchtsaft, mit Wasser verdünnt. Köhler war durstig, nahm einen großen Becher entgegen und trank in hastigen Zügen. Magister Andochos trat zu ihm, ebenfalls auf der Suche nach Erfrischung, und nickte dem Offizier zu.
»Eine großartige Sache, Trierarch.«
»In der Tat, in der Tat«, erwiderte Köhler ohne großen Enthusiasmus.
»Ich habe gehört, die hiesigen Handwerker sind bereits dabei, selbständig einen zweiten Wagen zu bauen. Mit einem Dach, als Fortbewegungsmittel für die alte Hohepriesterin. Sie weiß noch nichts davon, glaube ich.«
Köhler lächelte. »Ich glaube nicht, dass irgendwas auf dieser Insel passiert, von dem Ik’Naah nichts weiß. Ob sie ihr Wissen immer offen zeigt, ist eine andere Frage.«
Andochos schien diese Sichtweise noch nicht bedacht zu haben. Er stellte seinen Becher ab und lächelte.
»Was ich weiß«, sagte er dann, »ist, dass eine Delegation aus der nahe gelegenen Hafenstadt Zama erwartet wird. Gesandte des dortigen Königs. D’aak hat mir erklärt, dass dieser seit längerer Zeit ein Auge auf Cozumel geworfen hat und bis zu unserer Ankunft echte Angst bestand, dass er dieses Interesse durch einen militärischen Übergriff verdeutlichen will.«
»Das soll er mal versuchen«, murmelte Köhler und ließ sich Fruchtsaft nachschenken. Die beiden jungen Priesterinnen schenkten ihm dabei ein dermaßen sonnigliches Lächeln, dass er für einen Moment auch Terzia vergaß.
»Langenhagen und Ik’Naah haben eine Beistandsverpflichtung abgeschlossen?«, fragte Andochos. »Sie haben darüber geredet, das weiß ich. Ich habe ein wenig beim Übersetzen geholfen.«
Köhler schüttelte den Kopf.
»Nun, ganz so würde ich es nicht nennen. Aber wir haben der Priesterin verdeutlicht, dass ihre Gastfreundschaft und Unterstützung unsere Dankbarkeit verdient hat. Solange wir eine Präsenz auf Cozumel haben, sind die Sicherheitsbedürfnisse Ik’Naahs auch die unseren. Sie ist für uns eine verlässliche Größe, wir lernen sie gut kennen und ihre Leute sind uns gegenüber freundlich und aufgeschlossen. Wir lernen die Sprache, bekommen frische Vorräte, unsere Forscher dürfen sich frei auf der Insel bewegen, keiner von uns wurde jemals bedroht. Der König von Zama hat einen weniger guten Leumund, um es mal vorsichtig zu sagen. Er ist für uns nicht berechenbar. Wir haben mittlerweile genug erfahren, um zu wissen, dass es eine liebe Angewohnheit der Stadtstaaten ist, gegeneinander immer wieder Krieg zu führen. Langenhagen ist zu dem Schluss gekommen, dass wir nur dann eine sichere Basis etablieren können, wenn wir uns einen Verbündeten schaffen. Diese Funktion erfüllt zur Zeit Cozumel. Damit will ich aber nichts über die Zukunft gesagt haben.«
Andochos hatte Köhler aufmerksam zugehört. Es war keinesfalls so, dass die Offiziere diese Überlegungen vor der Mannschaft geheim hielten, zumeist hatten aber gerade die Wissenschaftler und Experten, vor allem das Sprachgenie vor ihm, dermaßen viel zu tun, dass sie diese Entwicklungen oft nur am Rande wahrnahmen.
»Heute Nachmittag kommen wieder neue Boote vom Festland, mit Pilgerinnen wahrscheinlich. Langenhagen hat mich angewiesen, Ausschau nach Leuten aus der Gegend von Mutal zu halten, um weitere Informationen über das zu erlangen, was dort in Bezug auf die Götterboten stattfindet.«
»Es gibt einen Krieg, so viel wissen wir«, kommentierte Köhler und trank seinen zweiten Becher leer. Er fühlte sich erfrischt. »Gibt es dort Zeitenwanderer, und davon müssen wir ausgehen, ist das nicht verwunderlich. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diesen Konflikt hineingeraten. Unsere Aufgabe ist es, Dinge herauszufinden. Wir sind eine militärische Expedition, aber keine Streitmacht. Höchste Vorsicht ist geboten. Wann genau kommen die Boote?«
»D’aak wollte mir Bescheid sagen. Ich schätze, in einer Stunde; sie brachen vormittags auf und das Wetter ist ruhig, fast windstill. Segeln wird nicht so gut klappen, es muss gerudert werden. Ich habe dem Ausguck auf der Gratian gesagt, er soll eine Meldung abgeben und … ah, wenn man vom Teufel spricht …«
Köhler wandte sich um. Ein Mannschaftsmitglied der Gratian, deutlich erkennbar an seiner Uniform, kam wie von Furien gehetzt auf sie zugerannt. Der Offizier goss einen frischen Becher ein, diesmal mit Wasser, und wartete, bis der Mann keuchend im Schatten angekommen war.
»Trierarch, Magister, ich melde die Ankunft der Pilgerboote. Sollten in wenigen Minuten anlanden.«
Köhler nickte ihm zu und hielt ihm das Wasser hin, was mit Freude aufgenommen wurde. Dann wandte er sich an Andochos.
»Wir machen uns auf den Weg, Magister. Oder haben Sie hier noch zu tun?«
Der ältere Mann schüttelte den Kopf. »Nichts, was der gute D’aak nicht auch erledigen könnte. Sein Latein ist nicht übel. Ich überlege, ihm auch Griechisch zu vermitteln.«
»Ich bin gespannt, mit welchen Sprachen wir noch konfrontiert werden«, erwiderte Köhler, als sie sich in Bewegung setzten. Es war gut, dass der Magister große Freude am Lernen und Vermitteln von Sprachen hatte und dabei eine Unermüdlichkeit zeigte, die in Köhler nur Bewunderung auslöste.
Der Weg bis zur Landestelle, die von den Römern höflich »Hafen« genannt wurde, war nicht allzu weit, dennoch war Köhler wieder schweißüberströmt, als sie dort ankamen. Die fehlende Brise machte das Atmen schwer und die drückende Sonne verstärkte die schwüle Hitze bis ins Unerträgliche. Sie hatten sich alle an das Klima gewöhnt, tranken viel Wasser und bekamen Ruhepausen im Schatten – aber das bedeutete noch lange nicht, dass sie sich so frei und dynamisch bewegten wie die Maya, die zwar auch manchmal klagten, aber unbeirrt ihrem Tagwerk nachgingen.
Sie hatten dabei meist auch etwas weniger am Leib, wie Köhler selbstkritisch feststellte.
Köhler beschattete seine Augen, als er aufs Wasser hinausblickte. Da war die Gratian, keine 200 Meter vor ihm lag sie vor Anker, und es war deutlich zu erkennen, dass über das ganze Deck große Planen aufgespannt waren. Dann dahinter, weiter hinaus im offenen Meer, war die Kette der anderen Schiffe der Expedition zu sehen, die damit die Insel und die Gratian bewachte, selbst aber nur schwer angegriffen werden konnte. Langenhagen gab auch den Mannschaften dort Landgang, Fokus des Kontakts mit den Maya blieb aber die Gratian.
Und dann waren da die kleinen Punkte, die sich näherten, mit einfachen Masten, an denen die Segel nur schlaff hinabhingen, und Ruderern, die die Boote eifrig voranbrachten. Es waren die üblichen Konstruktionen, von denen keine mehr als sieben oder acht Passagiere aufnehmen konnte. Die Maya waren keine großen Seefahrer, zwar schon durchaus ausdauernde Fischer, aber es hatte sie nie auf den Ozean hinausgelockt und sie hatten nie die dafür notwendigen Schiffe konstruiert. Die Fregatten der römischen Marine waren für sie Wunder und blieben es auch weiterhin. Köhler hatte gemerkt, dass eine Gruppe von Fischern sich am Anblick der Gratian nicht sattsehen konnte. Das Schiff wurde dauernd von ihnen umrundet und mit Argusaugen beobachtet. Es würde ihn nicht wundern, wenn Cozumel auch Zentrum einer neuen Generation von Mayaschiffsbauern werden würde. Allein die Anwesenheit der Römer bedeutete für die Einheimischen eine Inspiration, die nicht spurlos an dieser Zivilisation vorbeigehen würde.
Sie standen da und warteten, und sie waren nicht die Einzigen. Eine Abordnung des Tempels fand sich ein, um die Pilgerinnen in Empfang zu nehmen – und die Geschenke, die sie brachten. Für alle wurden die Rituale vorbereitet, die den Frauen Fruchtbarkeit bescheren sollte, doch jene, die zum Reichtum des Tempels beitrugen, bekamen eine Sonderbehandlung. Dann waren da Matten mit Nahrung und Wasser für die Bootsleute, die noch am gleichen Tag wieder zum Festland zurückkehren würden. Und es kamen Schaulustige, die sich etwas Abwechslung und die neuesten Gerüchte vom Festland erhofften, viele Ältere, viele Kinder. Es war mitten am Tag, dementsprechend war die arbeitsfähige Bevölkerung Cozumels eben damit beschäftigt – mit Arbeit.
Acht Boote kamen an, eine durchschnittliche Zahl, sechs davon mit Pilgerinnen besetzt, zwei mit den Geschenken der Wohlhabenden. Meist waren es leicht transportierbare Kostbarkeiten: Schmuckstücke, Obsidian, Kakaobohnen, von hohem Wert, aber ohne großen Platzbedarf. Geld kannten die Maya noch nicht. Köhler war sich nicht sicher, dass das ein Nachteil war. Zum Glück hatten die Planer der Expedition sich auf diese Eventualität vorbereitet und allerlei handelbare Güter von praktischem oder ästhetischem Wert in den Laderäumen der Schiffe verpackt. Obgleich die Maya hier vor allem mit der Nahrung freigiebig umgingen, war Langenhagen jederzeit bereit, für die Versorgung zu zahlen.
Köhler beobachtete, wie die Boote anlandeten und von hilfreichen Männern auf den flachen Strand gezogen wurden. Weitere eilten herbei, um den Pilgerinnen zu helfen. Es waren, wie nicht anders zu erwarten, jüngere Frauen, zumindest noch nicht so alt, dass auch eine wohltätige Fruchtbarkeitsgöttin nicht mehr allzu viel ausrichten konnte. Einige waren einfach, andere prächtiger gekleidet, und obgleich die Unterschiede im sozialen Status erkennbar waren, einte sie alle der gemeinsame Wunsch nach Nachwuchs, der sich bisher offenbar noch nicht oder nicht im ausreichenden Maße eingestellt hatte.
Köhler und Andochos, die in Gewandung und Gestalt einen starken Kontrast zu den Maya bildeten, wurden angestarrt, als die Damen anlandeten und aus den Booten kletterten. Es war keine misstrauische Aufmerksamkeit, keine Angst. Die Gegenwart der Priester wirkte sicher beruhigend. Dennoch standen sie beide im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es wurde getuschelt. Priester sprachen die Neuankömmlinge an. Langenhagen hatte Ik’Naah darum gebeten, dass alle sofort nach ihrer Herkunft gefragt werden sollten, um Pilgerinnen aus Mutal sofort identifizieren zu können. Es konnte aber gut sein, dass heute gar keine …
Doch.
Am Arm gefasst, freundlich, wurde eine junge Frau in ihre Richtung geführt. An ihrer Kleidung und Haltung war erkennbar, dass sie nicht zu jenen gehörte, die ihr Leben in Mühsal und täglicher Fron verbrachten. Sie war sicher Ende 20 und ein Blick auf ihre Hände genügte, um Köhler von der Tatsache zu überzeugen, es hier mit einer sehr privilegierten jungen Frau zu tun zu haben. Und mit einer selbstbewussten, denn sie zeigte keine Scheu, als sie auf die Römer zutrat und die höflichen Verbeugungen der beiden Männer zur Kenntnis nahm. Sie schaute sie interessiert an, mit wachem Blick, neugierig, weitaus weniger überrascht, als man hätte annehmen können.
Sie sprach einige Worte und Köhler sah am konzentrierten Stirnrunzeln von Andochos, dass dieser Mühe hatte, sie zu verstehen. Er hatte bereits früh gelernt, dass die Mayadialekte sich bereits von Stadt zu Stadt voneinander unterschieden. Mutal war eine Metropole weit im Inland, dort mussten die Unterschiede zur Sprache, die auf der Insel gesprochen wurde, erheblich sein. Als Andochos einen ihm bekannten Priester zu sich winkte und seine Hilfe bei der richtigen Interpretation des Gesagten in Anspruch nahm, wappnete sich Köhler mit Geduld.
Das konnte dauern.
Die beiden Männer konferierten und Köhler unterdrückte ein Seufzen. Er lächelte die junge Frau an, bereit, sich die Wartezeit mit der Betrachtung ihres angenehmen Gesichts zu vertreiben.
Er musste seine Geduld nicht weiter beanspruchen.
Die Frau sah Köhler an, dann trat sie auf ihn zu und sagte auf Englisch: »Sie sehen aus wie Robert Lengsley. Sind Sie mit ihm verwandt?«
Köhler starrte sie an, dann schüttelte er langsam den Kopf. Andochos hatte sein Gespräch abrupt eingestellt. Er hatte verstanden und er war wie vom Donner gerührt. Köhler wäre das auch gerne für einen Moment, aber die Frau verdiente eine sofortige Antwort.
»Mein Name ist Köhler«, erwiderte er langsam. »Ich bin ein Seefahrer aus dem Land Rom. Ich kenne den Mann nicht.«
»Die Welt ist groß«, sagte die Frau lächelnd. »Ich bin Muwaan aus Mutal, Tochter des Bakch. Mein Vater ist bei Hofe. Ich genoss Sprachstudien, die Meister Sawada uns gab. Kennt Ihr Meister Sawada?«
Köhler verneinte dies und machte eine einladende Handbewegung. Am Strand waren Planen für Schatten errichtet worden, darunter Sitzgelegenheiten. Andochos winkte einem Maya und es wurden Getränke gebracht. Muwaan schien diese Art der Aufmerksamkeit gewohnt zu sein, sie ließ sich ohne Diskussionen in den Schatten führen und setzte sich mit einer eleganten und fließenden Bewegung hin. Eine so schöne Frau, für sie musste die Tatsache, dass sie Schwierigkeiten mit der Empfängnis hatte, besonders schwer wiegen. Köhler war sich durchaus bewusst, dass die »Schuld«, soweit man davon überhaupt sprechen wollte, keinesfalls immer bei der Frau lag. Es würde aber noch eine Weile dauern, bis man über diese Alternative mit den Mayamännern offen würde reden können. Es war selbst im ach so modernen Rom nur schwer möglich.
Und so richtig, das gab er gerne zu, passte diese Alternative keinem Mann.
Er lächelte die Frau an und stellte seine erste Frage.
»Dieser Meister Sawada … er ist ein Lehrer?«
Muwaan nickte und nippte an ihrem Fruchtsaft.
»Ein weiser Mann. Er lernt und lehrt unermüdlich, beantwortet viele Fragen und ist der persönliche Lehrer des kleinen Prinzen.«
»Des kleinen Prinzen?«
Muwaan runzelte die feine Stirn und beugte sich vor, als sie in einem beinahe verschwörerischen Tonfall flüsterte: »Man sagt, er sei fortgelaufen!«
»Der Prinz?«
Muwaan nickte, eine gewisse Missbilligung auf ihren Zügen.
»Ja! Der Herr der Götterboten sei zu streng mit ihm gewesen. Und das wundert mich nicht. Der Herr Inugami ist ein strenger Mann.«
Dies war nun der dritte Name eines Götterboten. Sie bekamen hier ein Füllhorn an Informationen, aber leider ein wenig unstrukturiert. Andochos hob eine Hand.
»Edle Dame, könnt Ihr uns weitere Namen der seltsamen Fremden nennen? Vielleicht erkennen wir doch einen unserer Verwandten wieder?« Andochos’ Englisch war um einiges besser als das Köhlers und der Offizier beschloss, die weitere Konversation dem Gelehrten zu überlassen.
Wieder das durchaus entzückende Stirnrunzeln.
»Aber ja. Da wäre der Stellvertreter des Götterboten. Aritomo Hara ist sein Name. Wenn Ihr mich fragt, ein weitaus freundlicherer Mann als sein Herr, und das sagen sie eigentlich alle.«
Sie blinzelte Köhler an und zeigte makellose Zähne, als sie ihm ein Lächeln schenkte. Was auch immer sie auf diese Insel und zum Tempel der Göttin führte, mangelnde Reize und fehlende Bereitschaft, diese auch einzusetzen, waren nicht ihr Problem. Köhler ertappte sich dabei, wie er im Stillen Terzia mit Muwaan verglich und ihre Vorzüge zu bewerten begann. Muwaans Brüste waren kleiner, aber das war kein Nachteil und zu erwarten, da sie generell leichter gebaut war als die Römerin. Ihre hellbraune Haut wirkte sehr anziehend und sah makellos aus. Die Vorstellung, diese einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen, wurde mit jedem Augenblick attraktiver.
Köhler gemahnte sich zur Vorsicht. Ja, Muwaan suchte nach Fruchtbarkeit, aber nicht notwendigerweise nach seiner ganz speziellen Unterstützung in dieser Frage.
Das Gespräch ging noch eine Weile weiter und Magister Andochos gelang es, der jungen Dame einige interessante Details zu entlocken. In Gedanken stellte Köhler bereits einen Bericht zusammen, den er auf mühsame Art und Weise über die Kurzwellenanlage nach Rom übermitteln würde. Der Funker würde eine Entzündung am Morsefinger bekommen, aber es war notwendig, dass das Hauptquartier informiert wurde.
Als sie Muwaan verabschiedeten, blickte Köhler ihr schon fast wehmütig hinterher. Als er aber Andochos’ nachdenkliches Gesicht sah, verscheuchte er diese Gedanken sofort.
»Sie haben Ihre Schlüsse gezogen«, sagte Köhler. »Raus damit.«
Andochos nickte langsam. »Ich habe mich umfassend mit den Schriften befasst, die die Zeitenwanderer an Bord ihres Schiffes mitgebracht haben. Ich hatte während meiner Studien freien Zugang zur Bibliothek von Rheinberg, wie sie nun in der Akademie steht und vielfach kopiert wurde. Diese Namen sind mir bekannt.« Er hob eine Hand. »Nicht als historische Personen oder dergleichen. Aber die Art der Namen. Sie entstammen einer Sprache, die im Fernen Osten … oder von unserem derzeitigen Standort aus eher im Westen gesprochen wird. Sie haben eine ordentliche geografische Ausbildung genossen, Köhler. Sie wissen, wo Japan liegt.«
Köhler nickte. »Natürlich. In der ursprünglichen Epoche der Zeitenwanderer ein aufstrebendes Land unter einem mächtigen Imperator. Was heute da ist, wissen wir nicht. Sicher wird eines Tages eine Expedition dorthin entsandt werden, um mehr zu erfahren. Möglicherweise hören unsere Kameraden davon, die in Richtung Indien und China aufgebrochen sind. Ich könnte im Hauptquartier nachfragen.«
Andochos machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Das wäre vielleicht sinnvoll. Jedenfalls entstammen diese Namen – Inugami, Sawada, Hara – der Sprache jener Menschen aus Japan. Es dürfte daher sicher anzunehmen sein, dass diese Zeitenwanderer aus jenem Land stammen und auf sehr spezielle Weise bei den Maya eingetroffen sind. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil der ganzen Geschichte. Köhler, wissen Sie, was ein U-Boot ist?«
Der Offizier legte die Stirn in Falten.
»Ich bin mit dem Konzept vertraut«, erwiderte der Offizier. »Die Aufzeichnungen Rheinbergs sind Teil des Curriculums der Offiziersausbildung, gerade in Bezug auf die Schiffstypen seiner Zeit. Es ist eine faszinierende und gleichzeitig beängstigende Konstruktion. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals bereit wäre, so etwas zu betreten. Man kann mit ihr unter Wasser fahren und die Männer der Besatzung können atmen und leben, tagelang, ohne an Deck zu gehen. Eine heimtückische Waffe, effektiv gegen Schiffe, von großer Zerstörungskraft und kaum zu vernichten. Ich habe Angst alleine vor dem Gedanken an eine solche Konstruktion.«
Andochos lächelte. »Das ist nachvollziehbar. Auch mir fällt der Gedanke schwer. Aber wenn ich die Informationen richtig deute, die wir bisher gesammelt haben, dann sind die Japaner, so nenne ich sie jetzt einmal, mit einem solchen U-Boot in diese Zeit gereist.«
Köhler schüttelte den Kopf. »Mutal liegt nicht am Meer, so viel wissen wir mittlerweile.«
»Das ist zutreffend. Fragen Sie mich nicht, wie es möglich wurde, aber es ist das, was ich aus unseren Informationen schließen kann. Wir sollten mit Langenhagen reden.«
»Ja. Und ich weiß auch, was das bedeutet. Wir können eine Expedition ins Landesinnere nicht länger hinauszögern.« Köhler holte tief Luft und sah den älteren Mann an, der versonnen nickte.
»Wir müssen Cozumel verlassen.«
3
»Wir müssen nach Mutal.«
Inocoyotl konnte an dieser Logik keinen Tadel finden, er hielt Metzli, den göttlichen Herrscher Teotihuacáns, Herr über die Ewige Stadt, Vertreter der Götter auf Erden, aber trotzdem für einen Irren. Er sagte es nicht laut, er zeigte seine Gedanken nicht einmal in seinen Gesichtszügen, denn ohne Kopf konnte man nicht mehr denken und Inocoyotl war mit seinem Haupt sehr zufrieden. Es sah für sein Alter einigermaßen gut aus, war ordentlich frisiert und war zu vielfältiger Mimik fähig. Seine Zähne waren ebenfalls noch ganz gut und seine braunen Augen waren ihm schon alleine deswegen lieb und teuer, weil er damit in jungen Jahren bei den Damen viel Erfolg gehabt hatte und er gerne daran zurückdachte. Alles in allem war es ein Kopf, der seine Funktion gut erfüllte und gefällig anzusehen war.
Deswegen wollte er ihn auch gerne behalten.
Und deswegen verbeugte er sich tief vor seinem obersten Herrn, so tief, wie es sein Rücken noch fertigbrachte, ohne sich vor Metzli auf den Boden werfen zu müssen. Von dieser Pflicht waren die Anwesenden in Metzlis privatem Audienzzimmer befreit worden, ganz ausdrücklich sogar, aber das hieß nicht, dass die drei Männer sich irgendeine Unbotmäßigkeit erlauben konnten.
»Sicher, edler Herr«, beeilte sich Ichtaca zu sagen, der dem König am nächsten stand, und das nicht nur in dieser Kammer, sondern auch metaphorisch. Der alte Mann hatte ebenso wie Inocoyotl bereits Metzlis Vater gedient, und obgleich ihn die Jahre sichtlich niederdrückten, war er weiterhin der Herr der Lagerhäuser, verantwortlich für die Eintreibung der Steuern und Abgaben und, das war hier der Punkt, für die Herstellung von Waffen und anderem Kriegsmaterial. Metzli legte großen Wert auf eine einheitliche Ausrüstung der Krieger und hatte angeordnet, die Adligen und Clanoberhäupter mögen ihm Männer stellen, ihre Bewaffnung aber ihm überlassen. Ichtaca wurde zum Rüstungsminister ernannt, nur einen Tag nachdem Metzli Inocoyotl Dinge enthüllt hatte, an die dieser weiterhin nur mit größter Verwunderung und weitgehendem Unverständnis zu denken in der Lage war.
Auch General Izel wusste nichts Besseres zu tun, als Metzli zuzustimmen. Seine Verbeugung verlief eleganter und kraftvoller als die seiner Kameraden, er war auch der jüngste der Anwesenden, sogar ein Jahr jünger als der Herrscher selbst. Izel war ein Krieger und nie etwas anderes gewesen, ein Mann, der sich ausgezeichnet hatte und der, wie Inocoyotl mit etwas Neid feststellen musste, die Enthüllungen seines Oberherrn mit stoischem Gleichmut akzeptiert hatte. Die wundersamen Gerätschaften aus dem geheimen Lager des Palastes waren ihm sicher genauso seltsam vorgekommen, doch das geübte Auge des Kämpfers erahnte wahrscheinlich das dahinterliegende Potenzial viel mehr als der Botschafter. Izel gehörte zu jenen, die Metzli in jeder Hinsicht bedingungslos ergeben waren. Er wäre den Befehlen des Königs auch gefolgt, wenn dieser den Angriff auf die Götter befohlen hätte. Seine Respektsbezeugungen waren nicht aus Verlegenheit oder Resignation geboren, sondern aus Überzeugung. Und wenn ihrer Sache nun neue, alles überwindende Zerstörungswerkzeuge zur Verfügung stünden, wäre er sicher der Letzte, der daran etwas auszusetzen hätte.
»Wir müssen uns beeilen«, sagte der General. »Wenn die Berichte des Gesandten stimmen, dann wird der sogenannte Götterbote nicht an sich halten und nur darauf warten, dass wir seinem Tun Einhalt gebieten. Er wird weiterexpandieren, seiner Streitmacht weitere Männer zuführen und sie mit seinen neuen Methoden und Waffen vertraut machen. Wir haben einen Vorteil. Wir besitzen bereits eine große Streitmacht und wir haben Götterwaffen, die denen der Fremden mindestens gleichwertig sind. Aber ihre Zahl ist begrenzt und die neuen Herren von Mutal haben sich als klug und umsichtig erwiesen. Wir dürfen nicht mit der Unzulänglichkeit und Dummheit von Feinden rechnen, die bisher weder das eine noch das andere gezeigt haben.«
Metzli legte die Hände flach auf den Tisch, um den sie standen. Dieser zeigte eine grobe Karte des Gebietes, von dem sie sprachen, Basis ihrer Überlegungen und Planungen.
»Der General hat recht«, sagte er dann. Er sah Ichtaca an. »Aber ich vermute, es gibt Einwände.«
Der alte Mann beugte sein Haupt. »Wenn ich diese äußern darf.«
»Dazu fordere ich dich auf, Ichtaca. Es nützt uns nichts, wenn wir uns selbst mit Lügen und Illusionen blenden. Das ist der Weg in die Katastrophe. Zeig mir klar, wo die Fehler in meinem Denken liegen. Jede Kritik wird von mir akzeptiert. Hier sind wir unter uns.«
Und das waren sie in der Tat. Vor den mächtigen Holztüren mochten Wachen stehen, aber durch die dicken Mauern würde kaum ein Laut nach außen dringen. Es war ein Vertrauensbeweis des Herrschers, der gar nicht hoch genug bewertet werden konnte. Dennoch vernahm Inocoyotl die Worte des Königs mit Vorsicht. Das war ja alles schön und gut, aber wer würde Metzli zur Rechenschaft ziehen, wenn er seine Meinung plötzlich änderte und eine Äußerung doch nicht für angemessen hielt?
»Hoher Herr, Eure magischen Waffen alleine werden uns nicht den Sieg bringen. Wir benötigen eine gut vorbereitete Armee. Und diese Vorbereitung bedarf der Zeit. Es ist lange her, seit Teotihuacán einen größeren Feldzug durchgeführt hat. Seit Ihr, höchster König, Euer Amt angetreten habt, haben wir keinen Krieg von nennenswerten Ausmaßen mehr gehabt. Der Frieden tat dem Land gut. Wir werden respektiert. Keiner wagte es, uns anzugreifen. Aber gleichzeitig führte es dazu, dass gewisse Dinge … vernachlässigt worden sind. Ich muss Euch daher um Zeit bitten. Nur eine gut ausgerüstete und bestens vorbereitete Armee wird in der Lage sein, kurze Triumphe in einen dauerhaften Sieg umzuwandeln.«
Inocoyotl behielt seine Gedanken für sich, aber die Worte des alten Mannes hatten sein Unwohlsein eher verstärkt als gedämpft. Seit Metzli den Entschluss gefasst hatte, die Allianz der Mayastädte gegen Mutal zu führen, hatte er mehrmals deutlich gemacht, dass es ihm um mehr ging als nur die Niederringung der Götterboten. Es ging ihm darum, sein »Schicksal« zu erfüllen und aus Teotihuacán mehr als eine Ewige Stadt zu machen. Er nahm die Idee des Fremden Inugami auf und machte sie sich zu eigen, sprach von einem Reich und von seiner Befürchtung, dass es andere wie die Götterboten geben könne, gegen deren Ankunft man sich nunmehr zu wappnen habe. Andere wie sein Vater, der vor Jahrzehnten erschienen und die Macht in der Stadt an sich gerissen hatte, ein Mann, über den Inocoyotl jetzt so viel mehr wusste als vorher und dessen bloße Existenz das Auftauchen der Götterboten in einem ganz anderen Licht erschienen ließ.
Metzli schaute Ichtaca an. Wie gut, dass er Inocoyotls Gedanken nicht lesen konnte. Der Gesandte war nicht besonders begeistert von dem plötzlichen Expansionswillen und den Großmachtträumen seines Herrschers. Aber er würde seine Befehle getreulich ausführen und alles tun, damit diese Träume Wirklichkeit wurden. Alles andere war ein noch viel größerer Wahnsinn, als es die Absichten seines Herrn jemals sein konnten.
Niemand stellte sich dem König von Teotihuacán entgegen, außerhalb der Stadt nicht und innerhalb schon gar nicht.
Und da war ja immer die Sache mit seinem Kopf zu bedenken.
»Ich denke, dass du recht hast«, sagte Metzli nun. »Mein Vater lehrte mich dies: Ich sollte die magische Macht seiner Waffen verwenden, wenn der Zeitpunkt käme und andere Reisende durch die Zeit einträfen. Aber ich sollte mich niemals dem Wahn hingeben, alles alleine und ohne die Kooperation aller erreichen zu können. Deswegen hat er sich zum König gemacht. Das beste Werkzeug ersetzt niemals die gebündelte Kraft einer Nation, die sich in ihren Absichten einig ist. Und es wäre unverantwortlich von mir, diese Kraft zu verschwenden oder von vornherein zu verringern. Ichtaca, ich gebe dir sechs Monate. Das muss genügen. Sag mir, dass diese Zeit ausreicht.«
Der alte Mann verbeugte sich. Er wusste, was ein Befehl war und wie weit der Herrscher zu Kompromissen bereit war. Er hatte so viel erreicht, wie ihm möglich war. Jetzt musste er das Beste daraus machen. Inocoyotl hatte keinen Zweifel daran, dass Ichtaca erfolgreich sein würde.
Dann fand er die Augen seines Königs auf sich gerichtet und streckte sich. Nun würden seine Anweisungen folgen und angesichts dessen, was er gerade gehört hatte, konnte er sich recht gut vorstellen, was diese beinhalten würden.
Er sollte sich nicht irren.
»Inocoyotl, du begibst dich mit einer Gesandtschaft zum König Bahlam nach B’aakal. Du nimmst Queca mit, der dich bereits begleitet hat, und 200 Krieger als Zeichen unserer Macht und unserer Zustimmung zu einem Bündnis. Lass ihn in dem Glauben, dass wir nicht mehr tun werden, als Mutal zu erobern und damit die Gefahr der Götterboten zu beseitigen. Er soll nicht zu früh erfahren, dass auch er nicht mehr lange auf dem Thron seiner Stadt sitzen wird. Zeige dich freundlich und verhandlungsbereit und unterstütze die Allianz bis zu meiner Ankunft, so weit du kannst. Ich werde in spätestens sechs Monaten nach B’aakal aufbrechen und dort soll sich auch die Armee der Maya sammeln. Sollten die Götterboten von der Sache Wind bekommen, weiche man aus. Es soll keinen Angriff geben, ehe ich nicht eingetroffen bin, selbst wenn man dadurch weitere Städte verliert.«
Metzli beugte sich vor, seine Stimme wurde eindringlich.
»Das ist sehr wichtig, Stimme meines Willens. Hast du das gut verstanden?«
»Das habe ich«, erwiderte Inocoyotl devot. »Ich will sogleich aufbrechen und tun, was Ihr befohlen habt.«
Metzli richtete sich wieder auf und nickte zufrieden. »Ich verlasse mich auf dich, mein Gesandter. Und ich verspreche dir, sobald all dies getan ist und das neue Reich von Teotihuacán errichtet, wirst du dich auf einem Thron einer mächtigen Stadt der Maya wiederfinden und die Stelen werden deinen Namen tragen.«
Inocoyotl verbeugte sich tief, sehr tief. Erneut war er froh darum, dass damit sein Gesicht verborgen wurde. Metzli hätte sich sonst möglicherweise gefragt, warum kein rechter Ausdruck von Begeisterung auf seinen Zügen zu sehen war – sondern eher ein Ausdruck von Furcht. König werden, das war eine schreckliche Vorstellung und gleichzeitig eine Ehrung, die er niemals würde ablehnen dürfen. Dahin waren seine Hoffnungen auf einen ruhigen Ruhestand, ein sanftes, friedliches Lebensalter. König über aufsässige Maya. Eroberer und Statthalter.
Aber sein Kopf, o ja, sein Kopf.
Es wurden noch einige weitere Befehle gegeben, dann war der Kriegsrat entlassen und die Männer traten vor dem Palast wieder ins Freie. Ichtaca verabschiedete sich rasch und eilte zu seiner Sänfte, mit der man ihn sogleich wieder in das Gebäude tragen würde, von dem aus er die Vorbereitungen weiter vorantreiben wollte. Auch Inocoyotl hatte sich zu sputen. Natürlich war mit dem Auftrag, erneut in die Mayalande zu reisen, zu rechnen gewesen und er hatte seine Familie und Diener mit dieser Aussicht vertraut gemacht. Aber im Gegensatz zu Ichtaca hatte der Gesandte keine sechs Monate Zeit bekommen. Von ihm wurde erwartet, unverzüglich aufzubrechen.
Dass Queca, der Kommandant der 200 Krieger, auf den Stufen des Palastes bereits auf ihn wartete, zeigte, dass auch der Krieger seine Befehle erhalten hatte. Er machte einige Schritte auf Inocoyotl zu und deutete eine Verneigung an.
»Es geht also wieder los«, sagte er. »Ich bin bereit, wenn Ihr es seid.«
»Damit habt Ihr mir etwas voraus«, murmelte der ältere Mann und seufzte. »Ich habe das Gefühl, dass unsere zweite gemeinsame Expedition nicht ganz so reibungslos wie die erste ablaufen wird.«
Queca nickte nur. Es war ihm egal. Er gehorchte dem König und tat, was getan werden musste.
Inocoyotl war da nicht anders.
Es war sein persönlicher Fluch, dass er sich dabei auch immer noch so viele Gedanken machen musste.
4
»Ich soll … was?«