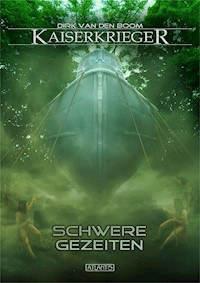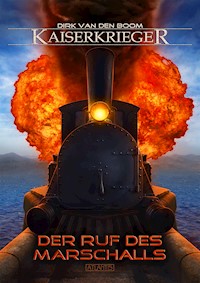Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Lord zu Tulivar hat endlich erreicht, was er sich immer erträumt hatte: seine Ruhe. Doch die Beschaulichkeit der abgelegenen Provinz wird gestört durch die Ankunft eines hohen Gastes: Der Kaiser entsendet seinen unbotmäßigen Sohn und einzigen Erben nach Tulivar, um ihn von Palastintrigen fernzuhalten. Der Prinz fällt nicht nur allen auf die Nerven, es stellt sich rasch heraus, dass die Gegner des Kaisers vor seiner Familie auch in der Ferne nicht haltmachen. Dem unfreiwilligen Beschützer des jungen Mannes bleibt nichts anderes übrig, als erneut seine alten Knochen zu bewegen – auch wenn es ihm sichtlich schwerfällt und der Ausgang höchst ungewiss ist. Wie gut, dass ihm alte Freunde dabei helfen, ob er nun will oder nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ein nächtlicher Wettstreit
Ein problematisches Ansinnen
Eine bemerkenswerte Ankunft
Ein Haus zu Tulivar
Eine mittlere Katastrophe
Eine große Katastrophe
Wohin jetzt?
Kein sicherer Ort
Die Suche beginnt
Die Weisheit der alten Netty
Das Haus des Magiers
Eine andere Perspektive
Alles ganz anders
Eine unmissverständliche Einladung
Gräfliche Nöte
Seltsame Getränke
Der Weg zum Kopfschmerz
Eine neue Unterkunft
Versprochene Hilfe
Ein Prinz
Der Tod der alten Netty
Epilog
Weitere Atlantis-Titel
Dirk van den Boom
Ein Prinz zu Tulivar
Ein nächtlicher Wettstreit
Es war kalt, es war dunkel und überall lag Schnee.
Dennoch wollten wir unbedingt herausfinden, wer weiter pinkeln konnte.
Es war so eine Männersache, die man schlecht erklären konnte. Woldan und ich zogen unsere Pelzjacken über und torkelten aus dem Haus. Wir hatten beide zu viel von … allem getrunken und dementsprechend waren Orientierungssinn und Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Als die eiskalte Luft in unsere Lungen drang und an unserer Haut biss, wurde es etwas besser.
Aber nicht viel.
»Dort, Hauptmann. Eine ideale Stelle. Der Mond scheint. Keine Wolken am Himmel. Weißer, jungfräulicher Schnee ohne jeden Makel!«
Ich blinzelte und betrachtete die Stelle, die Woldan genannt hatte. Man konnte ihm nicht trauen. Er würde jeden Vorteil nutzen, um mich hinters Licht zu führen. Doch an der ausgewählten Wettkampfstätte gab es in der Tat wenig auszusetzen.
»Wir … brauchen einen Schiedsrichter«, murmelte ich.
Woldan drehte sich einmal um sich selbst und sah dabei aus wie ein besoffener Tanzbär. Dann erblickte er die beiden Fackeln vor dem Wachhaus, das neben der Mauer stand, die Burg Tulivar umgab.
»He! He da! Wachen!«, brüllte mein Freund. Hektische Betriebsamkeit brach aus, als zwei Bewaffnete ins Freie stürmten, die Schwerter gezogen, und sich aufmerksam umsahen, um jedem Feind sogleich die Sinnlosigkeit seiner Absichten zu verdeutlichen. Als sie unser gewahr wurden, entspannte sich ihre Haltung und einer der Männer kam auf uns zugetrottet, während der andere sich murrend wieder in die Wärme des Hauses zurückzog.
»Herr«, begrüßte er mich und nickte Woldan zu. »Wie kann ich euch beiden helfen?«
Er sah uns zweifelnd an. Er war keiner der Veteranen, die ich aus dem Krieg mitgebracht hatte, sondern ein neuer Rekrut und wusste daher nicht, ob er uns jetzt den gleichen Respekt entgegenzubringen hatte wie zu jener Zeit, da wir nüchtern waren. An seiner Stelle hätte ich mich fluchend umgedreht, aber er traute sich das nicht.
»Du bist unser Schiedsrichter. Wir wollen wissen, wer weiter pinkeln kann«, sagte ich und wies auf eine flache Schneedecke, die vom Mondlicht wunderbar erleuchtet wurde. Diese war in der Tat völlig weiß und unberührt, eine ideale Zielfläche, die eine Messung ermöglichte.
Der Wachmann schaute von mir zu Woldan und wieder zurück, hob die Augenbrauen und zuckte mit den Schultern.
»Wohlan«, sagte er dann und wies auf die Fläche. Etwas besorgt musterte er uns, wie wir dorthin spazierten, nicht immer auf direktem Wege. Wir hatten beide ordentlich Druck auf der Blase, was an unserem fortgeschrittenen Alter sowie den Flüssigkeitsmengen lag, die wir heute Nacht zu uns genommen hatten, um Woldans Besuch in Tulivar würdig zu feiern. Demnach waren wir beide zu Höchstleistungen nicht nur bereit, sie erwiesen sich auch als drängend notwendig, nahezu unabwendbar.
Wir stellten uns auf und begannen, uns durch die mehrlagige Gewandung zu den Instrumenten unseres Wettstreits vorzuarbeiten. Es dauerte ein wenig und die Kälte, die daraufhin an meinem besten Stück zu fressen begann, minderte meine Zuversicht etwas.
»Bereit?«, fragte der Wachmann halb amüsiert, halb gelangweilt. Er begann, die richtige Einstellung zu finden, und wir mussten uns jetzt beeilen, ehe er uns aufgab und einfach mit den zunehmend verschrumpelten Kostbarkeiten in der Hand im Schnee stehen ließ.
Wir sahen uns an, voller grimmiger Entschlossenheit – soweit das in unseren leicht glasigen Blicken zu erkennen war. Aber wir empfanden es so. Es ging um alles. Eine Sache der Ehre. Wahre Männlichkeit. Niemand sonst verstand das.
»Dann legt mal los!«
Es war das eine, ein dringendes Bedürfnis zu haben, es war aber das andere, der Natur nunmehr freien Lauf zu lassen, nachdem man dieses über eine Stunde durch beständigen Muskeleinsatz unterdrückt hatte. Die plötzliche Befreiung von aller Bedrängnis führte keinesfalls immer zur Explosion des Harns nach draußen, oft genug schien sich die Blase zu fragen, ob es denn jetzt wirklich schon an der Zeit sei und die Mühsal ein Ende habe. Der Startschuss als solcher hatte demnach nicht die erwünschte Wirkung. Es tröpfelte eingangs nur und der Wachmann musste sich nunmehr sein Grinsen verkneifen, um gegenüber seinem höchsten Herrn sowie dem Dorfschulzen keine allzu große Respektlosigkeit zu zeigen.
Uns war das eigentlich egal. Wir schlossen die Augen, wippten ein wenig auf und ab und sammelten alle geistigen und körperlichen Kräfte, um den Urgewalten endlich Bahn geben zu können. Es dauerte nicht allzu lange, dann waren wir bereit, wechselten einen letzten Blick und entleerten uns.
Zwei fahlgelbe Strahlen, mit beachtlichem Druck von uns geschleudert, spannten einen Bogen über den Schnee. Ich hatte mich leicht zurückgelehnt, das Becken nach vorne geschoben, die Kronjuwelen fest im Griff und das Instrument meines Triumphs – so vieler Triumphe! – leicht nach oben gerichtet, um eine ordentliche Flugbahn hinzubekommen. Woldan, als geübter Bogenschütze, hatte das natürlich auch gut raus und berechnete intuitiv die richtige Kombination aus Abschusswinkel, Abschussgeschwindigkeit und Wind.
Es herrschte Windstille, also war Letzteres keine besondere Herausforderung.
Dennoch, ich glaube, es hatte mit seiner Erfahrung als Schütze zu tun, dass der Wachmann, nachdem er dem faszinierenden Schauspiel einige Sekunden gefolgt war, mit feierlicher Stimme erklärte, dass Woldan den Sieg davongetragen hatte.
Wir verpackten unsere Stücke mit ungelenken, zunehmend steif gefrorenen Fingern und stapften selbst nach vorne, um uns zu vergewissern, dass der Soldat sich nicht geirrt hatte. Es bestand leider kein Zweifel, es war die Wahrheit. Woldan hatte gut zehn Zentimeter Vorsprung und einige Spritzer waren sogar noch weiter vor den meinen im Schnee gelandet und hatten gelbliche kleine Löcher in die weiße Fläche gestanzt.
»Ich habe gewonnen«, erklärte Woldan zu allem Überfluss und stellte sich breitbeinig über den Beweis seiner Überlegenheit. »Der Sieg ist mein, Hauptmann.«
»Ah, ich hätte es wissen müssen«, erklärte ich mit einem deprimierten Kopfschütteln. »Es war kein fairer Wettkampf. Du bist Schütze. Und du hast mehr Bier getrunken. Wer Bier dem Wein vorzieht, entwickelt mehr Druck, das ist allgemein bekannt.«
»Keine Ausflüchte«, grummelte Woldan. »Ich …«
»Herr.«
Ich drehte mich schwerfällig zu dem Wachsoldaten um.
»Ja?«
»Darf ich mich zurückziehen?«
»Klar.«
»Danke.«
Der Soldat drehte sich kopfschüttelnd um und suchte die Wärme des Wachhauses, ohne Zweifel willens, am kommenden Morgen jedem, der es wissen wollte, die Geschichte seiner spannenden nächtlichen Erlebnisse darzulegen. Ein weiterer Baustein an der Legende des heldenhaften Barons zu Tulivar, auf den ich mit Recht stolz sein durfte.
Ich schaute noch einmal auf das Abbild meiner Niederlage. Wenn es heute Nacht nicht mehr schneite, würde dieses Denkmal durch die Eiseskälte dauerhaft in den Schnee gebannt werden und am kommenden Tag Anlass für zahlreiche Bemerkungen bieten. Es war mir immer ein Bedürfnis, zur guten Stimmung meiner Leute und Nachbarn beizutragen.
Woldan und ich torkelten zurück in mein Haus, aus dessen Fenster immer noch Licht schimmerte. In der Küche brannte ein Feuer im Ofen, das eine angenehme Wärme verbreitete. Auf dem Tisch lagen die Reste unserer Arbeit: halb geleerte Teller und Platten sowie vollständig geleerte Humpen und Schnapsbecher. Wir ließen uns schwer auf die Stühle sinken, nachdem wir uns umständlich unserer Jacken entledigt hatten. Wir versuchten, dabei möglichst leise zu sein: Meine Frau Dalina und meine Kinder schliefen im Obergeschoss und würden wenig erbaut sein, wenn wir allzu viel Lärm verursachten. Es war weit nach Mitternacht, aber Woldan würde nur wenige Tage bleiben und ich sah ihn viel zu selten, seit ihn seine Pflichten als Dorfschulze beschäftigten, von seiner eigenen Familie einmal ganz zu schweigen.
Eigentlich fehlte zumindest noch eine weitere Person bei unserem Gelage, doch Selur, der Dritte im Bunde, hielt sich im Norden auf, beobachtete die Grenze, die Mine und unsere kleine Festung voller Söldner, die den Reichtum Tulivars erzeugten und bewachten. Ich traute den Söldnern, soweit man ihnen überhaupt trauen konnte, aber Selur hatte eine sehr tief sitzende Vorsicht entwickelt, der er dadurch Ausdruck gab, dass er immer wieder zu Überraschungsvisiten in den Norden aufbrach. Es konnte natürlich auch damit zu tun haben, dass die in Felsheim lebenden Bewohner Tulivars zu dieser Jahreszeit nichts zu tun hatten und Selur damit eine Abwechslung war, die gerne willkommen geheißen wurde – eine Gelegenheit, die unser notgeiler Freund gerne und mit Intensität auszunutzen pflegte.
Wir saßen für einige Momente so da. Unsere Expedition nach draußen hatte arg an unseren Kräften gezerrt, und seit unsere Blasen entleert waren, sank auch unser beider Konzentrationsfähigkeit rapide ab. Die Entspannung jener Muskeln schien sich nahezu epidemisch auf den Rest unserer Körper zu verbreiten. Wir starrten in die leeren Becher und verloren langsam die Lust am weiteren Zechen. Wir hatten die Erinnerungen an die Vergangenheit – verklärt, verlogen und verfälscht – ausgetauscht und wir hatten über die aktuellen Entwicklungen in Tulivar gesprochen. Wer mit wem und warum. Auf wessen Äckern es gut lief und wer Probleme hatte. Ob man die Straße an dieser oder jener Stelle nicht ausbessern sollte, sobald der Schnee geschmolzen war. Wie weit der Ausbau des Hafens in Seeheim voranging, dem wiederbelebten Fischerdorf, das mein persönliches Lieblingsprojekt war. Alles wichtige Dinge, die Gesprächsstoff für geschlagene zwanzig Minuten bereitet hatten.
Es war alles nicht mehr so schön wie früher.
Selbst das Leid des Krieges verklärte sich in der Erinnerung. Wir wurden älter, gewannen mehr Abstand. Die Albträume wurden weniger oder verblassten. Wir begannen, das Erlebte zu idealisieren und die Aufregung der Vergangenheit mit der Monotonie des letzten Jahres zu vergleichen. Sicher, am Anfang hatten wir noch unseren Anteil an Spannung gehabt, mit den Bergkriegern, dem Steuereintreiber und dem neuen Grafen zu Bell. Aber auch das hatte sich schließlich schrittweise erledigt, zumindest erweckte es den Anschein. Die allgemeine Schockstarre, in die dieses karge Land im Winter verfiel, trug zu diesem Eindruck sicher bei. Die Leute hockten zu Hause, hofften, dass ihre Nahrungsvorräte für die kommenden Monate ausreichten, wagten sich bei gutem Wetter auf die Jagd auf den gelegentlichen Hasen und saßen ansonsten am Feuer und erzählten sich was. Viele hatten sich nichts mehr zu sagen und saßen nur noch am Feuer. Manche wurden melancholisch, wie Woldan und ich im Verlaufe des Abends, und mussten etwas tun, um sich mit Gewalt aus dieser Stimmung zu reißen.
Im Falle Woldans hatte das gut geklappt, denn er hatte unseren Wettstreit gewonnen.
Die Erkenntnis, dass ich nicht den notwendigen Druck hatte aufbauen können, um die Sache für mich zu entscheiden, trug zu meiner Melancholie eher bei. Oder lag es mehr an der Tatsache, dass meine verehrte Ehefrau bei Tagesanbruch, sobald sie die Küche betreten würde, Worte sagen und Dinge tun würde, die meinen zu erwartenden Kopfschmerz potenzieren und mich in völliger Wehrlosigkeit verharren lassen würde?
»Wir sollten morgen auf die Jagd gehen«, murmelte Woldan. »Ich will hier nicht herumsitzen. Ein paar Vögel oder einen Hasen. Das wird auch deine Familie freuen. Nicht immer nur das gepökelte Zeugs, davon bekommt doch jeder Sodbrennen.«
Ich sah auf, mein Gesicht voller Hoffnung.
»Das ist eine ausgezeichnete Idee«, artikulierte ich bedächtig, um auch jede Silbe an den richtigen Platz stellen zu können. »Ausgezeichnet. Die Jagd. Arbeit für Männer. Bei jedem Wetter. Wie damals, in Cyranshi, erinnerst du dich?«
»Ich habe mir fast die Eier abgefroren und wir haben nicht mal einen Igel aus dem Winterschlaf geschreckt.«
Ich kicherte.
»Sag ich doch. Männerarbeit. Geht nichts drüber.«
Woldan nickte bekräftigend und nach kurzer Diskussion beschlossen wir, zur Vorbereitung unserer soeben beschlossenen Expedition nunmehr schlafen zu gehen. Um auch richtig fit zu sein, kamen wir zu der Erkenntnis, dass Aufräum- und Säuberungsarbeiten in der Küche uns nur aufhalten würden, und mit einem Gemurmel aufrichtigen Bedauerns zogen wir uns beide ins Gästezimmer zurück, Woldans ins bereitete Bett und ich mit einigen Decken auf den Fußboden. Dass ich das eheliche Schlafgemach nicht betrat, hatte natürlich mit meinem großen Respekt vor dem Schlaf meiner geliebten Frau zu tun. Woldans Hinweis auf die Tatsache, dass der Schürhaken vom Kamin im Wohnzimmer fehlte und »dass man sich damit ja übel verletzen« könne, mochte gleichfalls dazu beigetragen haben, eher Vorsicht walten zu lassen.
Wir schliefen sehr schnell ein.
Wir schnarchten wahrscheinlich ganz furchtbar.
Am kommenden Morgen – oder vielleicht präziser: als der späte Vormittag sich gerade entschloss, sich fortan als Mittag anreden zu lassen – erwachten wir mit klebrigen Augen und trockener Zunge, im Schädel einen Schmerz, den wir uns wahrscheinlich verdient hatten, und immer noch so müde, dass nur der erneute Harndrang uns in die Senkrechte trieb. Ein weiterer Wettbewerb um die größte Reichweite hätte sicher interessante Ergebnisse gezeitigt, doch waren wir beide froh, es gerade noch so in die Latrine geschafft zu haben. Uns wieder vom Donnerbalken zu erheben, kostete viel Zeit und Anstrengung. Wir beschlossen, draußen zu bleiben und uns im Waschhaus zu reinigen, nicht nur, weil die beißende Kälte des Wassers half, wieder zu Sinnen zu kommen, sondern auch, weil wir uns dort mit frischer Kleidung versehen konnten, die uns danach zumindest halbwegs manierlich aussehen ließ. Es gelang uns sogar, eine Rasur zu bewerkstelligen, ohne dass Todesopfer zu beklagen waren, und diese Tat erfüllte uns mit berechtigtem Stolz.
Als wir in die warme Stube zurückkehrten, fühlten wir uns immer noch wie gerädert, aber wir waren einigermaßen wach und würden im Verlaufe des Tages wohl auch wieder imstande sein, vollständige Sätze zu äußern.
Und meine Frau war ein Schatz.
Anders kann man es nicht beschreiben.
Uns erwartete eine wunderbare Frühstückskomposition aus duftendem Gebäck, Marmeladen, gebratenen Eiern mit Speck und einem Tee, der so stark war, dass er gestern Abend bereits aufgesetzt worden sein musste. Woldan und ich starrten einigermaßen sprachlos auf das Dargebotene, hatten doch wir beide im Stillen erwartet, anstatt einer umfassenden Verköstigung eine umfassende Maßregelung zu erhalten. Doch wie reagierte man jetzt angemessen? Reichte es ihr bereits, dass wir in fassungsloser Hingabe auf die malerisch dekorierte Tafel blickten? War es Vergnügen genug, sich an unser beider Unfähigkeit zu weiden, die richtigen Worte zu finden? Oder wurde jetzt erwartet, in Wort und Tat die große Schuld abzutragen, die sie damit soeben auf unsere Schultern geladen hatte?
Ich versuchte, mich an noch nicht erledigte Aufgaben zu erinnern. Das Holz war gehackt und würde für eine Woche reichen. Der Stall war gereinigt. Das kleine Loch im Dachfirst hatte ich noch vor Woldans Besuch ausgebessert. Der Besuch entfernter Verwandter war von mir mit stoischer Freundlichkeit ertragen worden, und das dreimal in Folge binnen der letzten vier Wochen. Ich hatte meine Pflichten als Lehrer nicht versäumt und der ältesten Tochter beim Malen der ersten Buchstaben assistiert. Ich hatte meine Arbeit getan, jede Aufgabe getreulich erfüllt und war ein ganz und gar perfekter Ehemann gewesen. Bis gestern.
Im Grunde gab es also nichts, was sich nunmehr für eine Strafarbeit eignete. Und selbst wenn, wäre zur Motivation ein fulminantes Frühstück wie dieses nicht notwendig gewesen, außer um ein bereits bestehendes schlechtes Gewissen zu potenzieren, was auch ohne in Aussicht gestellte Anstrengung durchaus gelungen war.
Ich war demnach restlos verwirrt. Dalina war tatsächlich auf selbstlose Weise nett gewesen und Selbstlosigkeit kam bei ihr nicht oft vor.
Woldan war auch verwirrt, aber er war der Gast, also setzte er sich hin, griff zum Tee, zu einem Stück Kuchen und beobachtete mit einem zufriedenen Grunzen, wie ihm meine Frau einen Berg Ei mit Speck auf den Teller schaufelte.
Dann sah sie auf und mir direkt ins Gesicht.
Sie war immer noch die Schönste von allen, dachte ich und fühlte, wie sich diese Wärme in meiner Herzgegend breit machte. Ich lächelte, soweit meine von der Kälte gelähmte Muskulatur dies zuließ.
Ich beschloss, mich ebenfalls zu setzen und einfach nur dankbar dreinzuschauen.
Es schien fürs Erste zu genügen.
Das Frühstück belebte unser beider Geister. Der Kopfschmerz ließ langsam nach, der starke Tee gab uns Energie und die Tätigkeit unserer Verdauung produzierte genug Ablenkung von jedem Unwohlsein, dass wir annehmen durften, den Rest des Tages einigermaßen ruhig verbringen zu können. Keiner von uns erwartete die Notwendigkeit zu außergewöhnlicher körperlicher und geistiger Leistung. Woldan würde am kommenden Tag in sein Dorf an der Grenze zu Bell zurückkehren, ein beschwerlicher, aber letztlich sehr sicherer Weg. Tulivar hatte keine Banditen, und selbst wenn, würden sie bei diesem Wetter sicher zu Hause bleiben, anstatt einsamen Reisenden aufzulauern. Außerdem hatte Woldan so seine Erfahrungen mit strenger Witterung, ein sehr kräftiges Pferd und zwei Begleiter, auch alte Veteranen unserer Truppe, die zusammen das ganze Imperium durchqueren konnten, wenn sie wollten.
Sie wollten natürlich nicht, denn das hatten sie während des Krieges bereits getan und es hatte niemandem großen Spaß bereitet.
Wir fingen gerade an, unsere zweifelsohne bestehende tiefe Schuld bei meiner Frau abzuarbeiten, indem wir begannen, das Schlachtfeld der Frühstückstafel aufzuräumen, als es an der Tür klopfte und einer der Wachleute vom Turm um Einlass begehrte.
Er grüßte uns und grinste dabei, starrte uns an, wie man alternde Zirkusclowns anschaute, eine Illusion möglicherweise, die aber darauf hinwies, dass die Nachtschicht ihm detailreich unsere Eskapaden berichtet hatte. Ich gönnte ihm den Spaß und vor allem wurde er sofort wieder ernst.
»Hauptmann, Reisende halten auf die Burg zu. Eine Gruppe von drei Reitern und ein Packpferd.«
Ich zog die Augenbrauen zusammen. Von wandernden Dorfschulzen einmal abgesehen war der Winter gemeinhin die Zeit, in der kaum jemand irgendwelchen Besuch bekam, der weiter als eintausend Meter entfernt wohnte. Es war einfach viel zu beschwerlich und sinnlos, über Land zu reisen.
Außer es ging um etwas wirklich Wichtiges.
Oder jemand war verzweifelt.
In welche Kategorie würden die Besucher fallen?
»Was kannst du erkennen?«
»Sie sind ordentlich angezogen, mit Felljacken, und ihre Pferde sind kräftige, junge Tiere. Keine armen Männer, sondern Reisende, die sich bewusst und mit einem klaren Ziel auf den Weg gemacht haben.« Der Soldat lächelte verlegen. »Denke ich.«
Ich nickte. Ich ermunterte das selbständige Denken bei meinen Untergebenen, half es mir doch, meine eigenen diesbezüglichen Anstrengungen auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen. Ich wurde schließlich auch nicht jünger.
»Wann werden sie hier sein?«
»Halbe Stunde vielleicht. Sie haben es nicht besonders eilig.«
»Sag dem Stallburschen Bescheid. Die Tiere werden der Pflege bedürfen.«
Der Soldat nickte. »Soll ich die Männer gleich einlassen?«
»Wenn sie sich nicht vor dem Tor aufbauen und unsere sofortige Kapitulation fordern – ja, bitte.«
Der Soldat entfernte sich, um meine Befehle auszuführen.
Ich drehte mich um.
»Ich gehe in mein Arbeitszimmer im Turm. Woldan, ich möchte, dass du mich begleitest. Wo ist Frederick?«
»In Tulivar«, meinte Dalina, meine Frau. »Er kommt erst am Abend zurück.«
»Die Köchin soll ein Mittagessen für Gäste bereiten. Ich möchte heißen Tee in meinem Arbeitszimmer und der Kamin soll angefeuert werden. Und ich will zwei Wachen in der Nähe. Woldan.«
Doch mein Freund stand bereits im Türrahmen, um hinauszueilen und alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Ich sah meine Frau an, die Sorge in ihren Augen war unübersehbar.
»Ich glaube nicht, dass wir es mit einer neuen Bedrohung zu tun zu haben«, sagte ich leise. »Ich habe niemanden geärgert oder provoziert. Selbst der neue Graf zu Bell kann doch nur Gutes über seinen armen Nachbarn berichten.«
»Das muss seine Familie nicht davon abhalten, es erneut zu versuchen.«
Dalina spielte auf die Ereignisse von vor drei Jahren an, als meine Gegenspieler bei Hofe alles in Bewegung gesetzt hatten, um meine Position als Baron von Tulivar unmöglich zu machen – am liebsten dadurch, indem sie mich um einen Kopf kürzer gemacht hätten, was meine Regierungsfähigkeit in der Tat erheblich eingeschränkt hätte. So weit war es glücklicherweise nicht gekommen und ich hatte mich in die Illusion geflüchtet, allen da draußen klargemacht zu haben, dass ich einfach nur meine Ruhe wollte.
Nach mehr strebte ich tatsächlich nicht.
Aber vielleicht hatte ich dies noch nicht deutlich genug vermittelt.
Andererseits – warum immer das Schlimmste annehmen? Es waren drei Reiter, keine Drohungen ausstoßende Streitmacht. Und es war furchtbar kalt. Einfach zu kalt für gemeine Intrigen und hinterhältige Fallen, wie ich dachte.
Ich zog meine Jacke über und winkte Dalina zum Abschied zu. Die Sorge war aus ihren Augen nicht verschwunden.
Ich konnte es ihr nicht übel nehmen.
Ein problematisches Ansinnen
Der Mann war schlank, hochgewachsen, mit einem so schmalen Gesicht, dass ich mich wunderte, wie zwei Augen nebeneinander hineinpassen konnten. Er erinnerte mich an ein Pferd, das ich einst geritten hatte, und da ich mich mit Wohlwollen und Wehmut an dieses treue Tier erinnerte, bekam mein Besucher von mir einen Vertrauensvorschuss.
Wir saßen in meinem offiziellen Zimmer im Wachturm zu Tulivar, es war warm und es gab Tee und Brot, Käse und Schinken, da ich annahm, dass der Mann Hunger hatte. Seine beiden Begleiter – erwartungsgemäß Soldaten – wurden bereits versorgt. Bisher hatte der Besucher nichts angerührt und nicht viel mehr getan, als sich vorzustellen: Baron Jemerian von Kolk, persönlicher Gesandter Seiner Unausweichlichen Majestät, des Kaisers und Imperators, meines Herrn und Meisters. Das war kein Angriff, aber es war beunruhigend und die Nervosität stand mir ganz offenbar ins Gesicht geschrieben, denn Jemerian schenkte mir das, was er für ein beruhigendes Lächeln hielt.
Ich fand die Art, wie er sein beeindruckendes Gebiss zeigte, eher erschreckend. Ich musste den Impuls unterdrücken, ihm einen Beutel mit Hafer um den Hals binden zu wollen.
»Ich bin über Euren Besuch überrascht. Es ist keine Zeit, um weite Strecken zu reisen. Ihr kommt direkt aus der Hauptstadt?«
»Soweit man eine mehr als einmonatige Reise als direkt bezeichnen will, ja«, erwiderte der Baron, dessen Stimme immerhin sehr angenehm war und die er wohl einzusetzen wusste. Er lächelte weiterhin breit, aber es wirkte mit jedem Wort erträglicher. »Aber ja, Tulivar war mein Ziel und ich habe alles getan, um möglichst schnell hier zu sein, sozusagen als Vorhut.«
»Vorhut?«, echote ich und mein Unwohlsein wurde stärker. Es konnte doch nicht sein, dass der Kaiser selbst in dieser Zeit … und ausgerechnet hier … nein, wozu auch?
Meine Gedanken purzelten durch den Kopf und zweifelsohne ahnte von Kolk, was in mir vorging. Vielleicht sah er auch das Wechselbad der Gefühle – negativer Gefühle! – auf meinem Antlitz. Er sprach jedenfalls sofort weiter, und das in einem möglichst beruhigenden Tonfall.
»Es muss Euch sehr verwirren, Baron«, erklärte er. »Darf ich Euch zuerst sagen, dass Ihr bei Hofe durchaus in hohem Ansehen steht? Viele erinnern sich Eurer Heldentaten im Krieg. Viele finden auch, dass Ihr ungerecht behandelt wurdet, darunter auch der Kaiser. Er würde es gerne gutmachen, aber …«
»Es gibt politische Fragen zu bedenken«, sagte ich. »Schon verstanden. Ihr dürft unserem Herrn ausrichten, dass es mir nicht nach Wiedergutmachung verlangt. Ich habe schon vor langer Zeit meinen Frieden mit der Situation gemacht und hege keinerlei Ambitionen. Tatsächlich war es meine größte Hoffnung, hier schlicht in Ruhe gelassen zu werden.«
Ich warf dem Emissär dann einen bedeutungsvollen Blick zu, der ihm ein leichtes, tatsächlich bedauernd klingendes Seufzen entlockte.
»Ich bin froh, dass Ihr Euch in Tulivar wohlfühlt. Eure Untertanen bringen Euch Sympathie entgegen?«
Wohin führte diese Frage? Ich bewegte mich unruhig auf meinem Stuhl hin und her. Von Kolk hatte die dargebotenen Speisen noch nicht angerührt, aber ich verspürte den Drang, mich durch hektisches Kauen von meinen Mutmaßungen abzulenken.
»Soweit sie dazu überhaupt in der Lage sind. Bei den meisten wird es eine Mischung aus widerwilligem Respekt und duldsamer Bereitschaft sein, mich zu ertragen. Viel mehr kann man hier nicht erwarten. Die Hälfte meiner Untertanen ist seit Geburt zu positiven Gefühlen unfähig.«
Mein Gegenüber grinste und bei den Göttern, das konnte er gut.
»Verstehe.«
»Wessen Vorhut seid Ihr, Baron von Kolk?«
Der Mann antwortete nicht sofort, sondern legte in einer wohlstudierten Geste die Fingerspitzen seiner Hände aufeinander.
»In etwa vier Wochen wird eine weitere Gruppe von Reisenden hier eintreffen. Nicht allzu groß und über gewisse Umwege, um nicht unnötig Aufmerksamkeit zu erregen. Tatsächlich werden sie dem beiläufigen Beobachter keinen Hinweis auf ihre Identität geben. Wir haben uns bemüht, sowohl die Abreise wie auch den Weg des Prinzen so inkognito wie möglich zu gestalten.«
Mein Kopf fuhr hoch.
»Prinzen?«
»Ja, des Prinzen. Prinz Lejan, einziger überlebender Sohn unseres geliebten Herren, Thronfolger und Sonne seiner Eltern.«
Mir war der leicht ironische Unterton beim Thema »Sonne« keinesfalls entgangen und ich ahnte, dass diese Bemerkung somit nicht zufällig aus von Kolks Mund gerutscht war. Ich war mittlerweile der Überzeugung, dass der Baron gar nicht in der Lage war, auch nur ein einziges unüberlegtes Wort zu äußern.
»Der Prinz reist nach Tulivar?«
»Er ist unterwegs. Denke ich.«
»Warum?«
Baron von Kolk seufzte erneut und blickte für einen Moment in das Feuer. Dann griff er zielsicher am Tee vorbei zum gewärmten Würzwein, dem ich heute aus naheliegenden Gründen entsagte. Der angenehme Geruch des Getränks erfüllte alsbald meine bescheidenen Räumlichkeiten und hätte unserem Gespräch beinahe eine Note von Gemütlichkeit gegeben. Ich nutzte die Gelegenheit, um selbst am Tee zu nippen, dessen Aroma ich aufgrund der Beanspruchungen meiner Geschmacksnerven am letzten Abend nicht zu schätzen wusste.
Während der Baron trank, kramte ich in meinen Erinnerungen an Lejan. Ich war ihm begegnet, dessen war ich mir sicher. Aber Lejan war damals keine zehn Jahre alt und er war auch nicht Thronfolger gewesen, da er noch einen älteren Bruder gehabt hatte – dessen Leben ich einst rettete. Eine gewisse Verschwendung angesichts der Tatsache, dass der Gerettete sich einige Zeit später irgendwo den Eierfraß bei einer Hure des kaiserliches Trosses holte und daran wenig würdig zugrunde ging.
Ich erinnerte mich also nicht sehr genau an Lejan. Ein damals eher zurückhaltender Junge in der Gegenwart so vieler wichtiger Persönlichkeiten. Geboren in einem Feldlager, aufgewachsen in vielen Feldlagern, zweimal auf der Flucht vor dem scheinbar sicheren Tod, als der Feind die Stellungen umging und den Tross angegriffen hatte. Eine schwierige Kindheit, aber damit keine Ausnahme während des Krieges, der viele Familien entwurzelt und auseinandergerissen hatte, selbst hier im fernen und abgelegenen Tulivar. Ich vermutete, dass er sich langsam mit der Perspektive befasste, dereinst ein Kaiser zu sein, falls nichts dazwischenkam.
Es war der letzte Halbsatz, der mir plötzlich zu denken gab.
»Ist der Prinz in Gefahr?«, fragte ich, als von Kolk immer noch auf der Suche nach den richtigen Worten zu sein schien, was ich ihm allerdings keine Sekunde ernsthaft abnahm.
»Ja. In zweifacher Hinsicht.«
»Erzählt.«
»Prinz Lejan ist ein unbotmäßiges Kind. Er steht sich selbst sehr oft im Weg.«
»Wie alt ist er jetzt?«
»Dreizehn. Er wird in Kürze vierzehn.«
Ich nickte weise.
»Hm, mal überlegen … er gibt oft Widerworte?«
»Das stimmt«, bestätigte von Kolk.
»Er vermeidet seine Lektionen, wo er nur kann, und ist für seine Lehrer mehr Qual als Freude?«
»Das trifft die Sache recht gut.«
»Anstatt sinnvolle Dinge zu tun, zieht er es vor, sich Spielen hinzugeben, auszureiten, auf andere Leute oder Dinge einzuschlagen und sehr viel und bis in den Mittag hinein zu schlafen?«
Von Kolk räusperte sich. »Dazu neigt er.«
»Er nimmt seine Mahlzeiten unregelmäßig ein, achtet nicht sehr auf die Sauberkeit seiner Kleidung, sein Zimmer ist unordentlich und er wäscht sich nur mit Widerwillen?«
»Eine gute Beschreibung.«
»Er sitzt oft in einem Sessel in der Ecke oder in seinem Bett und verbringt seine Zeit damit, sich dem wunderbaren Geschenk zu widmen, das die Götter zwischen seinen Beinen platziert haben?«
Der Baron warf mir einen kurzen, tadelnden Blick zu, kam aber nicht umhin, zustimmend zu nicken und dann zu bemerken: »Sie kennen den Prinzen offenbar recht gut.«
»Ich kenne ihn so gut wie gar nicht. Aber ich war auch einmal dreizehn und es war keine Freude, meine Eltern zu sein.«
Kolk starrte mich an. »Ich habe auch Söhne in dem Alter und sie verhalten sich nicht so.«
»Ihr führt sicher ein strenges Regiment«, erwiderte ich. Ich wollte nicht wissen, was die Rabauken anstellten, jetzt, wo der Vater nicht zugegen war.
»Ich halte viel von Disziplin.«
»Das ist eine feine Sache«, sagte ich allgemein und goss mir einen Tee ein. »Prinz Lejan steht sich also selbst im Weg, wie Tausende seines Alters überall im Imperium. Ich kann Euch aus dem Stegreif ein Dutzend Lejans aus der näheren Bekanntschaft nennen, sowohl mit strengen, wie auch mit weniger strengen Eltern. Worin liegt also die Gefahr?«
»Er ist wirklich sehr, sehr dickköpfig. Er lässt sich nicht maßregeln. Er ist aufmüpfig, wendet Gewalt an, flucht. Er … kennt keine Grenzen, gar keine.«
Kolk beugte sich nach vorne. Er schien sich für das Thema zu erwärmen. »Wie will er jemals lernen, dieses Reich zu regieren, wenn er in diesem Alter täglich schlimmer und unerträglicher wird? Er schreit die Bediensteten an, er tritt um sich, wird er zu etwas gezwungen. Er verweigert sich auch sanften Worten der Vernunft. Der Kaiser ist ausgesprochen besorgt und die politischen Kräfte im Rat, die ihm kritisch gegenüber eingestellt sind, stehen bereit, um die Situation auszunutzen. Es geht um mehr als um einen wilden Jungen. Es geht um die Gefahr, die er für sich selbst darstellt, und um die Gefahr, die ihm von außen droht.«
»Das klingt nach etwas mehr, in der Tat.«
»Der Kaiser hat sich in den letzten beiden Jahren in eine Reihe von Auseinandersetzungen gestürzt. Gewisse Steuern und Gesetze, die manchen Familien nicht sehr schmecken. Das meiste davon werdet Ihr hier nicht mitbekommen haben.«
Ich nickte. Steuern zahlte Tulivar zwar, seitdem wir unser eigenes Gold schürften, aber ansonsten waren wir dermaßen weit vom Schuss, dass die Einhaltung der Gesetze dem Wohlwollen des Barons, also meiner Person, überlassen blieb, und solange das Geld floss, war ich in diesen Dingen recht autonom. Es gab hier keine Aufpasser, die ständig nach dem Rechten sahen – ein Grund mehr, warum mich von Kolks Besuch etwas beunruhigte, denn er wirkte wie der klassische Kontrolleur und das galt sicher nicht nur für das unbotmäßige Verhalten eines heranwachsenden Prinzen.
»Der Kaiser fürchtet um das Leben seines Sohnes?«
»Der Kaiser hält es für besser, wenn Lejan aus der Schusslinie gebracht wird, bis sich die Wogen wieder glätten. Und er findet, dass ein längerer Aufenthalt in einer Umgebung mit weniger … Ablenkung möglicherweise Züge von Ernsthaftigkeit und Disziplin bei seinem Sohn zum Vorschein kommen lassen, die bisher verborgen gewesen sind.«
»Ah … also auch eine erzieherische Maßnahme.«
»Gewissermaßen.«
»Und ich bin der Erzieher?«
Der Baron hob die Hände und schüttelte lächelnd den Kopf. Er musste den kläglichen und zugleich anklagenden Unterton meiner Frage richtig gedeutet haben.
»Niemals würden wir Euch mit dieser Bürde belasten«, erklärte er. »Der Prinz wird von zwei Leibwächtern begleitet, einem Hausdiener und drei Lehrern, die ihn weiterhin in allem unterrichten werden, was er wissen muss. Eure Aufgabe alleine ist es, eine geeignete Unterkunft zu finden – nicht zu luxuriös, denn …«
»Weniger Ablenkung, ich verstehe.«
Der Baron lächelte erfreut über mein Verständnis.
»Ganz recht. Bringt ihn unter, versorgt ihn mit allem Notwendigen. Ich habe den Auftrag, Euch dies zu geben, mit dem Versprechen auf mehr.«
Auf dem Tisch vor mir erschien wie aus dem Nichts ein Lederbeutel, dessen Inhalt sich charakteristisch unter dem Stoff ausbeulte. Münzen. Wahrscheinlich Silber. Aber genug, um einen Dreizehnjährigen und seine wenigen Begleiter mehr als ein Jahr mit dem »Notwendigen« zu versorgen, vor allem, wenn man sich bei der Definition, was darunterfiel, vom frugalen Charakter der Umgebung leiten ließ.
Ich nickte. Wie von Zauberhand verschwand der Beutel, diesmal aber in meine Richtung.
»Es wird sich schon etwas finden«, erklärte ich dann. Das war eine Untertreibung.
Halb Tulivar stand leer.
»Wie lange soll der Prinz von aller Ablenkung befreit bleiben?«
Von Kolk zuckte mit den Schultern. »Die Situation bei Hofe ist im Fluss. Es ist schwer abzuschätzen. Aber nicht mehr als ein Jahr, das wäre meine Schätzung.«
Ich wurde bestimmt blass. Es musste so sein.
Er beugte sich nach vorne. »Ich will ganz ehrlich sein, Baron von Tulivar. Die Dinge sind kompliziert. Ich wünschte, ich könnte Genaueres sagen, doch das größte Problem für den Kaiser und seine Getreuen ist exakt diese Ungewissheit, die uns alle derzeit erfasst. Es ist mir eine Erleichterung, dass Lejan hier in Sicherheit sein wird. Alles ist möglich. Der Krieg ist vergessen. Das übliche Intrigenspiel, das Gehacke bei Hofe, hat in vollem Ausmaße begonnen. Ihr seid nur ein Opfer und nur ein kleines. Es fließt Blut, Tulivar. Es ist wie vor dem Krieg, um keinen Deut besser. Entwürdigend, ja. Aber das sind derzeit die Regeln des Spiels. Der Kaiser will sie ändern, aber gerade das ruft den größten Widerstand derer heraus, die von den alten Regeln bisher profitiert haben. Für viele seiner Gegner geht es um … sehr viel!«
Ich nickte. »Und was wäre da besser als ein Kaiser, der durch den tragischen Tod seines einzigen überlebenden Sohnes außer Fassung gebracht wird und plötzlich die Thronfolgefrage neu regeln muss.«
»Oder ein minderjähriger Nichtsnutz auf dem Thron, der durch jeden manipulierbar ist, der seine kindischen Wünsche erfüllt und ihm das Gefühl gibt, damit auch noch im Recht zu sein.«
So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Beides waren keine besonders schönen Aussichten, auch nicht für Tulivar. Am Arsch der Welt oder nicht, die Provinz gehörte zum Reich und alles, was dort geschah, würde sich irgendwann auch hier niederschlagen. Der Kaiser war ein Übel, das mir wohlbekannt war und mit dem ich umgehen konnte. Es lag mir nichts daran, es gegen ein unbekanntes und möglicherweise größeres auszutauschen.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich die richtige Wahl bin«, erklärte ich offen und schaute etwas betrübt in das Feuer im Kamin. »Ich habe selbst so meine Gegner bei Hofe und es gibt genug da, die mich beseitigen wollen, und sei es nur aus Prinzip. Im letzten Jahr ist nichts passiert und ich war ein durchweg braver Baron, habe sogar dem jungen Grafen zu Bell Geburtstagsgrüße geschickt, obgleich er ein Zögling jener ist, die mir die Eingeweide um den Hals wickeln wollen. Aber das heißt für mich noch lange nicht, dass damit die Sache ausgestanden ist.«
Von Kolk schüttelte den Kopf. Er wirkte ernsthaft bekümmert.
»Jeder im Reich ist für jemanden oder gegen jemanden. Jeder, der zum Lager des Kaisers gerechnet wird, könnte die gleichen Argumente vorbringen wie Ihr. Wohin also sollte unser Herr seinen Sohn schicken, um ihn aus dem Schlangennest der Hauptstadt zu entfernen?«
»Ins Ausland?«
Der Baron lachte laut auf, es klang bitter, gar nicht fröhlich, und sehr gezwungen.
»Wo denn? Das Imperium hat während des Krieges die bekannte Welt klar unterteilt in Gut und Böse. Die Guten haben mit uns gesiegt und sind von uns abhängig, bessere Vasallenstaaten, manipulierbar und manipuliert durch unsere Politik, durch die großen Familien und weit genug außerhalb unserer Jurisdiktion, um sie zu einem Paradies für Stellvertreterkonflikte zu machen, wo die Regeln, die wir zumindest offiziell einhalten, gar nicht erst gelten. Den Prinzen in eines dieser Länder zu senden, ist das Gleiche, als wenn man ihn sofort auf das Schafott führt. Wir haben alles durchdacht, Baron von Tulivar. Eure Provinz ist, seid mir für diese klaren Worte nicht böse, das kleinste Übel. Ich weiß nicht, ob es erfreulich oder entsetzlich ist, aber dieser Ort ist derzeit der sicherste im gesamten Imperium.«
Ich starrte von Kolk wohl ein wenig entgeistert an, denn das Lächeln, das jetzt seine Lippen umspielte, hatte tatsächlich etwas Amüsiertes. Ein Superlativ, bezogen auf meine armselige Provinz – und dann auch noch ein positiver? Ich hatte gar nicht gewusst, dass die Grammatik so was hergab.
Er seufzte und trank gewürzten Wein.
»Das Leben ist hart«, sagte er dann. »Wir dachten, als der Krieg vorbei war, alles würde besser werden. Manches hat sich ja auch verbessert. Wir müssen nicht mehr jeden Tag in kalten Feldlagern sitzen, mit Läusen im Haar und nassen Füßen, die uns in den Stiefeln vergammeln. Wir haben keinen Feind mehr, der von einem unberechenbaren Fanatiker geführt wird und der weder Gnade noch Einsicht kennt. Wir spinnen unsere Intrigen im warmen Zimmer, bei einem Glas Wein …« Er hob zur Demonstration seinen Becher. »… und mit vollem Bauch. Aber die Welt ist um keinen Deut friedlicher geworden für jene, die Macht haben oder anstreben. Der Krieg ist subtil, aber er wird geführt und stärker als zuvor, da das einigende Band des gemeinsamen Kampfes gegen den äußeren Feind nunmehr fehlt.«
Ich verstand nur zu gut, was er meinte, denn ich hatte mit beidem zu tun gehabt und beides hatte mich nicht sonderlich mit Freude erfüllt. Aber warum jetzt schon wieder? Konnte man mich nicht einfach in Ruhe lassen?
Nein, das konnte man wohl nicht.
»Ich muss wohl akzeptieren, was Ihr sagt«, meinte ich dann bedächtig. Von Kolk sah mich mit einem mitfühlenden Ausdruck an.
»Der Kaiser weiß, dass dies eine besondere Bürde für Euch bedeutet«, sagte er leise. »Aber sie ehrt Euch gleichzeitig. Er scheint große Stücke auf Euch zu halten. Er meint, dass Ihr die richtige Person seid, um mit dieser Herausforderung fertigzuwerden. Seid Ihr das?«
»Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur bemühen, dem Vertrauen gerecht zu werden. Aber ich weiß es wirklich nicht.«
Ich sah den Baron offen an. »Genügt Euch meine Antwort?«
Der Mann lächelte etwas hilflos. »Sie muss mir genügen, Lord zu Tulivar. Ich habe nämlich auch für den Fall, dass sie mir nicht genügen würde, schlicht keine Alternative.«
Er erhob sich langsam, warf dem leeren Becher einen bedauernden Blick zu.
»Sobald der Prinz hier ist, trete ich den Rückweg an. Ihr benötigt keinen Aufpasser, der Euch ständig über die Schulter schaut.«
Damit zerstreute er immerhin eine meiner düstersten Vermutungen, ein Lichtblick, der mir die Situation nicht unwesentlich versüßte. Auch ich stand auf.
»Ich würde Euch gerne in den kommenden Tagen die Sehenswürdigkeiten von Tulivar zeigen. Ihr wart offenbar noch nie hier.«
Von Kolk hob die Augenbrauen. »In der Tat. Aber warum ›würde‹? Habt Ihr keine Zeit dafür? Ich …«
»O nein.« Ich grinste. »Das Problem liegt woanders.«
»Und wo?«
Ich zuckte mit den Achseln.
»Es gibt keine.«
Wir schwiegen einen Moment, dann beugte ich mich nach vorne.
»Noch etwas Wein?«
Von Kolk seufzte.
Eine bemerkenswerte Ankunft
Die nächsten Tage verbrachten wir mit allerlei Vorbereitungen. Es bedurfte einiger Überlegungen. Die Nachricht verursachte Aufregung. Irgendwas war da mit dem imperialen Charisma, das selbst verknöcherte Provinzler aus dem Winterschlaf riss. Ein Prinz! Hörte sich das nicht nach Romantik an, beflügelte es nicht die Fantasie nicht nur der jungen Mädchen? Natürlich tat es das und es bereitete mir Sorge. Ich kannte Prinzen. Sie popelten sich in der Nase und kratzten sich am Sack und fassten Dienstmägden an die Brüste. Sie lachten schräg, rülpsten, furzten und sagten unanständige Dinge.
Bei den Göttern, sie taten unanständige Dinge. Es waren Prinzen! Für irgendwas musste das ja gut sein!
Ich erwartete hier nicht zu viel von einem Jungen in Lejans Alter, aber dennoch tat ich mein Bestes, um der um sich greifenden Romantik Einhalt zu gebieten. Als einige Mütter anfingen, ihre gerade erblühenden Töchter mit neuen Kleidern einzudecken – immerhin freute sich der Schneider von Tulivar, er hatte plötzlich viel Arbeit –, wusste ich, dass die Dinge aus dem Ruder liefen. Ich beschloss sogleich, ein strenges Besuchsregime einzuführen. Kein Kind Tulivars würde Prinzessin werden, dessen war ich mir sicher, und allein die Aussicht, dass es doch so kommen könnte, drohte mir schlaflose Nächte zu bereiten.
Aber auch so kam ich nur wenig zur Ruhe.
Es gab viel zu tun und die Zeit war knapp.
Eine Unterkunft für den Prinzen war in der Stadt schnell gefunden, es gab genug leer stehende Häuser, von denen die Besitzverhältnisse sich niemals würden klären lassen. Ich beschlagnahmte eines, das noch in einigermaßen gutem Zustand war, und ließ sofort eine Kolonne von Handwerkern aufmarschieren, um das »einigermaßen« aufzubessern. Von Kolk kommentierte meine Bemühungen kaum, er war mit den Arrangements entweder einverstanden oder er meinte, dass er mir überlassen müsse, mit dem Problem fertigzuwerden. Wir trafen uns bis zur Ankunft des Prinzen nur selten. Der Baron war ein zurückhaltender Mann.
Ich war dankbar dafür.
Die Zeit verging wie im Fluge. Hektische Betriebsamkeit hatte diesen Effekt.
Am Tag, als wir den hohen Besuch erwarteten, gab es einen Schneesturm, der in mir große Besorgnis auslöste. Die Reisegruppe des Prinzen war hoffentlich in einem Dorf, vielleicht an der Grenze zu Tulivar, aufgehalten worden und würde abwarten, bis das Unwetter vergangen war. Schneestürme dauerten nicht länger als drei bis vier Stunden, während dieser Zeit aber sah man die Hand vor Augen nicht und die Kälte war kaum zu ertragen. Er gab uns in jedem Falle etwas Aufschub, etwas Schlaf und die Möglichkeit, einen Schnaps oder zwei zur Beruhigung der Nerven zu nehmen, eine Chance, die ich begierig ergriff.
Einen Tag später – die Witterung hatte sich beruhigt und es war fast windstill – meldeten die Beobachtungsposten oben auf dem Turm, dass sich die erwartete Reisegruppe näherte, sechs Personen auf Pferden, dazu ein Packtier. Es dauerte nicht lange, da waren sie in der Tat eingetroffen und ich erfuhr, dass der Anführer der Expedition, ein Sergeant der kaiserlichen Leibgarde, wohlweislich als Gast meines Freundes Woldan, der nach Flussdorf zurückgekehrt war, auf besseres Wetter gewartet hatte. Sergeant Ernest Maliki war ein Veteran des letzten Krieges und er hatte von mir schon allerlei gehört, wie er mir gleich augenzwinkernd mitteilte. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Nachricht war. Sein Kamerad war ein Soldat namens Jordin, der mich gleichfalls freundlich begrüßte. Außer Lejan selbst waren da noch drei Privatlehrer, die alle einen sehr erschöpften und wenig erfreuten Eindruck machten. Ich war mir nicht sicher, ob das nur auf die Beschwerlichkeiten der Reise zurückzuführen war.
Prinz Lejan war von seiner neuen Heimat jedenfalls nicht begeistert.