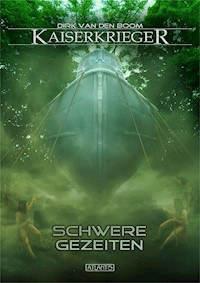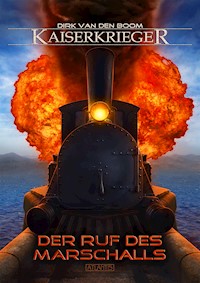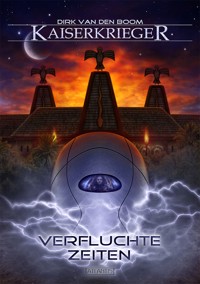Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kaiserkrieger
- Sprache: Deutsch
Der Siegeszug der neuen Eroberer aus Teotihuacán scheint unaufhaltsam. Doch unter den Maya, die lediglich ein Imperium gegen das andere austauschen, regt sich Widerstand. Alte Gewissheiten haben ihre Gültigkeit verloren und neue Allianzen bilden sich. Hoffnung keimt, wo niemand sie erwartet hätte; aus der Niederlage erwächst oft eine neue Stärke. Doch ein Pfad der Vernichtung zieht sich durch das Land der Maya und es brennen nicht nur die Tempel. Derweil wird man in Rom mit der Perspektive einer weitaus größeren Bedrohung konfrontiert, als beunruhigende Nachrichten aus dem Osten eintreffen. Und was in Mittelamerika passiert, bekommt für die Kaiserkrieger aller Nationen eine globale Perspektive.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Epilog
Personenverzeichnis
Weitere Atlantis-Titel
Dirk van den Boom
Kaiserkrieger: Brennende Tempel
1
Drei Tage dauerte das Blutgericht.
Drei Tage der Freude, drei Tage des Leids. Eine Zeit der Entscheidung, der Umwälzung.
Sie machte Metzli, König von Teotihuacán, zum Herrn der Welt.
Als Ruhe einkehrte und der Lärm des Kampfes sich in das leise Wehklagen der Verletzten und das Weinen der Trauernden verwandelte, schritt Metzli in Begleitung der Zwölf durch B’aakal, die große Stadt der Maya, die einst den Befehlen Bahlams gehorcht hatte. Seine Sandalen traten in rotbraune Pfützen aus getrocknetem Blut, über die gebrochenen Leiber der Toten hinweg und seine Nase nahm den Geruch von Tod und einsetzender Verwesung in sich auf. Seine Armee war weiter schwer beschäftigt: die Leichen einsammeln, diese unzeremoniell verbrennen, die Körper der Könige und Adligen auslöschen, wie er begann, die Erinnerung an sie auszulöschen. Das Knistern der großen Totenfeuer, der brennenden Leichenberge, wurde übertönt durch das Knirschen und Krachen der zertrümmerten Stelen, die an die ruhmreiche Ahnenreihe der Könige von B’aakal erinnerten und deren Reste zu Bergen aus Stein aufgeschichtet wurden. Die Fresken wurden aus den Tempelwänden gebrochen, die Bilder und Symbole geschändet, ihrer Bedeutung beraubt. Die Bewohner B’aakals, die gefangenen, mutlosen Krieger der versammelten Allianz, beobachteten diesen methodischen Vorgang, das Ausradieren ihrer Vergangenheit, mit stumpfen Blicken, alle noch gefangen im Schock des Massakers, das ihre Welt so gründlich auf den Kopf gestellt hatte, wie es kein Götterbote jemals zustande gebracht hätte.
Götterbote. Ja, richtig.
Metzli lächelte, etwas in Gedanken, als er über einen abgeschlagenen Arm stolzierte, der von seinen Männern noch nicht aufgelesen und zum Verbrennen gebracht worden war. Inugamis Leib lag bereits irgendwo da auf einem der großen, abfackelnden, nach geröstetem Fleisch riechenden Haufen. Er selbst, Metzli, hatte ihn vor den Augen aller aufgehoben, in die Höhe gehalten und dorthin getragen, das Feuer entfacht, für alle zu sehen. Eine symbolische Handlung, die gezeigt hatte, wie eine neue Weltordnung den Fluch der Götterboten zu Grabe trug. Eine Nachricht, die sicher an keinem der zahlreichen Zuschauer verloren gegangen war und die sich in Windeseile verbreiten würde. Was Metzli hoffte, was er beabsichtigte.
Er strickte an seiner Legende und es sollte ein festes Tuch werden.
»Herr.«
Metzli blieb stehen, als sich sein General an ihn wandte. Izel verbeugte sich, seine Kleidung voller Blut und den Resten von Eingeweiden. Er war ein guter Mann, gnadenlos, erbittert, diszipliniert und grausam. Und etwas leichtsinnig, wie die Wunden zeigten, die er trug wie einen Schmuck. Metzli würde ihn belobigen, beschenken und ermahnen, nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge.
»Wir haben sie nicht gefunden, nicht unter den Toten, nicht unter den Lebendigen.«
Izels Worten war zu entnehmen, dass er eine Strafe für diese Meldung erwartete, doch Metzli hatte sich mit der Möglichkeit dieses Ergebnisses bereits vertraut gemacht und verschwendete keine wertvollen Männer in Ausbrüchen sinnloser Brutalität. Ixchel und Nicte waren entkommen und das war letztlich nicht mehr als eine kleine Trübung im ansonsten glänzenden Ergebnis der Aktion. Es war auch nicht Izels Schuld. Das Chaos, das nach ihrem überraschenden Angriff ausgebrochen war, so unvermeidlich wie ein Gewitter nach heißen Sonnentagen, hatte die Flucht begünstigt. Die junge Frau hatte sich in der Vergangenheit bereits als jemand erwiesen, der über einen ausgeprägten Überlebensinstinkt verfügte. Metzli konnte ein klein wenig Bewunderung nicht verhehlen. Ja, seine Feinde sollten alle sterben und niemand durfte sich ihm entgegenstellen, doch das hieß nicht, dass er einem Gegner nicht zumindest Respekt zollen konnte, ehe er ihm die Eingeweide aus dem Leib schnitt.
Ixchel war kein Problem.
Wenn die anderen Städte fielen, würde es bald keinen Ort mehr geben, in dem sie Zuflucht fand. Mutal jedenfalls ganz sicher nicht. Die Hauptstadt der Götterboten stand als Nächstes auf der Liste und Metzli hatte nicht die Absicht, den Angriff unnötig hinauszuzögern. Jetzt, wo ihm alles gehörte, alle am Boden lagen, galt es, schnell und entschieden zu handeln, und exakt das war seine Absicht.
»Lass es gut sein, Izel. Sie wird uns eines Tages über den Weg laufen. Ich lasse sie dann vielleicht sogar am Leben und gebe sie einem verdienten Krieger zur Sklavin, und ihre kleine Schwester gleich mit. Es soll uns jetzt nicht weiter kümmern, mein Freund. Wasche dich, kleide dich neu, iss und trink. Hörst du meine Worte, General?«
Für einen winzigen Augenblick war da Unwille im Gesicht des Veteranen zu sehen, doch dann verneigte er sich tief. »Herr, ich höre.«
»Dann legst du dich hin und schläfst. Ich will, dass die Toten auf den Scheiterhaufen von deinem Geschnarche aus der Unterwelt geholt werden.«
Izel rang sich ein Lächeln ab. Die Zwölf sahen sich vielsagend grinsend an. Keiner von ihnen war der Hellste unter der Sonne, aber das mussten sie auch nicht sein. Sie waren Instrumente, genauso wie die modernen Heckler-&-Koch-Gewehre in ihren kräftigen Händen. Und wenn es ihnen gut ging, funktionierten sie auch gleich umso besser. Es lohnte sich, gegenüber den eigenen Getreuen Freundlichkeit und Sorge zu zeigen. Es schmiedete ein Band zwischen ihnen, es erhöhte die Treue. Metzli wusste das gut. Sein Vater hatte es ihn gelehrt. Drohung und Güte, Zuckerbrot und Peitsche. So hatte das Drogenkartell funktioniert, in dem sein Erzeuger tätig gewesen war, und so funktionierte jetzt auch das Imperium des Metzli.
Izel verbeugte sich und ging, sein König setzte seinen Rundgang fort. Er hatte auch zu wenig geschlafen, denn er musste darauf achten, dass die Disziplin gewahrt blieb. Er wollte herrschen, nicht ausrotten. Den Kopf abschlagen und dem Körper der Stadt einen neuen aufsetzen, der ohne die Gliedmaße aber nichts würde anfangen, nicht würde angemessen dienen können. Seine Männer hatten die strengsten Befehle und Metzli ahnte nicht, dass diese denen der Soldaten Inugamis bei ihren Eroberungen sehr ähnelten.
Von diesen hatten seine Leute fünf lebend gefangen genommen. Fünf von zweihundert. Der Rest hatte gekämpft, und das mit einer Vehemenz, die Metzli nur Bewunderung abnötigte. Mutal würde kein Spaziergang werden, Schnellfeuergewehre hin oder her.
Aber das hatte er auch nicht erwartet.
Er erreichte den Palast des Königs, wo sich zuletzt Adlige und Höflinge verschanzt und eine gute Stunde erfolgreich verteidigt hatten. Die Schusswaffen waren an den dicken Mauern gescheitert, dennoch hatten sie lange Muster von Einschusslöchern in die Fresken gestanzt. Der Kampf hatte schließlich ein Ende gefunden, als Metzli den Leuten das Leben und freies Geleit versprochen hatte. Nachdem sie alle vertrauensselig das Gebäude verlassen und sich auf den Weg gemacht hatten, waren sie von den Zwölf dahingemäht worden, in einer einzigen, schnellen Aktion.
Es durfte keiner von ihnen bleiben.
Er betrat den Palast, sah das Blut, eingetrocknet, vermischt mit Staub und untrennbar mit dem Sandstein verbunden. Ein bleibendes Mahnmal, wie Metzli wusste, der Stein war nur zu reinigen, indem man die äußere Schicht abmeißelte. Der scharfe, metallische Geruch hing noch in der Luft und nicht alle Leichen waren entfernt worden. Kein angenehmer Ort, als ob das Leid der Toten, der Schmerz der Niederlage sich wie eine Patina auf den Stein gelegt hatte, und nicht nur auf ihn. Auf absehbare Zeit war dieser Palast mit Verzweiflung, Verrat und Mord verschmutzt. Metzli kümmerte das wenig.
Er legte keinen Wert darauf, hier zu residieren. Einen Statthalter würde er einsetzen, einen treuen Mann, und er wusste auch schon genau, wen er mit dieser möglicherweise etwas undankbaren Aufgabe betrauen würde.
Deswegen war er hier.
Und da stand er auch schon, nur begleitet von zwei Wachen, und starrte auf den verwaisten Sitz des Königs von B’aakal. In Inocoyotls Gesicht spielten sich Ablehnung und Angst. Metzli räusperte sich und der ältere Mann fuhr zusammen, verbeugte sich tief. Es war Krieg und Metzli hatte einige Regeln geändert. Wenn seine Männer sich jedes Mal auf den Boden warfen, wenn sie seiner ansichtig wurden, verringerte das ihre Effizienz. Er hatte die notwendige Ehrerbietung daher auf Verbeugungen reduziert und fand nicht, dass ihm damit ein Zacken in seiner Krone abhandengekommen war. Es reichte, wenn sie alle bereit waren, für ihn zu sterben. Sie mussten nicht ständig ihre Stirn in den Dreck werfen.
»Inocoyotl. Richte dich auf. Setzen wir uns?«
Metzli winkte mit einem Lächeln in Richtung des breiten Stuhls, der einst den massigen Körper Bahlams getragen hatte. »Du wirst zunehmen müssen, wenn du da hineinpassen willst.«
Inocoyotl hörte die Worte und verstand sie. Es war die Ankündigung dessen, weswegen er hierher gerufen worden war.
»Ja, Herr.«
»Keine andere Antwort? Du weißt, dass du zu jenen gehörst, von denen ich Widerworte nahezu erwarte!«
»Nein, Herr.«
Inocoyotl senkte den Kopf, seine ganze Haltung Ausdruck von wehrlosem Fatalismus. Für einen winzigen Moment erwog Metzli, seine Meinung noch einmal zu ändern, doch dann sagte er sich, dass zu viel Milde und Fairness seinen Ruf beschädigen würden. Inocoyotl ging es nicht schlecht. Ihm würde es an nichts mangeln. Er konnte sich ins Bett holen, wen er mochte, und würde eine der großen Metropolen der Maya beherrschen, eine Stadt, fast so beeindruckend wie Teotihuacán selbst. Zu viel Mitleid war nicht angebracht.
Sie setzten sich, keiner von beiden auf den Platz des Bahlam, dessen Leiche da draußen zu einem knusprigen, sehr großen Braten und anschließend zu Asche wurde.
»Du wirst gut regieren.«
»Ich habe keine große Freude an der Macht«, sagte Inocoyotl mit dem kleinsten Anflug an Trotz. Es war also doch noch Leben in ihm, wie Metzli zu seiner Freude feststellte.
»Das ist eine gute Voraussetzung für einen guten Regenten«, stellte er dann fest. »Vor allem dann, wenn er einem Oberherrn zu dienen hat.«
Inocoyotl nickte schweigend.
»Du wirst die Schäden beseitigen. Ich lasse dir eine Besatzungsarmee zurück, 1000 Mann. Die überlebenden Mayasoldaten unterstelle ich meinen Offizieren und marschiere mit ihnen gen Mutal.«
»Ob sie Euch alle dienen werden?«
»Wer sich weigert, wird getötet. Und ihre Könige und Adligen habe ich bereits ausgelöscht.«
»Es gibt noch welche in den Städten, aus denen sie kamen.«
»Aber sie werden nicht gegen mich kämpfen, nachdem sie sich dessen erinnern, was ich in den letzten drei Tagen hier vollbracht habe.«
Metzli hatte den Eindruck, Inocoyotl konnte sich da auch andere Szenarien vorstellen und wäre sich, nachdem er nun viel Zeit unter den Maya verbracht und mit vielen lange Gespräche geführt hatte, nicht sicher, ob sein Herr in seiner Einschätzung nicht irrte. Metzli kannte das: Männer, berauscht von ihrer eigenen Macht, mochten einst vernünftig und maßvoll gehandelt haben. Sobald sie aber von diesem ganz speziellen Trunk nahmen, stieg es ihnen zu Kopf und sie ersetzten den Blick für das, was war, durch eine bloße Vorstellung, die ihren Wünschen entsprach.
Er war aber nicht in der Stimmung, diese Thematik zu vertiefen. Natürlich würde nicht alles glattlaufen. Das war der Lauf der Dinge. Etwas ging immer schief.
Und Inocoyotl wusste natürlich, dass auch die Geduld des Königs ein Ende fand, wenn ein Untergebener ein Thema allzu sehr verfolgte und das Urteilsvermögen des obersten Herrn infrage stellte. Obgleich die Perspektive, B’aakal zu beherrschen, für Inocoyotl keine angenehme war, zog er sie doch ganz bestimmt einer Existenz ohne Gedärme oder Kopf weiterhin vor.
»Du wirst mir auf deine Art helfen«, sagte Metzli nun. »Erhalte mir B’aakal als blühende Metropole. Sorge dafür, dass die neue Herrschaft beim Volk gut ankommt. Bestrafe Widerstand hart, doch belohne Loyalität. Mische dich nicht in die religiösen Angelegenheiten ein. Wollen die Maya zum Menschenopfer zurückkehren, so gestatte dies. Stärke die Priesterschaft, sorge dafür, dass neue, junge Priester sich in Untergebung üben. Ich habe in den vergangenen drei Tagen genug der alten Zausel hinrichten lassen, es dürfte ausreichend Möglichkeiten für junge Männer geben, die Gunst der Stunde zu nutzen. Gewinne die Herzen und du wirst ein glorreicher Herrscher sein, dessen Name in Teotihuacán mit großer Ehrfurcht ausgesprochen wird.«
Inocoyotl wand sich ein wenig. Metzli wusste, warum. Ehrfurcht und Glorie waren in Ordnung, doch würde die Tatsache, dass man seinen Namen aussprach, sich vor allem darauf beziehen, dass der glorreiche Inocoyotl fern der Heimat blieb, und das möglicherweise für immer?
»Herr«, sagte er dann doch, weil es ihn wohl einfach umtrieb. »Ich freue mich über die große Aufgabe und will sie nach bestem Wissen und Gewissen für Euch erledigen. Doch erlaubt mir die Frage nach Euren Absichten mit mir: So Mutal gefallen ist und die Götterboten besiegt sind, wenn Euer Friede einkehrt im Land der Maya, darf ich dann einst nach Hause zurückkehren und ein anderer meinen Platz übernehmen? Ich bin nicht mehr der Jüngste, mein König.«
Metzli sah Inocoyotl forschend an, dann nickte er.
»Du willst das enge, stickige Teotihuacán gegen die luftige Weite eines königlichen Palasts eintauschen? Das Gekeife deines alten Weibes und die Forderungen deiner faulen Nachkommen gegen die Unterwürfigkeit junger Mädchen und die Ergebenheit treuer Untertanen? Die Ordnung deines bescheidenen Hauses gegen den Aufbau und die Regierung einer großen Stadt?«
Inocoyotl zögerte einen Moment. Metzli verbarg ein Lächeln. Er kannte die Antwort natürlich. So war das mit alten Männern. Die Veränderung lag ihnen einfach nicht mehr im Blut und viele verließ der Ehrgeiz.
»Herr, es ist meine Heimat und dies ist die Fremde. Ich folge Eurem Befehl, egal wohin Ihr mich schickt, aber wenn ich mir wirklich eine Gunst in Euren Augen verdient habe, dann lasst mein Exil nicht ewig währen.«
»Es ist kein Exil. B’aakal ist mein. Es ist deine Heimat.«
»Herr, natürlich, entschuldigt bitte. Ich …«
Metzli hob eine Hand, Inocoyotl verstummte sogleich. Der Gebieter lächelte immer noch, war nicht erzürnt und das war für Inocoyotl wohl eine Erleichterung. Die Zwölf lauschten dem Gespräch mit gelassenem Interesse. Sie würden auf einen Fingerzeig ihres Herrn den alten Mann vor ihnen töten und weiterspazieren, als wäre nichts geschehen.
»Es sei dir versprochen«, sagte der König und nickte Inocoyotl zu. »Wenn alles getan ist, entbinde ich dich von dieser Aufgabe und du sollst in die Heimat zurückdürfen. Für dein Auskommen sei dann gesorgt bis zum Ende deiner Tage und ich will dich nicht mit weiteren Aufgaben behelligen. Es ist dein Wunsch und du bist nicht ich. Diene mir gut in B’aakal und ich werde dich nicht länger hier verpflichten, als es unbedingt notwendig ist.«
Er sah den Mann forschend an. »Ist es das, was du zu hören erhofft hast?«
Inocoyotl verbeugte sich. »Ich bin dankbar für Eure große Gnade!«
So trennten sie sich.
Metzli wanderte weiter, sah sich nicht einmal mehr um nach seinem frischgebackenen Statthalter. Er wunderte sich nicht über ihn, nicht wirklich. Es gab solche und solche Menschen, und wer letztlich klein dachte, der lebte auch klein, selbst wenn ihm die Chance der Größe geboten wurde.
Metzli würde diesen Pfad sicher nicht beschreiten.
2
Sie standen einander gegenüber, der weiße Sand knirschte unter ihren Sandalen und Stiefeln. Die Gruppe der Römer war genauso groß wie die der Japaner, aber obgleich es in beiden Fällen die exakt gleiche Anzahl an Männern war, gab es ein vielfaches Ungleichgewicht.
Die Römer wurden angeführt von einem Navarchen, nach Okadas Verständnis so etwas wie ein Geschwaderkommodore, ein hoher Offizier, weit über seinem eigenen Dienstrang. Die Römer trugen keine Waffen, aber hier, an der Wasseroberfläche, an Land, waren sie ihm und seinen Männern überlegen. Die Schiffe der römischen Expedition dümpelten in der Brandung und der Turm des U-Bootes ragte unweit davon aus dem Wasser. Die gegenseitige Bedrohung an Land wurde durch die Waffen auf See ausbalanciert, dort hatte das Boot den Vorteil. Mit genug Torpedos an Bord, alle Schiffe der Römer zu vernichten, ohne selbst in ernsthafte Gefahr zu geraten, konnte es umfassende Vernichtung androhen.
Jeder hier wusste das. Alle waren sie sehr höflich zueinander. Es sollte nicht so weit kommen.
Okada hatte einen Rückzieher gemacht und jetzt würde sich erweisen, ob das ein Fehler war. Im Grunde hatte er seine Trumpfkarte nicht aus der Hand gegeben und das allein hatte ihm geholfen, die Entscheidung zu treffen, ein Gespräch zuzulassen. Wenn es sich als wahr herausstellte, dass Prinz Isamu – und dessen Lehrer – sich an Bord eines der römischen Schiffe befand, wäre ein Angriff absolut unverantwortlich gewesen. Vielleicht nicht aus Sicht von Kapitän Inugami, aber in diesem Fall wusste Okada, dass die Loyalität zum Kaiserhaus jeden Gehorsam gegenüber seinem Kommandanten überschattete. Es gab wenige Gründe, für die ein Mann wie Okada, trainiert in Selbstaufopferung und Disziplin, einen Befehl verweigern würde. Auf den Prinzen zu schießen, sein Leben aktiv zu gefährden, gehörte definitiv dazu.
Und so stand er hier. Er hoffte, er würde trotzdem seiner Würde als vorübergehender Kommandant des Bootes gerecht werden. Es war nicht leicht für ihn. Er war kein Offizier, ihm fehlte die Art zu denken, die Männer wie Inugami auszeichnete. Zumindest nahm er das an.
Die beiden Delegationen, jeweils fünf Mann stark, waren ans Ufer gerudert und standen sich im Abstand von gut zehn Metern gegenüber. Ein einsames Ruderboot kam auf den Strand zu, darin ein kräftiger Mann, der sich ordentlich in die Riemen legte, sowie zwei weitere Gestalten, ein alter Mann und ein Junge. Okada beschattete sein Gesicht. Er wollte nicht zu voreilig sein, aber selbst auf diese Entfernung hatte er schnell den Eindruck, nicht betrogen worden zu sein. Es war Isamu und Sawada erkannte er auch.
Es erleichterte ihn. Er hatte richtig gehandelt.
Als das Boot an Land ging und die beiden Japaner den Boden betraten, gingen sie schnurstracks auf Okada zu, ohne dass sich einer der Römer zu ihnen gesellte. Ein Vertrauensbeweis der Fremden, wie der Unteroffizier eingestehen musste.
»Meister Sawada«, sagte er mit belegter Stimme, ehe er sich vor Isamu tief verbeugte. Die Scheu, die sich auf seine Stimmbänder zu legen schien, war nur schwer abzulegen. Isamu sah ihn mit einem freundlichen Lächeln an, was ihm ein wenig von der Verlegenheit nahm.
»Okada, nicht wahr?«, sagte er leise.
»Hoheit, ich …«
Der junge Mann hob eine Hand. Okada war ihm oft begegnet und er vermeinte, eine veränderte Qualität an ihm wahrzunehmen. Als wäre er gewachsen. Erwachsen. Der Eindruck konnte natürlich täuschen. Es war einiges an Zeit vergangen.
»Nein, es ist gut. Ich bin von den Römern gut behandelt worden. Sie haben mir geholfen, Meister Sawada aus der Gefangenschaft feindseliger Maya zu befreien. Es geht uns beiden gut. Kein Grund zur Besorgnis.«
»Das ist beruhigend«, sagte Okada, der ein wenig auf der Suche nach Worten war.
Sawada trat vor. »Sie haben das Boot zu Wasser gebracht«, stellte der alte Mann fest. »Eine beachtliche Leistung. Sie führen das Kommando?«
»Vorübergehend. Kapitän Inugami hat mir den Auftrag gegeben …« Okada zögerte. Verstanden die Römer Japanisch? Unwahrscheinlich.
»Welche Befehle haben Sie?«
Der Unteroffizier zögerte weiter, doch Isamu sah ihn gleichfalls auffordernd an und es bedurfte auch keiner allzu großen Fantasie, um zu ermessen, warum er an den Küsten unterwegs war. Trotzdem, Okada senkte seine Stimme ein wenig, als er antwortete.
»Der Kapitän befahl mir, ein Schiff der Römer aufzubringen und möglichst viel von ihrer Technologie und Ausrüstung zu erbeuten und nach Mutal zu bringen. Wir haben an der Stelle, wo das Boot ins Meer trat, einen kleinen Außenposten eingerichtet. Dort soll ich mich wieder melden.«
Sawada war nicht so dumm nachzufragen, warum Inugami das Material der Römer wollte, es lag für ihn wie auch für Isamu sicher klar auf der Hand. Weitere moderne Waffen, nicht auf dem Stand der Japaner, aber vor allem viel mehr und mit ausreichend Munition versorgt, dazu die Kanonen, mit denen man Städte verteidigen und angreifen konnte. Es war bezeichnend, dass Inugami nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet hatte, mit den Römern friedlich zu reden. Er hatte sogleich den Angriff befohlen.
»Wir sollten über eine flexible Auslegung dieser Befehle sprechen«, sagte Sawada. »Ich denke nicht, dass es sehr sinnvoll sein dürfte, die Römer jetzt anzugreifen, auch wenn wir es könnten.«
»Ich muss niemanden angreifen. Wenn man mir ein Schiff voller Ausrüstung übergibt, kann der Rest friedlich von dannen ziehen. Ich habe dann erreicht, was ich wollte.«
Okada hatte sich das genau überlegt. Es widerstrebte ihm, jetzt noch ein Gemetzel zu veranstalten. Es fühlte sich ehrlos an, vor allem nun, da klar war, dass die Römer den Prinzen gerettet hatten. Er glaubte nicht, dass dieser ihn diesbezüglich anlog.
Sawada nickte. »Ich verstehe Sie. Mein Vorschlag ist der: Ich bewege die Römer, mit uns zum Außenposten zu segeln. Dort nehmen wir Kontakt mit Inugami auf. Wir sagen ihm, dass Navarch Langenhagen eine Unterredung wünscht. Das ist für alle Beteiligten am besten. Sollten sich die Römer uneinsichtig zeigen, können wir sie immer noch angreifen.«
»Sie wollen Euch und die Hoheit als Geiseln behalten?«, fragte Okada und es war eine naheliegende Frage. In der Tat hatte Langenhagen exakt das in Aussicht gestellt, mit einem entschuldigenden Lächeln, das die Härte hinter seinen Worten nur teilweise kaschiert hatte. Sawada nahm es ihm nicht übel. Wenn es dazu diente, unnötige Feindseligkeiten zu vermeiden, wollte er diese Funktion auf sich nehmen. Er wusste, dass der wahre Faustpfand Isamu war. Inugami würde nicht einfach befehlen können, auf den Prinzen zu schießen oder sein Leben anderweitig zu gefährden. Seine Männer würden rebellieren. Okadas Zwiespalt machte dies sehr deutlich. Er hatte nicht gefeuert, er hatte dem Treffen zugestimmt.
»Damit müssen Sie rechnen«, erwiderte er also die Frage wahrheitsgemäß.
»Dann bin ich gezwungen, auf den Vorschlag einzugehen«, sagte Okada und er verbarg seine Erleichterung nicht. »Das Boot wird führen und die römischen Schiffe werden folgen. Es ist nicht weit, etwa drei Tage von hier bei langsamer Fahrt. Das schaffen die Dampfmaschinen?«
»Das schaffen sie, und wenn der Wind günstig steht, sogar mehr«, erwiderte Isamu, der sich ganz sicher mit großer Faszination und intensiv mit den Anlagen seiner Retter befasst hatte. Okada hätte es jedenfalls in seiner Lage getan.
»Dann brechen wir in einer Stunde auf, wenn der Navarch einverstanden ist.«
Sawada stimmte zu. Er wirkte zufrieden, hatte wohl das erreicht, was die Römer vorher mit ihm besprochen hatten, daher würde es keine weiteren Einwände geben. Er und Isamu wandten sich ab und stapften auf die wartende Gruppe der römischen Soldaten zu, während Okada mit den Seinen in das Ruderboot stieg, das sie zum U-Boot zurückbringen würde.
Langenhagen sah den alten Lehrer auffordernd an. »Und? Was hat er gesagt?«
Sawada lächelte beruhigend. Die Anspannung des Offiziers war mit Händen greifbar.
»Er ist einverstanden. Sie haben offenbar einen Außenposten an der Küste errichtet, drei Tage von hier. Dorthin führt uns die Reise.«
»Sehr gut. Sie kommen wieder mit uns – es tut mir leid …«
Langenhagen sah in der Tat so aus, als würde er aufrichtiges Bedauern empfinden – dabei tat er nur seine Pflicht, beschützte seine Schiffe. Es würde noch eine Weile dauern, bis er derlei verstand, dessen war sich Sawada sicher.
Der Lehrer hob eine Hand. »Wir haben das diskutiert, denke ich. Es ist notwendig und sichert den Waffenstillstand. Ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie leichtfertig den größten Trumpf aus der Hand geben. Sie behandeln uns anständig. Und ich glaube nicht einen Moment daran, dass Sie uns einfach umbringen würden, um eine Botschaft zu vermitteln. Sie sind nicht Inugami.«
Langenhagen hob die Augenbrauen. »Er würde das tun?«
Der alte Mann seufzte. »Er würde noch ganz andere Dinge tun.«
Langenhagen nickte und machte eine einladende Bewegung zum Ruderboot. Sie stapften über den Sand und Sawada sah, dass die Japaner schon fast am U-Boot angekommen waren. Das da drüben war ein Stück echter Heimat, japanischer Boden, aus Metall zwar, aber alles, was sie aus der Zukunft hatten mitbringen können.
Würde er jemals wieder einen anderen Flecken, ob nun aus Metall, Holz oder Erde, in gleicher Weise seine Heimat nennen können?
Er wischte den Gedanken fort. Er löste ein jedes Mal eine tiefe Melancholie in ihm aus, spätestens seit ihm der Prinz verdeutlicht hatte, nach Rom reisen und die Gestrandeten verlassen zu wollen. Eine Entwurzelung hatte er bereits hinter sich und es hatte gedauert, sich an die Umstände in Mutal einigermaßen zu gewöhnen. Geholfen hatte die Gemeinschaft der Leidensgenossen, trotz aller sich ausbildenden Differenzen. Würde er allein unter Gaijin in Rom nicht untergehen wie eine verdorrende Pflanze? Sawada war sich nicht sicher. Er war jung, der Prinz, und junge Menschen waren anpassungsfähig und schlugen, um im Bild zu bleiben, neue Wurzeln. Er wollte glauben, dass es sich bei Isamu genauso verhalten würde.
Sie machten sich auf den Weg zur Gratian. Bevor Sawada in die Verlegenheit kam, sich über diese Perspektive seines eigenen Lebens ernsthaft Gedanken machen zu müssen, würden noch viele andere Dinge geschehen müssen. Und an Isamus Aufbruch nach Rom war in absehbarer Zeit ohnehin nicht zu denken.
Sawada gemahnte sich, Ruhe zu bewahren. Er war sich sicher, dass er diese Haltung noch dringend gebrauchen würde.
3
»Wie weit sind wir?«
»Weit. Wie weit ist Metzli?«
»Weit genug.«
Lengsley und Sarukazaki starrten Aritomo an, als hätten sie eine andere Antwort erwartet, eine, die ihnen entgegenkam, eine, die etwas mehr Hoffnung bot, eine Alternative. Aber die Lage war, wie sie war, und es war alles entsetzlich.
Zumindest kam es ihnen so vor.
Aritomo hatte nicht erwartet, dass der Tod Inugamis ihn so treffen würde. Er fühlte sich aus dem Gleichgewicht gebracht, in Schwankungen versetzt. Er hatte sich über Inugami geärgert, ihm zunehmend misstraut, seine Politik kritisiert – und dabei nicht gemerkt, wie dieses ständige geistige Abarbeiten an dem Kapitän ihm eine Stütze geworden war, ein Antipode, der durch seine Gegensätzlichkeit das Selbstbild Aritomos sicherte und stärkte. Inugami hatte dann entschieden, und das mit einer Selbstsicherheit, die sich letztlich als irrig herausgestellt hatte.
Aber er hatte entschieden und sie hatten gehorcht, alle.
Nun war es, als habe jemand einen Pfeiler weggenommen, gegen den er sich gelehnt hatte, und es war schwierig, ein neues Gleichgewicht zu erlangen. Dazu kam, dass die Berichte der Flüchtlinge aus B’aakal eine weitere, erschreckende Neuigkeit erbracht hatten: Metzli hatte seine Untat mit modernsten Feuerwaffen durchgeführt, Gewehren, die denen der Japaner erkennbar überlegen waren und die mit großer Sicherheit und Professionalität eingesetzt worden waren. Die Japaner, die Römer … und jetzt der König von Teotihuacán. Wie viele Zeitreisende mochte es noch auf die Erde verschlagen haben, gelenkt durch ein unerklärliches Naturphänomen oder die Absicht mächtigster Kräfte, die Pläne verfolgten, die niemand zu verstehen in der Lage war?
Wem würden sie noch begegnen, ehe dies alles ein Ende fand?
Die Frage danach, wie weit sie waren, hatte sich auf die Vorbereitungen bezogen, Mutal zu verlassen. Aritomo hatte mit den Ältesten der Stadt besprochen, was passieren würde, wenn sie blieben und ohne umfassende Informationen über den Feind nur aus Sturheit die Stadt verteidigen und damit ein großes Risiko eingehen würden. Er hatte ihnen geraten, sich Metzli zu unterwerfen und seine Befehle auszuführen. Er würde mit den Janitscharen Inugamis, die laut Rache für den Tod ihres Herrn geschworen hatten, einen strategischen Rückzug antreten, in der Hoffnung, sich entweder mit den Römern verbünden zu können oder einen anderen Vorteil zu erlangen. Eine Verteidigungsposition in den Bergen etwa oder noch besser: eine auf einer Insel wie Cozumel. Auch hier wäre die Hilfe der Römer und ihrer großen Schiffe sehr willkommen. In jedem Fall war dies ein sicherer Weg, die eigenen Kräfte zu schonen und eine Position der Stärke zu suchen, von der aus sie planen konnten, ohne in Gefahr zu geraten, blind in eine Katastrophe zu rennen.
Alles gute Argumente.
Logisch, zwingend, vernünftig.
Es würde die Leben vieler Maya retten, ganz ohne Zweifel.
Aber es fühlte sich einfach falsch an und Aritomo fand es schwer, mit diesem Gefühl richtig umzugehen.
Und er war damit nicht der Einzige. Für Une war es sehr schwer, dem Aufbruch zuzustimmen. Doch als Schwester des ebenfalls toten Chitam stand sie ohne Zweifel auch auf der Todesliste Metzlis. Wer sonst noch auf dieser zu finden war, darüber konnten sie nur spekulieren. Aber neben den Janitscharen hatten noch einige weitere hohe Adlige beschlossen, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Andere wollten bleiben. Aritomo zwang niemandem zum einen oder zum anderen.
»Wir werden das Geschütz morgen abmontiert haben. Runter ist genauso schwierig wie nach oben. Es ist aber nicht die Arbeit daran, die hier eine Rolle spielt. Es ist eher das … Gefühl. Für die Maya ist es schwer«, sagte Sarukazaki. »Das Geschütz war das Symbol des Schutzes durch die Götterboten. Dadurch, dass wir es nehmen und damit wegrennen – na ja, es löst gewisse Zweifel aus.«
Er lächelte entschuldigend, als wisse er nicht, dass er in diesem Kreis jederzeit offen sprechen durfte. Vielleicht gehörte er selbst zu jenen, die diese Zweifel hegten.
»Das geht nicht nur ihnen so«, erwiderte Aritomo. Es war durchaus nicht erstaunlich, welches Einfühlungsvermögen der Mechaniker entwickelt hatte. Kaum jemand arbeitete so eng mit Mayahandwerkern zusammen wie er oder Lengsley. Dass beide ein besonderes Gespür für die Stimmungen in der Bevölkerung entwickelt hatten, war zu erwarten gewesen.
»Wir können es nicht ändern«, fügte er dann hinzu und die Bitterkeit in seiner Stimme war wirklich für niemanden zu überhören. »Treiben wir die Arbeiten voran und lassen wir uns nicht ablenken. Die Späher sind unterwegs?«
»Weiträumig im gesamten Gebiet zwischen Mutal und B’aakal. Wir werden Vorwarnung bekommen. Nicht endlos viel, aber wir werden nicht mit heruntergelassenen Hosen überrascht«, sagte Lengsley. »Unser Ziel bleibt der Außenposten?«
Aritomo nickte, wenngleich ohne sonderlichen Nachdruck. Seine Entscheidung war durchaus logisch, aber sie basierte zu viel auf Hoffnungen und Annahmen. Inugami hatte sich nicht viel mit Hoffnungen aufgehalten, er hatte Pläne gemacht. Richtige, handfeste, manchmal höchst fragwürdige Pläne. Doch er hatte immer gewusst, was der nächste Schritt sein würde. Aritomo aber hatte das Gefühl, im Nebel zu stochern.
»Wir ziehen uns in Richtung Küste zurück«, bekräftigte er nun, und wenn nur, um sich selbst zu überzeugen. »Hoffentlich ist Okada nicht frühzeitig in die Römer gerannt und hat eine zweite Front eröffnet. Das können wir derzeit gar nicht gebrauchen.« Das Boot war ihre Hoffnung, mithilfe der Römer die See zu beherrschen und die Insel Cozumel als Rückzugsgebiet zu nutzen. Aritomo war sich nicht sicher, ob die Bewohner des Eilands damit einverstanden sein würden, aber er war relativ entschlossen, sie nicht allzu lange um ihre Erlaubnis zu fragen. Er wollte nicht wie Inugami klingen, wie er denken oder wie er werden, aber das Überleben der ihm Anvertrauten stand jetzt an oberster Stelle und der Tod Inugamis, der große Verrat Metzlis, hatte seine Gedanken fokussiert und ihn mit neuer, kalter Entschlossenheit erfüllt. Wie lange dieses Gefühl anhalten würde, konnte er nicht absehen.
Machte das die Macht aus einem Menschen? War Inugami gar nicht schuld an dem gewesen, was aus ihm geworden war? Musste Aritomo Angst um sich selbst haben?
Er hatte Angst um sich selbst und um seine Leute. Das trieb ihn an, nichts weiter. Es war beruhigend, dass er sich das bis auf Weiteres einreden konnte, ohne damit nagende Zweifel in sich zu wecken. Vor dem Zeitpunkt, da dies nicht mehr möglich sein würde, empfand er noch mehr Furcht.
»Wir treffen uns am Abend«, erklärte Aritomo. »Das Ziel bleibt, spätestens übermorgen alles für den Aufbruch bereit zu haben. Ich möchte, dass weiter hart gearbeitet wird. Ich habe ein erneutes Treffen mit dem Rat und es wird wieder schwierig, den Leuten zu erklären, was auf sie zukommt und warum wir sie im Stich lassen.«
Das war es, der Grund für seine Unruhe, seine negativen Gefühle. Er ließ Mutal im Stich. Wie rational seine Entscheidung auch zustande gekommen sein mochte, wie vernünftig sie in strategischer Hinsicht auch war, wie sehr sie menschliches Leid und unnötige Opfer vermeiden helfen würde, sie fühlte sich vor allem deswegen falsch an, weil Mutal zu seiner neuen Heimat geworden war. Er hatte hier Leid und Freude erlebt, sich an die Menschen gewöhnt, ihr Essen, ihre Gesänge, ihre Sprache, ihre kleinen Eigenheiten, und viele hatte er als anständige und ehrliche Personen kennengelernt, manchmal als tragische, oft als bewundernswürdige Gestalten. All dies sang- und klanglos hinter sich zu lassen und dem heranrückenden Feind zu weichen, fühlte sich einfach grundfalsch an. Das Gefühl, Mutal zu verraten und zu enttäuschen, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, ein Versprechen zu brechen – das war durch die Gegenargumente nicht zu bekämpfen, nicht wegzurationalisieren. Es war da und blieb wie ein lungernder Schatten, jeden Moment bereit, seine schwarzen Klauen nach Aritomos Herz auszustrecken.
Die Besprechung fand ein Ende, die Runde löste sich auf. Für einige Minuten wollte sich Aritomo Ruhe gönnen, nicht zu viel, denn die Muße führte meist zu Grübeleien und die konnten selbstzerstörerisch werden.
Als er ins Freie trat und hinaufschaute zur Geschützplattform, an der Sarukazakis Leute arbeiteten, fühlte er das Symbolhafte dieser Handlung auch und verstand, was der Mechaniker meinte. Es gab viele Zuschauer und die Gesichter sprachen Bände, zeigten Angst und Unverständnis. In manchen standen Vorwurf und Anklage, exakt das, was der neue Kapitän sich selbst mehr als einmal vorhielt.
Er ballte die Fäuste.
Aritomo fühlte in sich das Bedürfnis aufsteigen, jeden Einzelnen an den Schultern zu fassen und zu rütteln, ihm seine Entschuldigungen und Erklärungen ins Gesicht zu schreien, doch er wusste, dass dies wenig bringen würde. Er hatte sich bereits den Mund fusselig geredet und musste feststellen, dass er nicht über halb das rhetorische Talent Inugamis verfügte. Er konnte sich verständlich machen, aber die Herzen der Menschen erreichte er mit seinen Worten nicht und das erwies sich jetzt als besonders fatal.
Aritomo Hara mochte ein guter Offizier sein; seine Karriere hatte zu früh geendet, als dass er viel Gelegenheit gehabt hätte, es herauszufinden. Aber er war kein guter König, kein Präsident, kein Volksheld. Das, was der Tod Inugamis in seinen Schoß gelegt hatte, war schlicht und einfach zu groß für ihn.
4
Worte – er verstand sie nicht, aber er hörte sie. Erst nur Geräusche, dumpf. Dann artikuliert. Unverständlich, aber artikuliert. Silben, Vokale, Konsonanten. Tonfall. Lautstärke. Worte.
Nach einer langen Zeit, in der er nur Schatten gewahr worden war, dem Schmerz, der in seinem Körper wühlte, und Lichtern, die vor seinen Augen tanzten, unterbrochen von endlosem Schlaf, einer tiefen Bewusstlosigkeit, die immer und immer wieder seine Erinnerungen auszulöschen drohte … nun Worte.
Nicht mehr nur Laute, die wie durch dicke Tücher an seine Ohren drangen, ohne einen Sinn zu ergeben, nur als Erinnerung, am Leben zu sein. Worte. Es war nicht seine Sprache. Er lauschte dennoch mit Interesse. Da waren Gefühle, die ausgedrückt wurden. Interesse. Sorge. Unterwürfigkeit. Ungeduld. Nicht immer beruhigend oder angenehm, aber interessant, abwechslungsreich, eine Verbindung in die Realität.
Das war ein Fortschritt.
Es war ein Erwachen, ein Auftauchen aus einem tiefen See des Schmerzes, des Unbehagens, von Hitze und Kälte, die sich in seinem Körper einen Widerstreit zu liefern schienen. Er wurde sich seiner eigenen Existenz mit klarer Deutlichkeit bewusst, wo vorher Schatten auf allem gelegen hatten. Ein Erwachen aus der Dämmerung.
Konnte er es wagen, den nächsten Schritt zu gehen?
Er hatte ein wenig Angst. Das war in Ordnung. Angst war ein Gefühl, das sich von dem unterschied, was er vorher empfunden hatte. Sie vertrieb die Gleichgültigkeit, setzte dem Schmerz eine neue Perspektive entgegen.
Er öffnete die Augen, die völlig verklebt waren, widerwillig, mühselig seinem Willen folgten. Dann wurde es abrupt wieder dunkel, doch die einsetzende Angst und Enttäuschung wurde sofort beruhigt, als er spürte, wie jemand sanft mit einem feuchten Tuch über seine Lider strich, was ein angenehmes Brennen hinterließ, ein Gefühl der Reinigung und sich so wahrhaft und klar auf seiner prickelnden Haut verbreitete, dass er nun wahrlich wach war.
Er war da. Wieder da.
Er fühlte, er atmete, er nahm den Schmerz klar wahr, nicht als etwas, das sein Bewusstsein mit Trägheit und Abwehr erfüllte, sondern deutlich situiert, in seinem Leib, an bestimmten Stellen, bei bestimmten Bewegungen, klar abgegrenzt, verstehbar, Teil von ihm und doch distinkt.
Das war gut. Es war besser als vorher.
Er öffnete die Augen ein zweites Mal, mit mehr Vertrauen, blinzelte die klamme Feuchtigkeit der Reinigung weg. Es ging jetzt besser als vorher. Das Halbdunkel des Raumes war ihm angenehm. Die schlanke Hand mit dem feuchten Tuch, die nun sein Gesicht abzutupfen begann, war gut zu erkennen. Eine Frau, schoss es ihm durch den Kopf und er genoss die Berührung, die ihm nichts Böses wollte, die aufmerksam war, fürsorglich, warm und weich, eine Gnade des Schicksals.
Plötzliche Dankbarkeit vermischte sich mit plötzlicher Angst.
Wo war er?
Das konnte man herausfinden.
Wer war er?
Das war schon schwieriger. Da war Leere in seinem Kopf, eine Lücke, nein, ein Abgrund. Er entsann sich vager Bilder, von Kampf und Leid. Des Gefühls, dem sicheren Tod in die Augen gestarrt zu haben, und eines Versinkens in der Gewissheit, das Ende wäre nah. Sehr nah. Es war so gewesen, die Sicherheit empfand er mit der gleichen Klarheit, wie er sich nun seiner eigenen Existenz, seiner Lebendigkeit wieder bewusst wurde.
Doch wer war er?
Und warum wusste er das nicht mehr?
Was genau war geschehen?
Und was geschah nun, da er wieder wusste, dass er existierte?
Die schlanke Hand war von all diesen Gedanken unbeeindruckt. Sie verschwand kurz und er hörte das Geräusch von Eintauchen in Wasser, dem Auswringen, dem Aufsaugen frischer Flüssigkeit, dann spürte er die Tropfen auf seiner Haut, winzige, kleine, kühlende Explosionen, ein wunderbares Gefühl, von dem er sich wünschte, es würde niemals enden.
Und wieder das Tuch. Stirn. Schläfen. Wangen. Hals. Brustkorb, da ganz langsam, je näher die Orte des Schmerzes lagen. Die Arme, oberhalb des Ellenbogens, darunter, die Oberschenkel, die Knie. Seine Genitalien, sanft und achtsam, ohne eine Reaktion herauszufordern.
Wieder das Tuch über dem Wasser. Eintauchen, auswringen. Eine langsame, methodische Arbeit, sorgfältig und mit Fürsorge. Beruhigend. Er hatte jetzt keine Angst.
Er neigte seinen Kopf zur Seite, sah eine junge Frau, die seinen Blick erwiderte, ein Lächeln andeutete, sich aber durch nichts von ihrer Tätigkeit abbringen ließ. Das war in seinem Sinn. Es war das Angenehmste, Schönste und Wunderbarste, was er je in seinem Leben genossen hatte, obgleich er sich an kein Detail dieses Lebens erinnern konnte.
Er war sich trotzdem absolut sicher. Niemals zuvor hatte er Fürsorge so benötigt.
Sie sagte etwas.
Er verstand es nicht. Ihre Stimme war sanft, wie eine Melodie. Er lauschte ihrem Klang, fand darin Trost und Wärme. Es war egal, was genau sie ausdrückte. Sie hatte schon alles gesagt.
Sie reichte ihm eine Schale, darin war Trinkwasser. Seinen Kopf stützte sie, damit er trinken konnte. Das kühle Nass war belebend. Er schluckte langsam und spürte, wie sich die Flüssigkeit seinen Hals hinunter in den Körper bewegte, konnte die Ausbreitung genau nachvollziehen. Er schloss die Augen, genoss den Augenblick. Hustete kurz. Kein Nachlassen. Wieder die Stimme, auffordernd, ein erneutes Trinken, bis die Schale leer war.
Der Kopf fiel zurück. Der Vorgang war anstrengend gewesen. Er war so kraftlos.
Ein neues Geräusch, ein Schatten. Ein Mann war eingetreten, breitschultrig, mit ernstem Gesichtsausdruck. Sein Auftreten war herrisch, die Stimme befehlsgewohnt, so viel stand fest. Eine Aura von Autorität umgab das breite, knochige Gesicht. Seine dunklen Augen sahen ihn an, kalt, ohne jede Anteilnahme, ohne Freude über die Genesung, wie ein Ding. Er redete mit der Frau und deren Haltung hatte sich unvermittelt geändert. Sie schien in der Gegenwart des Neuankömmlings kleiner zu werden, zu schrumpfen zu einem fahlen, niedrigen und unterworfenen Abbild ihrer selbst. Sie antwortete leise, hielt den Kopf gesenkt. Ihre Worte schienen den Besucher zufriedenzustellen, denn er wurde weder laut noch herrisch.
Er trat näher an die Liegestatt, sah auf den Erwachten hinunter, forschend, sezierend und abschätzend. Er sagte etwas, diesmal langsam, sorgfältig artikuliert. Und der Erwachte verstand, was gesprochen wurde, eine plötzliche, in dieser Situation unerwartete Erkenntnis. Da war mehr in seinem Kopf, als er wusste, und es bedurfte der richtigen Anreize, um es zu wecken.
»Du bist bereit!«, sagte die Stimme des Mannes und es war definitiv keine Frage, sondern eine Feststellung.
Der Erwachte widersprach nicht. Er fühlte sich nicht bereit, zu gar nichts. Aber er spürte instinktiv, dass Widerspruch nicht nur sinnlos, sondern geradezu gefährlich war. Er schwieg, begegnete den Blick, bis der Mann mit dem knochigen Gesicht sich abwandte und ohne weitere Worte ging.
Dieser Abgang löste in ihm ein Gefühl der Erleichterung aus. Der Mann war eine Bedrohung. Kein Freund. Kein Helfer. Das spürte er sehr deutlich.
Das Geräusch des Tuchs im Wasser. Eintauchen, auswringen. Die kühlende Berührung auf seiner Stirn. Er blickte zur Seite, in das Gesicht der jungen Frau, die ihm wieder ihre ganze Aufmerksamkeit und Anteilnahme schenkte. Doch da war jetzt stumme Sorge in ihrem Blick, wie über ein Kind, das sich in Gefahr begeben würde, ohne dass die Mutter daran etwas ändern konnte.
Es machte ihn traurig, sie so zu sehen. Er wollte sie trösten, doch ihre Bewegungen trösteten ihn.
Ein Tag verging.
Erstmals bekam er den Wechsel von Tag und Nacht mit, kehrte sein Leben zu einem Rhythmus zurück. Er aß und trank und schlief, begann, sich zu bewegen, ganz behutsam auch aufzurichten. Jede Bewegung schmerzte, doch der Schmerz erinnerte ihn daran, dass er lebte, und nicht, dass der Tod bevorstand. Die junge Frau wechselte die Verbände, die um seinen Oberkörper geschlungen waren, und er blickte auf die frischen Narben, die seine Haut in eine zerklüftete Landschaft verwandelten. Der erste Anblick war ein Schock für ihn. Wenn diese Narben keiner Halluzination entsprangen, ja dann waren sie Zeugnis tiefer, lebensgefährlicher Verwundungen und die Tatsache, dass er noch am Leben war, grenzte an ein Wunder.
Ein zweiter Tag verging. Langsam wurde es besser. Der dritte Tag kam und er konnte aufstehen, auf seine beiden Beine, etwas wackelig, aber ohne fremde Hilfe, einige Schritte gehen, alles unter dem wachsamen Blick der jungen Frau, die ihm nicht von der Seite wich. Er aß kräftig, trank viel, spürte, wie die Kraft in seinen Körper zurückkehrte, erfreute sich an der stetig wachsenden Körperbeherrschung, am Spiel seiner Muskeln. Er begann, sich an den Anblick seiner Narben zu gewöhnen, als erneut sein Verband gewechselt wurde, und spürte die angenehme Wärme, als die Frau einen Brei aus Kräutern auf seine Narben aufzutragen begann, der, so vermutete er, den Heilungsprozess förderte und, das zumindest konnte er bestätigen, den Schmerz linderte.
Am vierten Tag kehrte der Mann zurück, sah ihn kalt an und die Frau schrumpfte wieder zusammen, verschmolz mit der Liegestatt, dem Mobiliar, fiel nicht auf und wurde diesmal auch nicht beachtet.
»Komm!«, sagte er nur.
Für Widerworte war kein Platz.
Der Verletzte gehorchte. Er richtete sich unsicher auf, ging und folgte dem Mann ins Freie. Das helle Sonnenlicht blendete ihn, doch der heiße Schein tat ihm auch gut. Es war, als würde das Licht ihm zusätzliche Kraft schenken.
Er sah sich um. Er stand außerhalb eines Gebäudes; dieses war aus Lehm errichtet und bunt bemalt. Um ihn herum herrschte geschäftiges Treiben.
»Komm!«, wurde der Befehl wiederholt. Zwei kräftige Männer gesellten sich zu ihm, ihre Haltung unmissverständlich. Er sah sich nach der jungen Frau um, doch sie war nirgends mehr zu sehen. Er hatte das Gefühl, dass er ihr niemals wieder begegnen würde, und war überrascht, wie tief das Bedauern war, dass dieser Gedanke in ihm auslöste.
Er trug ein einfaches Gewand, nicht mehr als einen Umhang, der ihm um die Schultern lag, und einen gebundenen Lendenschurz. Er lief barfuß und das war schmerzhaft. Auf dem Pflaster der Stadt war es heiß, denn die brennende Sonne erhitzte die Steine extrem. Und die losen Kiesel stachen empfindlich in seine Fußsohlen. Er stolperte ein ums andere Mal, doch niemand machte Anstalten, ihm zu helfen.
Er wollte auch nicht, dass ihm jemand half. Da war jetzt ein wenig Stolz in ihm, zurückgekehrt und gepflegt von der kundigen Hand einer jungen Frau. Er bewahrte ihn sich, wie einen kostbaren Schatz, drückte den Rücken durch, ignorierte die schmerzenden Füße.
Sie führten ihn durch die Stadt und es war ein ordentlicher Fußmarsch, der seine Kräfte stark beanspruchte. Seiner Begleitung war sein Zustand wohl bekannt, denn sie drängten ihn nicht übermäßig, machten eine Pause, gaben ihm zu trinken, warteten geradezu geduldig, damit er Luft holen konnte. Passanten kamen vorbei und musterten ihn nur kurz, aber als sie am Stadtrand angekommen waren, füllten sich die Straßen mit Kriegern. Es waren Hunderte. Alle sahen sie zuversichtlich aus, lächelten den Verletzten an, murmelten Kommentare, die Gelächter auslösten. Er verstand von alledem kein Wort.
Er fand sich an einem Hafen wieder, der eher einem flachen Strand glich, der direkt in die Stadt überging. Erstaunt musterte er das Treiben, als er auf Geheiß seiner Wachen zum Stehen kam. Hunderte von Booten lagen im Wasser, kleine Einbäume für zwei oder drei Passagiere, längere Segelboote für bis zu einem Dutzend oder mehr, und alle füllten sich mit Soldaten. Es herrschte eine beinahe schon festliche Stimmung.
Er war verwirrt. Wenn ihn nicht alles täuschte, dann wurde hier eine Invasion vorbereitet. Das löste in ihm Angst aus und es war nicht die Furcht um sein Leben. Es war, als ob sich eine Information aus dem Nebel des Vergessens nach vorne drängen wollte. Er griff danach, doch die Details entglitten ihm, nur die Furcht wurde immer stärker. Das machte ihn nun wütend. Er war wütend auf seine Unfähigkeit, sich zu erinnern. Ungeduldig. Ungnädig. Er mochte sich nicht in diesem Moment, denn er fühlte sich hilflos.
Dann wurde er an die Schulter gepackt und zu einem der Einbäume geführt. Er watete durch das Wasser, bis er kniehoch darin stand, dann kletterte er auf das schaukelnde Gefährt. Vor ihm und hinter ihm nahmen die Krieger Platz, ergriffen die Ruder, bekamen einen Befehl – der Tonfall war unverkennbar –, senkten die Blätter ins Wasser und machten sich eifrig auf den Weg. Sein Boot war das einzige, das sich bewegte. Alle anderen wurden noch bemannt und jene, die bereits bis zum Maximum ihrer Kapazität voll waren, warteten treibend ab. Der Befehl zum Aufbruch war noch nicht an alle ergangen, schoss es ihm durch den Kopf.
Der Aufbruch. Wohin?
Auch diese Information kratzte an seinem Bewusstsein. Sein Blick wanderte unwillkürlich über die Wasser. Das Licht des frühen Morgens tanzte über die Wellen. Aus dem diesigen Horizont schälte sich eine ferne Landmasse, eine Insel. Ja, sein Gefühl trog ihn nicht. Das musste das Ziel ihrer Reise sein.
Reise.
Er lachte lautlos.
Das war keine Reise. Es war ein Angriff. Und mit diesem Gedanken kehrte die Furcht zurück.
Sie kamen beim größten Segelboot an, eine lange Konstruktion, auf der rund zwanzig Krieger hockten, einer prächtiger herausgeputzt als der andere. Sie sahen dem Erwachten erwartungsvoll entgegen. Ihre Blicke und Gesten waren ebenfalls nicht direkt feindlich, sondern drückten eher Schadenfreude aus.
Schadenfreude?
Niemand sprach mit ihm. Er wurde an Bord bugsiert, sein Einbaum legte sofort wieder ab. Kräftige Fäuste packten ihn und er war viel zu schwach, um sich zu wehren. Mit Entsetzen sah er sich an den Bug geführt, wo eine Art Sitz auf einer winzigen Plattform arretiert worden war. Er musste sich darauf niederlassen, dann wurden seine Arme und Beine gefesselt, ein festes Seil um seine Hüfte geschlungen und mit der kurzen Lehne des Sitzes verknotet. Da diese oben breiter war als unten, konnte er die Fessel nicht einfach durch ein Aufstehen abstreifen. Er fand sich völlig bewegungsunfähig auf dem unbequemen Sitz festgezurrt, vor sich nur das tanzende Meer und hinter sich die Krieger, die sich unterhielten, lachten und wahrscheinlich mit dem Finger auf ihn zeigten.
Jemand reichte von hinten nach ihm und gab ihm Wasser zu trinken, reichlich, bis er den Kopf zur Seite drehte.
Nein, noch sollte er nicht sterben.
Jemand hinter ihm sprach, der höhnische Tonfall war nicht zu überhören, aber er verstand nicht einmal die Hälfte der Worte und reagierte nicht.
Dann wurden Befehle gegeben, laut und vernehmlich. Hektik brach aus. Ruder wurden ins Wasser gesenkt, Bewegung sichtbar und spürbar. Die Boote begannen, langsam über das Wasser zu gleiten. Die See war ruhig, der Wellengang beherrschbar. Ideales Wetter für eine Überfahrt.
Der Bug des Bootes richtete sich auf die Insel.
Was auch immer nun geschehen sollte, es begann.
5
»Vorsichtig!«
Nicte blieb stehen, die nackten Beine zerkratzt, die Haare strähnig. Sie starrte ihre Schwester aus müden, rot umränderten Augen an und ihr Arm zitterte, als sie sich am Baumstamm abstützte. Die Kleidung, die sie zur Feier der Hochzeit ihrer Schwester getragen hatte, lag weitgehend in Fetzen, aufgerissen durch Äste und Dornen, durch mehrmaliges Hinfallen, strapaziert durch Nächte in Baumkronen auf kratzigen und ungemütlichen Zweigen. Dass sie es bisher durchgehalten hatte, und das, ohne andauernd zu klagen, war nicht nur ein Wunder, es war eine grandiose Leistung, die Ixchel sehr viel Stolz für ihre kleine Schwester empfinden ließ.
Sie waren jetzt lange unterwegs, viel zu lange, und die Reise fernab der Straßen, auf denen sie die Häscher Metzlis erwarteten, zog sich mehr hin als erwartet. Ixchel war gut mit dem Atlatl und eine passable Jägerin. Doch Nicte, die am Anfang so stark gewesen war, verlor nun an Kraft und das war nicht allein damit zu erklären, dass sie nicht immer zu essen bekam, wenn sie sich hungrig fühlte.
Es war einfach alles zu viel.
Es war auch für Ixchel zu viel.
Doch wenn Nicte nachts weinte und weinte und ihre Schwester sie nicht zu trösten vermochte, weil kein Wort den Schmerz nehmen konnte, wenn ihr doch selbst danach zumute war, ihre Trauer und Wut klagend hinauszuschreien, wie konnte sie von Nicte dann noch mehr Selbstbeherrschung verlangen? Ixchel war verloren, fühlte sich wie Treibgut in einem reißenden Fluss. Sie spürte, wie wenig erwachsen sie wirklich war, egal was sie für ein Bild ihrer selbst vorgaukelte. Aktul hatte ihr Halt gegeben, der Gedanke an ihren Vater ebenso, doch beide Stützpfeiler waren in einer Orgie der Gewalt eingerissen worden.
Wer war da noch?
Es war doch niemand mehr da.
Ixchel hatte Nicte. Nicte hatte Ixchel. Da war die Verwandtschaft in Mutal und ihre Hoffnung setzte das Mädchen auf Une, die Schwester ihres Vaters. Die hatte sie in guter Erinnerung, und wenn es jemanden gab, der wieder ein wenig Ordnung in ihr Leben bringen konnte, dann war es die selbstbewusste und starke Une. Nach Mutal reisten sie, doch sie waren keine schnellen Soldaten mit kräftigen Beinen. Sie waren Prinzessinnen auf der Flucht vor einem fähigen und erbarmungslosen Gegner. Niemals durften sie in die Hände von Metzlis Männern fallen. Und all die Vorsicht, die Vermeidung des geraden Weges, die Ferne von den gut ausgebauten Straßen, verzögerte ihre Reise mehr und mehr.
Zu sehr.
Es ging so nicht weiter. Zumindest nicht mehr allzu lange.
Es waren die Anstrengungen der Reise, sicher. Es waren aber auch die Belastungen ihrer Seelen, die Bilder vor allem vor Ixchels Augen. Der Tod ihres Vaters. Der Tod Janabs, der sein Leben für sie geopfert hatte, des tragischen Prinzen, von allen verachtet, selbst manchmal von ihr, wie sie sich schmerzhaft eingestehen musste. Der Tod des alten Aktul, der ein sehr großes Loch in ihr Herz gerissen hatte. Ixchel war nicht so leicht aus der Bahn zu werfen, aber die Grenze war erreicht. Sie wollte sich einfach nur irgendwo hinsetzen und es wäre so schön, wenn jemand sie in den Arm nehmen würde und ihr sagte, dass alles gut sei.
Alles ist gut.
Alles ist gut.
Alles ist gut.
Sie flüsterte diese Worte vor sich hin. Vor dem Einschlafen. Wenn sie versuchte, Nicte gleichfalls in den Schlaf zu wiegen. Wenn sie selbst um Ruhe rang, um Erlösung von den bohrenden Grübeleien, vom Hunger, vom Schmerz in ihrem überanstrengten, geschundenen Leib. Sie schlief dennoch nicht gerne. Die Albträume ließen nicht nach, schienen eher immer schlimmer zu werden. Oft sah sie Janab, sein trauriges Gesicht. Es ließ ihr die Brust zerspringen, auch nur an ihn zu denken. Es war alles so ungerecht. Der Sohn des B’alam hätte Besseres verdient gehabt, weitaus Besseres. Ixchel fühlte jetzt Stolz darin, seine Witwe zu sein. Sie würde darauf bestehen, dass alle es wussten und verstanden. Die Zeremonie war abgeschlossen worden und die Trauung vollendet. Ixchel war eine Witwe, eine verdammt junge, und nein, sie hatte ihren Mann niemals zu lieben gelernt. Aber er war ein guter, ein würdiger Gatte gewesen und das war ein Punkt, den sie niemals verheimlichen oder kleinreden würde.
Egal, was andere sagten. Darüber war sie hinweg. Andere. Alle jagten sie nur, alle wollten sie benutzen. Wut und Trauer wechselten sich in ihr ab, wenn sie nur daran dachte.
Nicte setzte sich auf die Wurzel des Baumes, umschlang die herangezogenen Knie mit den dünnen Armen, legte ihren Kopf auf die Knie und murmelte leise: »Ich bin müde.«
Ja, sie war müde. Kein Schlaf konnte diese Müdigkeit bekämpfen. Es war eine bleierne Schwere, die die Götter auf sie gelegt hatten wie einen Fluch, und sie sog die Lebenskraft aus ihren Körpern.
Es war so leicht, dieser Art von Müdigkeit nachzugeben. Doch Ixchel wusste, wohin das führte. Selbstaufgabe bedeutete den Tod und all ihre Anstrengungen würden sich als sinnlos erweisen. Ein verlockender Gedanke, es einfach sein zu lassen.
Doch Ixchel war noch nicht bereit aufzugeben.
Trauer ja, Verzweiflung auch, aber da war auch die stille Glut der Wut und des unstillbaren Gefühls der Rachlust, und so wie Janab und Aktul und Chitam gestorben waren, vor ihren Augen, so sollte Metzli sterben, direkt vor ihr und, bei allen Göttern, durch ihre Hand. Und jeder auf dem Weg dorthin, der sich der Vollendung dieser Rache widersetzte. Ein stiller Schwur, der in ihr brannte wie zu jenem Zeitpunkt, kurz nach der Flucht aus B’aakal, als sie ihn sich geschworen hatte. Eine Glut, die sie am Leben erhielt und ihr die Energie gab, die sie vorantrieb, sie und ihre kleine Schwester.
»Wir ruhen uns aus«, sagte sie und schaute sich um. Dieser Ort war so gut wie jeder andere. Sie holte einige Früchte aus ihrem Beutel, die Reste dessen, was sie vor einiger Zeit gesammelt hatten, und bot Nicte eine an. Das kleine Mädchen nahm sie, hielt sie unschlüssig in der Hand. Sie musste hungrig sein, doch die Kraft zu essen hatte sie verlassen. Ixchel insistierte. Es nützte ihnen beiden nichts, sich jetzt selbst zu besiegen. Sie mussten weitermachen und dazu gehörte, dass sie bei Kräften blieben.
»Iss!«, sagte sie mit Strenge in der Stimme.
Nicte sah auf.
»Du klingst wie Mutter.«
»Das ist gut. Iss! Alles!«
Nicte lächelte schwach und biss in die Frucht. Ihr war die Lustlosigkeit anzusehen, doch sie hatte ein wenig gelernt, was Disziplin bedeutete, und sie tat, wie ihr geheißen war. Die große Schwester war ihre Heldin, der einzige verbliebene Bezugspunkt ihres Lebens. Ixchel achtete darauf, selbst etwas zu sich zu nehmen. Für sie galten die gleichen Regeln, denen sich Nicte zu unterwerfen hatte. Außerdem musste sie ein Vorbild sein, jetzt mehr denn je.
»Mutal ist nicht mehr weit«, sagte sie dann. »Wir sind bald da. Une wird sich um uns kümmern. Das hat sie immer getan. Alles wird gut werden.«
Immer die gleiche Litanei. Glaubte sie selbst noch daran?
»Nein.«
Das eine Wort hatte Nicte mit einer so inneren Überzeugung ausgesprochen, dass Ixchel kalt ums Herz wurde. Sie hatte ihre Frucht gegessen, nahezu methodisch und wischte sich etwas heruntergelaufenen Saft vom Kinn.
»Nein«, sagte sie erneut. »Nichts wird gut.«
Ixchel sah die Kleine hilflos an.
»Nicte … ich weiß, dass …«
»Nein«, wiederholte die Kleine mit ernstem Nachdruck. »Alle sind tot. Und es wird weiter getötet. Viele Menschen sterben. Noch mehr werden sterben. Überall Blut und Leid und keine Gnade. Es wird nicht gut. Es wird immer schlimmer.«
Sie sah Ixchel auffordernd an, als ob sie ihre Schwester herausfordere, Gegenargumente vorzutragen, die aus mehr als verzweifelter Hoffnung entsprangen. Ixchel ertappte sich dabei, wie sie nach Worten suchte und im Dunkeln zu stochern begann. Ihre Schwester hatte recht. Das Morden hatte erst begonnen. B’aakal war nicht der letzte, es war der erste Streich Metzlis gewesen. Er hatte so eine infame Tat nicht begangen, um dann aufzuhören und abzuwarten. Er war wahnsinnig, davon war Ixchel überzeugt, und machtbesessen. Er würde nicht nachlassen, ehe er nicht jeden Feind geschlagen und alle Macht an sich gerissen hatte.
Nicte hatte zu viel mitgemacht, um noch an das Gute, an Erlösung, an Frieden zu glauben. So klein und so hart, so misstrauisch, so traurig. Ixchel spürte, wie das Mitgefühl sie zu überwältigen drohte, gespeist aus Hilflosigkeit. Sie schob die Gefühle mit Macht von sich.
»Es wird vielleicht tatsächlich schlimmer«, sagte sie also, denn sie wollte ihre Schwester nicht belügen. »Aber für uns wird es besser. Une wird sich um uns kümmern.«
»Du kümmerst dich«, sagte Nicte klar und ruhig. »Das reicht. Wir leben.«
»Aktul und Janab haben …«
»Du lebst, ich lebe. Du kümmerst dich. Bald bin ich groß.« Nicte machte eine Pause. »Dann töte ich sie alle.«
Sie lächelte Ixchel an, die ihre kleine Schwester fassungslos anstarrte.
»Hast du noch eine Frucht für mich? Ich habe jetzt doch noch Hunger.«
Ixchel gab ihr, was sie verlangte. Sie sagte nichts mehr, blickte auf den Boden und hörte zu, wie ihre Schwester erneut mit sehr methodischen Bewegungen aufaß.
Ja, natürlich.
Nicte hatte absolut recht.
Genau das würden sie tun.
6
Balkun warf sich auf den Boden und das konnte er gut.
Er hatte es in letzter Zeit nicht mehr allzu oft getan, aber es hatte eine Zeit gegeben, da war es beinahe tägliches Ritual gewesen. Damals, in Yaxchilan, als einfacher Bauer und, wenn es nichts zu ernten oder zu säen gab, als einfacher Krieger, vor seinem Aufstieg vom Sklaven zum Statthalter. Sein alter König, der vor Mutal gestorben war, hatte diese Geste der Unterwerfung oft genug verlangt und niemand hatte sein Recht darauf jemals infrage gestellt.
Es war eine ihm nur allzu vertraute Geste und es half, dass er dem Braten nie richtig getraut hatte. Tief in ihm war der Zweifel stets wach gewesen: Er als kleiner König? Das konnte nicht auf Dauer gut gehen. Das musste ein Ende finden, und ein schlimmes dazu. Also hatte er sich diese Fähigkeit, diese Billigung dessen, sich jederzeit wieder vor einem neuen Herrn zu erniedrigen, bewahrt. Das half ihm jetzt, die Fassung zu wahren.
Dennoch hatte Balkun, als er noch geherrscht hatte, solche Rituale abgeschafft, zumindest in Saclemacal. Das war möglicherweise ein Fehler gewesen, denn man warf ihm daraufhin Schwäche vor, eine Verbrüderung mit dem einfachen Volk, dem Pöbel, dem er doch selbst entstammte. Und Balkun hatte den Kritikern recht gegeben: Ja, es war eine Schwäche, ja, er entstammte dem Pöbel. So war es nun einmal. Sie hatten ihn damit nicht treffen können und so gaben sie es irgendwann auf.
Jetzt aber hatten seine Gegner recht behalten. Pöbel war er, Balkun, und dorthin kehrte er zurück. Es war alles wieder, wie es sein sollte.
Und nun lag er da, die Stirn auf den Boden gepresst, den Staub auf den Lippen. Seine Familie hatte er rechtzeitig fortgeschickt, in Sicherheit, nach Yaxchilan, zurück in die alte Heimat, deren Statthalter von Inugamis Gnaden wahrscheinlich auch sein Haupt beugte, denn exakt das war ihnen allen befohlen worden. Er wähnte sie dort in Sicherheit, seine Frau, seine Kinder, unerkannt unter Verwandten, die ihnen die Solidarität und Hilfe geben würden, die Balkun hier niemals erfahren würde. Er selbst konnte nicht fliehen. Er war zu bekannt. Und es gab zu viele, die eine Rechnung offen hatten.