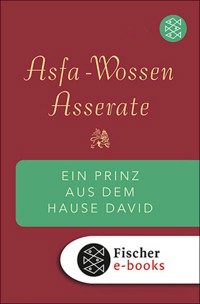
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1974: Sein Vater, Präsident des äthiopischen Kronrats, wird von den Generälen der Revolution erschossen, seine Mutter und seine Geschwister gefangengenommen, das Hab und Gut der Familie beschlagnahmt. Über Nacht wird das Gastland Deutschland, in dem er studiert, zum Ort des Exils. Seine Pläne, nach Äthiopien zurückzukehren, werden durch die neue politische Situation von heute auf morgen zunichte gemacht. Prinz Asfa-Wossen Asserate erzählt vom Glanz des Kaiserhofs, seiner Zeit an der Deutschen Schule in Addis Abeba und vom Leid der Revolution. Er erzählt, wie er jahrzehntelang um seine Familie kämpfte, wie er in Deutschland neu anfing und nach seinen Studien in Tübingen und Frankfurt am Main die Deutschen und deren große Dichter und Denker kennen- und liebenlernte: der Fremde, der blieb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Asfa-Wossen Asserate
Ein Prinz aus dem Hause David
Und warum er in Deutschland blieb
Autobiographie/Memoir
Über dieses Buch
1974: Sein Vater, Präsident des äthiopischen Kronrats, wird von den Generälen der Revolution erschossen, seine Mutter und seine Geschwister gefangengenommen, das Hab und Gut der Familie beschlagnahmt. Über Nacht wird das Gastland Deutschland, in dem er studiert, zum Ort des Exils. Seine Pläne, nach Äthiopien zurückzukehren, werden durch die neue politische Situation von heute auf morgen zunichte gemacht.
Prinz Asfa-Wossen Asserate erzählt vom Glanz des Kaiserhofs, seiner Zeit an der Deutschen Schule in Addis Abeba und vom Leid der Revolution. Er erzählt, wie er jahrzehntelang um seine Familie kämpfte, wie er in Deutschland neu anfing und nach seinen Studien in Tübingen und Frankfurt am Main die Deutschen und deren große Dichter und Denker kennen- und liebenlernte: der Fremde, der blieb.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Asfa-Wossen Asserate, Prinz aus dem äthiopischen Kaiserhaus, wurde 1948 in Addis Abeba geboren. An der Deutschen Schule bestand er als einer der ersten Äthiopier das Abitur. Er studierte Geschichte und Jura in Tübingen und Cambridge und promovierte in Frankfurt am Main. Die Revolution in Äthiopien verhinderte die Rückkehr in seine Heimat. Er blieb in Deutschland und ist heute als Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten tätig. Sein Buch »Manieren« wurde von der Kritik gefeiert.
Impressum
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2007
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400910-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
»It was the best [...]
Meinem Doktorvater in Frankfurt [...]
Der Tag, der mein Leben veränderte
Über den Dächern von Addis Abeba
Im Glanz des äthiopischen Kaiserhofes
Man spricht deutsch
Risse im Fundament
Gaudeamus igitur
My Salad Days
Dem Abgrund entgegen
»Ityopya tikdem!« – »Äthiopien über alles!«
Schickt mir die Heimatlosen ...
Zeitenwende
Dort, wo das Herz spricht
Nachbemerkung
Verzeichnis Kaiserlich-äthiopischer Titel
Register
»It was the best of times, it was the worst of times.«
Charles Dickens, A Tale of Two Cities
Meinem Doktorvater in Frankfurt Herrn Prof.Dr.Eike Haberland und meinem Tutor in Cambridge His Honour Dr.Colin F. Kolbert in großer Dankbarkeit.
Der Tag, der mein Leben veränderte
Der 23.November 1974 war ein grauer, trüber Tag, einer jener Tage, an denen es gar nicht hell werden wollte. In meiner kleinen Studentenwohnung am Beethovenplatz im Frankfurter Westend, ich nannte sie liebevoll mein Schließfach, brannte den ganzen Tag über Licht. Vor dem Fenster direkt unter dem Dach hingen dunkle Wolken. Ich war nicht allein an jenem Nachmittag. Mein Freund Zewde Germachtew, genannt Basha, und seine Freundin Rena Makridis versammelten sich mit mir um den niedrigen Holztisch, auf dem sich das kleine schwarze Transistorradio befand. Neben uns standen drei Teller mit Zwetschgenkuchen und Sahne, die inzwischen zu einem weißen See zerlaufen war. Frau Rumbler, die Hausmeisterfrau, die zusammen mit ihrem Mann gleich nebenan wohnte, hatte ihn uns einige Stunden zuvor gebracht, aber wir hatten die Teller nicht einmal angerührt. Alle paar Minuten drehte ich an dem winzigen Schalter, um die Frequenz zu wechseln, vom Hessischen Rundfunk zu den Kurzwellenprogrammen von Deutscher Welle und BBC und wieder zurück. Noch heute kann ich die Schlagzeilen jenes Tages auswendig vorsagen: »Oppositionsführer Carstens mahnt für die anstehenden Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst einen moderaten Abschluß an.« – »Das Schicksal der Passagiere der von palästinensischen Terroristen in Dubai entführten British Airways-Maschine ist weiter unklar.« – »Der amerikanische Präsident Ford und der sowjetische Parteisekretär Breschnew zeigen sich bei ihrem Zusammentreffen in Wladiwostok zuversichtlich, daß ein bilaterales Abkommen zur Beschränkung strategischer Offensivwaffen in greifbarer Nähe sei.« – »Der evangelische Bischof von Berlin Kurt Scharf weist Forderungen nach einem Rücktritt im Zusammenhang mit seinem umstrittenen Gefängnisbesuch bei Ulrike Meinhof zurück.«
All diese Meldungen interessierten uns an jenem Tage nicht – wir warteten verzweifelt auf Nachrichten aus Addis Abeba. Rena Makridis war gerade mit dem Flugzeug aus Äthiopien eingetroffen, Basha und ich hatten sie am Morgen vom Flughafen abgeholt. Die Stimmung war gedrückt. Seitdem im Frühjahr des Jahres die Taxifahrer von Addis Abeba zu streiken begonnen hatten, geschahen schier unglaubliche Dinge in meiner Heimat. Nach den Taxifahrern demonstrierten die Studenten und verlangten nach demokratischen Rechten. Und es gab kaum einen jungen Menschen, kaum einen Intellektuellen, der nicht mit dem neuen Geist, der in diesem äthiopischen Frühling überall zu spüren war, sympathisierte. Eine neue Regierung, angeführt von einem meiner Vettern, Endalkatchew Makonnen, war angetreten und eine Kommission eingesetzt worden zur Erarbeitung einer neuen, demokratischen Verfassung, welche die Befugnisse des Kaisers beschränken sollte. Der Kaiser selbst schien sich all diesen Plänen nicht zu widersetzen. Doch irgendwann begann der Wind sich zu drehen. Die neue Regierung wurde bereits nach wenigen Monaten wieder abgesetzt. Eine Gruppe von Militärs – die sich Derg, Provisorischer Militärrat, nannte – hatte sich nach und nach als das neue Machtzentrum des Landes herausgeschält. Sie streckten die Hand nach den Politikern und Repräsentanten des alten Regimes aus. Zuerst traf es nur den ein oder anderen Offizier oder kaiserlichen Beamten, die aus ihren Wohnungen, Kasernen und Amtsstuben abgeführt wurden. Vielleicht waren die Militärs selbst überrascht davon, daß sich kein Widerstand regte, allmählich wagten sie sich weiter hervor. Nach einigen Monaten jedenfalls saß die gesamte Führungsschicht des äthiopischen Kaiserreichs im Gefängnis. Und am Morgen des 12.September 1974, dem Tag nach dem äthiopischen Neujahrsfest, war der Kaiser selbst – der König der Könige aus dem Hause David, der Löwe von Juda, wie ihn die Europäer nannten, aus dem Geschlecht der Salomoniden, der 225. Herrscher auf dem Thron des drei Jahrtausende alten äthiopischen Kaiserreichs –, war Haile Selassie abgesetzt und, wie es hieß, »unter Hausarrest gestellt« worden. Die Verfassung war aufgehoben, die Regierungsgeschäfte hatte eine Provisorische Militärregierung übernommen. Das Photo, auf dem zu sehen ist, wie Uniformierte den Kaiser die Stufen des Palasts hinab in einen hellblauen VW Käfer dirigieren, ging um die Welt. Während all dieser Monate war in Addis Abeba kaum ein Schuß gefallen, die politischen Kommentatoren der internationalen Medien sprachen von einer »schleichenden Revolution«.
Doch verblaßte die Sorge um das Schicksal meines Heimatlandes vor dem Hintergrund der Angst, die ich um meine Familie hatte. Mit Haile Selassie waren nämlich, neben weiteren Angehörigen der kaiserlichen Familie, auch meine Mutter und meine Geschwister inhaftiert worden – alle außer meiner Schwester Tsige, die ihren Häschern durch Zufall entging und sich an einem unbekannten Ort versteckt hielt. Mein Vater Leul Ras (Kaiserlicher Herzog) Asserate Kassa, Vorsitzender des Kaiserlichen Kronrats, saß bereits seit fast drei Monaten in Haft. Wie jeden Sonntag hatte er auch am Morgen des 30.Juni 1974 die Messe besucht, beim Verlassen der Kirche war er von einer Abordnung des Derg abgeführt worden.
Es war schwierig, verläßliche Informationen aus Addis Abeba zu bekommen. Anrufe im Kreis der Familie und der Freunde konnten nur mit äußerster Vorsicht erfolgen – uns allen war klar, daß die Leitungen abgehört wurden. Meine wichtigsten Vertrauenspersonen in diesen Tagen (und in den schweren Wochen und Jahren, die auf diese noch folgen sollten) waren die Bediensteten meiner Eltern. Bis auf Ketemma, den Kammerdiener meines Vaters, waren sie alle auf freiem Fuß. Doch was ich von ihnen erfuhr, war niederschmetternd. Debre Tabor, die Residenz meiner Eltern auf dem Entoto in den Bergen über der Hauptstadt, war von Soldaten abgeriegelt worden, niemand durfte sich ihr nähern. Meine Mutter und meine Geschwister waren mit weiteren Mitgliedern der Kaiserfamilie im Palast des Herzogs von Harrar festgesetzt, mein Vater zusammen mit vielen hohen Würdenträgern des Landes im Keller des Menelik-Palastes. Dort saß auch der Vater meines Freundes Basha ein, der einstige Landwirtschaftsminister Dejazmatch Germatchew Tekle-Hawriat, der als Schriftsteller im ganzen Land bekannt und darüber hinaus wie mein Vater Mitglied des Kronrats war. Sie alle warteten auf den Beginn der von den neuen Machthabern mit großer Geste angekündigten gerichtlichen Untersuchungen. Und ich saß in weiter Ferne in Frankfurt am Main, abgeschnitten von allen Informationen und ohne Möglichkeit zu helfen. Vor wenigen Tagen hatte ich meinen sechsundzwanzigsten Geburtstag begangen, aber nach Feiern war mir nicht zumute gewesen.
Die neuen Informationen, die Bashas Freundin Rena aus Äthiopien brachte, waren alles andere als dazu angetan, die Stimmung aufzuhellen. Es kursierten Gerüchte, daß es innerhalb jener geheimnisvollen Gruppe des Derg Auseinandersetzungen über die Zukunft des Landes gäbe. Seit einer Woche war der offizielle Vorsitzende der Provisorischen Militärregierung, in dessen Händen angeblich die Geschicke des Landes lagen – General Aman Andom –, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Statt dessen hatte eine neue, bis dahin unbekannte Figur die öffentliche Bühne betreten. Der 36jährige Oberst Mengistu, vormals Major der Kaiserlichen Armee und nun Erster Stellvertretender Regierungschef der Provisorischen Militärregierung, hatte zu einer Pressekonferenz geladen, und sein Ton unterschied sich merklich von der konzilianten und umsichtigen Art von General Aman. Er richtete eine scharfe Mahnung an die äthiopischen Studenten, den Weisungen der Militärregierung Folge zu leisten. Und er wies daraufhin, daß sich in die Regierung »reaktionäre Elemente« eingeschlichen hätten, bis in die höchste Verantwortungsebene hinein, die man nicht zu dulden gewillt sei.
Ich wußte nicht, was mir lieber war: nichts über Äthiopien im Radio zu hören – was immerhin die Hoffnung aufrecht erhielt, daß sich die Dinge nicht zum Allerschlimmsten gewendet hatten –, oder aber, Klarheit über die aktuelle Lage zu bekommen. Am späten Nachmittag gab es auf BBC World dann tatsächlich Informationen aus meiner Heimat: In der Hauptstadt seien Truppen aufgezogen, General Aman Andom sei – wie die inzwischen bekannte Formulierung hieß – »unter Hausarrest gestellt«, eine »militärische Auseinandersetzung« zwischen den verschiedenen Gruppen des Militärrats stehe unmittelbar bevor. Von nun an klebten wir förmlich am Radio. Alle dreißig Minuten wurden die wenigen Sätze wiederholt wie die Litanei in einem Gottesdienst, ohne daß wir Näheres erfahren hätten. Basha und ich versuchten uns abzulenken, indem wir uns an unsere gemeinsamen Jahre an der Deutschen Schule von Addis Abeba erinnerten – der imposante Weihnachtsbaum in der Aula, die Faschingsfeiern mit Luftschlangen und bunten Kostümen, der Besuch des Kaisers, den ich als Schülersprecher offiziell begrüßen durfte, und all die Nachmittage, die wir zusammen im Schwimmbad des Ghion-Hotels verbrachten ... Doch all das vermochte unsere Beklemmung nur für Minuten zu lösen.
Gegen Mitternacht müssen wir auf unseren Stühlen eingenickt sein. Der Regen peitschte gegen das Dachfenster, als ich aus dem Schlaf fuhr. Ich weckte meine Freunde. Wir beschlossen, daß es sinnlos sei, die ganze Nacht wach zu bleiben, und ich richtete für meine Gäste die Couch.
Ich hatte den Wecker auf sechs Uhr gestellt, und sowie er am nächsten Morgen klingelte, galt mein erster Handgriff dem Radio. Nun war Äthiopien auf BBC die Spitzenmeldung: »Blutiger Machtkampf in Äthiopien – Mehr als fünfzig Personen erschossen.« Und noch bevor ich Näheres erfuhr, noch bevor ich auch nur den Namen eines einzigen der Erschossenen hörte, spürte ich es instinktiv: Mein Vater war nicht mehr am Leben.
Eine Stunde später meldete die BBC, daß unter den Ermordeten nicht nur General Aman Andom, der offizielle Chef der Militärregierung, sondern auch zahlreiche hohe Politiker und Offiziere des Kaiserreichs seien, darunter zwei ehemalige Ministerpräsidenten, ein Enkel und ein Vetter des Kaisers. Ich griff nach dem Telefon. Egal, wie schwierig, und egal, wie gefährlich es sein mochte, in Äthiopien anzurufen: Ich mußte Gewißheit bekommen. Es dauerte zwei Stunden, bis ich eine Verbindung bekam. Als meine Tante, Emamma Bezounesh, meine Stimme hörte, brach sie in Tränen aus. Dann hörte ich die Stimme ihres Mannes, meines Onkels Abbaba Nebeye. Sie klang ruhig und gefaßt: »Lege dein Schicksal in die Hände des Allmächtigen«, sagte er zu mir. »Das Los, das unserer Familie und unserem Volk bestimmt ist, ist so schlimm, daß die Weisheit und das Vermögen von Menschen nicht hinreichen, es zu wenden.« Meinen Geschwistern und meiner Mutter gehe es gut, aber mein Vater und drei meiner Vettern seien in der Nacht erschossen worden.
Ich wunderte mich, daß ich ebenso ruhig und gefaßt blieb wie Abbaba Nebeye. Es muß eine ganze Weile still geblieben sein in der Leitung. Ich erinnere mich, daß ich aus der Ferne das Weinen vieler Menschen hörte, bevor ich meinen Onkel fragte, ob er etwas über das Schicksal von Bashas Vater wisse, aber über diesen hatte er nur vage Informationen.
Sowie ich den Hörer aufgelegt hatte, fing das Telefon an zu klingeln. Die erste, die ich am Apparat hatte, war die Kronprinzessin Medferiash-Work aus London, die den Hörer an ihren Mann, den Kronprinzen Asfa-Wossen, weitergab. Ich verstand kaum, was der Kronprinz sagte; seitdem er ein Jahr zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte, war der Sohn des Kaisers halbseitig gelähmt. Er machte sich große Sorgen um das Schicksal des Kaisers, und der Tod meines Vaters erschütterte ihn. Mit ihm hatte er einen seiner engsten Vertrauten verloren. Mein Vater war damals von Haile Selassie zum persönlichen Betreuer des Kronprinzen bestimmt worden und hatte diesen über ein Jahr lang zu medizinischen Behandlungen nach Europa begleitet. Von der Kronprinzessin erfuhr ich dann erstmals die Namen der insgesamt sechzig Erschossenen, die Militärs in Addis Abeba hatten eine Liste bekanntgegeben. Ich war fassungslos. Über Nacht war im Handstreich die gesamte Führungsschicht des Landes – Minister und Würdenträger, Generäle und leitende Beamte – ausgelöscht worden: auf Grund von »Verbrechen gegen das äthiopische Volk«, wie Radio Äthiopien verkündet hatte. Die Prinzessin forderte mich auf, die nächste Maschine zu nehmen und nach London zu kommen, doch ich lehnte ab. Zuerst mußte ich mit mir selbst ins reine kommen.
Aber das Telefon wollte nicht mehr stillstehen. Aus allen Erdteilen kamen die Anrufe, mechanisch und wie in Trance nahm ich die Beileidswünsche entgegen. Mancher meiner aufgelösten Cousinen und Tanten, manchem erschütterten Freund, der selbst einen Onkel oder nahen Verwandten verloren hatte, versuchte nun ich Trost zu spenden. Basha hatte inzwischen seine Mutter in Addis Abeba erreicht und die Bestätigung erhalten, daß sein Vater am Leben war. Am Nachmittag fuhren meine beiden Freunde nach Ulm zurück, und ich war zum ersten Mal allein in meiner Wohnung. Mein Kopf dröhnte von den Ereignissen der letzten Stunden. War das Wirklichkeit oder war es ein schrecklicher Traum?
Es gibt in Frankfurt einen Ort, den ich als meine geistige Mitte bezeichne: die Liebfrauenkirche an der Hauptwache, die einzige noch vorhandene Klosterkirche der Stadt. Vielleicht ist mir die Liebfrauenkirche auch deshalb so nahe, weil die heilige Muttergottes meine Patronin ist. Nach dem äthiopischen Kalender bin ich an einem Marienfesttag geboren. Wenn ich eine Last zu tragen habe, wenn ich zur Besinnung kommen will, gehe ich dorthin, um zu beten, und so tat ich es auch an jenem Nachmittag. Ich öffnete die schwere Kupfertür zur Anbetungskapelle, in der das Allerheiligste aufbewahrt wird. Keine der drei schmalen Sitzreihen war besetzt, ich war ganz allein im Raum. Ich trat in die erste Bank, kniete nieder und fing an zu beten. Und in diesem Moment brach es aus mir heraus: Ich weinte, wie ich noch nie in meinem Leben geweint habe. Ich weiß nicht, wie lange ich so verbrachte, als ich plötzlich eine Stimme vernahm. Eine ältere Frau, die ich hier noch nie gesehen hatte, saß hinter mir – ich hatte sie gar nicht hereinkommen hören. Sie mußte wohl schon eine Weile mitangesehen haben, wie ich mit mir kämpfte: »Ich will Ihnen nicht zu nahe treten ...«, flüsterte sie. »Aber was auch immer passiert ist – lassen Sie los!«
Nach einer Weile versiegten die Tränen. Und ich beschloß, dem Rat meines Onkels zu folgen: Ich legte mein Schicksal in die Hände meines Schöpfers. Ich dankte ihm für meine Rettung. Ich war am Leben. Was wäre wohl geschehen, wenn ich mich in Äthiopien aufgehalten hätte? Wäre mir, der ich als jemand galt, der sich nicht leicht einschüchtern ließ und immer klar und deutlich seine Meinung sagte, nicht das gleiche Schicksal zuteil geworden wie meinem Vater? Ab diesem Moment war ich wieder in der Lage, klar zu denken.
Schon beim Aufschließen der Wohnungstür hörte ich wieder das Telefon. Ich beschloß, an diesem Tag für niemanden mehr erreichbar zu sein, und zog das graue Kabel aus der Dose. Ich erinnerte mich der Worte meines Bruders Mulugeta, die er mir Jahre zuvor inmitten einer ausgelassenen Hochzeitsfeier in Addis Abeba zugerufen hatte, als er meinte, ich hätte mich danebenbenommen. »Du bist der Älteste! Du repräsentierst die Familie!«
Mein Vater war tot. Meine Mutter und meine Geschwister saßen im Gefängnis – aber sie lebten. Ich war jetzt nicht mehr nur der älteste, ich war der einzige aus meiner Familie, der sich in Freiheit befand und in Sicherheit. Die lähmende Trauer, die mich die letzten Stunden in ihrem Bann gehalten hatte, verwandelte sich in ein neues Gefühl, ein Gefühl der Wut. Und ich schwor mir: Ich würde alles daransetzen, meine Mutter und meine Geschwister zu befreien. Ich würde nicht eher ruhen, bis ich sie alle wohlbehalten in meine Arme schließen konnte. Dies sollte von nun an meine Lebensaufgabe sein.
Aber was konnte ich tun? Ein einfacher äthiopischer Student in Frankfurt, der gerade dabei war, an der dortigen Universität im Fach Äthiopistik zu promovieren. Dessen Zukunftspläne nach Äthiopien ausgerichtet waren, dessen Karriere als Diplomat im äthiopischen Staatsdienst vorgezeichnet war. Dessen privates Glück an der Seite seiner zauberhaften Freundin Tessy, der Tochter des Oberbürgermeisters von Asmara, gemacht schien. Der sich nun über Nacht vom Studenten zum politischen Flüchtling verwandelt sah, und sein Gastland in den Ort des Exils. » Wer das Exil nicht kennt«, schrieb Heinrich Heine, »begreift nicht, wie grell es unsere Schmerzen färbt, und wie es Nacht und Gift in unsere Gedanken gießt.«
Doch ich beschloß zu kämpfen.
Hätte ich damals geahnt, wie lange der Kampf um meine Familie dauern sollte – siebzehn bleierne, von Schmerzen gefärbte Jahre –, hätte ich geahnt, wieviel Leid und Verheerung die Zeit des Roten Terrors über Äthiopien bringen würde, wieviel Nacht und Gift das traurige Schicksal meines Landes in meine Gedanken gießen würde – hätte ich die Kraft gehabt, diesen Kampf durchzustehen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß wohl, wie sehr mir in jenen mehr als dreißig Jahren, die mein Exil in Deutschland nun währt, jenes Land, das mir einst Zuflucht gewährt hat, dem ich mich schon seit meiner Kindheit verbunden wußte, ans Herz gewachsen ist. Ich bin deutscher Staatsbürger geworden und lebe nun schon länger in Deutschland als in meiner Heimat. Nach meinen vielen Reisen, die mich mit meinem Buch Manieren durchs ganze Land führten, kann ich sagen, daß ich Deutschland inzwischen wahrscheinlich sogar besser kenne als mancher Deutscher. Dennoch verbindet mich ein unauflösbares Band mit Äthiopien, ja, ich kann sagen: Alles, was ich tue – bis zum heutigen Tag –, hat im weitesten Sinne mit Äthiopien zu tun.
Manchmal frage ich mich selbst, wie ich, der von seinen deutschen Freunden ein »deutscher Äthiopier« und von seinen äthiopischen Freunden ein »äthiopischer Deutscher« genannt wird, nach Deutschland kam – und warum ich, dessen Brust ein Archiv äthiopischen Gefühls ist, in Deutschland geblieben bin.
Es ist eine Gewohnheit von mir seit Kindertagen, vor dem Einschlafen im Bett noch in einem Buch zu lesen, und wenn es nur ein paar Seiten sind. Am Abend jenes 24.November 1974, an dem ich in Frankfurt von der Ermordung meines Vaters aus dem Radio erfuhr, am Abend jenes Tages, der mein Leben veränderte, nahm ich ein Buch aus dem Regal, das mich seit meiner Kindheit begleitet: Robert Louis Stevensons Schatzinsel. Ich fing an, die vertrauten Worte zu lesen:
»Unser Gutsherr, Baron Trelawney, Dr.Livesay und die übrigen Herren drangen in mich, eine genaue Darstellung unserer Reise nach der Schatzinsel niederzuschreiben und nichts auszulassen als die Angabe ihrer Lage ... So greife ich denn im Jahre des Heils 17** zur Feder und versetze mich in die Zeiten zurück, da mein Vater noch das Wirtshaus ›Zum Admiral Benbow‹ hielt ... Ich erinnere mich deutlich, als wäre es gestern gewesen ...«
Nach einigen Seiten legte ich das Buch zur Seite, und zwischen Wachen und Schlafen tauchten vor meinem inneren Auge die glücklichen Tage meiner Kindheit auf.
Ich sah die Terrasse der Residenz meines Vaters auf dem Entoto in der Dämmerung, von der ich so gerne auf Addis Abeba hinabblickte, wenn die Sonne über der Stadt unterging und im Tal nach und nach die Lichter angingen, die Luft vom Duft der Eukalyptuswälder erfüllt. Ich sah mich im alten Genete-Leul-Palast am Weihnachtstag, mit meinen Vettern in Reih und Glied aufgestellt, vor uns Kaiser Haile Selassie, freundlich lächelnd, einem nach den anderen sein Geschenk überreichend. Ich sah die riesigen Bücherwände in der Bibliothek meines Vaters, in der ich so viele Nachmittage verbracht hatte. Und ich sah den strengen Blick unseres alten Zeremonienmeisters, Balambaras Assefa, mit dem er uns Kinder musterte, wenn wir bei Tisch nicht stillsitzen wollten.
Ich sah mich mit meinen Geschwistern als kleiner Junge in unserem offenen grünen Pontiac vor der Enrico-Bar und unseren Chauffeur auf uns zukommen, beide Hände voll mit Eistüten beladen. Über seine dunklen Handrücken flossen dünne Bäche von Erdbeerrot, Pistaziengrün und Vanillegelb. Und ich sah mich, den Duft von Weihrauch in der Nase, an der Hand meines Großvaters, wie er mich ins Allerheiligste der Jesus-Kirche führte, das eigentlich nur geweihten Priestern zu betreten erlaubt ist. Er zeigte mir den hölzernen Schrein mit dem Tabot, dem Symbol der heiligen Bundeslade, und lehrte mich die Proskynese. Er legte sich flach auf den Boden, das Gesicht nach unten gerichtet, führte die Finger zum Kuß an den Mund und streckte sie in Richtung des Tabots aus, und ich tat es ihm nach.
Ich roch die Holzkohleöfen in den Straßen von Addis Abeba, die am frühen Abend, wenn ich von der Schule nach Hause ging und es langsam kühler wurde, zum Anfachen nach draußen vor die wellblechbedeckten Rundhütten geschoben waren. Ich sah mich mit meinen Mitschülern im Awassa-See herumtollen, bis zur Brust im grünlich-blauen Wasser, beim Versuch, uns gegenseitig unterzutauchen, während die Fische uns zwischen den Beinen hindurch schwammen. Und ich sah mich mit meinem Vater frühmorgens durch die menschenleeren Straßen von Asmara reiten. Die Nüstern der stolzen Rosse aus dem Palastgestüt dampften in der feuchten Luft zwischen den Palmenalleen.
Ich sah mich als Junge mit meiner Mutter und meinen Schwestern Tsige, Rebecca und Turuwork im Hotel Meurice in Paris sitzen, als mir Tsige, die ich – wenn ich bloß wüßte, womit – bis zur Weißglut gereizt haben muß, eine Flasche Cola über den Kopf goß. Und ich sah meine geliebte Freundin Tessy, wie ich mit ihr Hand in Hand lachend im großen Garten des Palastes von Asmara spazierenging, sie in ihrem hochgeschlossenen zitronengelben Kleid, die Haare nach oben gesteckt und zart nach Pfirsich duftend.
Über den Dächern von Addis Abeba
Wenn ich als kleiner Junge bei Abbaba Nebeye, meinem Onkel Fitaurari Nebeye-Leul, zu Gast war, nahm er mich manchmal nach dem Essen beiseite und erzählte mir die Geschichte von der Königin von Saba und König Salomo.
In biblischen Zeiten herrschte über Israel König Salomo, und über die südlichen Länder zu beiden Seiten des Roten Meeres, über den Jemen und über das Horn von Afrika, die Königin von Saba, in Äthiopien Makeda oder auch Azeb genannt. Bis an den Hof der Königin des Südens verbreitete sich damals die Nachricht vom Großen Tempel, den König Salomo in Jerusalem errichtete – an eben der Stelle, die seinem Vater, dem König David, zugewiesen war.
Der äthiopische Kaufmann Tamrin brachte für den Tempelbau aus Arabien rotes Gold, schwarzes Holz und Saphire an den Hof nach Jerusalem und zeigte sich tief beeindruckt von der Weisheit Salomos. Nach seiner Rückkehr an den Hof der Königin Makeda verging kaum ein Tag, an dem er seiner Herrscherin nicht von der Weisheit Salomos vorschwärmte. Kein Mensch, so hieß es, komme Salomo an Weisheit gleich – und was gebe es überhaupt auf der Welt, das mehr zähle als die Weisheit? Sie ist süßer als Honig, läßt einen mehr frohlocken als Wein, sie strahlt heller als die Sonne, sie sättigt mehr als das feinste Öl und das köstlichste Fleisch und verleiht mehr Ruhm als alles Gold und Silber der Welt. Kein Königreich hält sich aufrecht ohne Weisheit, und kein Reichtum läßt sich ohne Weisheit bewahren. So weise soll der Sohn Davids sein, erzählte Tamrin, daß ihm nicht einmal die Sprache der Raubtiere und die der Vögel ein Geheimnis bleibe. Einen solchen Menschen mußte auch die Königin von Saba kennenlernen. Und so machte sie sich mit einer Karawane von 797 Kamelen, unzähligen Maultieren und Eseln, allesamt hochbeladen mit den kostbarsten Geschenken, auf die lange und beschwerliche Reise nach Jerusalem.
Am Hof von König Salomo wird sie empfangen, wie es der Königin des Südens gebührt. Ein köstliches Mahl wird ihr gereicht mit geschlachteten Ochsen und Stieren, Hirschen und Gazellen und gebratenen Hühnern in Hülle und Fülle, begleitet von den Gesängen eines Chores von fünfundzwanzig Männern und fünfundzwanzig Frauen. Die Pracht des Hofes von König Salomo beeindruckt die Königin, aber wie mag es mit Salomos Weisheit bestellt sein? Makeda will ihn auf die Probe stellen. Sie läßt Jungen und Mädchen in gleiche Kleider stecken und den König raten, wer wer ist. Der wirft Äpfel in die Schar – die Jungen sammeln sie auf, die Mädchen halten sich zurück. Sie stellt ihm prachtvolle Blumensträuße auf, und er soll raten, welche künstlich sind. Auch diese Probe löst der König im Nu: Nur über den echten summen die Bienen, über den künstlichen die Fliegen.
Vierhundert Hauptfrauen und sechshundert Nebenfrauen nennt Salomo sein eigen, aber keine von ihnen ist von einer solchen Schönheit wie Makeda. Doch hartnäckig widersetzt sie sich seinem Werben, Tag für Tag, bis zum Vorabend ihrer Abreise. So sinnt Salomo auf eine List. Er empfängt die äthiopische Gesandtschaft zu einem prachtvollen Abschiedsessen. Mit Purpurvorhängen und mit Teppichen ist das Lager ausgelegt, die Luft ist von Moschus, Myrrhe und Weihrauch erfüllt. Aber serviert werden scharf gewürzte Speisen, und die Getränke sind mit Essig versetzt. Nach dem Mahl lädt Salomo die Königin ein, in seiner Kammer zu schlafen. Er schwört, sich ihr nicht mit Gewalt zu nähern – unter der Bedingung, daß sie sich nicht an etwas vergreife, was ihm gehöre. Die Königin lacht über seine Worte. Ihr Königreich sei ebenso prächtig wie das seine, glaube er etwa, sie sei gekommen, um ihn zu bestehlen? In der Nacht bekommt die Königin großen Durst und greift nach dem bereitstehenden Wasserbecher. Das ist der Augenblick, auf den Salomo gewartet hat, er hat sich nur schlafend gestellt. Makeda erschrickt: »Mit einem Becher Wasser habe ich den Eid gebrochen?« Es hilft nichts, sie muß das Lager mit ihm teilen.
In der Nacht erscheint König Salomo eine helleuchtende Sonne, die vom Himmel herabsteigt und ihren Glanz über Israel verbreitet, bis sie sich plötzlich abwendet und die Flucht ergreift. Im fernen Äthiopien läßt sie sich nieder. Dort erstrahlt sie von neuem und heller als je zuvor, und Israel bleibt in Dunkel gehüllt. Am darauffolgenden Morgen wird Makeda von König Salomo reich beschenkt: Sechstausend Kamele werden beladen mit allem, was kostbar ist. Dazu erhält die Königin der Sage nach auch ein Gefährt, in dem man geschwind über die Meere reisen kann, und eines dazu, mit dem man die Lüfte durchquert. Beim Abschied zieht König Salomo den Ring von seinem Finger und überreicht ihn der Königin mit den Worten: »Nimm diesen Ring, damit du mich nicht vergißt. Wenn mein Same Frucht trägt und du einen Sohn gebierst, sende ihn an meinen Hof. Der Ring soll ihm das Zeichen sein.« Und er erzählt ihr von seinem Traum und von der über Äthiopien aufgehenden Sonne. »Möge Gott der Herr mit dir sein, und dein Land soll gesegnet sein.«
Neun Monate und fünf Tage später, noch immer auf der Heimreise nach Äthiopien, gebiert Makeda einen Sohn und tauft ihn Menelik (amharisch für: » Was wird er wohl schicken?«). Schon bald fragt der Sohn nach seinem Vater, und Makeda erklärt ihm, sie sei ihm Vater und Mutter zugleich. Doch Menelik ist beharrlich, und so weiß er bald um die Geschichte seiner Herkunft. Im Alter von zweiundzwanzig Jahren, erfahren in den Künsten der Kriegsführung und des Reitens, des Jagens und Fallenstellens, macht er sich auf die Reise nach Jerusalem zu seinem Vater, dem König von Israel. An seinem Finger trägt er den Ring Salomos. Schon auf dem Weg macht er auf sich aufmerksam, denn er ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. » Vor uns steht Salomo, der Sohn Davids!« rufen die Bewohner Gazas und verneigen sich in Ehrfurcht. Gesandte werden nach Jerusalem vorausgeschickt, um König Salomo den Besucher anzukündigen. Salomo geht ein Stich durchs Herz, denn trotz seiner zahlreichen Gemahlinnen hat Gott ihm nur drei Nachkommen geschenkt, und der Sohn der Königin von Äthiopien ist sein Erstgeborener. In Jerusalem wird Menelik von seinem Vater gesalbt und gesegnet. Salomo trägt ihm die Königswürde Israels an, doch alles Zureden bleibt vergeblich: Menelik drängt es zurück in die Heimat zu seiner Mutter. Dort soll er König von Äthiopien werden, und zum Geleit schickt ihm Salomo die erstgeborenen Söhne der Fürsten seines Reiches mit. Wie die Väter zur Linken und Rechten des Königs von Israel sitzen, so sollen deren Söhne zur Linken und Rechten des erstgeborenen Sohnes von König Salomo am Throne Äthiopiens sitzen, als Kammerdiener, Schreiber, Siegelbewahrer, Zeremonienmeister, Heerführer und Hofrichter. Doch mit dem Abschied von Menelik erfüllt sich auch die Prophezeiung jener Nacht, in der Salomo mit Makeda schlief. Die Söhne Israels nehmen die heilige Bundeslade mit auf den Weg nach Äthiopien, jenes heilige Gefäß, das die Tafeln mit den Gesetzen enthält, die Mose einst auf dem Berg Sinai von Jahwe erhielt. Gott selbst öffnete ihnen die Türen zum heiligen Tempel in Jerusalem. Bis zum heutigen Tag, so will es die äthiopische Tradition, werden die heiligen Tafeln in Axum, der einstigen Hauptstadt des äthiopischen Kaiserreichs im Norden des Landes, aufbewahrt.
Und so ging über Äthiopien die Sonne auf: Makeda überließ Menelik (auch genannt Ebna Hakim – der Sohn des Weisen) den Thron und nahm den Fürsten des Reiches den Eid ab, daß über Äthiopien nie ein anderer als ein Nachkomme Salomos, ein Nachfahre aus dem Hause Davids, herrschen solle. So steht es geschrieben in dem uralten Werk der äthiopischen Literatur, dem Kebra Negast (»Die Herrlichkeit der Könige«).
Mit dem Hinweis auf das Kebra Negast pflegte Abbaba Nebeye seine Erzählung von der Königin von Saba und König Salomo zu beenden, und stets schloß sich daran die Geschichte meiner Herkunft an. Dabei griff Abbaba Nebeye zu Papier und Feder, und ich sah staunend zu, wie sich auf dem Blatt ein weitverzweigter Stammbaum entfaltete. »Schau, hier bist du, und da dein Vater und dein Großvater Ras Kassa, der einst zu den drei Kandidaten gehörte, die für den äthiopischen Thron vorgeschlagen wurden. Der Fürstenrat entschied sich dann nicht für ihn, sondern für Ras Tafari, seinen Vetter, unseren Kaiser Haile Selassie. Von ihm führt die Linie zurück zu König Salomo und Königin Makeda.« Striche und Namen flogen aufs Papier, dann zog Abbaba Nebeye einen langen senkrechten Strich, malte zwei ineinander verschlungene Ringe und schrieb daneben die Namen Salomo und Makeda. »Die andere Linie deines Großvaters führt zurück zum Königshaus von Lasta und von Gondar ...«, und Abbaba Nebeye zog einen zweiten, nicht ganz so langen Strich. »Und schau, da ist deine Mutter, sie entstammt der königlichen Familie von Wollo. Unsere Kaiserin ist ihre Großmutter, und Negus Mikael von Wollo war ihr Urgroßvater.« Er schrieb den Namen aufs Papier. »Er nannte sich der große Imam Mohammed Ali, bevor er von Kaiser Yohannes IV. getauft wurde. Seine Linie leitet sich direkt vom Propheten Mohammed ab. Wenn man es also genau betrachtet ...«, mein Onkel machte eine kleine Pause und zeichnete mit energischer Hand zwei waagrechte Striche aufs Papier, als würde er die Lösung einer Rechenaufgabe präsentieren, »... stammst du von König David und vom Propheten Mohammed ab ... Und mit Kaiser Haile Selassie bist du gleich doppelt verwandt: Du bist sein Urgroßneffe und sein Stiefurenkel.« Mir kam das Ganze damals tatsächlich wie eine knifflige Rechenaufgabe vor, die mein Onkel mit Bravour zu lösen imstande war. Auch wenn ich als kleiner Junge wohl nicht verstand, was genau man sich unter einem Stiefurenkel vorzustellen hatte, war ich stolz darauf, von König Salomo und der Königin Makeda abzustammen.
Mir stand Makeda seit ich denken kann lebhaft vor Augen, und das keinesfalls nur aus Erzählungen meines Onkels. Die Geschichte ihrer Reise nach Jerusalem ist eines der beliebtesten Motive der äthiopischen Malerei. Überall sieht man sie dargestellt, auf dem Kamel von Äthiopien nach Jerusalem reitend oder an der Tafel im Palaste König Salomos, und, Seite an Seite mit dem König, in dessen Gemächern liegend, neben ihnen der schicksalhafte Becher mit Wasser. Mein Großvater Ras Kassa erzählte mir oft die Geschichte, wie er höchstpersönlich ein Stück des Felsens, auf dem einst der Salomonische Tempel stand, von Jerusalem nach Addis Abeba gebracht hatte. Im Juni 1911 hatte er der Krönungsfeier von Georg V. in London beigewohnt und war dabei auf den Stone of Scone, den englischen Krönungsstein, aufmerksam geworden, der Ende des 13. Jahrhunderts unter dem Königsthron in Westminster eingebaut worden war und bis heute Teil der Krönungszeremonie ist. Auf der Rückreise machte er dann in Jerusalem Station und erbat vom Vertreter des Kalifen in Jerusalem den Stein aus dem heiligen Tempel. Als Haile Selassie dann am 2.November 1930 in Addis Abeba im Beisein von Repräsentanten aus vielen Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland, zum Negusa Negast, zum König der Könige, gekrönt wurde, stand sein Thron auf jenem Stein, der aus dem Felsengrund des Salomonischen Tempels geschlagen war. Wie die englischen Könige im Krönungsritual durch den Stone of Scone die Einheit der Königreiche England und Schottland hervorhoben, so demonstrierte Haile Selassie durch den Felsenstein des Salomonischen Tempels von Jerusalem seine königliche Abstammung aus der Salomonischen Dynastie. Der äthiopische Kaiser, so die Überlieferung, stammte also von König David ab, er war ein Verwandter Jesu Christi und führte den Titel »Auserwählter Gottes«. Noch in der äthiopischen Verfassung von 1955 wird der Anspruch der Salomonischen Dynastie auf den Thron festgeschrieben: »Die Würde des Kaisers soll verbunden bleiben mit der Linie, die ohne Unterbrechung herführt vom Geschlecht Meneliks I., des Sohnes der Königin von Äthiopien, der Königin von Saba, und König Salomo von Jerusalem.« Und weiter: »Kraft Seines kaiserlichen Blutes und als gesalbter Herrscher ist die Person des Kaisers heilig, Seine Würde unantastbar und Seine Macht unteilbar.« Haile Selassie, wie sich Ras Tafari Makonnen als Kaiser nannte, zählte sich in der Salomonischen Dynastie als 225. Nachfolger Meneliks I. auf dem äthiopischen Thron.
Später, als ich größer war und mit vielen klugen Männern und Gelehrten zusammenkam, hörte ich immer wieder, wie Zweifel an dieser Tradition angemeldet wurden. Jüdische Schriftgelehrte erzählten mir, sie hätten nirgendwo in den heiligen Schriften einen Hinweis gefunden, daß die Bundeslade aus Jerusalem entwendet worden sei. Im Alten Testament stehe lediglich, daß die Königin von Saba König Salomo besucht habe und voller Ehrfurcht über seine Weisheit gewesen sei. Islamische Geistliche wiederum erzählten mir, die Königin des Südens habe gar nicht Makeda geheißen, sondern Bilquis. Nur eines ihrer Beine sei bildhübsch gewesen, das Ende des anderen ein behaarter Eselsfuß – ein Tropfen Blut von einem Drachen, den sie einst besiegt hatte, sei im Kampf auf ihren Fuß getropft und habe ihn entstellt. Salomo habe von diesem Makel erfahren und die Königin mit einer List dazu gebracht, ihr Bein zu zeigen. Doch sei er von der Königin derart bezaubert gewesen, daß er seinen Dämonen befohlen habe, sie von ihrem Eselsfuß zu befreien. Anschließend seien sie zusammen, die Königin des Südens und der König von Israel, zum Islam übergetreten, so stehe es ganz zweifelsfrei im Koran.
Auch die Riege der Historiker meldete sich zu Wort. Die Königin des Südens könne gar nicht in Axum geherrscht haben, erklärten sie, das Reich von Axum sei nämlich erst nach dem Reich von Saba, im fünften Jahrhundert vor Christus, entstanden. Und mehr als das: Es sei höchst fraglich, ob es sie überhaupt gegeben habe, schließlich seien von ihr keinerlei historische Zeugnisse überliefert. Der große Schatz der äthiopischen Geschichtsschreibung, das im 14. Jahrhundert aufgezeichnete Kebra Negast, sei ohnehin nur eine Legende, ersonnen um einer politischen Funktion willen. Man habe das äthiopische Herrscherhaus glorifizieren wollen; indem man den Kaiser von Gott habe abstammen lassen, habe man ihn unangreifbar machen wollen. Und überhaupt: Gefährte, mit denen man über die Meere und durch die Lüfte fliegen könne, wie Makeda sie von König Salomo zum Abschied erhielt, entstammten doch wohl dem Reich der Märchen. Das Patent für das erste Motorflugzeug hätten die Brüder Wright im Jahre 1903 angemeldet! Sie nannten mir eine Vielzahl von historischen Büchern, in denen dies alles haarklein dargelegt sei.
Ich wußte nicht, was ich darauf entgegnen sollte, aber ich fühlte mich wie jemand, den man seiner Großmutter und seines Großvaters berauben wollte. Wenn ich heute derlei höre und lese – und als Historiker ist dies unvermeidlich –, antworte ich diesen Kritikern im stillen mit den Worten von Gilbert Keith Chesterton: »Man erkennt leicht, weshalb eine Legende mit größerem Respekt behandelt wird als ein Geschichtsbuch. Die Legende stammt gewöhnlich von der Mehrheit der Leute im Dorf, die bei Vernunft sind. Das Buch wird gewöhnlich von dem einen Mann im Dorf verfaßt, der verrückt ist. Man vertraut einem Konsensus gewöhnlicher menschlicher Stimmen anstatt einem vereinzelten oder willkürlichen Zeugnis.« Hat Chesterton nicht recht? Jede Nation bezieht ihre Kraft aus ihren Legenden. Was wäre England ohne die Artussage, was Frankreich ohne den heiligen Remigius und die Nationalfigur der Marianne? Deutschland hielt über Jahrhunderte hinweg – in den Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und auch noch danach – den Mythos Karls des Großen und die Idee des »Reiches« aufrecht, bis Adolf Hitler diese im 20. Jahrhundert wohl für immer diskreditierte. »Tradition«, so Chesterton weiter, »ist die Demokratie der Toten. Sie lehnt es ab, sich der kleinen, arroganten Oligarchie derer zu unterwerfen, die zufällig zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Erde herumlaufen. Die Demokratie lehrt uns, die Meinung eines anständigen Mannes nicht geringzuachten, und wenn es unser Stallknecht ist; die Tradition fordert uns auf, die Meinung eines anständigen Mannes nicht zu verachten, auch wenn er unser Vater ist.« Nach der Eroberung Roms traf Napoleon Bonaparte mit dem Sekretär des Heiligen Vaters, dem Fürsten Camillo Francesco Massimo, zusammen, dessen Familie zu den ältesten Italiens gehörte und von sich behauptete, von dem römischen Konsul und Heerführer Quintus Maximus Cunctator aus dem dritten Jahrhundert vor Christi abzustammen. »Monsignore«, sprach Napoleon zu ihm, »ich habe gehört, daß sich Ihr Geschlecht auf den Bezwinger Hannibals zurückführt. Das kann doch nicht wahr sein!« – »Sie mögen recht haben, Sire«, erwiderte Fürst Massimo, »aber in meiner Familie erzählt man sich diese Geschichte seit zweitausend Jahren.«
So trug im äthiopischen Kaiserreich der höchste Orden den Namen König Salomos, der zweithöchste Orden den Namen der Königin von Saba. Und während der goldene Bruststern des Ordens vom Sigel Salomonis einen Davidstern zeigt, in dessen Mitte ein Kreuz prangt, ziert jener des Ordens der Königin von Saba ein Miniaturportrait der legendären Königin. Zu den Trägern des Ordens der Königin von Saba gehörten übrigens nicht nur meine Mutter, sondern auch die deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss und Heinrich Lübke. Noch heute steht gegenüber dem Bahnhof in Addis Abeba das Marmormonument mit dem goldenen Löwen von Juda, mit einer Krone auf dem Haupt und in der rechten vorderen Tatze das Auferstehungsbanner. Noch heute, mehr als dreißig Jahre nach dem Sturz des Kaiserhauses, werden viele äthiopische Mädchen auf den Namen Saba, Azeb oder Makeda getauft. Und noch heute pilgern die Gläubigen der äthiopisch-orthodoxen Kirche zu hohen Feiertagen zur Kirche Marjam Tsion (St. Maria von Zion) nach Axum, wo einst auch die äthiopischen Kaiser gekrönt wurden, um dort zu beten. Jedes Gotteshaus der äthiopisch-orthodoxen Kirche in Äthiopien hat in seinem heiligsten Bezirk den Tabot, eine Nachbildung der heiligen Bundeslade, die einst mit Menelik I. nach Äthiopien gekommen ist und überall im Lande verehrt wird.
In den Jahren, in die meine Kindheit fiel, erstrahlte das äthiopische Kaiserhaus in vollem Glanz. In ganz Afrika genoß Haile Selassie großes Ansehen als der Regent jenes Landes, das als einziges auf dem Kontinent den europäischen Imperialmächten widerstanden hatte und nie in seiner Geschichte unter das Joch einer Kolonialmacht gezwungen war. Die dunklen Jahre von 1935 bis 1941, die Zeit der Besetzung durch die Truppen des faschistischen Italiens, die den Kaiser ins Exil nach England getrieben hatten, schienen überwunden. Äthiopien war das erste Land, das von einem der Regime der späteren Achse Berlin-Rom-Tokio überfallen wurde, und es war das erste Land, das mit der Unterstützung alliierter Truppen von seinen Besatzern befreit wurde. Im Triumph war Haile Selassie im Mai 1941 nach Addis Abeba zurückgekehrt, die Truppen Mussolinis waren mit der Unterstützung der britischen Armee vernichtend geschlagen. Mein Großvater Ras Kassa war als »Kaiserlicher Herzog« (wie sich der Titel »Leul Ras« übersetzen läßt) und Generalfeldmarschall der äthiopischen Armee einer der führenden Politiker des äthiopischen Kaiserhauses. Protokollarisch kam er direkt nach dem Kaiser, er genoß Vorrang sogar vor dem Kronprinzen. Nie hatte es Haile Selassie meinem Großvater vergessen, daß dieser im Jahre 1916, als der Kronrat drei Kandidaten für das Amt des Regenten benannte, seine Ansprüche zurückgestellt hatte.
Die Freundschaft war unverbrüchlich und lebenslang und bewährte sich in den finsteren Stunden des Landes. Mindestens ebenso schwer wie die familiären Bande der beiden Vettern wog die Verbundenheit durch das gemeinsam erlittene Schicksal des Landes. Ras Kassa war stets loyal zu seinem Kaiser, und diese Loyalität übertrug sich auch auf seinen Sohn.
Mein Vater Asserate Kassa wurde 1922 in Fiche, rund hundert Kilometer nördlich von Addis Abeba geboren, wo mein Großvater damals als Generalgouverneur seine Residenz hatte. Im Alter von sechs Jahren wurde Asserate Kassa nach Addis Abeba geschickt. Zusammen mit dem zweiten Sohn des Kaisers, des Herzogs von Harrar, bekam er Privatunterricht in den Räumen des kaiserlichen Palastes. Die Lehrer kamen aus England, und so lernte er neben Schreiben und Rechnen ein geschliffenes Englisch. (Amharisch und Oromifa und auch die alte Kirchensprache Ge’ez hatte er bereits als kleiner Junge im Hause des Großvaters gelernt.) Er war vierzehn Jahre alt, als er 1936 im Gefolge des Kaiserpaars zusammen mit meinem Großvater nach England kam. Dort besuchte er die Monkton Combe School in der Nähe von Bath, im Westen Englands, wo die kaiserliche Familie die Zeit des Exils verbrachte. Im Jahre 1940 sollte er auf die Royal Military Academy nach Sandhurst gehen, um zum Offizier ausgebildet zu werden. Er war gerade zwei Wochen dort, als Italien England den Krieg erklärte und die neue britische Regierung unter Winston Churchill sich bereitfand, die äthiopischen Truppen bei der Befreiung des Landes zu unterstützen. Großbritannien schmiedete Pläne für einen Feldzug, und mein Vater sollte an der militärischen Befreiung an der Seite meines Großvaters und des Kaisers teilnehmen. Also wurde mein Vater in einer Geheimmission von London nach Sudan geschickt. In der Militärschule von Soba, der Schwesterschule von Sandhurst in der Nähe von Khartum, beendete er seine Offiziersausbildung. Im April 1941 rückte er in englischer Uniform im Gefolge des Kaisers in Äthiopien ein. Als sie die erste Stadt auf äthiopischem Boden, Omedla nahe der sudanesischen Grenze, betreten hatten, ernannte der Kaiser meinen Vater zum Oberst im Generalstab – mit gerade einmal achtzehn Jahren war er der jüngste Oberst der äthiopischen Geschichte. Er nahm an mehreren Militäroperationen teil und auch an jener Schlacht am 20.Mai 1941, als die Truppen meines Großvaters zusammen mit britischen Verbänden unter der Leitung des Brigadegenerals Orde Charles Wingate die italienischen Truppen, die unter dem Befehl des Obersten Maravento im Gebiet Salale noch Widerstand leisteten, bei Dera vernichtend schlugen.
Meinem Vater wurde die Ehre zuteil, auf einem stattlichen Schimmel die Siegesparade vor dem Kaiser in Fiche anzuführen. Kurze Zeit später wurde er zum Militärgouverneur der Region Salale ernannt. Alles deutete auf eine militärische Laufbahn hin, doch mein Großvater war darüber gar nicht glücklich. Drei Söhne hatte er im Krieg gegen Italien verloren, und er wollte nicht, daß seinen einzigen verbliebenen Sohn dasselbe Schicksal ereilte. Mein Großvater trug dem Kaiser seine Bedenken vor, und so kam es, daß mein Vater eine zivile Laufbahn einschlug. Als erstes wurde Asserate Kassa zum Generalgouverneur der Provinz Gondar bestellt, und im Lauf der Jahre lernte mein Vater dann die verschiedensten Provinzen seines Heimatlandes kennen, denen er nacheinander als Generalgouverneur vorstand: Gondar, Wolegga, Arusi und Shoa, auf dessen Gebiet auch Addis Abeba liegt, und zum krönenden Abschluß Eritrea.
Meine Eltern kannten sich von Kindesbeinen an, und sie heirateten, nach europäischen Maßstäben, in jungen Jahren. Einundzwanzig Jahre zählte mein Vater zum Zeitpunkt der Hochzeit im Februar 1944, und meine Mutter, Prinzessin Zuriash-Work, war gerade einmal dreizehn. Sie war die Enkelin der Kaiserin Menen aus erster Ehe und zugleich Urenkelin des Negus Mikael von Wollo, jener Provinz im Nordosten Äthiopiens, die im Jahre 1973 durch die Hungerkatastrophe weltweit traurige Berühmtheit erlangen sollte. In früheren Zeiten war die Provinz islamisch, und noch heute leben dort viele Muslime. Negus Mikael nannte sich der große Imam Mohammed Ali. Der schwarze Turban, den er trug, wies ihn als direkten Nachfahren des Propheten Mohammed aus, ein Privileg, das er einzig mit den Königen von Jordanien und Marokko teilte. Er wurde von Kaiser Yohannes IV. bekehrt und getauft und schwor, die orthodoxen Gebote strikt zu befolgen. So eifrig war er in seinem neuen Glauben, daß er sich auch um das Seelenheil seiner Ahnen sorgte. Er soll den Bischof gefragt haben, ob es nicht möglich sei, die Mausoleen zu öffnen, um seine Vorfahren posthum taufen zu lassen. Nicht zuletzt dieser Teil meiner Abstammung mag der Grund dafür gewesen sein, daß ich mich in den letzten Jahren intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt habe.
Auch in der Familie meiner Mutter hatte der Kampf gegen die italienischen Besatzer Wunden geschlagen. Im Alter von sechs Jahren hatte sie bereits ihren Vater verloren, nun war ihr Großvater mütterlicherseits, der einstige äthiopische Kriegsminister Ras Mulugeta, im Krieg gefallen. Daß die Familien meiner Mutter und meines Vaters eines Tages ihre Verbundenheit durch eine Eheschließung zum Ausdruck brachten und bekräftigten, schien fast zwangsläufig. Die Kaiserin, so erzählte es meine Mutter, vergötterte meinen Großvater geradezu. Nie hatte sie es ihm vergessen, wie er sich einst im Krönungsjahre 1930 für sie eingesetzt hatte. Der Kaiser wollte damals den Thron mit einer neuen Frau besteigen und seine erste Frau verlassen. Auf Geheiß ihres Onkels, des damaligen Thronerben Lij Iyasu, war sie neunzehn Jahre zuvor von ihrem Ehemann geschieden worden, um Ras Tafari zu heiraten. Sie hatte sich gefügt und zu ihrem neuen Gatten Zuneigung gefaßt – und nun wollte dieser sie mir nichts, dir nichts verlassen? Mein Großvater war sehr erzürnt über das Verhalten Haile Selassies und scheute sich nicht, ihn zur Rede stellen: »Wie kannst du deine Frau im Stich lassen, die in deinen dunkelsten Tagen immer an deiner Seite stand und die dir sechs Kinder geschenkt hat! Nur weil du ein Auge auf eine andere geworfen hast?« Die Predigt verfehlte ihre Wirkung nicht, und so bestieg sie als Kaiserin Menen zusammen mit Haile Selassie den äthiopischen Thron. Niemand in unserer Familie wollte es als bloßen Zufall betrachten, daß das Datum der Geburt meiner Mutter ausgerechnet auf den Tag der feierlichen Krönung Haile Selassies, den 2.November 1930, fiel. Die verschiedensten politischen und familiären Erwägungen mögen bei der Eheschließung zwischen meinem Vater und meiner Mutter ihre Rolle gespielt haben, aber wer meine Eltern zusammen sah, dem konnte nicht verborgen bleiben, daß sie einander in aufrichtiger Liebe und gegenseitigem Respekt verbunden waren.
Debre Tabor, die Residenz meiner Eltern, befand sich in unmittelbarer Nähe des Anwesens meines Großvaters außerhalb von Addis Abeba auf den Bergen des Entoto, in dreitausend Metern Höhe. Ihren Namen verdankt Debre Tabor dem biblischen Berg Tabor, nach dem auch der gleichnamige Ort in der Region Gondar getauft wurde, der einst den Kaisern Yohannes IV. und Theodorus II. als Hauptstadt diente. Von der elterlichen Villa aus lag einem ganz Addis Abeba zu Füßen. Hier auf dem Entoto hatte einst 1881 der König von Shoa und spätere Kaiser Menelik II. sein Lager aufgeschlagen, Jahre bevor seine Frau, die Königin Taytu, dem im Tal liegenden Gebiet mit seinen warmen Quellen den Namen Addis Abeba – die »Neue Blume« – gab und er selbst im Tal mit dem Bau seines kaiserlichen Palastes begann. Vom Rücken seines Pferdes aus hatte Kaiser Menelik II. die Ländereien auf dem Entoto unter seinen Würdenträgern aufgeteilt, zu denen auch die Vorfahren meines Großvaters Ras Kassa gehörten.
Mein Großvater erbaute sich Anfang der zwanziger Jahre auf dem Gelände eine Residenz und ließ dort auch eine Kirche errichten, die Jesus-Kirche, der er selbst als Patron vorstand. Denn mein Großvater spielte nicht nur eine wichtige Rolle auf dem Gebiet der Politik, er war auch eine tragende Säule der äthiopisch-orthodoxen Kirche. Er war der Patron des größten äthiopischen Klosters Debre Libanos und las als geweihter Priester selbst regelmäßig die Messe. Wenn er sich nicht auf Reisen befand, leitete er oft sonntags den Gottesdienst in der Jesus-Kirche. Als meine Familie ins Exil ging, bemächtigten sich die Italiener der Residenz und ließen sie im Stil des Liberty, des italienischen Art decó, umgestalten. Offenbar bewiesen sie darin Geschmack, denn als mein Großvater seine Residenz 1941 wieder in Besitz nahm, beließ er fast alles so, wie er es vorgefunden hatte. Ich erinnere mich noch an die große Empfangshalle, die mit geprägten Ledertapeten ausgekleidet war. In allen Ecken der Halle standen Liberty-Stühle und Sofas und auf einem Sockel ein großer dunkelgrüner Diwan, über und über mit Seidenkissen beladen, auf dem mein Großvater seine Gäste zu empfangen pflegte. Von der Decke herab hing ein großer funkelnder Kandelaber aus Murano-Glas, auch er ein Überbleibsel der italienischen Zwischenmieter. Vor dem Gebäude hatten die Faschisten meinem Großvater ein imposantes Marmormonument hinterlassen. Über ein Dutzend Stufen stieg man empor zu einer wuchtigen Platte, die wie ein riesiger Sarkophag aussah. In ihr waren die Ziffern 05.05.1936 eingraviert, jenes Datum, an dem die italienischen Truppen Addis Abeba eingenommen hatten. Mein Großvater ließ auch dieses Monument fast unversehrt, er befahl lediglich, die letzten beiden Ziffern zu ändern. So trug das einstige Siegerdenkmal des faschistischen Italiens fortan das Datum 05.05.1941 – das Datum jenes Tages, an dem Haile Selassie siegreich in Addis Abeba wiedereinzog.
Die Residenz erhob sich – vergleichbar einer mittelalterlichen Burg in Europa – majestätisch über der Umgebung. Links und rechts von ihr waren Gemüse- und Obstgärten angelegt, umstanden von Wacholderalleen, Koniferen und Olivenbäumen. In einem separaten Gebäude war ein großer Festsaal untergebracht, der sogenannte Aderash, in dem viele hundert Gäste bewirtet werden konnten. Hier fanden zu traditionellen Feiertagen prunkvolle Bankette statt, Geber genannt, und nicht nur das: Am 27. jedes Monats, dem Tag des Erlösers, wurden hier von meinem Großvater die Bettler der Stadt bewirtet. Sie versammelten sich in Addis Abeba und zogen zur Residenz herauf, wo sie ein Mittagessen und etwas Geld bekamen. Nach dem Tod meines Großvaters setzte mein Vater die Tradition fort. Unterhalb des Aderash befanden sich die Stallungen, in denen Mulis, Ochsen und vor allem Milchkühe untergebracht waren. Hinzu kamen ein kleiner Pferdestall und Garagen für die Wägen und Maschinen. Das gesamte Gelände war umzäunt, und jenseits des Zaunes war die zahlreiche Dienerschaft angesiedelt, deren versprengte Behausungen, von einer Mauer umgeben, sich zu einem kleinen Dorf zusammenfanden.
Kaum fünfhundert Meter von der Residenz meines Großvaters hatte mein Vater im Jahre 1941 seine Villa errichtet, und in unmittelbarer Nähe hatten auch viele meiner Verwandten, meine Onkel und Tanten, ihre Häuser. Mein Vater pflegte zeit seines Lebens die Erinnerung an seine Kindheit in England, also ließ er auch die Villa nach dem Vorbild eines englischen Landhauses gestalten. Die Zimmer und der Salon waren mit prächtigen Stuckarbeiten verziert und mit Seidenvorhängen drapiert, überall im Haus standen Empire-Möbel und viktorianische Antiquitäten. Ich erinnere mich besonders an den imposanten Marmorkamin, der inmitten des Salons stand und an kalten Abenden der Regenzeit seine gemütliche Wärme verbreitete.
Um die Villa herum war ein großer Garten angelegt, den ein Hain von Pflaumenbäumen schmückte. Aus den Pflaumen wurde Jahr für Jahr Pflaumenwein gemacht. Da mein Vater ein großer Rosenliebhaber war, ließ er um die Villa herum einen zauberhaften Rosengarten anlegen. Mehrmals im Jahr ließ er sich die neuesten Züchtungen von Closeburn Nurseries aus Nairobi schicken, ein halbes Dutzend Gärtner wetteiferten auf dem Entoto um die prächtigsten Blüten. Ein Vertreter der Deutschen Botschaft erzählte mir übrigens später, daß auch die 1953 auf der Internationalen Gartenbauausstellung in Hamburg im Beisein Konrad Adenauers auf dessen Namen getaufte Rose in den Rosengarten meines Vaters Einzug gehalten habe – als ein Geschenk der Deutschen Botschaft. Die Konrad-Adenauer-Rose blüht, wie mir der Botschaftsgesandte versicherte, blutrot, sogar mehrmals im Jahr, und verströmt einen besonders intensiven Duft.
Die Freude meiner Familie war groß, als ich am Sonntag, den 31.Oktober 1948, fast fünf Jahre nach der Heirat meiner Eltern, um die Mittagszeit im Kaiserin-Zauditu-Krankenhaus von Addis Abeba das Licht der Welt erblickte, und vielleicht war sie im Hause meines Großvaters am größten. Der Schmerz, den die Ermordung seiner drei Söhne im Krieg ihm zugefügt hatte, war unstillbar. So sah man meinen Großvater nach 1941 nie wieder in seiner prächtigen Uniform, sondern stets in seiner schwarzen Kabba, dem traditionellen äthiopischen Umhang, mit einem Tropenhelm, den er bei feierlichen Anlässen gegen einen Bowlerhut tauschte. Jahr um Jahr verbrachte er im Bangen, ob sich die Linie der Familie wohl fortsetzen würde. Die Sorge wich einer zunehmenden Erleichterung, als er sah, wie dem ersten Kind seines einzigen noch lebenden Sohnes sogar weitere folgten. Sieben Kinder sollte meine Mutter meinem Vater insgesamt schenken.
Die äthiopisch-orthodoxe Kirche leitet ihre Gläubigen mit einer Vielzahl von Riten und Geboten durchs Leben, und wie in allen christlichen Kirchen stellt auch in ihr das Sakrament der Taufe das Tor zum Eintritt in die Kirche dar. Der Tradition zufolge muß die Taufe genau vierzig Tage nach der Geburt stattfinden, wenn es sich um einen neugeborenen Jungen handelt; für Mädchen hält die äthiopisch-orthodoxe Kirche mit Rücksicht auf Evas Sündenfall eine Frist von achtzig Tagen für angebracht. Stets wird die Taufe mit einem großen Fest verbunden, doch in meinem Fall wurde daraus fast eine Staatsangelegenheit gemacht. Drei Tage und Nächte vergingen mit Festivitäten, deren detaillierter Ablauf in der äthiopischen Wochenzeitung Sendek Alamachin (Unsere Flagge) zum Abdruck gebracht wurde. Am ersten Tag waren die Diplomaten und Vertreter der europäischen Staaten zusammen mit der kaiserlichen Familie, Vertretern der Regierung und des äthiopischen Adels zum Bankett in den Aderash meines Großvaters geladen, am zweiten Tag gab es ein großes Essen für die Priesterschaft, und am dritten Tag fand ein Fest statt, zu dem nicht nur alle Dienstboten, sondern die ganze umliegende Bevölkerung eingeladen war. Jener dritte Festtag meiner Taufe soll, so erzählten es mir später nicht wenige der Bediensteten meines Vaters, mit Abstand der fröhlichste und ausgelassenste gewesen sein. Dies gilt sicher nicht für alle der Anwesenden, denn für mich endete meine Taufe fast tödlich.
Wie jede traditionelle äthiopisch-orthodoxe Messe beginnt auch der Taufgottesdienst, der am Anfang der Feierlichkeiten steht, frühmorgens um sechs Uhr, und wie die traditionelle Messe erstreckt er sich über einen Zeitraum von mindestens drei Stunden. Ich wurde in der Jesus-Kirche unweit des Anwesens meines Großvaters getauft, der damalige äthiopische Erzbischof Basileos höchstpersönlich hielt die Messe und achtete darauf, daß die Zeremonie streng nach den Regeln ablief. Zunächst weiht der Priester vor den Augen der versammelten Gemeinde das Salböl, und so war es auch in meinem Fall. Dann hält der Taufpate den Täufling dem Priester entgegen, und der Täufling wird in einer ausgedehnten Zeremonie gesalbt. Da ich keinen irdischen Taufpaten besaß, sondern der heiligen Muttergottes geweiht wurde, war es meine Mutter, die mich in den Armen hielt. Sodann bläst der Priester dem Täufling ins Gesicht, damit der den Heiligen Geist empfange, und also hauchte mir der Erzbischof den Heiligen Geist ein. Erst dann folgt der eigentliche Akt der Taufe, der wiederum mit der Weihzeremonie des Taufbeckens beginnt. Jeder äthiopische Christ hat zwei Namen, einen weltlichen, den er von seinen Eltern verliehen bekommt, und einen kirchlichen, den er bei der Taufe erhält. Der Taufname ist in der Regel für alle kirchlichen Belange, Zeremonien und Sakramente reserviert, zum Beispiel bei einer Hochzeit und der Totenmesse. Nur in einem Falle tritt der Taufname ganz an die Stelle des Geburtsnamens: im Falle der Kaiserkrönung. So nannte sich Ras Tafari Makonnen nach der Ernennung zum Negusa Negast fortan mit seinem Taufnamen Haile Selassie – »Macht der Dreifaltigkeit«. Ich wurde auf den Namen Sarsa Dengel, »Schützling der heiligen Muttergottes«, getauft, da ich an einem Marienfesttag zur Welt kam und die heilige Muttergottes meine Patronin ist.
In Äthiopien ist es Brauch, den Täufling mit dem ganzen Körper ins Taufbecken zu tauchen. »Ich taufe dich, Sarsa Dengel, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes«, sprach also der Erzbischof, bevor ich dreimal von Kopf bis Fuß im eiskalten Wasser verschwand. Heute dürfen die Eltern zur Taufzeremonie warmes Wasser mitbringen, aber damals galt der strenge Brauch noch ohne Ausnahme: Das Wasser mußte eiskalt sein, und der Täufling war dreimal unterzutauchen. Meine Mutter erzählte mir später, daß ich die Prozedur reglos über mich ergehen ließ, ich schrie nicht, ja, ich verzog nicht einmal die Miene. Ich kann es mir nur so erklären, daß mich die klirrende Kälte in eine Art Schockzustand versetzte. Jedenfalls trug ich eine doppelseitige Lungenentzündung davon. Je ausgiebiger und ausgelassener in den darauffolgenden Stunden und Tagen mir zu Ehren und um mich herum gefeiert wurde, desto blasser, kränker und fiebriger wurde ich. Am Morgen nach dem letzten Tag der Feierlichkeiten hatte ich so hohes Fieber, daß ich das Bewußtsein verlor. Als meine Mutter mich reglos in meinem Bett fand, stieß sie einen Schrei aus. Im Nu setzte hektische Betriebsamkeit ein, meine Verwandten rissen sich förmlich darum, mich ins Krankenhaus zu fahren, aber da stand mein Vater schon mit dem Wagen vor dem Tor der Villa Debre Tabor. In Windeseile chauffierte er mich ins Kaiserin-Zauditu-Krankenhaus, das ich doch erst wenige Wochen zuvor verlassen hatte. Es waren nur fünf Kilometer von der Residenz zum Krankenhaus, aber sie schienen sich endlos zu dehnen. Ich lag auf dem Rücksitz im Arm meiner Tante Lady Bezounesh Kassa, und ihr habe ich mein Überleben zu verdanken. Mitten auf der Fahrt – so erzählte es mir Emamma Bezounesh später viele Male wild gestikulierend und mit dramatischen Worten – hörte ich plötzlich auf zu atmen. Meine Tante griff geistesgegenwärtig nach ihrer Shamma, dem traditionellen togaartigen Gewand, legte sie mir auf den Mund und fing an, hineinzublasen. Der Direktor des Krankenhauses, das von schwedischen Ärzten geführt wurde und einen exzellenten Ruf hatte, war schon telefonisch von meiner Ankunft in Kenntnis gesetzt. Dr.Anderson setzte die Mund-zu-Mund-Beatmung fort und leitete eine Herz-Rhythmus-Massage ein. Mein Vater, wenig vertraut mit den Errungenschaften der modernen Medizin, war angeblich nur mit Mühe davon abzuhalten, auf den Doktor loszugehen, als dieser seine verschränkten Arme gegen meinen zarten Brustkorb preßte. Er war felsenfest davon überzeugt, daß der schwedische Arzt dabei war, mich umzubringen. Groß war die allgemeine Erleichterung, als ich ein paar Augenblicke später wieder anfing zu atmen und die Augen aufschlug. Die nächsten Wochen verbrachte ich im Krankenhaus, selten zuvor und selten danach hatte man im Kaiserin-Zauditu-Krankenhaus eine derartige Ansammlung von Besuchern gesehen. Die ganze zahlreiche Taufgemeinde pilgerte an mein Krankenbett. Auch der Kaiser und die Kaiserin ließen es sich nicht nehmen, mich zu besuchen. Mein Überleben wurde in meiner Familie als ein Wunder betrachtet. Und nachdem alles gut überstanden war, bedankte sich mein Vater bei Dr.Anderson mit einer goldenen Omega-Uhr. Emamma Bezounesh beendete die Erzählung von meiner Taufe stets mit einem anerkennenden Nicken, gefolgt von den Worten: »Du hast alle Krankheiten, die ein Mensch haben kann, in den drei Tagen deiner Taufe bewältigt, dir kann nichts mehr passieren.« Sie hatte nicht unrecht damit, seitdem bin ich – Gott sei’s gedankt – von ernsthaften Krankheiten verschont geblieben.





























