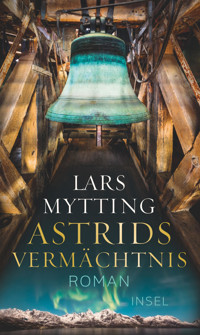Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schwesterglocken-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein norwegisches Tal im Jahr 1880: Der junge Pfarrer Kai Schweigaard will in Butangen eine neue Kirche bauen. Dafür muss die 700 Jahre alte Stabkirche weichen. Mit ihr die beiden Glocken, denen übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden. Und die auf Gedeih und Verderb zusammenbleiben müssen – wie die beiden Hekne-Schwestern, siamesische Zwillinge, zu deren Gedenken sie vor langer Zeit gestiftet wurden. »Eines Tages wirst du dafür bluten«, prophezeit die Hekne-Nachkommin Astrid, die sich vergeblich für den Erhalt des Glockenpaars einsetzt. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Astrid stirbt im Kindbett nach der Geburt von Zwillingen, von denen angeblich nur einer überlebt, Jehan. Den Pfarrer plagen Schuldgefühle. Wie lässt sich das Glockenpaar zurückgewinnen? Die Legende sagt, dass nur zwei »Folgebrüder«, also Zwillinge?, die Glocken wiedervereinen können.
Butangen im Jahr 1903: Jehan lebt als Bauer in bescheidenen Verhältnissen. Ihn zieht es in die Freiheit, zu Fischerei und Rentierjagd. Eines Morgens im August erlegt er einen gewaltigen Rentierbock – und begegnet in diesem Moment einem rätselhaften Fremden.
Ein Roman über den Weg in eine neue Zeit, über Erleuchtung und Mühsal und das Ringen um Liebe, über die Zähmung von Wasserfällen und den ersten elektrischen Lichtstrahl im nächtlichen Dunkel des Tals.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Lars Mytting
Ein Rätsel auf blauschwarzem Grund
Roman
Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel
Insel Verlag
Motto
Es ist aber nichts verborgen, das nicht offenbar werde,
noch heimlich, das man nicht wissen werde.
Darum, was ihr in der Finsternis saget,
das wird man im Licht hören.
Evangelium nach Lukas
Irgendwo im Hekne-Teppich findet sich auch dein Gesicht.
Astrid Hekne
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Motto
Inhalt
Eine vergessene Geschichte 1611-1613
Zwergenwerk
ERSTER TEIL Das Kind des Silberwinters
Die Distel
Die Jagdflinte
Der Riss im Talar
Vierundfünfzig Kronen und sechzig Öre
Unseren Träumen ganz nah
Das Hekne-Gewehr
Der Flickwolf
Der neue Talar
Die Frau, die wusste
Bergkönig und Kronhirsch
Wind aus Südost
Danke, nein danke
Sie war so schön
Das Ren ist nie da, wo es war
Gerhard Schönauer kehrt wieder
Deine Mutter hat wollt, dass du…
Einmal hab ich dich schon begraben
Das Flechtwerk der Verliebtheit
Ein vollgesogenes Glockenseil
Abschied von Butangen
ZWEITER TEIL Der Sprung im Spiegel
Mythische Clara
Kopflos, bei allem
Galerie Apfelbaum
Bauherren
Die Einzimmerhütte
Wie der Herr Pfarrer sterben wird
Funkensprühender Heudraht
Der Meister des Dynamos
Geh ruhig mal selbst in den Stall, Herr Gildevollen
Auf der Höhe der Glockenschläge
»Zieh dich gut warm an, mein Junge«
Der Kreuzmantel
Morgen lassen wir Bomben regnen
Der Hammerschlag auf Hekne
Mir sind mal zu zweien gewesen
Nicht in den Flammen
Das Letzte, was mir machen tun
DRITTER TEIL Ihr Name in Bronze
Unsere armseligen Glocken
Frau Kreis
Wenn du in der Tür stehen und hören willst
Eine alte Blériot
Zum Liebe vollen Gedencken
Das Sakrament des alten Glaubens
Wiedersehen
Dank
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Eine vergessene Geschichte
1611-1613
Zwergenwerk
Der Schlitten glitt leicht über das Eis des Flusses. Der Lågen war auf ganzer Länge gefroren. So benötigten Eirik Hekne und seine beiden Töchter nur drei Tage für die Reise von Butangen nach Dovre.
Im Jahre 1611 führten nur mühsame Karrenwege durch das Tal, wenn aber der Fluss zugefroren war, gingen solche Reisen sehr viel leichter vonstatten, oft sogar fröhlich. Die Leute, die sie im stiebenden Schnee sahen, dachten, die Schwestern würden eng beieinander unter dem Rentierfell sitzen, um sich gegenseitig zu wärmen. Wenn die Pferde ausruhen mussten, stiegen sie nicht ab, und nach ihrem Alter gefragt, antworteten sie, sie seien 1595 geboren, aber Halfrid im Sommer und Gunhild näher an Weihnachten. Dann fuhren sie weiter, ließen die Neugierigen verdutzt stehen, und wenn der Schlitten so weit gekommen war, dass niemand sie mehr hören konnte, lachten Vater und Töchter lange. Ein Lachen mit einem Beiklang war das, Übermut mit einem Kern von Resignation, zwiespältig wie alles andere in ihrem Leben auch, ganz ähnlich dem kurzen Kichern, wenn die eine von ihnen Lust auf etwas hatte und die andere sagte, sie solle doch aufstehen und es sich holen.
Sie trieben die Pferde weiter in nördliche Richtung und machten abends in der Nähe von Sel halt, an einem Hof, wo die Hekne-Leute Bekannte hatten. Dort rutschten die Mädchen vom Schlitten herab, vier Füße trafen den Boden zugleich. Als Erstes zogen sie sich die Schürze zurecht, die so breit war, dass sie beider Leibesmitte bedeckte, dann humpelten sie in ein Blockhaus, wo ein extrabreites Bett auf sie wartete.
Tags darauf waren sie gemeinsam mit der Sonne wach, die aber verschwand, als sie die tiefen Schluchten von Rosten erreichten, in denen ewiger Schatten herrschte. Die Felswände sahen aus wie von einem wütenden Riesen zugehauen. Niemals erreichte die Sonne den Talgrund, es hieß, hier werde es nie wärmer als an einem kalten Oktobertag, und hier lebten ausschließlich Geschöpfe, die kein Licht brauchten – oder keines ertrugen. Ringsum stürzte der Fels in den brausenden Fluss, der an dieser Stelle nie ganz gefror und nur als Schaum zu sehen war. Eirik leitete die Pferde im tiefen Schnee zwischen herabgestürzten Felsblöcken hindurch steil bergauf. Vater wie Pferde, Töchter wie Schlitten waren weiß vom gefrorenen Wasserdunst, durch den sie fuhren, das Tosen war so laut, dass nichts zu hören war und nichts gesagt zu werden brauchte, denn der einzige Gedanke in Rosten galt der Frage, wie lange es noch dauerte, bis man aus Rosten draußen war.
Dann glättete sich die Landschaft wieder, es gab die Sonne doch immer noch, und froh erreichten Pferde und Menschen die Blockhäuser des Hofs Lie, wo sie von der Tante der Mädchen empfangen wurden. Sie war in Butangen bei der unendlich langen Geburt dabei gewesen, an deren Ende ihre Schwester, die Mutter der Zwillinge, starb und die Frauensleute das Wunder bestaunten, das da im Blut von Astrid Hekne strampelte: zwei Mädchen, an der Hüfte zusammengewachsen.
Inzwischen waren diese Mädchen sechzehn Jahre alt und sollten hier in einer Hütte oberhalb von Lie leben, an einem selten befahrenen Karrenweg, in passender Entfernung von den Menschen. Die Hütte war eigens für sie gebaut worden, aus ordentlich winddicht gesetzten Stämmen und ebenmäßig zugerichteten Innenwänden, die gelb leuchteten und nach frischer Kiefer dufteten; ein Schlaf- und ein Arbeitsraum. Sie richteten sich dort ein und scherzten wie üblich miteinander. Als Halfrid Gunhild bat, im Ofen Holz nachzulegen, antwortete ihre Schwester: »Ja, wenn du Wasser holst.«
Seit ihrer Kindheit hatten die beiden Mädchen ihre Familie mit Webarbeiten überrascht und erfreut. In Butangen und den umliegenden Dörfern waren allerdings nur schlichte Muster bekannt. Jetzt wollte Eirik ihnen das jahrhundertealte Wissen zugänglich machen, das, so wusste er, weiter nördlich bewahrt wurde. Bei ihrer Tante konnten sie von den ältesten Meisterinnen aus dem Bøverdal und Lesja und den Dörfern dazwischen lernen. Murmelnd und bedacht, gebeugt und oft barsch, alles Frauen, Trägerinnen von aus der Vergangenheit ererbtem Wissen um Wolle und Pflanzenfarben. Nur sie kannten bestimmte Muster, die von der Nachwelt als skybragd, Wolkenpracht, oder lynild, Blitzfeuer, bezeichnet und weder mündlich erklärt noch schriftlich aufgezeichnet wurden, sondern nur erlernt werden konnten, indem man wochenlang danebensaß und sie dann stets aufs Neue wiederholte.
Ohne dass es ihnen selbst bewusst war, gehörten viele Frauen im nördlichen Gudbrandsdal zu den kundigsten Vertreterinnen der europäischen Webkunst. Tagelang saßen sie vor altertümlichen, an der Wand lehnenden Hochwebstühlen, deren Kettfäden von durchbohrten Steinen beschwert herabhingen. In anderen Ländern war dieses Handwerk durch Zunftregeln oder sogar Gesetze Männern vorbehalten, und was in dieser Gegend smettvev hieß, wurde im übrigen Europa als Gobelin bezeichnet, als Webteppich, Bildwirkerei. Aber was woanders in der Welt vorging, interessierte hier noch weniger, als was auf dem Mond passierte, und wenn sich jemand darüber beschwert hätte, hätte er zu spüren bekommen, dass es für Frauen aus dem Gudbrandsdal, waren sie nun arm oder reich, keine Tradition in Untertänigkeit gab und sie selbst dem geduldigsten Mann die Hölle heiß machen konnten.
Monat um Monat wurden die Hekne-Schwestern von ihren Lehrerinnen besucht. Bei Tageslicht wurde gewebt, am Abend vor der Feuerstelle gesponnen, in deren Wärme das Wollfett weicher wurde. Die Mädchen lernten geheime Techniken der pflanzlichen Wollfärbung, überdies – so wurde erzählt – durften sie im Zwielicht auch einen Blick auf Webstücke aus vorchristlichen Zeiten werfen, auf Bilder, die uralte nordische Sagen erzählten, mit nicht mehr deutbaren Symbolen und Figuren von Gestaltwandlern und Wesen, halb Tier, halb Mensch.
Doch das gehörte zu den Lehren der Nacht. Am Morgen saßen die Mädchen wieder im Sonnenlicht, bereit, Bildteppiche mit der Darstellung christlicher Legenden zu schaffen. Stets Seite an Seite, die breite, schön bestickte Schürze über Leibesmitte und Beinen. Ihre Fingerfertigkeit hatten sie dann schon durch die stets variierenden Zopfmuster bewiesen, die sie einander bei Sonnenaufgang flochten, und die Traurigkeit, die ihre Begleiterin sein musste, war entweder noch nicht herangereift, oder sie hatten sich längst mit ihr abgefunden.
Die Alten entdeckten schnell, wie behände und genau die beiden arbeiteten. Mit ihrer ganz eigenen vierhändigen Methode flochten sie die Fäden rascher ein als sonst jemand, und wer sie beobachtete, dem wurde klar, warum »Weberknecht« (norwegisch »Webweib«) auch der Name einer Spinne war. Bald auch bemerkten die Meisterinnen die besondere geistige Verbindung zwischen den Schwestern. Eng verknüpfte Reflexe, schattenartig gelesene Gedanken – der Einfall der einen war noch nicht mal ausgesprochen, so half ihr die andere bereits bei seiner Verwirklichung. Wenn sie sich aber uneins waren und gegeneinander arbeiteten, ging gar nichts mehr, da konnte die eine sich nichts vornehmen, ohne dass die andere es sofort blockierte oder zerstörte. Zudem sahen sie die störenden Züge der anderen vorher und ärgerten sich zusätzlich darüber. So war es schwer, Frieden zu finden und den Ärger aus der Welt zu schaffen. Dann gab es ein hartnäckiges, fruchtloses Ringen, das die Lehrerinnen beenden mussten, damit eine schöne Arbeit nicht verdorben wurde.
Bis dahin hatten die beiden Mädchen nur selten eigene Muster entworfen und hatten sich die geheimnisvolle Bildsprache, für die sie später bekannt werden sollten, noch nicht erarbeitet. Die sollte sich am deutlichsten in dem nachmals berühmten Wandteppich zeigen, der die Skråpånatta darstellte, die Kratzenacht, das Weltenende, bei dem die Erde bis auf den blanken Fels abgeschabt und Lebende wie Tote zum Jüngsten Gericht geschoben würden. Vorerst webten sie Teppiche mit den Heiligen Drei Königen oder den klugen und den törichten Jungfrauen, und so ging es den Winter und den Frühling hindurch, bis in den Sommer des Jahres 1612.
Dieser Sommer war bis zu einem Sonntag spät im August gediehen, einem Sonntag, der geschichtlich bedeutsam werden sollte. An einem Samstag hätte sich alles ganz anders entwickelt, aber sonntags waren die Dörfler in der Kirche versammelt. Alle außer den zwei Schwestern, die aufgrund ihrer Behinderung Menschenansammlungen mieden.
Auf diese Weise verpassten sie den unerhörten Vorgang, dass der Lensmann von Dovre mitten im Gottesdienst in die Kirche getrampelt kam, schlimmer noch, er hatte seine Streitaxt nicht im Vorraum abgestellt, sondern schritt mit ihr im Arm bis zur Kanzel, stieß den Schaft dreimal hart auf den Boden und gab bekannt, dass das Land sich im Kriege befand. Ab sofort.
Mehrere hundert schottische Söldner waren im Westen des Landes, im Romsdal, an Land gegangen, hatten die Lesja-Dörfer bereits passiert und näherten sich Dovre. Der Pfarrer erklärte den Gottesdienst für beendet, die Kirche leerte sich rasch, und im Laufe des Tages stellte jeder einzelne Hof einen Soldaten. Die Höfe am Talgrund wurden nacheinander verlassen, die Menschen flüchteten sich auf die Sommeralmen, nur das eine oder andere festgebundene Kalb blieb zurück. In diesen Zeiten pflegten Soldaten sich zu nehmen, was sie benötigten, ob Verpflegung, Obdach oder Frauen. Die Gerüchte besagten überdies, dass diese Schotten mit dem Leibhaftigen selbst im Bunde stünden. Es hieß, sie erschlügen jeden, den sie unterwegs antrafen, und würden die Häuser, aus denen diese armen Leute gerannt kamen, niederbrennen. Wer fliehen konnte, werde von ihren Hunden in Stücke gerissen. Sie vergnügten sich damit, dem Milchvieh die Hufe abzuschlagen und es blutend herumstapfen zu lassen. Da war es am besten, auf dem Hofplatz ein Kalb anzubinden und alle Türen offen stehen zu lassen, in der Hoffnung, dass die Soldaten genügend Essen und Platz vorfanden und den Hof verschonten.
Die Hekne-Schwestern blieben zurück. War es, um einen kostbaren Webteppich zu schützen? Sie konnten sich nur langsam zu Fuß fortbewegen, sodass sie dem Feind leicht zum Opfer gefallen wären. Oder wollten sie schlicht und einfach nicht fliehen, aus Gründen, die sie bereits zu dieser Zeit ahnten? Niemand stand ihnen nahe genug, um das zu erfahren.
Tags darauf passierte ein lärmender Trupp von über dreihundert Soldaten Dovre. Voraus die Hunde, gefolgt von Offizieren zu Pferde mit Helmen, Schwertern und je zwei Pistolen. Der Tross bestand aus einem buntscheckigen Haufen von abgerissenen Fußsoldaten und jungen Kerlen. Dann kamen noch ein paar Frauen, Waffenschmiede und Sattelmacher. Als Nachhut folgten einige erfahrene Veteranen.
Da dieses kleine Heer einem schmalen Karrenweg hoch am Hang folgte, kam es direkt an der Tür der Hekne-Schwestern vorüber. Die mussten längere Zeit die Stimmen und das Getrampel von Soldaten und Pferdehufen gehört haben. Fast war der Tross durch, da zügelte ein Offizier sein Pferd und gab einen Befehl. Zwei junge Männer bekamen je ein Schwert, verließen die Reihen und gingen auf das Blockhaus zu. Hinter ihnen wartete die Truppe.
Ohne anzuklopfen gingen sie hinein.
Blieben seltsam lange drinnen.
So lange, dass der Offizier ihnen schon jemanden nachschicken wollte, doch da kamen sie heraus, die Schwerter gesenkt, zwei mit Trinkwasser gefüllte Ledersäcke in den Händen.
Welche Worte an jenem Tag im Hekne-Haus gewechselt wurden, sollte nie jemand erfahren außer den Beteiligten. Gewiss ist, dass Soldaten auf der Hut sind, oft angsterfüllt, und man kann durchaus annehmen, dass diese beiden sich auf den ersten Blick fragten, ob das da am Webstuhl möglicherweise zwei Nornen waren, Schicksalsgöttinnen, die den Lebensfaden eines jeden Menschen sponnen. Auf den Inseln, von denen die Soldaten stammten, lebte der altnordische Götterglauben stark fort.
Sie dürften überrascht gewesen sein, dass sie einander verstanden. Die Offiziere waren Schotten vom Festland, die Söldner aber kamen von den Orkneys und von Hjaltland – so hatten die Wikinger die Shetlandinseln genannt, die vor über sechshundert Jahren von Norwegen aus besiedelt worden waren. Man sprach dort immer noch eine Variante des Altnordischen, obwohl die Inseln jetzt Schottland zugehörten.
Das Heer zog weiter und schlug am selben Abend sein Lager an einer Stelle namens Kråkvolden auf, eine Stunde Marsch südlich des Hekne-Hauses. Dort entzündeten sie Feuer, tranken tüchtig und gaben sich dem ryggtak hin, einer Form des Ringens mit Klammergriffen um den Rücken, wohl auch von ihren norwegischen Vorvätern ererbt.
Was die Bevölkerung allerdings nicht wusste: Die Soldaten planten gar nicht, Norwegen zu plündern. Sie wollten hinüber nach Schweden, um dem schwedischen König als Söldner im Kalmarkrieg gegen Dänemark zu dienen. Sie hatten bislang auf ihrem Weg weder gebrandschatzt noch getötet. Ihren Ruf als wüste Kerle aber verdienten sie durchaus. Fast alle waren sie unbewaffnet, die wenigsten hatten schon gekämpft, die meisten waren zwangsrekrutierte Armeleutesöhne, manche aus dem Gefängnis freigekauft, andere schlicht und einfach verschleppt.
Der Führer dieses Heeres hieß Ramsay, unter ihm diente Oberst Sinclair, der jeden Morgen ein wenig Schießpulver in seiner Handfläche abbrannte, um aus der Form des Rauchs zu deuten, welche Gefahren der Tag bereithielt. Nicht, dass sie die Norweger gefürchtet hätten. Der Marsch durch dieses Land war weniger riskant als die Schiffspassage durch den Skagerrak. Norwegen war abgewirtschaftet und arm, nichts als öde Landschaften, deren abgemagerte Bewohner sich beim Anblick Fremder versteckten. Das hatte die Reise bisher ja bewiesen, oder nicht? Keine Feinde zu sehen!
Doch verbreiteten Nachrichten sich zu jener Zeit nur langsam, und so wussten Ramsay und Sinclair nicht, dass König Christian in Kopenhagen bereits acht Jahre zuvor den Glauben an das Söldnerwesen verloren und zur Verteidigung dieses unwegsamen, von harschem Wetter geplagten Landes eine neue Regelung erlassen hatte, den leidang. Diese Wehrpflicht erlegte den Bauern auf, Soldaten zu stellen, außerdem hatte jeder Hof die Pflicht, ein Gewehr zu besitzen. Es gab ein Warnsystem auf festgelegten Routen mittels Botschaftsstäben, Heerpfeile genannt. Am einen Ende waren sie schwarz angebrannt, am anderen hing eine kleine Schlinge wie von einem Galgen, zur Mahnung, dass jeder Bauer, der den leidang versäumte, am Dachfirst seines eigenen Hauses aufgehängt und das Haus selbst in Brand gesteckt werden sollte.
Die Verteidiger sammelten sich bereits.
Am Dienstag hatten die Heerpfeile auch noch den letzten Winkel des Gudbrandsdals erreicht. Einen Tagesmarsch südlich der Schotten standen fünfhundert Bauernsoldaten bereit, in einer Kringen genannten Gegend, wo der Fels steil in den Laagen abstürzte und ein schmaler, gewundener Pfad die einzig gangbare Passage war. Nebeneinander zu gehen war hier unmöglich. Am Mittwoch erreichten die Schotten diese Stelle. Als das Heer auf seine ganze Länge auseinandergezogen war, fiel ein Schuss, und Oberst Sinclair stürzte vom Pferd, an der Stirn getroffen von einem Jackenknopf aus Erbsilber, zu einer runden Kugel gekaut und abgefeuert aus einem fast zwei Meter langen Radschlossgewehr. Der Schütze war ein Mann aus Ringebu, der wusste, um einen zu töten, der mit dem Teufel im Bunde stand, war Silber vonnöten. Sinclairs einziger Trost bestand darin, dass er in den folgenden Jahrhunderten als Heerführer der Schotten bekannt wurde, denn er war vorausgeritten.
Nun wurden die Schotten mit Gewehren, Spießen und Langäxten von oben angegriffen. Drei Stunden später war die Hälfte der Söldner tot. Nur wenige Norweger waren gefallen. Die überlebenden Schotten wurden ein Stück nach Süden geführt und in eine Scheune gesperrt. Die Lensmänner gaben Order, sie in die Festung Akershus in der Hauptstadt zu bringen und dort den Männern des Königs zu überlassen. Allerdings wurde jetzt im August jede Hand bei der Ernte benötigt, und als spätnachts der Branntwein kreiste, wurde Murren laut, denn um die Gefangenen so weit zu begleiten, brauchte es viele Leute zur Bewachung und große Mengen Verpflegung und würde zudem so lange dauern, dass zu Hause Korn und Heu auf dem Feld verdarben. Das konnte ja wohl nicht der Dank des Königs dafür sein, dass sie das Land verteidigt hatten!
Der nächste Morgen brachte Fluchtversuche, Streit zwischen Wachen und Gefangenen, später auch der Wachen untereinander, und es endete damit, dass die schottischen Söldner je zu zweit aus der Scheune geführt und draußen mit Gewehren und Spießen hingerichtet wurden.
In der Stille darauf stellten sich Schreck und Scham ein.
Helf uns Gott. Was haben wir getan. Großer Gott. Was haben wir bloß getan.
Eine nach innen gewandte Angst. Darüber, zu welcher Brutalität sie fähig waren.
Dazu waren wir imstande. Selbst ich. Selbst du.
Achtzehn Mann kamen mit dem Leben davon, drei davon wurden bis nach Akershus verbracht, wo das Geschehene vom Statthalter aufgezeichnet und die Akte geschlossen wurde. Eine militärische Großtat, von einem Massaker gefolgt – niemand wollte an das Blutbad vor der Scheune erinnert werden. Achtzig Jahre sollten vergehen, bevor der Schottenfeldzug schriftlich erwähnt wurde, in Gedichten und Liedern zum Leben erweckt, und zwar durch und durch als Heldentat. Die einzige Ausnahme war ein Lied, das aber bald wieder in Vergessenheit geriet, da es auch das Massaker erwähnte. Ein Vers davon galt einem Jungen, der verschont wurde. Er hatte sich losgerissen, war mutig auf die Spieße zugeschritten und hatte dabei auf Norwegisch gesagt:
Wenn Gott einst die Toten lässt auferstehen, sollt als Halfrid Heknes Freund ihr mich sehen.
Man darf wohl annehmen, dass es ebendieser junge Mann war, der einige Tage nach der Schlacht in Lie eintraf. Er hatte eine hässliche Stichwunde und sagte, er wolle gegen Kost und Logis gratis arbeiten. Sein Bruder war in Kringen getötet worden. Sie waren Söhne kleiner Leute von den Hebriden, die Arbeit auf Hjaltland gesucht hatten, als die Offiziere junge Männer zwangsrekrutierten. Das verstieß zwar gegen Recht und Gesetz, aber sie waren bewaffnet, die Jungs waren es nicht. Die Bauern in Lie glaubten ihm, er bekam Sense und Axt, Hacke und Spaten. Jeden Tag brachte er Wasser, Feuerholz und etwas zu essen zum Hekne-Haus.
Was genau im Frühsommer des nächsten Jahres geschah, weiß niemand so genau. Der Tante der beiden Mädchen gelang es, die Dinge aus dem Geschwätz der Leute herauszuhalten, und der Einzige außerhalb des Tales, der davon erfuhr, war Eirik Hekne, als er die Mädchen gegen Weihnachten nach Hause holen wollte. Da war die Wunde fast wieder verheilt. Jedenfalls die Wunde, die bluten konnte.
Eines Tages, erzählte die Tante, kamen Schreie aus dem Hekne-Haus, Schreie von beiden Mädchen, so gellend und flehentlich, dass sie unten auf dem Hof zu hören waren. Man rannte hoch und fand die Schwestern blutend und verängstigt. Was geschehen war, wollten sie nicht sagen, außer, dass sie sich selbst versehentlich verletzt hätten und niemand sonst die Schuld trage. Es war schwierig, die Wunde zu versorgen, die Aufregung war groß, und so bemerkte man erst später am Tage, dass der schottische Junge verschwunden war. Er hatte genügend Proviant eingesteckt, um sich bis zur Küste durchzuschlagen. Doch eigenartig, unmissverständliche Spuren zeigten, dass er einen Teil des Gestohlenen wieder in den Vorratsschuppen zurückgebracht hatte. Offenbar hatte er für zwei gepackt, dann aber den Plan aufgegeben und den zweiten Flüchtling zurückgelassen.
Die Wunde entzündete sich, die Mädchen fieberten lange, und dass sie überhaupt überlebten, lag nur daran, so meinte die Tante, dass sie sich mit einem besonderen Messer verletzt hatten, das sie auch bei ihren Webarbeiten verwendeten, dem Geschenk einer Frau aus dem Bøverdal. Dieses Messer war ein Erdfund, also verlorengegangen und irgendwann wiedergefunden, nachdem es bereits vergessen worden war. Es war überdies ebenso scharf wie jene Messer, die von den Leuten als Zwergenwerk bezeichnet wurden, die also von den Unterirdischen geschmiedet und gehärtet worden waren. Solche Messer gab es in jedem Dorf, die Leute reichten sie von Hand zu Hand, um kranke Tiere und Menschen zu heilen, und die Tante meinte, die beiden Mädchen seien nur mit dem Leben davongekommen, weil auch dieses Messer von Zwergen gefertigt worden war.
In der Folge stellte sich eine neue Schweigsamkeit zwischen den beiden Schwestern ein. Zum ersten Mal arbeitete jede für sich an einem eigenen Webstück, und die beiden ersten Arbeiten, die so entstanden, schienen Fiebervisionen entsprungen zu sein. Einem Gerücht nach war der Junge noch einmal nachts zu ihnen zurückgekehrt und hatte Halfrid angeblich etwas dagelassen, das ihr besonders lieb und teuer war, doch niemand erfuhr, worum es sich da handelte. Eirik holte sie nach Hause, und unter dem Eis, über das sie fuhren, trug der Lågen wieder einmal ein Geheimnis aus dem Gudbrandsdal mit sich dem Meer entgegen.
Zu Hause in Butangen zogen sie in das kürzlich errichtete Wohnhaus auf Hekne ein. Ein neuer Hochwebstuhl wurde ihnen hingestellt, hier arbeiteten sie für den Rest ihres kurzen Lebens an einem besonderen Stück. Hekne-Teppich wurde es genannt, als Eirik es nach ihrem Tod der Kirche stiftete; ihre reichste und rätselhafteste Arbeit. Später, nachdem die Schwesterglocken gegossen und nach den beiden Mädchen benannt waren, ahnten die Leute, woher die Macht der Glocken stammte, denn so unzertrennlich wie die beiden Mädchen waren auch die Kirchenglocken. Welcher Freiheitsdrang aber in einer solch schicksalhaften Verbundenheit wohnte, hätte nur begriffen, wer gewusst hätte, was dort in Lie vorgefallen war. So ahnte auch kaum jemand, welche Mächte auf dem Sterbelager der Schwestern entfesselt wurden, als Gunhild ihre Hände mit Halfrids verschränkte und sagte:
Solls du treittn weit und soll ich treittn kort und wann das Stück is fertich solln wir beide wiederkehrn.
ERSTER TEIL
Das Kind des Silberwinters
Die Distel
Manche Menschen bewirken im Tode ebenso viel wie im Leben.
Kai Schweigaard hockte sich hin, das Knie auf die Bibel gestützt. Das tat er sonst nie, wenn er den Talar trug, aber der Wind hatte eine Distel zwischen die Bepflanzung aus Heidekraut und Ranunkeln geweht. Kai wunderte sich, dass sie es so weit geschafft hatte, sonst wuchsen Disteln nur auf der anderen Seite der Friedhofsmauer, um die alten, nicht markierten Gräber von Verbrechern und Selbstmördern.
Schön war diese Distel. Leblos, aber ihre Blätter und Dornen waren immer noch tiefgrün.
In mancher Hinsicht ihr nicht unähnlich.
Er grub ein kleines Loch, schüttelte ein paar Samen hinein und bedeckte sie mit Erde. Dann stand er auf und wischte Gras und Erde von der Bibel.
Manche meinten ja, man müsse die Toten hinter sich lassen.
Aber so konnte nur denken, wer nicht den Tod eines anderen Menschen verschuldet hatte. Vielleicht sogar von zweien oder dreien, wie er dachte, wenn ihn die Sache besonders quälte. Gerhard Schönauer hatte er jedenfalls auf dem Gewissen, vielleicht auch Astrid Hekne. Und möglicherweise auch einen ihrer beiden Söhne, Edgar, der irgendwo anonym in Kristiania beerdigt war.
Unten auf dem Løsnesvatn ließen die Windstöße die Wasserfläche erbeben, bevor sie zu Kai heraufwehten. Es war August, warm, der Wind kam von Süden und trug die Düfte der Løsnesmoore mit sich. Ein Hauch desselben Atems, der die Distel auf Astrids Grab gepustet hatte.
Hin und wieder hatte er so eine Empfindung, als ob etwas geschehen würde. Als stünden seine Füße schwerer auf der Erde des Friedhofs. Als würde etwas ihn rufen. Doch wenn er sich umwandte, war niemand zu sehen. Niemand zu sehen, aber etwas zu spüren, so, wie wenn die Leute aus dem Dorf behaupteten, sie könnten die Kirchenglocke aus der Tiefe des Løsnesvatns hören, die nach ihrer Schwester rief.
Das eiserne Tor in der Friedhofsmauer quietschte. Oddny Spangrud kam auf ihn zu. Obwohl sie schon seit achtzehn Jahren hier wirkte, wurde sie immer noch die Neuhebamme genannt. Offensichtlich hatte sie etwas auf dem Herzen.
Oddny fasste ihre Schürze und verbeugte sich. »Herr Pfarrer?«
»Ja?«
»Da ist Nachricht kommen von der Althebamme. Der Framstad-Alten. Sie hat da was, das sie Herrn Pfarrer sagen will. Aber sie ist zu schlecht zuwege, sie kann nicht runterkommen.«
Schweigaard nickte, er könne gleich heute, spätestens morgen zu ihr gehen. Oddny Spangrud dankte und ging.
Sie war eine gute Hebamme. Gründlich ausgebildet. Zwar hatte sie von der Framstad-Alten die Geburtszange geerbt, die eigentlich nicht mehr verwendet werden sollte, aber da drückte der Bezirksarzt ein Auge zu, gut.
Kai Schweigaard atmete tief ein und ging zum Pfarrhof hinauf. Unterwegs nahm er den Geruch aus Haushälterin Bressums Küche wahr und beschloss, jetzt gleich zur Framstad-Alten zu gehen. Eine Stunde zu Fuß pro Strecke, das passte gut, denn wenn man die Abendessen, die Frau Bressum heutzutage zubereitete, runterkriegen wollte, brauchte man wirklich Hunger.
Man schrieb das Jahr 1903, dennoch sah er dem Kai Schweigaard, der im Frühjahr 1879 hierhergekommen war, immer noch erstaunlich ähnlich. Schlank und kräftig, wenn auch nicht stark wie ein Bauer, aber wach und ausdauernd wie ein erwachsener Jagdfalke. Ein wenig grau an den Schläfen, Geheimratsecken, sehr gut zu seinem Amt passend. Die Erlebnisse um Astrids Tod hatten sein unversöhnliches, kantiges Temperament zurechtgefeilt, der Hang zur Prinzipienreiterei war Großmut gewichen. Aber immer noch kam es vor, dass er ohne Vorwarnung mit der Faust auf den Tisch schlug und trunksüchtigen Familienvätern oder irgendwelchen Quacksalbern gründlich Bescheid stieß. Er arbeitete gern im Pfarrbüro, vom Sonnenaufgang bis spät am Abend, eine Pause machte er nur zur Hauptmahlzeit. Und da er es nicht über sich brachte, Haushälterin Bressum zu kritisieren, waren diese Mahlzeiten entweder versalzen oder fade.
Frau Bressum hatte bereits dem alten Pfarrer gedient, die ersten Jahrzehnte über war sie mürrisch und dickköpfig, jetzt aber von einer etwas fahrigen Launenhaftigkeit. Bisweilen wusste sie nicht mehr so genau, welches Jahr gerade war, und es konnte vorkommen, dass sie Kai mit »junger Herr Pfarrer« ansprach. Beim Pflichtbesuch des Stiftspropstes vor sechs Jahren standen frische Leberküchlein auf der Speisekarte, doch aus Sparsamkeitsgründen hatte Frau Bressum Haifischleber besorgt, die zu nichts anderem taugte als zum Trankochen, und ranzig war sie außerdem. Und zwar schon länger, wie Kai beim zweiten Mundvoll feststellen musste.
Das war die letzte Gelegenheit, bei der im Pfarrhof von Butangen so etwas wie eine Gesellschaft stattfand.
Die Jahre waren vergangen. Mit Psalmengesang und Harmoniummusik, mit Kindstaufen und Tod. Erkältungen und ein hartnäckiger leiser Husten verfolgten Kai von November bis März, nach der Papierarbeit und dem Verfassen der Predigten in dem fußkalten Büro schmerzten ihn Gelenke und Nacken. Mit solchen Plagen musste ein Pfarrer leben.
Aber es gab ja noch die Sonne. Die langen, glutheißen Gudbrandsdal-Sommer, wenn die Hitze an den Hängen flimmerte und die Insekten über die Wiesen summten. Dann fuhr er jeden zweiten Tag mit dem zum Pfarrhof gehörenden Boot hinaus und angelte, mit langen Ruderschlägen, dank derer die winterstarren Schultern wieder geschmeidig wurden. Auf dem Weg zum See ging er häufig an Astrids Grab vorbei, und auf dem Rückweg jedes Mal, wenn er große Forellen gefangen hatte.
Da stand er dann. Vor der Einzigen, der er seinen Fang zeigen konnte.
Damals, im Frühling 1881, als Astrid in der Geburtsstiftung in Kristiania starb, hatte er Gott verflucht und sich von ihm abgewandt. Später waren der Herr und er übereingekommen, dass sie sich in vierzig Jahren wieder beraten wollten. Wenn sich bis dahin herausgestellt haben sollte, dass Astrid Heknes Tod doch irgendeinen Sinn gehabt hatte, wollte Kai wieder ein gottgläubiger Mann werden. Bis dahin versah er seinen Dienst in Butangen nach eigenem Gutdünken, hier, in diesem abgelegenen Winkel, den Gott vielleicht nicht gänzlich vergessen hatte, den er aber ohne größere Qualen anderen Händen überlassen konnte.
Das erste Jahr nach Astrids Tod war pechschwarz und sinnlos, die Arbeit ging zäh, alles, was Kai tat, erschien ihm unnütz. Anfangs war er manchmal so verwirrt, dass er, wenn er etwas Schönes sah, sich vornahm, ihr davon zu erzählen – bis ihm unsanft wieder bewusst wurde, dass sie nicht mehr da war und nie wiederkommen würde.
In den folgenden Jahren nagte die Reue schwer an ihm. Manchmal ließ er den Selbstvorwürfen freien Lauf, dann durchbrachen sie einen Damm, den er selbst immer nur halbherzig wieder instand setzte. Den Silberwinter nannten die Dörfler die Jahreszeit, in der das alles geschehen war, als die Schwesterglocken verschwanden, die Halfrid-Glocke nach Deutschland und die Gunhild-Glocke in den Tiefen des Løsnesvatns.
Er hatte Astrid im Sarg nach Hause gebracht, war aber auch mit einer Pflicht zurückgekehrt, die ihm Kraft und Sinn verlieh. Im Schlitten hatte er den kleinen neugeborenen Jehans auf dem Schoß, in eine Wolljacke gehüllt, die Astrid in den Monaten vor der Geburt gestrickt hatte. Er hatte gelobt, dieses kleine Bündel zu beschützen, und er versuchte, sein Heranwachsen zu begleiten und ihm eine gute Bildung zu vermitteln, was ihm lange Jahre hindurch auch gelungen war.
Jehans wuchs bei den Hekne-Leuten auf. Er gehörte fraglos zu ihnen, aber die Familie war schon früher innerlich uneins gewesen, was sie von Astrids Streben nach Unabhängigkeit halten sollte, und diese Uneinigkeit wirkte sich jetzt darauf aus, wie sie Jehans behandelten. So wurde er nicht mit Kuh-, sondern mit Ziegenmilch aufgezogen und nie nahm ihn jemand mal auf den Schoß. An seinem zweiten Geburtstag gaben sie ihn weg, auf die Häuslerstelle Halvfarelia, und die Alten dort kümmerten sich um ihn wie um ihren eigenen Sohn.
Kai Schweigaard hatte stets verfolgt, wie es dem Jungen ging. Die Wochenenden durfte er auf dem Pfarrhof verbringen, und es gelang Schweigaard, die Talente und Fähigkeiten zu stärken, die er in Jehans erkannte. Als dieser jedoch fünfzehn war, wurde ihrer beider Verbindung jäh abgeschnitten.
Die Trauer kam jetzt eher dumpf. Die schmerzvollen Erinnerungen stachen nicht mehr so. Er genoss es, rauchend und lesend in der guten Stube des Pfarrhofs vorm Kamin zu sitzen, gern bei geöffnetem Fenster, sodass er zugleich die Wärme des offenen Feuers und die feuchte, kühle Abendluft spürte. Manchmal kam Astrid ihm dann ganz nah, eine Verdichtung der Schatten, eine Bewegung der Gardinen, und da kam es vor, dass er sich leise mit ihr unterhielt, froh, bisweilen flüsterte sie ihm sogar etwas zu, andere Male war sie tot. Er wusste, er hätte die Trauer längst hinter sich lassen müssen. Aber das Priesteramt ist nicht gut dazu geeignet, etwas so Schweres abzulegen. Seine Grabreden waren für ihre Einfühlsamkeit und Intensität berühmt. In jedem Sarg, der zu seinen Füßen in die Erde gelassen wurde, lag für ihn Astrid Hekne. Jedes Mal, wenn er die Auferstehung erwähnte, erstand Astrid Hekne auf. Nach all den Beerdigungen war er schlimmer müde, als er seine Gemeinde erkennen ließ. Er saß allein für sich, verschnaufte still, bevor er unabhängig von Wetter und Jahreszeit in den Apfelgarten hinausging und über das Dorf schaute, das seine Heimat geworden war, mit einem Blick, der zugleich nach Erinnerungen wie nach der Sicherheit im Unveränderlichen suchte.
Er zog sich um, Wollpullover, Kniebundhosen und ein Hut mit schmaler Krempe. Er besuchte gern die kleinen Leute des Dorfes, und nur wenn er einem Großbauern gegenüber seine gesamte Autorität ausspielen musste, fuhr er mit Pferd und Kutsche oder Schlitten vor. Typisch für ihn waren ein rascher Gang und eine klare Rede, dazu eine Genügsamkeit, die dem Gebäude des Pfarrhofs ähnelte. Eigentlich waren das zwei Häuser in einem, das große, weiß angestrichene Wohnhaus, zweihundert Jahre alt mit viel zu vielen Zimmern, Fahnenmast, Apfelgarten und einem Grundstück, auf dem noch einige Nebengebäude Platz hatten, darunter, hinter ein paar schirmenden Weidenbäumen, lag der eigentliche Bauernhof, dessen einzige Aufgabe darin bestand, für Nahrung und Transport der Pfarrfamilie zu sorgen. Dort gab es auch Ställe, einen Wagenschuppen und das Haus der Pächter, von dort strich der Geruch von Pferden und Kuhmist zu ihm herauf, gemeinsam mit dem Gackern der Hühner und dem Gemurmel der Hofleute.
Die Dörfler waren großmütig gewesen, als das Christentum kam, und der Pfarrhof lag sehr günstig an einem breiten Hang voller Beete und Kornäcker, die sich bis unten zum Løsnesvatn erstreckten. Das Gelände hatte einiges Gefälle, war aber ebenmäßig, hier lagen die größten Höfe des Dorfes. Jetzt aber stieg Kai Schweigaard einen der gerölligen Karrenwege bergan, die sich am Flussufer der Breia entlangwanden, in einer Gegend, wo Häuslerstellen und kleine Blockhäuser hoch oben an abfallenden Grundstücken lagen, die direkt in den Fluss hinabführten, derart steil, dass man, wollte man nicht abstürzen, hier nur mit talwärts gerichtetem Hintern arbeiten konnte.
Das hier war Butangen, und das waren die Menschen.
Sie hatten ihre Lebenszeit, wie ein Lattenzaun oder ein Pflug.
Er hielt an dem Bach an, wo der Weg sich gabelte. Die eine Abzweigung führte an den kleinsten, ärmlichsten Häuslerstellen des Dorfes vorüber, darunter Halvfarelia, wo Jehans mit seinen Pflegeeltern Anton und Ingeborg lebte, und dann weiter hinauf zu den Sommeralmen. Der andere, schmalere Abzweig, jener, den er nehmen wollte, führte durch dichten Fichtenwald – zu einem verborgen liegenden Haus, in dem verborgen gehaltene Dinge vor sich gingen.
Am Bach füllte er eine flache Metallflasche und trank einige Züge daraus. Von hier hatte er zum letzten Mal Sicht über das Dorf, und wie immer, wenn er es überblickte, verspürte er etwas wie eine Forderung, eine Erwartung seines Wohnorts an ihn. Als ob der Silberwinter seinen Abdruck auf Butangen hinterlassen hätte. Als ob Bäume und Steinhaufen, Äcker und Fluss etwas über ihn wüssten. Als ob diese Natur ihn für etwas benötigen würde und auch die Vollmacht hätte, es von ihm einzufordern.
Wahrscheinlich lag das daran, dass das Dorf wiederum auch von Kais Tätigkeit geprägt war. Am Hang zwischen Pfarrhof und dem Løsnesvatn hatte vormals eine Stabkirche gestanden. Jetzt überlebte nur noch die Erinnerung daran, und an ihrer Stelle befand sich ein weiß gestrichenes Gotteshaus, das nie anders heißen würde als die Neukirche, ebenso gesichtslos wie die Kirchen in der amerikanischen Prärie. Mit dem Glockenstuhl hatte er mehr Glück gehabt, einem fensterlosen, zweigeschossigen Türmchen mit quadratischem Grundriss, das er für die Schwesterglocken hatte bauen lassen. Winters diente es als Leichenhaus für die Toten der Gemeinde. Reihe um Reihe standen dort im Dunkeln die Särge und warteten darauf, dass der Boden im Frühjahr auftaute und man sie hastig unter die Erde bringen konnte. Aber keine Glocken hingen im Glockenstuhl, anders, als er es Astrid versprochen hatte.
Der Anblick, der am meisten von ihm forderte, war der See selbst, das Løsnesvatn. Es bildete die Grenze des Dorfes zur Umwelt, aber auch seine eigene Grenze. Ein recht schmales Gewässer, so lang, dass der Zufluss vom Pfarrhof aus nicht zu sehen war. In der Abenddämmerung lag das Løsnesvatn dunkel und blank unter dem bewaldeten jenseitigen Ufer, es sei denn, seine Oberfläche trug den Abdruck des Windes und kündigte Unwetter an.
Das Wissen darum, was am Grunde des Sees lag, bewirkte in ihm ein beständiges Ziehen. Manchmal dachte er, wenn es ihm gelingen würde, die Glocke aus dem Løsnesvatn zu bergen, dann hätte er sich all seiner Pflichten entledigt. So viele andere hatten schon danach gesucht. Gerade einmal zwölf Jahre alt, hatte Jehans zusammen mit einem Freund ein Floß gebaut, um die Glocke zu finden und hochzuholen. Das war ein paar Jahre her. Bevor Jehans dem Jungen in sich den Abschied gegeben hatte.
In den Jahren davor hatten junge Leute aus Deutschland dasselbe versucht, wohl, weil unten in Dresden eine Belohnung für denjenigen ausgelobt war, der die beiden Schwesterglocken wieder zusammenführen würde.
So viele hatten es versucht, und sämtlich waren sie gescheitert, es ließ sich einzig so erklären, wie die Legende es behauptete: dass nur Folgebrüder – die ohne eine Schwester zwischen einander zur Welt gekommen waren – die Gunhild-Glocke bergen und sie wieder mit ihrer Schwester Halfrid zusammenführen konnten.
Als Kai jetzt über eine Brücke, die sowohl schwer beladenen Pferdefuhrwerken als auch der Schneeschmelze standzuhalten vermochte, über die Breia ging, um zum Haus der Framstad-Alten weiterzugehen, dachte er wieder an sein Versprechen Astrid gegenüber, als die alte Kirche abgerissen wurde, nämlich, nach dem Hekne-Teppich zu suchen.
Es hieß, er zeige das Jüngste Gericht. Lebewesen, halb Vogel, halb Mensch, spuckten Flammen und steckten alles unter sich in Brand.
Angeblich war der Hekne-Teppich irgendwann durch verschlossene Türen aus der Kirche, in der er hing, verschwunden, aber solche unheimlichen, halb okkulten Fantasien weckten in ihm eher den Trieb herauszufinden, was tatsächlich geschehen war. Jedenfalls hatte er sich das einzureden versucht, als er vor vielen Jahren begann, nach dem Webteppich zu suchen.
Überall.
Zu Beginn durchsuchte er sämtliche Gebäude des Pfarrhofs, sämtliche Stockwerke und Keller, kroch unter die auf Pfosten gebauten Vorratsschuppen und stieg in alle Dachböden hinauf, stellte Verschläge auf den Kopf und robbte bäuchlings in Kriechkeller. Der Ertrag bestand aus nichts als ein paar verschlissenen Pferdedecken und muffig riechenden Kleidern, dazu noch Tausendfüßler und Kellerasseln im Halsausschnitt.
Aber versprochen ist versprochen. Und den Toten gegebene Versprechen können irgendwann zur Besessenheit werden.
Bei jedem Besuch auf einem der Höfe bemühte er sich, nicht immer wirklich elegant, das Gespräch auf Webarbeiten zu bringen, oder Vorkleid und Haustracht, wie die Dorfleute es nannten. Einmal vergaß er sich so weit, dass er in einer Abendstube vor einem Webbild stand und es studierte, es mochte dem Hekne-Teppich ähneln, denn es zeigte sechs große Vögel mit aufgespannten Flügeln. Keiner davon spie Feuer oder hatte ein Menschengesicht, dennoch starrte er lange darauf, in der Hoffnung, noch etwas mehr zu entdecken, bis hinter ihm drei trauernde Töchter sich räusperten und ihm bedeuteten, sie seien bereit, schon länger bereit, mit ihm die Grabrede für ihren Vater vorzubereiten.
Ein anderes Mal ertappte er sich dabei, wie er ein Leichentuch an einem Zipfel hochhob und darunter schaute, weil er Stickereien auf der Unterseite vermutete, doch da irrte er.
Der Tote sagte nichts. Aber wer weiß, was er davon hielt.
Das Wort machte die Runde, dass der Herr Pfarrer sich für Gewebtes interessierte, und bald bekam er alle möglichen verschlissenen Tücher und Wandteppiche angeboten, kaufte sie manchmal auch beschämt und hängte sie in seiner Wohnstube an die Wände.
Einen einzigen Hof besucht er nie, nämlich Hekne. Aber dort konnte das Stück nicht sein, dann hätte Astrid es gefunden.
Er besann sich auf den Methodiker in sich und begrenzte die möglichen Jahreszahlen, zwischen denen der Bildteppich hatte verschwinden können. Sich einen Überblick über die früheren Gemeindepfarrer in Butangen zu verschaffen war nicht schwer. Viel schwerer war es, die äußerst umständlichen Notizen seiner Vorgänger zu entziffern, allesamt geschraubt formuliert und in schiefen und krummen gotischen Buchstaben aufgezeichnet, oft mit großen Lücken in der Chronologie. Irgendwann gelangte Kai Schweigaard nach mühseligen Recherchen im bischöflichen Archiv zu zwei wichtigen Erkenntnissen.
Der Pfarrer, der zu Lebzeiten der Hekne-Schwestern hier seinen Dienst versehen hatte, hieß Sigvard C. Krafft. Von 1591 bis 1620 war er in Butangen, dann folgte er einem Ruf nach Nordnorwegen, hinterließ offenbar aber keine schriftlichen Aufzeichnungen, und trotz mehrerer dringlicher Briefe an den Bischof im Norden fand Kai Schweigaard nichts weiter über ihn heraus. Offenbar war er ebenso spurlos verduftet wie der Hekne-Teppich Jahrhunderte später.
Eine andere Figur, die sein Interesse erweckte, war ein gewisser Ørnulf Nilssøn, Gemeindepfarrer in Butangen nur für die wenigen Jahre von 1813 bis 1816. Dieser Nilssøn schien ein zupackender und pflichtbewusster Mann gewesen zu sein. Im bischöflichen Archiv in Hamar – es war so zugestaubt, dass Kai fast ununterbrochen niesen musste – fand er ein Schriftstück, aus dem hervorging, dass Nilssøn ähnlich unternehmungslustig nach Butangen gekommen war wie er auch, denn »ohne Verzug« war eines der Wörter, die er selbst gern verwendete:
Es war für mich von vordringlicher Wichtigkeit, dieser unfruchtbaren und seelenlosen Gemeinde aufzuhelfen. Folglich erarbeitete ich ohne Verzug eine Liste notwendiger Unternehmungen, die ich auszuführen erachtete: 1. Ohne Verzug eine gründliche Reinigung des Inventariums der Kirche verfügen, einbegriffen Auffrischung der rissigen Bemalung der Predigtkanzel. 2. Ohne Verzug das heidnische Webbild verbrennen, das den Glauben der Menschen in die Irre leitet und zugleich junge Rekruten vom Soldatendienst abschrecket, denn es bildet ihnen ein, sie möchten den erschröcklichen Feuervögeln begegnen. 3. Endlich die schon seit Jahren verbotene Unsitte abschaffen, Tote unter dem Kirchboden zu bestatten. 4. Den unwissenden Bauern die Vorzüge der Kartoffelpflanze nahebringen. 5. Ein neues, mit Rentierpelz gefüttertes Messgewand anschaffen, um meine frierenden Gliedmaßen in der unerträglich kalten Kirche zu wärmen. 6. Für standesgemäßes Kirchensilber sorgen, so Altar-Kelch und Kerzen-Ständer, nachdem die jämmerlich kleinen alten verbeult sind und wahrscheinlich aus Falschsilber. 7. In einigen Jahren: eine neue Kirche errichten.
Mit einer gewissen Beklommenheit hatte Schweigaard sich selbst in diesen Plänen wiedererkannt. Aber er ließ die Selbsterforschung beiseite, denn hier hatte er endlich eine Jahreszahl, aber auch eine mögliche Erklärung gefunden. Er stutzte darüber, dass erschröckliche Feuer-Vögel jemanden vom Militärdienst abschrecken können sollten, es klang wie ein Vorwand der Dörfler gegenüber einem naiven Pfarrer, aber dass der Wandteppich selbst Furcht erregen konnte, überraschte ihn nicht. Noch im Jahre 1879, als er nach Butangen kam, war der Aberglauben höchst lebendig gewesen. Im frühen 18. Jahrhundert waren Sitten und Gebräuche hier wohl noch geradezu mittelalterlich, und 1813, einem der schlimmsten Notjahre seit Generationen, mit Hungersnot und Kriegsgefahr, dürfte der Volksglauben eine besondere Blüte erlebt haben, denn Hunger und Angst bewegten die Menschen dazu, in jeder nur möglichen Richtung nach Wegweisung und Zeichen zu suchen.
In jenem Jahr also hatte Herr Nilssøn seinen Dienst angetreten und die Verbrennung des Teppichs befohlen. Wahrscheinlich hatten die Leute lauthals protestiert. Und was war dann tatsächlich geschehen? Dazu fand er keinen Anhaltspunkt. Nur, dass Hochwürden Nilssøn schon drei Jahre später angesichts der seelenlosen Gemeinde und seiner frierenden Gliedmaßen aufgab und Butangen wieder verließ.
Nach sechsjähriger Suche musste Schweigaard aufgeben. Da waren alle Höfe durchforscht und alle bischöflichen Sekretäre ihn leid. Er ließ diese Besessenheit ebenso ruhen wie die Glocke im Løsnesvatn. Er hatte schon seit einigen Jahren nicht mehr an Nilssøn gedacht. Erst jetzt wieder, als er auf seinem Weg zur Framstad-Alten über Butangen blickte.
Du hattest ganz sicher auch so deine Fehler, Nilssøn. Und ich? Ich bin geblieben. Und blicke über dasselbe Dorf, aus dem du geflohen bist. Und über denselben See.
Hier stehe ich und sehe es. Hier stehe ich und fühle es.
Denn ich bin geblieben, und ich blicke auf meine Fehler.
»In zwölf Tagen sterbe ich«, sagte sie.
Sie war uralt geworden, die Framstad-Alte. Runzelig und krummrückig, eine echte Greisin. Im Kanonenofen brannte ein Feuer, Kai roch Kaffee. Die Alte saß in einer Ecke im Schaukelstuhl. Er nahm einen Schemel und setzte sich zu ihr. Die Glut leuchtete schwach durch die Spalten der Ofentür. Es war so dunkel in der Stube, dass sich das Licht in den Winkeln verlor.
»Zwei Sachen darum. Meine Hütte. Die Hütte und das Stückchen Erde. Beides soll die Kirche haben, wenn die Kirche es will. Soll es gut nutzen. Für arme Leute oder Alte.«
Kai Schweigaard sagte, das sei eine sehr großzügige Gabe und eine hochwillkommene dazu, er versprach, sie verantwortungsvoll zu nutzen. Wenn die Zeit gekommen sei.
»Und dann die Blumenwiese über dem Rhabarber. Da hab ich sie beerdigt. Sie alle.«
Als er begriff, wen sie meinte, senkte sich tiefer Ernst über die kleine Stube.
»Wenn ich sie hab mitnehmen müssen. Wenn klar war, sie schaffen es nicht. Die hab ich mit heimnehmen müssen, in der Hebammentasche. Keiner hat sie gesehen. Über zweihundert. Etwas mehr Mädchen als Buben. In all den fünfundfünfzig Jahren. Ich hab sie gezählt. Hab ihnen Namen gegeben und eine Art Zeremonie.«
Wenn ich sie hab mitnehmen müssen. Totgeborene und Kinder, die sie im Mutterleib zerschneiden musste, um die Frauen zu retten. Auf alte Hebammenweise. Rasch handeln, keinen Zweifel über die Notwendigkeit aufkommen lassen. Diese Kinder waren ungetauft geblieben, also waren sie nicht Gottes Kinder und wurden seinerzeit nicht auf dem Kirchhof bestattet. Nur, wenn sie nicht Gottes Kinder waren, was waren sie dann? Das wusste niemand.
»So, jetzt weiß der Herr Pfarrer«, sagte sie. »Dass ihr die Wiese gut haltet und keine Kartoffeln drauf setzt oder Rüben. Du erkennst die Stelle, wenn du sie siehst.«
Kai Schweigaard nickte sachte. Ein langsames, tiefes Pfarrersnicken. Schräg nach unten, ein kurzes Innehalten mit gebeugtem Nacken, bevor er den Blick langsam wieder aufrichtete, als höbe er den Kopf nach einer Schweigeminute wieder zur Welt. Er kannte es. Wie schwarz diese Erinnerungen im Sinn der Eltern standen, wenn die Freude am Hoffnungstag selbst erstickt wurde. Die herzzerreißende Verzweiflung, die allzu lange dauerte und nie ganz erlosch.
Er hatte sich schon gefragt, wo sie geblieben waren, die Totgeburten von Butangen. Den neuen Regeln gemäß wurden sie in ein Tuch gehüllt und am Morgen vor einer Beerdigung in ein frisch ausgehobenes Grab gelegt, sodass hernach ein erwachsener Toter im Sarg über dem Kind ruhte. Aber in so einem kleinen Dorf ohne häufige Beerdigungen ließ sich das nicht machen, und er hatte schon stillschweigend angenommen, dass die Hebammen auf ihre eigene Weise für Abhilfe sorgten. Jetzt hatte er eine Bestätigung für seine Ahnung, auch die neue Hebamme hatte wahrscheinlich ihre Blumenwiese.
Schweigaard räusperte sich, er sagte, er werde die Wiese einzäunen lassen. »Ich werde darauf achthaben.«
»Ja, du passt auf, du.«
Sie schwiegen miteinander.
Sie sagte: »Bist ein guter Pfarrer, du. Auch wenn dein Gottesglauben mehr soso ist.«
Darauf sagte er nichts, sondern fragte, wie sie darauf komme, dass sie noch zwölf Tage habe?
»Hab das Zeichen gesehen.«
Als er sie fragte, was für ein Zeichen, nahm sie seine Hand und drückte sie.
»Wirst ein langes Leben haben, du, Pfarrer. Aber dann wirst du auch das Zeichen sehen. Besonders du, Pfarrer. Besonders du, rechtzeitig.«
Sie ließ seine Hand los, er räusperte sich und fragte nicht weiter. Die Framstad-Alte kam mühsam auf die Beine, holte den Kessel vom Ofen, und sie tranken Kaffee. Auf einem Tischchen lag weißes Leinenzeug, Nadel und Faden, und ihm war klar, dass sie sich wie viele andere Alte in Butangen ihr Leichenhemd selbst nähte, dem Brauch gemäß. Die Situation wirkte nicht makaber auf ihn, denn die alte Frau saß da und schlürfte Kaffee, sie wirkte vollkommen sicher und angstfrei.
»Ich hab dich nicht im Kirchbuch gefunden«, sagte er, »und darum weiß ich nicht, ob du noch Vornamen hast und wann genau du geboren bist.«
Sie kicherte. »Oh, der Herr Pfarrer nimmt es genau.« Sie nannte ihm ihren Vornamen. »Ich bin ein wildes Ding gewesen, ich. Bin der Mutter ausgekommen und unten auf Framstad groß geworden. Da hat’s kein Kalender gegeben. Bin da so um 1810 hin, da hab ich wohl schon können gehen. Jetzt rechne selbst, Pfarrer.«
Sie kicherte wieder. »Mir haben da immer Spaß gemacht mit. Ob die Hebamme mich geholt hat oder ob ich einfach schon da war. Dass ich vielleicht gar nicht geboren bin, sondern einfach angelaufen kommen. Ha! Ich kann’s nicht wissen, ich war noch zu klein.«
Sie stellte die Kaffeetasse hin und griff sein Handgelenk.
»Du, Pfarrer. Das Hekne-Mädchen. Ich weiß, du magst sie.«
Magst.
»Das hat sie gut gewusst. Dass es gefährlich war wegzureisen, um die Kinder zu kriegen. Hätt sie das mit mir auf die alte Art gemacht, dann wär sie jetzt noch am Leben. Aber die Kinder nicht. Die hätt ich müssen wegmachen. Die wären jetzt auf der Wiese droben. Und sie? Hätt hier in Butangen gelebt und andere Kinder gekriegt. Vielleicht deine. Wahrscheints deine. So ist das gewesen früher. Aber sie hat es anders gemacht. Ist weggefahren und hat dort entbunden. In der Stadt. Hat sie müssen. Um sie zu kriegen. Sicher, weil ich ihr den Bauch gefühlt und gewusst hab, sie würde sie nicht rauskriegen.«
»Das hat sie mir erzählt«, sagte Kai. »Dass sie hier war und ein Gesicht hatte. Dass sie ihre Kinder gesehen hat.«
»Sie hat gesagt, es waren zwei. Zwei Buben. Hat sie hier den Weg runtergehen sehen, bergab. Aber ich glaub, sie hat auch noch was gesehen, was ihr Angst gemacht hat. Sie hat nicht sagen wollen, was. Ich hab’s aber verstanden.«
»Der eine Junge ist gestorben«, sagte Kai.
Die Framstad-Alte schien unter der Zimmerdecke nach etwas zu schauen.
»Das hab ich auch gehört. Aber ich glaub’s nicht. Die beiden, ich hab sie in ihrem Bauch gefühlt, beide gleich stark. Das Leben ist ungerecht, aber nicht so. Wegen der Glocke im See. Die nur Folgebrüder holen können. Zwei müssen das sein. Nicht einer, nicht drei. Zwei Folgebrüder, zwei Glocken. Die Hekne-Schwestern waren auch zwei.«
Die Worte gleich stark weckten eine alte Unruhe in ihm. Worin genau die Komplikationen bei der Geburt bestanden hatten, war ihm nie recht klar geworden. Aber dass sie die Hekne-Schwestern erwähnte, weckte eine andere Neugier in ihm.
»Wenn du vor 1810 geboren bist«, sagte Schweigaard, »hast du dann als kleines Mädchen den Hekne-Teppich gesehen?«
»Kann ich mich nicht dran erinnern, nein. Aber unten auf Framstad hat eine davon erzählt. Dass er groß war und seltsam. Dass sie sich nicht getraut hat, den länger anzusehen. Da waren so unheimliche Vögel drauf. Als ob die sie anziehen würden.«
Er fragte, was die Leute damals noch darüber erzählt hatten.
»Oh, so dies und das. Im Hekne-Teppich werden alle ihr Gesicht erkennen, das haben manche gesagt. Aber damals ist so viel gewebt worden, und so viel geredet. Seltsam, aber alle Arbeiten von den beiden Schwestern sind weg. Ich hab gehört, sie haben mit Kettfäden aus Brennnesselstielen gewebt, und die Stücke haben sich gut gehalten. Aber bei anderen haben sie irgendwas gemacht mit den Kettfäden, nach einer Zeit sind die morsch geworden und alles ist voneinandergefallen. Weil sie nicht haben wollten, dass es länger hielt. Weil es seine Aufgabe dann erfüllt hatte.«
»Weißt du, wo der geblieben ist?«, fragte Schweigaard. »Der Hekne-Teppich? Haben sie den versteckt oder verbrannt?«
»Verbrannt nicht. Das hätt ich gehört. Aber verschwunden, das ist er. Einmal hab ich eine getroffen, die wusste, wo er hin war. Nein, die ist schon lang tot. Sie hat gesagt, weit weg ist er nicht. Dass die Leute ihn sehen können, ohne ihn zu sehen. Der sollte so nah sein, dass man ihn nicht sehen kann. Wo, hat sie nicht sagen wollen, nur, dass der Hekne-Teppich wiederkommen wird, wenn die Zeit da ist.«
»Aha – wie lange es bis dahin wohl noch ist?«
»Eine Weile vor der Kratzenacht, hab ich verstanden. So was haben sie eben geredet. Dass sie wiederkommen sollen, die Schwestern. Wenn das Stück gewebt ist.«
»Was das wohl bedeutet«, sagte Schweigaard. »Was meinst du?«
Sie schüttelte den Kopf. »Kann man’s wissen. Wiederkommen sollen sie. Wiederkommen werden mir alle. Aber vielleicht anders, als unsereins mit seinem kleinen Verstand sich das denkt.«
Nachdem sie sich voneinander verabschiedet hatten, stand er vor der Tür und blickte auf ihr Gemüsebeet. Sie musste kurz vor seinem Besuch Unkraut gejätet haben, die Erde um Mohrrüben, Kohl und Kartoffeln herum war frisch und schwarz. Durch ein Fenster sah er, dass sie beim Wasserfass stand und seine Kaffeetasse spülte.
Die Baumkronen bewegten sich schwach im Wind, nichts war zu hören außer Bachgeriesel weiter unten. Schweigaard ging zur Wiese hoch und sah gleich, dies war die Stelle. So, wie man in einem Haus spürte, ob sich jemand darin aufhielt oder nicht.
Hier ruhten sie. Hier um ihn herum. Unter der buckligen Wiese. Unter großen Flusssteinen, sicher aus der Breia, die in regelmäßigen Abständen zwischen Blumen und langen Grashalmen lagen. Hier waren sie. Die Kleinen, die der Tod schon beim ersten Schritt ins Leben umgestoßen hatte. Sie alle hätten Muttermilch kriegen, dann gefüttert werden sollen, sie hätten krabbeln und irgendwann gehen lernen sollen. Hier hätten vielleicht auch sie gelegen, Edgar und Jehans. Wenn Astrid nicht das größte Opfer gebracht hätte.
Heutzutage starben weniger Neugeborene und weit weniger Mütter. Vor einigen Jahren hatte ein Arzt namens Sänger eine Operationsmethode entwickelt, dank der die Mutter beim Kaiserschnitt nicht mehr starb. Das ganze Geheimnis bestand darin, die Gebärmutter mit einem Silberfaden zu nähen. Für seine Entdeckung wurde Sänger mit einer der höchsten Auszeichnungen Norwegens geehrt, dem königlichen Sankt-Olavs-Orden.
Kai Schweigaard hielt seine Bibel hoch und sagte: »Hiermit erkläre ich diesen Ort als gesegnet und geweiht zur Ruhestätte der in ihm schlafenden Leiber. Der Herr lasse seinen Frieden walten über diesen Totenacker bis zum Tage der Auferstehung.«
Zwölf Tage später starb die Framstad-Alte, und er hielt den Begräbnisgottesdienst für sie. Dieses eine Mal war die Kirche ganz voll. Die meisten Erwachsenen des Dorfes hatten durch ihre Hände das Licht der Welt erblickt, und manch ein Mann hatte es ihr zu verdanken, dass seine Frau die Geburt überlebte.
Auch diesmal wieder war Kai Schweigaard mit seiner Predigt nicht restlos zufrieden. Wieder fand er, dass sie von der Form der Neukirche beeinflusst war. Sie strebte gen Himmel, aber der Ton war zu kurz. Drinnen herrschte ein zu helles Licht, ohne dämmerige Ecken und Winkel, was ihm wie die Behauptung erschien, man könne das menschliche Sinnen und Trachten restlos erkunden. Einzig die Klänge der Truhenorgel waren noch unvorhersehbar. Er sehnte sich nach der alten Kirche, nach den tiefen Mysterien, die sie barg, nach der Verbindung mit ihren anderen Kräften, dem Duft von Teer und vergangener Zeit. Die Stabkirche war sehr dunkel, sie verkündete, dass nur wenig im menschlichen Leben voll und ganz verstanden werden kann. Dieser Neubau hingegen versuchte, alles zu erhellen, und dadurch wurden die Unzulänglichkeiten in seinen Gottesdiensten allzu deutlich. Für Kai war es, als würde der Widerhall von den Wänden seine Worte lächerlich machen.
Aber es war unwiderruflich. Er hatte selbst dafür gesorgt, dass die Stabkirche abgebaut wurde. So stand er jetzt hier in seinem Talar und hörte sich zu. Schweigaard blickte über die Kirchenbänke vor ihm, in dem harten Licht waren alle Gesichter zu erkennen. Nur das von Jehans nicht. Wie üblich war er nicht zu sehen, weder in der Kirche noch sonst wo. Wahrscheinlich war er wieder drinnen im Gebirge auf der Jagd.
Draußen genügte ihm der Anblick des Sargdeckels. Der Geruch der Erde, die dumpf darauf klatschte. Ihre Worte kamen ihm in Erinnerung.
Aber dann wirst du auch das Zeichen sehen. Besonders du, Pfarrer.
Sie war tatsächlich zwölf Tage später gestorben, da konnte er das andere, was sie gesagt hatte, nicht einfach so wegschieben.
Schweigaard segnete die große Trauergemeinde, die sich zum Gehen umwandte, darunter auch Oddny Spangrud, die von heute an nur noch die Hebamme genannt würde, nicht mehr die Neuhebamme. Nachdenklich blieb er stehen. Spürte die Angst vor der verrinnenden Zeit, eine Empfindung, die auf dem Friedhof durchaus nicht fehl am Platze war, am Aussichtspunkt in die Ewigkeit.
Sie hat gesagt, weit weg ist er nicht. Dass die Leute ihn sehen können, ohne ihn zu sehen.
Er ging zu einer nicht weiter markierten Stelle in der Wiese oberhalb der Kirche, suchte ein wenig mit der Schuhspitze, bückte sich dann und zog das halblange Gras über einem faustgroßen, schwarz und weiß glitzernden Pflasterstein beiseite. Hierher, an diese freie Stelle, hatten sie 1880 die Särge umgebettet, die unter dem Boden der alten Kirche gelegen hatten. Allesamt grau und verwittert, manche so rissig, dass zwischen den Planken Totenschädel und Knochen zu sehen waren.
Ein einziger Sarg hatte sich von den anderen unterschieden. Gezimmert aus unvergänglicher Erzkiefer. Die Form eher rechteckig, ohne Kopf- oder Fußende, eher eine Kiste, und als sie ihn bewegten, waren keine klappernden Gebeine zu hören. Darum hatte er die Stelle mit diesem Pflasterstein markiert.
Jetzt war eine alte Unruhe in ihm erwacht. Und zugleich sein alter Tatendrang. Der ihn dazu gebracht hatte, Beerdigungssitten, Armenfürsorge und Schulwesen des Dorfs zu modernisieren.
Dieser Bußgang hatte jetzt wahrhaftig lange genug gedauert.
Die stille Kiste. Und wenn jetzt kein menschlicher Leichnam darin beerdigt war, sondern jener legendäre Bildteppich?
Konnte es sein, dass er nie aus der Kirche verschwunden war? Dass jemand auf raffinierte Weise – in diesem Dorf durchaus nicht undenkbar – ihn in einem Sarg unter dem Kirchenboden deponiert hatte? So wäre er immer noch vorhanden und damit wirksam, zusammen mit den anderen Kräften, die in der Stabkirche atmeten und lebten?
Kai Schweigaard eilte zum Pfarrhof hinauf und rief Frau Bessum zu, sie solle ein spätes Abendessen für ihn und den Kirchendiener, Røhme, vorbereiten. Nein, nicht jetzt, ein spätes Abendessen. Um sieben herum. Ja, am besten Fisch! Die Forellen, die ich gestern Abend geangelt habe! Rasch ging er die Treppe zu einer Dachkammer hinauf und klopfte an.
»J-ja?« Kurz darauf öffnete der Kirchendiener die Tür.
»Herr Røhme. Ziehen Sie Arbeitssachen an. Wir müssen etwas – erledigen.«
Der Mann nickte. Schweigaard erklärte ihm, was er vorhatte, Røhme musste ein paarmal schlucken, dann schüttelte er den Kopf.
»Keine Sorge«, sagte Schweigaard. »Es ist ja ein Kirchhof. Die Leute kennen es so, dass da gegraben wird. Nur daran, dass ein Sarg hochkommt, sind sie nicht gewöhnt. Und das behalten wir für uns. So weit wie möglich.«
Die Jagdflinte
Die Rentiere kamen den Berghang herab wie die französische Kavallerie, nur stolzer, dichter und rascher. An Geweihen, von denen kürzlich erst der Bast abgefegt worden war, glänzte Blut wie an Schwertern nach der Schlacht, mit dem Unterschied, dass dies hier keine Überlebenden oder Auserwählten waren – alle, Kälber, Jährlinge und Jungböcke, Kühe und Großböcke, alle miteinander, die ganze Herde, kamen wie aus der Urzeit angesprungen, hinter der Leitkuh her. Weit ausladende, hohe Geweihe, spitze Sprossen, lang genug, um sie einem Vielfraß oder Wolf oder, zur Brunftzeit, sich gegenseitig ins Herz zu rammen. Diese Waffe war die Belohnung für viele Jahre des Lebens im kahlen Gebirge, wo sie nirgends hängen blieb, sodass das Geweih freier und breiter und größer wuchs als bei Elch oder Hirsch, den Verwandten, die sich kaum ins Freie wagten, sondern sich im Wald versteckt hielten.
Vierhundert Stück mussten es sein, sie hatten drinnen im Gebirge Frost und Stürmen und Schneeregen getrotzt, oft auch allem auf einmal, sie waren den Winter über gewandert und hatten den Schnee weggescharrt, bis sie auf Flechten stießen, dieselben Rentierflechten, auf denen die hochträchtigen Kühe im Frühling ihre Kälber bekamen und sie säugten, bis sie ihnen beibrachten, selbst zu fressen, und so würden sie das ganze Jahr über weiden und stärker werden, in kleinere Herden aufgeteilt, bis die erwachsenen Böcke sich absonderten und darum kämpften, sich mit möglichst vielen Kühen zu paaren. Danach hatten sie sich wieder gesammelt, um dem Winter und ihren Fressfeinden zu begegnen, lang gestreckte Herden, die durch die Gebirgsformationen glitten wie fließendes Wasser. Aus einiger Nähe ließen sich Geweihe ausmachen, die hoch über die Rücken der Jungtiere und Kühe hinausragten. Das waren die alten Männchen, das Erbgut, Böcke, so groß, dass ihre Zotteln unter den Hälsen bis zum Boden reichten; erblickten sie Feinde, konnten sie sich im Kreis aufstellen und alles niedertrampeln und aufspießen, das näher zu kommen wagte.
Meistens aber verschwanden sie einfach. Sie kamen aus dem Nichts und wurden zu Nichts.
Seit zwei Tagen hatte Jehans sie jetzt verfolgt, obwohl er dieses Wort so nicht verwenden würde, denn einer Rentierherde zu folgen war unmöglich. Seit zwei Tagen aber hatte er ihre Nähe gespürt, hatte an ihren Wanderrouten auf der Lauer gelegen und im Wind nach ihnen geschnuppert, an Bergen mit Namen nach ihnen gespäht, aus denen das Schroffe, Trostlose sprach, das Grau des Gebirges: Jammerdalshøgda, Kleberkakken, Gråhøgda. War durch Hochmoore gestapft, wo er sie vermutete, hatte dasselbe getan, das die Rentiere getan hätten, und dabei stets gedacht: Würden sie mich jagen, ich hätte keine Stunde mehr zu leben.
Es war ungewöhnlich, dass sich so viele Tiere um diese Zeit des Jahres zusammenschlossen, aber sein einziges sicheres Wissen über Rentiere bestand darin, dass man nie sicher sein konnte. Er erinnerte sich an jedes einzelne Ren, das er geschossen hatte, und nie hatten die Umstände sich geähnelt.
Er legte sich flach auf den Bauch und folgte ihnen mit den Blicken.
Die Herde ließ sich in einem Moor zur Ruhe nieder. Flirrender feuchtwarmer Dunst ließ den Anblick immer wieder verschwimmen.
Der Hauptteil der Herde war weit entfernt, aber jetzt sonderte ein kleiner Trupp sich ab und kam näher, ein Aufzug von grauen Mähnen, langen Beinen und knorrigen Geweihen. Jehans lag mucksmäuschenstill da, bis auch diese Tiere erst niederknieten und sich dann hinlegten. Das eine oder andere Geweih war noch im Heidekraut zu sehen, dann verschwand es auch.
Nur die Leitkuh stand noch, und so würde es bleiben.
Der niemals ruhende Wachtposten. Eine alte Kuh, die nicht mehr trächtig werden konnte. Eine, die alles gesehen und alles überlebt hatte und die jüngeren jetzt schützen konnte.