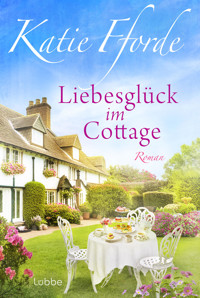9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein romantischer Sommer in einem Château in der Provence
Sommer 1963. Gerade hat die junge Alexandra in London ihre Ausbildung als Köchin abgeschlossen, nun träumt sie von einer Anstellung in Paris. Doch eine Verwechslung führt sie in die Provence - in das charmant verwitterte Château des Comte Antoine de Belleville. Der ist als alleinerziehender Vater heillos überfordert mit drei eigenwilligen Teenagern, die Alexandra nun für vier Wochen als Nanny betreuen soll. Kein Problem für sie - kochen kann sie, und was sie nicht kann, wird sie eben mit Humor meistern. Eine weitaus größere Herausforderung ist der ebenso chaotische wie unverschämt gutaussehende Antoine, von dem Alexandra sich schon bald magisch angezogen fühlt.
»Katie Fforde ist die Königin traumhaft romantischer Wohlfühlgeschichten voller Zuversicht« DAILY MAIL
Die britische Bestsellerautorin Katie Fforde begeistert mit ihren romantischen Geschichten auch im ZDF Herzkino ein Millionenpublikum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Weitere Titel
Titel
Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Epilog
Dank
Über das Buch
Sommer 1963. Gerade hat die junge Alexandra in London ihre Ausbildung als Köchin abgeschlossen, nun träumt sie von einer Anstellung in Paris. Doch eine Verwechslung führt sie in die Provence – in das charmant verwitterte Château des Comte Antoine de Belleville. Der ist als alleinerziehender Vater heillos überfordert mit drei eigenwilligen Teenagern, die Alexandra nun für vier Wochen als Nanny betreuen soll. Kein Problem für sie – kochen kann sie, und was sie nicht kann, wird sie eben mit Humor meistern. Eine weitaus größere Herausforderung ist der ebenso chaotische wie unverschämt gutaussehende Antoine, von dem Alexandra sich schon bald magisch angezogen fühlt.
Über die Autorin
Katie Fforde wurde in Wimbledon geboren, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Heute lebt sie als freie Autorin mit ihrer Familie in einem idyllisch gelegenen Landhaus in Gloucestershire. Mit ihren heiteren, herzerwärmenden Romanen erobert sie regelmäßig die britischen Bestsellerlisten. Darüber hinaus ist Katie Fforde als Drehbuchautorin erfolgreich, und ihre romantischen Beziehungsgeschichten begeistern auch in der ZDF-Serie Herzkino ein Millionenpublikum.
Weitere Titel der Autorin
Zum Teufel mit David
Im Garten meiner Liebe
Wilde Rosen
Wellentänze
Eine ungewöhnliche Begegnung
Glücksboten
Eine Liebe in den Highlands
Geschenke aus dem Paradies
Sommernachtsgeflüster
Festtagsstimmung
Eine kostbare Affäre
Cottage mit Aussicht
Glücklich gestrandet
Sommerküsse voller Sehnsucht
Botschaften des Herzens
Das Glück über den Wolken
Sommer der Liebe
Fünf Sterne für die Liebe
Eine unerwartete Affäre
Eine perfekte Partie
Rendezvous zum Weihnachtsfest
Sommerhochzeit auf dem Land
Eine Liebe am Meer
Begegnung im Mondscheingarten
Weihnachtszauber im Cottage
Das Paradies hinter den Hügeln
Rosenblütensommer
Wo die Liebe Urlaub macht
Sommerfest der Liebe
Übersetzung aus dem Englischen von Gabi Reichart-Schmitz
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe: Copyright © 2023 by Katie Fforde Ltd Titel der englischen Originalausgabe: »A Wedding in Provence« Originalverlag: Century/The Random House Group Limited, London
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Covergestaltung: Kirstin Osenau Covermotiv: © Chiyacat/Shutterstock; majeczka/Shutterstock; Manzhula Alexander/Shutterstock; Irina Wilhauk/Shutterstock; simoly/Shutterstock; marebella/Shutterstock; Bermek/Shutterstock; Bermek/Shutterstock; Terezika/Shutterstock; RomanaMart/Shutterstock Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, PößneckISBN978-3-7517-5599-3
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de
Für meine liebe Freundin Jane Wenham-Jones 1962 – 2021, in Liebe
1. Kapitel
Paris, Herbst 1963
Alexandra konnte ihr Glück noch immer kaum fassen – sie war in Paris! Nun ja, es war nur für vierundzwanzig Stunden, doch der Oktobertag war strahlend und voller Verheißungen. Sie liebte diese Stadt, obwohl sie erst einmal dort gewesen war, vor vielen Jahren, als ihr Kindermädchen sie mitgenommen hatte, damit besagte Kinderfrau ihren Freund besuchen konnte. Paris hatte Alexandra tief beeindruckt. Deshalb genoss sie auch jetzt jeden einzelnen Augenblick.
Am folgenden Tag würde sie mit dem Zug in die Schweiz reisen, um dort ein Mädchenpensionat zu besuchen, oder was auch immer ihre wohlmeinenden und fantasielosen Vormunde für eine gute Idee hielten. Dort sollte ihr der letzte gesellschaftliche Schliff verpasst werden. Doch der heutige Tag gehörte ihr allein, und sie hatte schon so einiges ausgekundschaftet.
Als sie am Fuße von Montmartre von einer Windböe erfasst wurde, zog sie den Gürtel ihres Regenmantels ein wenig enger. Staunend sah sie zu Sacré-Cœur auf und bewunderte die Schönheit der Kirche.
Sie wollte gerade die zahlreichen Stufen hinaufsteigen, da hörte sie hinter sich einen leisen Aufschrei. Alexandra drehte sich um und sah eine hübsche junge Frau mit blondem Haar, die sich entsetzt die Hände vors Gesicht geschlagen hatte. Zu ihren Füßen kullerten Kartoffeln und Zwiebeln in alle Richtungen, und in der Hand hielt sie ein zerrissenes Einkaufsnetz. »Ich kann es nicht fassen!«, jammerte sie leise und begann zu weinen. »Da denkt man, der Tag hätte schon schlecht angefangen, und dann wird es noch schlimmer!«
Alexandra brachte es nicht übers Herz, sie einfach zu ignorieren. Die Frau war offensichtlich kaum älter als sie selbst mit ihren zwanzig Jahren, und sie war vollkommen aus der Fassung. Außerdem sprach sie ebenfalls Englisch, wenn auch mit einem amerikanischen Akzent.
»Hör mal, alles ist gut! Ich helfe dir.« Alexandra ging in die Hocke und begann, das Gemüse aufzusammeln. Sie schlug den unteren Teil ihres Mantels hoch und legte die Kartoffeln und Zwiebeln hinein.
»Es ist sehr nett von dir, dass du mir helfen willst«, sagte die junge Frau, die sich offenbar ein wenig gefasst hatte. »Aber falls du keine Tasche dabeihast, können wir das Zeug auch genauso gut liegen lassen!«
Alexandra betrachtete ihren Schoß. Die Frau hatte nicht ganz unrecht; sie würde nicht gehen können, wenn sie das ganze Gemüse an ihren Bauch presste.
»Sicher können wir unsere Taschen damit füllen. Oh, sieh dir mal diesen Knoblauch an!« Sie war an feste, kleine Knoblauchknollen gewöhnt, doch diese große, violette Knolle von der Größe eines Tennisballs erinnerte Alexandra an den Kochkurs, den sie vor Kurzem in London absolviert hatte. Gleich zu Beginn hatte Madame Wilson gesagt, wie jämmerlich doch der Knoblauch in England sei. Diese Knolle hier stammte eindeutig aus Frankreich.
»Du kannst ihn haben, wenn du möchtest«, erwiderte die junge Frau. »Ich habe keine Tasche, ich werde ihn nicht verwenden.«
»So schlimm ist es bestimmt gar nicht«, gab Alexandra beschwichtigend zurück. »Steck doch alles, was reinpasst, in deine Handtasche …«
Die Frau schwenkte ihre winzige Tasche in Alexandras Richtung.
»Okay, dann müssen wohl meine Manteltaschen herhalten. Und ich kann auch ein paar Teile in meine Handtasche stopfen, allerdings vielleicht nicht den Kohlkopf.«
Alexandras Tasche war eine Posttasche und ziemlich geräumig, doch eindeutig nicht groß genug für etwas von der Größe eines menschlichen Schädels.
»Das ist so nett von dir, aber ich habe nichts, worin ich das Gemüse transportieren könnte. Ich weiß noch nicht mal, warum ich das ganze Zeug gekauft habe. Ich soll für heute Abend eine Dinnerparty organisieren und habe nicht einmal einen Menüplan! Ich kann nicht kochen, und ich bin nicht in der Lage, für eine Mahlzeit einzukaufen! Mein Mann wird so enttäuscht von mir sein.«
»Seid ihr frisch verheiratet?« Es musste so sein, wenn man bedachte, wie jung diese Frau war.
»Sehr frisch! Und wenn das so weitergeht, zweifele ich daran, ob wir das erste Jahr schaffen werden. Er hat mich zum ersten Mal gebeten, mich um eine große Dinnerparty heute Abend zu kümmern, und schon erleide ich Schiffbruch!« Die Frau wirkte immer noch verzweifelt, weinte jedoch nicht mehr. »Hör mal, können wir irgendwo was trinken gehen? Auch wenn es nur ein Kaffee ist? Ich habe mit niemandem mehr Englisch gesprochen, seit wir in Paris sind – abgesehen von meinem Mann, er ist auch Amerikaner. Das wäre ja normalerweise nicht so schlimm, doch ich spreche kein Französisch!«
Alexandra war von Natur aus gutherzig und konnte der jungen Frau, die schrecklich einsam sein musste, die Bitte nicht abschlagen. »Warum nicht? Hier ist ein hübsches Café – hast du schon zu Mittag gegessen? Ich nicht. Und ich spreche Französisch. Natürlich nicht perfekt, aber ganz passabel.« Alexandra hatte Hunger. Weil sie jede Minute ihrer Zeit in Paris auskosten wollte, war sie zu früh aufgestanden, um in ihrer Pension frühstücken zu können. Außerdem hatte sie schon weite Strecken zu Fuß zurückgelegt.
»Oh! Ich würde liebend gerne in ein Café gehen, vor allem weil ich in deiner Gesellschaft nicht mit den Kellnern kämpfen muss, um mich verständlich zu machen!«, erwiderte die Frau. »Ich heiße übrigens Donna.« Die Amerikanerin streckte die Hand aus.
»Alexandra.« Sie schüttelte Donna kurz die Hand. »So, nun lass uns etwas essen gehen.«
Als schließlich Teller mit steak frites und eine Flasche Wein vor ihnen standen und sie beide schweigend einige Bissen gegessen hatten, ließ Donna Messer und Gabel sinken.
»Ich werde dir jetzt kurz meine Geschichte erzählen«, sagte sie, »und danach möchte ich deine hören.«
Alexandra lächelte. »Dann schieß mal los.«
»Nun, ich bin in Connecticut aufgewachsen und habe sehr jung einen netten Mann geheiratet, den auch meine Eltern für gut befunden haben. Er heißt Bob. Dann wurde er ziemlich bald beruflich nach Paris entsendet. Das klingt erst mal sehr romantisch und ist es eigentlich auch, aber nicht, wenn man die Sprache nicht beherrscht, der Mann den ganzen Tag nicht da ist und man noch keine Freunde hat. Außer dem Hausmädchen habe ich niemanden, mit dem ich reden könnte, doch sie versteht kein Englisch – außerdem hasst sie mich! Meine Eltern sind nicht glücklich darüber, dass ich so weit weg bin, und fragen in ihren Briefen ständig, ob Bob nicht wieder in den USA arbeiten kann. Na ja, eigentlich ist es hauptsächlich meine Mutter, die das anspricht.«
Donna hielt inne, um Luft zu holen. »Das ist im Wesentlichen meine Geschichte. Paris ist eine wunderschöne Stadt, und ich würde sie sehr gerne besser kennenlernen«, fuhr sie seufzend fort. »Jetzt bist du an der Reihe.«
»Du hast mir noch nicht von der Dinnerparty erzählt«, erwiderte Alexandra, »aber ich gebe dir schnell eine Zusammenfassung meines Lebens. Ich bin in London aufgewachsen und habe keine Eltern mehr, doch es gibt Verwandte, die sich um mich kümmern. Eine Zeit lang habe ich mit Freunden in einem großen Haus gelebt, das sich im Besitz meiner Familie befindet, und jetzt muss ich in die Schweiz reisen.«
Alexandra zögerte kurz. »Meine Verwandten haben herausgefunden, dass ich mein Leben nicht so führe, wie sie es für angemessen halten. Deshalb haben sie mir mitgeteilt, dass ich mich ins Zeug legen und tun muss, was sie wollen.«
Wenn man es so ausdrückte, klang es nicht sonderlich dramatisch, doch zu dem Zeitpunkt war es für Alexandra schlimm gewesen. Sie hatte die Hochzeit ihrer guten Freundin Lizzie besucht. Als sie zusammen mit David, der fünfzehn Jahre älter als sie und ihr bester Freund war, zurückgekehrt war, hatten sie das Haus hell erleuchtet vorgefunden. Nachdem ihr ganz kurz der Gedanke durch den Kopf geschossen war, dass sich Einbrecher im Haus zu schaffen machten, wurde ihr klar, dass ihre Verwandten aus der Schweiz gekommen sein mussten.
Damit war für David und sie das lockere Leben vorbei. David kehrte nicht einmal ins Haus zurück; er kam bei einem Freund unter, bis die Luft wieder rein war. Zum Glück hassten die Verwandten London und blieben nicht lange, doch ihre Anweisungen für Alexandra waren eindeutig: Sie hatte sich im folgenden Monat in der Schweiz einzufinden.
»Wie schrecklich, dass du ohne Eltern aufgewachsen bist! Aber du hast doch Verwandte. Warum haben sie dich nicht aufgenommen, nachdem deine Eltern gestorben waren?«, wollte Donna wissen.
»Ich weiß es nicht, ich bin jedoch wirklich froh, dass sie es nicht getan haben. Ich hatte jede Menge Kindermädchen und Leute, die sich um mich gekümmert haben. Das hat mir nichts ausgemacht. Meine Verwandten wollen das Beste für mich, doch ich wäre nicht glücklich gewesen, wenn ich bei ihnen gelebt hätte.« Alexandra trank einen Schluck Wein, um sich von der Vorstellung zu erholen. »Sie sind sehr puritanisch und zugeknöpft. Ich bin eher ein Freigeist.«
»Meine Güte!«, entfuhr es Donna. »Das klingt so – verwegen!«
Alexandra lachte. »Es hat Spaß gemacht, vor allem, als ich in der Kochschule meine zwei ganz besonderen Freundinnen kennengelernt habe.«
»Du bist gelernte Köchin?«
»Nein! Ganz bestimmt nicht, aber ich kann jetzt einigermaßen gut kochen. Ich habe einer meiner Freundinnen bei ein paar Profi-Jobs geholfen. Meg ist eine hervorragende Köchin.«
»Wäre sie doch nur hier!«, seufzte Donna, der offensichtlich die Dinnerparty wieder eingefallen war, die sie eigentlich verdrängen wollte.
»Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich dich etwas Persönliches frage?«
»Nur zu«, antwortete Donna. »Es tut so gut, jemanden zum Reden zu haben. Da ist es mir egal, ob du diskret bist oder nicht.«
»Das Gefühl kenne ich. Ich hatte in London einen ganz reizenden Freund, der mein Vertrauter war, doch Freundinnen sind etwas anderes, nicht wahr?«
Donna nickte. »Was willst du mich denn fragen?«
»Hat Bob einen gut bezahlten Job? Ich meine, falls Geld keine Rolle spielt, könnten wir jemanden suchen, der für die Dinnerparty kocht – dann müsstest du dir keine Sorgen mehr machen. Ich habe schon selbst solche Aufträge ausgeführt.«
»Ich hatte ja jemanden! Ich hatte einen Koch gebucht, und dann bekam ich von ihm eine Absage. Bob hat nur gemeint: ›Oh, du kannst es ja selbst machen, Schatz, das wird schon.‹ Danach hat er seine Zeitung zur Seite gelegt und ist zur Arbeit gegangen. Seine Mutter hat immer gekocht, wenn sein Vater Geschäftspartner zum Essen eingeladen hat. Er glaubt, Frauen können diese Dinge automatisch, einfach nur, weil sie Frauen sind.« Donna sah plötzlich wieder aus, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen.
»Und du hast nicht gesagt, dass du das nicht kannst?«
Donna senkte verschämt den Blick. »Nein. Ich wollte die Art von Ehefrau sein, die für eine Dinnerparty kochen kann. Ich wollte ihn nicht enttäuschen.«
Alexandra schwieg. Sie versuchte, nicht vorwurfsvoll zu schauen, ahnte jedoch, dass es ihr nicht gelungen war.
»Könntest du es für mich übernehmen, Alexandra?«, fragte Donna. Sie klang sehr jung und sehr hilflos. Als sie sich vorbeugte, fiel eine Strähne ihres langen blonden Haares in ihr Weinglas.
Alexandra dachte an die kurze Zeit, die ihr blieb, um Paris zu genießen. »Aber du brauchst einen richtigen französischen Koch! Davon muss es in dieser Stadt Hunderte geben.«
»Kennst du jemanden, den ich kontaktieren könnte? Dem Koch, der heute abgesagt hat, ist niemand eingefallen.«
»Das heißt nicht, dass es keinen gibt.«
»Nun, das verstehe ich. Doch wie sollen wir für heute Abend noch rechtzeitig jemanden finden?«
Donna hatte recht. »Ich stimme dir zu: Es ist sehr kurzfristig – aber es muss doch Agenturen geben, über die wir es versuchen können.« Alexandra, die sich eigentlich in fast jeder Situation zu helfen wusste, sah ein, dass es fast unmöglich war, ohne entsprechende Kontakte so kurzfristig einen Koch aufzutreiben, der ein Essen in einer privaten Küche zubereitete.
»Kannst du es nicht übernehmen?«, bat Donna und setzte ihren ganzen Charme ein, etwas, was bei ihrem Vater und Bob sicherlich gut funktionierte. Alexandra stellte fest, dass auch sie nicht immun dagegen war. »Auch wenn du keine gelernte Köchin bist, hast du wenigstens schon mal Mahlzeiten für andere zubereitet«, schloss Donna.
»Die Sache ist die, ich habe nur den heutigen Tag, um mir Paris anzusehen …« Alexandra hielt inne, überlegte kurz und traf die Entscheidung, dass die Schweiz und alles, was damit zusammenhing, warten konnten. Sie hatte ein bisschen Geld im Innenfach ihrer Handtasche, Travellerschecks, die sie mit ihrem in London verdienten Geld gekauft hatte. Ihre Verwandten wussten nichts davon. Sie würde das Geld dafür verwenden, ein wenig mehr Zeit in dieser herrlichen Stadt zu verbringen.
Die Pension, in der sie ein Zimmer gebucht hatte, war sehr günstig. Sie könnte ihren Verwandten ein Telegramm schicken und ihnen mitteilen, dass sie in Paris eine Freundin getroffen hatte und noch ein wenig bleiben wollte. Schließlich hatte es ihnen ja auch nichts ausgemacht, sie jahrelang nur sehr selten zu sehen. Ein paar Tage mehr oder weniger würden da keinen Unterschied machen. Und wo konnte man sein Französisch besser aufpolieren als in Paris?
Sie lächelte Donna an. »Okay, ich mache es. Allerdings mit dir, nicht für dich, und ich möchte auch keine Bezahlung. Die Lösung ist, dich aus deinen Schwierigkeiten herauszukaufen! Die Franzosen bieten hervorragende fertige Speisen an. Wir werden pâté besorgen, außerdem jede Menge Käse und ein traumhaftes Dessert, dann müssen wir uns nur noch über das Dazwischen Gedanken machen.«
»Das hört sich so einfach an«, meinte Donna. »Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe. Ich hätte gedacht, du wärst eine Französin, wenn ich es nicht inzwischen besser wüsste. Ist das ein Hermès-Schal?«
Alexandra nickte. »Ein Geschenk von meinem Onkel. Als er vergangenen Monat in London war, ist ihm klar geworden, dass ich kein Kind mehr bin, und er hat mir etwas geschenkt, was ich auch wirklich tragen möchte.«
»Mit deinem Mantel und dem Gürtel siehst du irgendwie …«
Alexandra seufzte. »Ich weiß. Ich habe immer schon anders ausgesehen als andere Mädchen in meinem Alter. Ich gehe von jeher meinen eigenen Weg, was Mode angeht.«
»Ich wollte sagen, du bist wie Audrey Hepburn. So … so cool. Und sehr stilvoll.«
»Ehrlich? So! Lass uns zu Ende essen, und dann kümmern wir uns um deine Dinnerparty. Wir werden ein oder zwei Einkaufstaschen kaufen müssen!«
Doch sie konnte sich nicht in den Einkauf und ins Kochen stürzen, bevor sie nicht das Telegramm an ihre Verwandten geschickt hatte, die sie eigentlich am folgenden Tag in der Schweiz am Bahnhof abholen wollten. Zuerst musste Alexandra eine perfekte Nachricht verfassen, die die Verwandtschaft davon überzeugte, dass es eine gute Idee war, wenn sie noch ein paar Tage in Paris bliebe. Dann musste sie ein bureau de poste finden, von dem aus sie das Telegramm verschicken konnte.
Sie blieben im bistrot sitzen, während Alexandra ein Notizbuch mit Eselsohren aus der Tasche zog, in dem sie zuvor immer Einzelheiten zu den Antiquitäten notiert hatte, die sie hobbymäßig in London erworben und wiederverkauft hatte. Es war eine gewinnbringende Freizeitbeschäftigung gewesen.
»Kann ich dir bei der Formulierung helfen?«, bot Donna an, als sie sah, wie Alexandra ein paar Entwürfe verwarf.
Normalerweise war Alexandra gut darin, ihren Verwandten genau das mitzuteilen, was sie hören wollten. Während sie in dem Haus der Familie in London gelebt hatte, war es ihr über einen sehr langen Zeitraum hinweg gelungen, ihnen die Tatsache zu verheimlichen, dass sie nicht mit einer bezahlten weiblichen Begleitperson zusammenwohnte. Doch dieses Telegramm musste den Eindruck vermitteln, dass das, was sie tat, genau den Wünschen ihrer Verwandten entsprach.
Da ihre Hauptsorge momentan darin bestand, dass Alexandras Französisch nicht gut genug sei (sie fanden es zu umgangssprachlich und zu derb), konzentrierte sie sich auf dieses Thema. Außerdem betonte sie, dass sich ihre Ankunft in der Schweiz nur um kurze Zeit verzögern würde. Zunächst wollte sie von »ein paar Tagen« sprechen, doch dann beschloss sie, nicht zu konkret zu werden.
»Nein, danke, ich glaube, ich habe es jetzt. Was hältst du davon?« Sie las das Ergebnis ihrer Bemühungen laut vor.
»Großartig! Und während du damit beschäftigt warst, hatte ich eine wunderbare Idee. Wir geben den Text Bobs Sekretärin telefonisch durch und bitten sie, das Telegramm zu verschicken. Dann können wir sofort mit den Dinner-Vorbereitungen beginnen.«
Sie brauchte nicht viel Überzeugungskraft.
»Schließlich«, sagte Donna, »ist das nur eine Kleinigkeit verglichen damit, dass du mich aus einer Notlage retten wirst. Wir haben uns eben erst auf der Straße kennengelernt und sind noch nicht mal Freundinnen!« Sie runzelte die Stirn. »Na ja, ich hoffe, dass wir das jetzt schon sind, aber du weißt, was ich meine.«
Donna hatte im bistrot ein Telefon entdeckt. Sobald sie Bobs Sekretärin, die sie als »beängstigend tüchtig und nicht im Geringsten attraktiv« beschrieb, das Telegramm diktiert hatten, konnten Alexandra und Donna sich den Einkäufen widmen. Der Nachmittag versprach sehr unterhaltsam zu werden.
2. Kapitel
»Es ist toll, wie du dich mit dem Taxifahrer unterhalten kannst«, sagte Donna einige Stunden später, als sie ihre prall gefüllten Einkaufstaschen im Kofferraum eines Taxis verstauten.
»Das kannst du auch bald. Du musst nur ein wenig üben«, erwiderte Alexandra. »Wie ist die Adresse?«
Donna wohnte in einem sehr guten arrondissement in der Nähe des Eiffelturms. Alexandra beschloss, ihren Verwandten unter Verwendung von Donnas Adresse eine Postkarte zu schicken. Das würde sie auf jeden Fall beruhigen. Die Gegend, in der die kleine Pension lag, war bei Weitem nicht so eindrucksvoll.
Donnas Wohnung war prachtvoll. Sie verfügte über hohe Decken, große Räume mit Fischgrätparkettböden, Marmorkamine und bodentiefe Fenster, die auf Balkone führten, von denen aus man einen Ausblick über Paris und darüber hinaus hatte.
»Das ist ganz entzückend!«, bemerkte Alexandra und sah sich im Salon um. Bob musste wirklich sehr gut verdienen, um sich so eine wunderschöne Wohnung leisten zu können.
»Stimmt. Aber warte erst mal, bis du siehst, wo ich kochen muss.«
Alexandra folgte Donna in die Küche. »Ich verstehe, was du meinst!«, rief sie entsetzt aus. »Das ist ja wie ein enger Flur mit einer Spüle darin!«
»Wie soll ich hier eine Dinnerparty vorbereiten?«, fragte Donna. »Es gibt kaum genug Platz, um Kaffee zu kochen und Toast zu rösten.«
Der Raum erinnerte eher an eine Spülküche, lang gezogen, aber sehr schmal. Es gab eine flache Spüle mit einem Abtropfständer, dem einzigen Gegenstand, der Alexandra an ihre geliebte Küche in London erinnerte.
»Ich gehe nicht davon aus, dass man hier ein Dinner vorbereiten kann«, erwiderte sie. »Wahrscheinlich hätte dein Koch dasselbe getan, was wir jetzt machen – er hätte das fertige Essen von außerhalb mitgebracht.«
»Oder vielleicht lädt man seine Gäste in ein Restaurant ein. Das hätte Bob vorschlagen sollen, aber schließlich sind wir Amerikaner!«
»Alles wird gut«, meinte Alexandra beruhigend, weil Donna ein bisschen beschämt wirkte. »Wir haben pâté, frisches Brot und Butter als Vorspeise gekauft, und zum Nachtisch gibt es einen wundervollen Gâteau Saint-Honoré. Wir müssen uns nur noch um das Hühnchengericht kümmern.«
»Das ist eine ganz wunderbare Nachspeise«, meinte Donna und betrachtete die Torte, die sie während der Taxifahrt in einem weißen Karton auf dem Schoß balanciert hatte. Goldene Kugeln aus Brandteig saßen kreisförmig angeordnet auf einer mit leichter Vanillecreme gefüllten Blätterteigtorte. Eine Verzierung aus Sahne und Zuckerwatte verlieh der Torte den letzten Schliff. »Niemand wird glauben, dass ich sie gebacken habe.«
»Das müssen die Gäste auch nicht glauben«, entgegnete Alexandra. »Mein Kindermädchen hat mir während eines Paris-Besuchs erzählt, dass keine französische Frau auch nur im Traum daran denken würde, einen Kuchen oder eine Torte für ein formelles Abendessen selbst zu backen.« Sie hielt kurz inne. »So, was machen wir nun mit dem Huhn?«
Donna schnappte entsetzt nach Luft. »Du weißt es nicht? Du hast dieses ganze Gemüse und die Kräuter gekauft – ich dachte, du hättest ein bestimmtes Rezept im Sinn!«
»Ich werde bald eins haben«, antwortete Alexandra zuversichtlich. »Sieh mal, hier ist ein Larousse Gastronomique.« Sie zog ein großes und ziemlich zerfleddertes Buch aus dem Regal. »Zum Glück gibt es hier eine Ausgabe davon.«
»Wir haben die Wohnung möbliert gemietet«, sagte Donna. »Wahrscheinlich betrachten sie dieses Kochbuch als wesentlich.«
»Hoffentlich ist mein Französisch den Fachbegriffen gewachsen.« Alexandra merkte, dass Donna sie unsicher ansah. »Warum deckst du nicht schon mal den Tisch? Das kann eine Ewigkeit dauern!«
»Ja, stimmt. Ich könnte Teller auswählen. Es gibt Hunderte von Tellern und Gläsern in allen Formen und Größen.«
»Dann sieh doch mal nach, ob du etwas Schönes findest, auf dem wir die pâté servieren können«, schlug Alexandra vor. »Und auch Teller für den Käse. Ich glaube, wir sollten ihn schon mal auspacken.«
Sie war froh, als Donna im Esszimmer verschwand, denn sie war nicht ganz so zuversichtlich, wie sie behauptet hatte. Sie wollte weder beobachtet noch angesprochen werden, während sie das Kochbuch durchforstete. Doch sie hatte einen Kochkurs besucht und bisweilen ihrer Freundin Meg aus demselben Kochkurs geholfen. Meg bot inzwischen Catering für Geschäftsleute an – also verfügte sie selbst zumindest über ein gewisses Maß an Erfahrung.
Es dauerte nicht lange, bis sie die sogenannte »Bibel der französischen Küche« zur Seite legte und beschloss, einfach anzufangen. Sie hatte nicht genug Zeit, schwierige Fachbegriffe zu übersetzen. Der Kochkurs in London war auf junge Frauen und nicht auf ausgebildete Köche zugeschnitten gewesen.
Sie begann damit, ein paar Zwiebeln und jede Menge violetten Knoblauch klein zu schneiden, der ihr so gefallen hatte, als er über den Boden gerollt war.
Zum Glück war Alexandra so vorausschauend gewesen, den Metzger zu bitten, die beiden Hühner bereits zu zerteilen. Sie mussten noch fertig ausgenommen werden, jedoch musste sie sich nicht damit plagen, so etwas Großes in Stücke zu schneiden. Sie warf alle Überreste zusammen mit den Zwiebelschalen, ein paar ganzen Zwiebeln, Karotten und einem Bund Thymian in einem Topf. Alexandra plante zwar keine Brühe, aber vielleicht würde sie sich noch als nützlich für die Zubereitung einer Soße erweisen.
Einige Stunden vergingen, und schließlich duftete die winzige Küche köstlich nach Hühnchen, Wein und Pilzen. Es gab eine Soße, mit der die Portionen angerichtet werden konnten, und gehackte Petersilie zum Bestreuen.
Alexandra war erschöpft. Sie wollte nur noch in ihre Pension zurückkehren, sich aufs Bett legen und gar nichts mehr tun. Die Zubereitung eines einfachen Geflügelgerichts war nicht annähernd so leicht, wie alle taten. Zumindest nicht für sie. Doch es hatte Spaß gemacht, Donna aus der Patsche zu helfen. Nun war sie traurig, weil sie sich wahrscheinlich nicht wiedersehen würden. Während sie gemeinsam passende Gläser ausgewählt und Spekulationen darüber angestellt hatten, wie die Gäste wohl sein würden, hatten sie Freundschaft geschlossen.
»Und du bist sicher, dass jemand da sein wird, der das Servieren übernimmt?«, fragte Alexandra. Sie zögerte zu gehen, obwohl sie müde war.
»Ja, auf jeden Fall. Bobs Sekretärin hat das organisiert, zusammen mit der Dinnerparty. Sie hat auch den Koch gebucht. Ich muss ihr noch sagen, dass er abgesagt hat.«
»Das solltest du auf jeden Fall tun!«, stimmte Alexandra ihr zu, die gleich zu Beginn Groll aufgebaut hatte, weil der professionelle Koch nicht wie angekündigt gekommen war.
»Aber wenigstens kann ich dir das hier geben.« Donna drückte Alexandra einen Umschlag mit Geldscheinen in die Hand. »Keine Diskussion. Steig einfach in ein Taxi und lass dich zu deiner Unterkunft bringen. Aber versprich mir, dass du morgen Vormittag wiederkommst, damit ich dir erzählen kann, wie es gelaufen ist, ja?«
»Versprochen«, antwortete Alexandra, obwohl sie befürchtete, trotz der gebuchten Servierkraft beim Aufräumen helfen zu müssen.
»Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte, Alexandra!«, sagte Donna. »Du warst einfach wunderbar.«
»Ich hatte richtig Spaß! Ich wünschte bloß …«
»Was denn?«
»Dass ich mehr als nur ein paar Tage in Paris verbringen könnte.«
»Oh, das fände ich wunderbar!«, erwiderte Donna. »Wir könnten die Stadt gemeinsam erkunden, und ich könnte lernen, mich nicht mehr so vor den Kellnern zu fürchten.«
Alexandra lachte und seufzte dann. »Ich bräuchte einen richtigen Grund, um zu bleiben, wie zum Beispiel einen Job. Wenn ich für jemanden aus der gehobenen Gesellschaft arbeiten könnte, würden meine Verwandten bestimmt ihre Zustimmung geben. Bei der Arbeit mit Leuten mit dem richtigen Umgangston und der richtigen Aussprache könnte ich mein Französisch verbessern.«
»Welche Qualifikationen hast du denn? Steno, Maschinenschreiben?«, erkundigte Donna sich.
Alexandra zuckte mit den Schultern und seufzte erneut. »Ich habe keine Qualifikationen. Ich kann nichts.«
»Das stimmt auf keinen Fall! Sieh doch nur, was du gerade für mich getan hast.«
»Das habe ich sehr gerne gemacht.« Die beiden umarmten sich herzlich zum Abschied, bevor Alexandra in den winzigen, quietschenden Aufzug stieg.
Als Alexandra am folgenden Vormittag um elf Uhr in der eleganten Wohnung eintraf, war Donna sehr aufgeregt.
»Es ist fantastisch gelaufen!«, rief sie und fiel gleich mit der Tür ins Haus, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin!« Donna nahm Alexandra am Arm und führte sie in den Salon. Die Balkontür stand offen, und draußen entdeckte Alexandra einen kleinen gedeckten Tisch. »Setz dich doch. Ich hole Kaffee und Nachtisch, und dann berichte ich dir von den wunderbaren Neuigkeiten.«
Alexandra nahm gerne Platz und freute sich, das sonnige Paris von hier oben betrachten zu können. Donna erschien mit Kaffee und einem Teller voller kleiner Windbeutel und Sahne: Gâteau Saint-Honoré in Einzelteilen.
»Ich habe einen umwerfenden Mann kennengelernt!«, berichtete Donna. »Keine Bange, nicht auf diese Weise. Ich bin mit Bob verheiratet, und das wird sich auch niemals ändern. Aber dieser Mann hat eine Stelle für dich! Was sagst du dazu? Er war in Begleitung einer sehr hübschen Frau, doch darum geht es nicht. Kannst du dir das vorstellen? Als ich ihm von dir erzählt habe, war er sehr interessiert, vor allem, als ich euren Familiensitz in Belgravia erwähnt habe.«
Alexandras Herz machte einen Satz. Sie wollte nicht auf dieses Pensionat in der Schweiz gehen, vor allem nicht, wenn sich die Möglichkeit bot, in Paris zu bleiben und eine gute Zeit mit Donna zu verbringen.
»Um was für eine Arbeit handelt es sich? Weißt du das?« Inzwischen wollte Alexandra unbedingt in Paris bleiben und würde alles dafür geben. Allerdings suchte dieser attraktive Mann wahrscheinlich eine zweisprachige Sekretärin, die nicht nur Englisch und Französisch sprach, sondern auch noch Steno beherrschte – in beiden Sprachen.
Donna zog eine Grimasse. »Ich weiß es nicht, aber das Gute daran ist, dass es nur um einen Monat geht. Deine Verwandten haben vielleicht nichts dagegen, wenn du einen Monat länger bleibst. Ich habe festgestellt, dass Eltern gerne feste Daten hören möchten. Meine Familie wollte nicht, dass wir nach Paris ziehen, doch als ich ihnen gesagt habe, dass wir nur ein Jahr bleiben, ging es ihnen schon viel besser.«
Alexandra nickte. »Ich glaube, das wäre bei mir genauso, aber ich muss wissen, um was für eine Stelle es sich handelt. Vielleicht kann ich die Arbeit nicht ausüben. Ich habe dir ja erzählt, dass ich zum Beispiel kein Steno beherrsche.«
»Er hat nichts in der Richtung gesagt. Er meinte, du musst kochen können, was du tust, Englisch und Französisch sprechen, was offensichtlich der Fall ist, und einen Führerschein besitzen. Hast du einen Führerschein?«
»Ja«, antwortete Alexandra, »allerdings bin ich nicht sicher, ob ich die französischen Straßenverkehrsregeln beherrsche.« Sie versuchte, sich vorzustellen, wie sie durch Paris fuhr, und fühlte sich ein bisschen eingeschüchtert.
»Oh, du meinst die in Paris? Die Menschen hier stellen ihre eigenen Regeln auf.«
Doch dann überwand Alexandra ihre pessimistische Anwandlung. »Ich habe in London Autofahren gelernt, und ich bin schon in Hyde Park Corner gefahren, da kann ich mich sicher auch an Paris gewöhnen. Für einen Monat, hast du gesagt?«
Donna nickte. »Deine Familie fände das gut, oder? Du könntest deine Französischkenntnisse richtig aufpolieren, auch wenn ich sie jetzt schon völlig in Ordnung finde, und danach kannst du das Pensionat besuchen.« Donna schwieg, etwas, was nicht oft vorkam, wie Alexandra bereits festgestellt hatte. »Was werden sie dir da beibringen, was meinst du?«
»Ach, ich weiß nicht. Wie man Schecks ausstellt, wie man Adelige anspricht und wie man in Sportwagen ein- und aussteigt, ohne dass man die Unterhose sieht.«
Donna lachte entzückt auf. »In Amerika werden Unterhosen von Männern getragen. Frauen tragen Schlüpfer. Aber egal. Hier ist seine Visitenkarte. Heute Mittag um zwei Uhr hast du einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Die Adresse steht hier drauf. Falls du eine Referenz brauchst, kann Bob dir eine geben.«
Als Alexandra die Karte inspizierte, hob sich ihre Stimmung. »Er ist ein Graf! Meine Verwandten werden es lieben. Wenn ich diesen Job bekomme, muss ich sie sofort darüber informieren.«
»Natürlich! Nun, was wirst du anziehen?«
Die Frage gab Alexandra zu denken. Sie hatte nur sehr wenig Kleidung dabei. »Ich habe keine große Auswahl. Die meisten meiner Sachen sind wahrscheinlich schon in der Schweiz eingetroffen. Sie sind vorausgeschickt worden, damit ich mich im Zug nicht mit schwerem Gepäck herumschlagen muss. Ich habe einen Schlafanzug, Wechselunterwäsche, dieses Kleid, eine lange Hose und eine Strickjacke. Das ist mehr oder weniger alles.«
»Und deinen Hermès-Schal.«
»Ja, aber auch wenn er nützlich ist, so ist er doch kein ganzes Outfit.« Alexandra sah an ihrem schmal geschnittenen, ärmellosen, knielangen Kleid hinunter. Es war das passende Outfit, um seine Verwandten zu treffen, und es musste jetzt eben auch für ein Bewerbungsgespräch herhalten.
»Ich finde das Kleid in Ordnung. Es könnte ein bisschen nach Küche riechen, doch vielleicht ist das einem Franzosen ja egal. Dieser Graf beurteilt mich schließlich nicht nach meiner Kleidung; er möchte wissen, ob ich für die Stelle geeignet bin.« Alexandra zögerte. »Bist du wirklich sicher, dass er nicht erwähnt hat, um welche Art von Arbeit es geht?«
»Mach dir keine Sorgen. Er hat jedenfalls nicht von Fähigkeiten in Büroorganisation oder Buchhaltung gesprochen, und das hätte er doch sicher, wenn das gewünscht wäre, oder?«
»Ich würde viel lieber in die Schweiz gehen, wenn sie mir da solche Dinge beibringen würden. Auch wenn es bestimmt schrecklich langweilig wäre, könnten Fähigkeiten im Sekretariat und in Mathematik nützlich sein.«
Donna tätschelte Alexandra das Knie.
»Du wirst dich bestimmt wacker schlagen. Und es wäre so wunderbar, dich noch länger in Paris zu haben. Ich hätte endlich eine Freundin!«
»Ja, stimmt, das wäre toll.«
»Bist du sicher wegen des Kleides? Wir könnten auch einen Blick in meinen Schrank werfen – ich würde dir etwas leihen. Du bist ein bisschen größer als ich, sodass meine Sachen bei dir etwas kürzer wären. Aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein.«
Alexandra lächelte. »Ich glaube, das Kleid ist vollkommen in Ordnung. Ich habe gestern eine Schürze getragen, als ich gekocht habe. Ich wäre allerdings sehr froh, wenn du einen angenehmen Duft hättest, den ich auflegen könnte. Damit könnte ich den schwachen Geruch nach eau d’oignon überdecken.«
»Parfüm!«, rief Donna aus. »Ich habe so viel davon, dass ich darin baden könnte. Nun, ich dachte, wir könnten ein frühes Mittagessen einnehmen, ohne Wein, und nach deinem Gespräch feiern wir.«
»Vielleicht bekomme ich die Stelle ja gar nicht«, sagte Alexandra. »Ich hatte noch nie ein Bewerbungsgespräch. Hast du irgendwelche Tipps für mich?«
Donna schüttelte den Kopf. »Ich war noch nie berufstätig.«
»Ich habe schon oft im Catering-Bereich gejobbt, und ich habe mit Antiquitäten gehandelt. Aber ich hatte noch keine Stelle mit geregelter Arbeitszeit.«
»Antiquitäten? Wie aufregend!«
»Ein guter Freund hat einen Stand auf dem Portobello Road Market. Ich darf meine Sachen bei ihm anbieten. Er hat mir alles beigebracht, was ich darüber weiß.«
Alexandra verlor sich kurz in ihren Erinnerungen. Sie hatte in London ein schönes Leben geführt, hatte sich mit ihren Freunden ein großes Haus geteilt, Geld mit Kochen oder Kellnern zusammen mit einer ihrer Freundinnen verdient und mit einer anderen jungen Frau an Wochenenden am Antiquitätenstand gearbeitet. Sie war ein Mensch, der immer das Beste aus der jeweiligen Situation machte, doch in der Schweiz würde sie sich wahrscheinlich einsam und eingeschränkt fühlen.
Zu Hause müsste sie mit ihren langweiligen und steifen Verwandten herumsitzen, und in der Schule würde sie von Mädchen umgeben sein, mit denen sie vermutlich nicht viel gemeinsam hatte.
»Darf ich mich dann wenigstens um dein Make-up kümmern?«, fragte Donna. »Ich habe meine ganze Freizeit damit verbracht zu üben, wie man Eyeliner aufträgt, ohne dass er verschmiert. Du hast wunderschöne Augen; es wird mir Riesenspaß machen, ihre Schönheit noch zu betonen. Der Herr Graf muss dir den Job einfach geben!«
3. Kapitel
Als Alexandra am Nachmittag das große elegante Gebäude betrat, in dem das Vorstellungsgespräch stattfinden sollte, war sie nervöser als erwartet. Normalerweise war sie ausgesprochen selbstbewusst, außerdem spielte es keine Rolle, wenn sie die Stelle nicht bekam. Schließlich war sie nicht auf der Suche nach Arbeit. Sie konnte einfach ein paar Tage in Paris bleiben und nach einem schönen Kurzurlaub in den Zug in die Schweiz steigen.
Doch als sie nun am Empfang nach dem Weg fragte, stellte sie fest, dass ihr Mund trocken war. Bevor sie an die Tür des Büros klopfte, zögerte sie kurz und atmete ein paar Mal tief durch, bis sie bereit war.
Nachdem man sie hereingebeten hatte, fand sie sich in einem Arbeitsraum mit zwei großen Schreibtischen wieder. An dem Tisch am Fenster saß ein Mann und schrieb, hinter dem anderen direkt vor Alexandra sah sie sich der Sorte Frau gegenüber, die man wohl als »Drachen« bezeichnen konnte.
Sie trug ein elegantes schwarzes Kostüm, das gut und gerne von Chanel sein konnte, hatte eine ausgesprochen gepflegte Frisur, ein zu blasses Gesicht und dünne Lippen. Alexandra gewann den Eindruck, dass sie es vermied zu lächeln, um keine Falten zu bekommen. Damit hatte sie nur teilweise Erfolg.
Alexandra wünschte sich jetzt, sie hätte sich doch etwas von Donnas umfangreicher Garderobe ausgeliehen. Ihre eigene Kleidung war von London nach Paris gereist und hatte schon einiges mitgemacht, einschließlich einer Kochaktion mit Zwiebeln, Knoblauch und Sahne – vielleicht hatte die Schürze doch nicht ausgereicht, sie zu schützen.
Da es keinen Sinn hatte, ihre Kleiderwahl zu bereuen, begrüßte Alexandra die Frau in ihrem besten Französisch so höflich und förmlich wie möglich und nannte ihren Namen.
Die Frau bedachte sie mit einem Nicken, erwiderte die Begrüßung und bat Alexandra, auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch Platz zu nehmen. »Ich bin Madame Dubois; ich werde dieses Vorstellungsgespräch führen.« Sie reichte Alexandra ein Formular. »Bitte füllen Sie das aus, Mademoiselle. Hier ist ein Stift.«
Einer plötzlichen Eingebung folgend machte Alexandra sich spontan fünf Jahre älter, als sie tatsächlich war, und füllte den Rest des Bewerbungsformulars in ihrer schönsten Handschrift aus. Sie beschrieb ihre letzte Tätigkeit als »Firmenchef«, obwohl sie nicht ganz sicher war, ob chef d’entreprise tatsächlich das Zubereiten von Mahlzeiten für die Vorstandmitglieder von Banken in Londons Bankenviertel beschrieb. Doch etwas Besseres fiel ihr nicht ein.
Als sie das ausgefüllte Formular zurückgab, tröstete sie sich damit, dass ihr erstes Vorstellungsgespräch nicht ganz ohne war. Das bedeutete, dass künftige Bewerbungsgespräche, bei denen das Ergebnis wichtiger war, ihr wahrscheinlich leichter fallen würden. Von einer Furcht einflößenden Pariserin durch die Mangel gedreht zu werden, die sie abschätzig musterte, war sicherlich eine Feuertaufe, die sie abhärten würde.
Während Madame Dubois das Formular studierte, zog sie einige Male die Augenbrauen hoch. »Sie sind also Engländerin?«
Alexandra nickte.
»Aber Sie sprechen Französisch?«
Obwohl Alexandra fand, dass sie das schon ziemlich gut unter Beweis gestellt hatte, nickte sie erneut.
»Sie sind eine passable Köchin?«
Alexandra bejahte. »Das habe ich in dem Formular beschrieben.«
»Mademoiselle, Sie haben angegeben, dass Sie die Geschäftsführerin einer Firma sind, was vermutlich nicht der Fall ist.« Sie kniff die Augen ein wenig zusammen, was einem Lächeln schon fast nahekam. »Möglicherweise ist Ihr Französisch nicht ganz so gut, wie Sie glauben.«
Verlegen murmelte Alexandra eine Entschuldigung.
Ihre Gesprächspartnerin fuhr fort: »Und Sie können Auto fahren?«
Als Nachweis suchte Alexandra ihren britischen Führerschein heraus und hoffte, dass Madame Dubois nicht weiterblättern und ihr tatsächliches Alter entdecken würde.
Weit gefehlt. Sie warf nur einen flüchtigen Blick darauf, bevor sie Alexandra das Dokument mit spitzen Fingern zurückgab. »Das scheint mir zufriedenstellend zu sein«, sagte sie. »Die Stelle ist nur für einen Monat zu besetzen. Ist Ihnen das bewusst?«
»Ja, Madame.«
»Nun gut, Mademoiselle. Es geht um eine Stellung als Kindermädchen – die jetzige Kinderfrau besucht ihre kranke Mutter. Verfügen Sie über entsprechende Erfahrung?«
Alexandra atmete innerlich tief durch. Die Vorstellung, als Kindermädchen zu arbeiten, schockierte sie. Sie hatte bislang kaum etwas mit Kindern zu tun gehabt, geschweige denn die Verantwortung für eines übernommen. Allerdings hatte sie selbst jede Menge Kindermädchen gehabt und konnte eine gute Kinderfrau von einer schlechten unterscheiden. »Gewiss doch, Madame«, antwortete sie.
Sie wollte gerade erklären, dass sie dies nicht im Formular erwähnt hatte, weil sie nicht gewusst hatte, dass die Stellung Erfahrung in diesem Bereich voraussetzte, doch es schien Madame Dubois nicht zu interessieren.
»Die Familie hat drei Kinder, sie sind nicht mehr ganz klein. Werden Sie damit zurechtkommen?«
Alexandra nickte. Sie war ausgesprochen erleichtert, dass unter ihren Schützlingen kein neugeborenes Baby war. »Oh ja.«
»Drei Kinder? Sie kriegen das wirklich hin?«
»Auf jeden Fall.« Die Aussage war wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch, doch es sollte ja nur für einen Monat sein. Das konnte eigentlich nicht zu schwierig sein. Sie würde zusammen mit den Kindern Ausflüge zu den touristischen Attraktionen von Paris unternehmen. Donna konnte sie unterstützen – das würde lustig werden.
Madame musterte sie einige zermürbende Sekunden lang. »Wir müssen die Stelle dringend besetzen, ansonsten würden wir jemanden wie Sie nicht in Erwägung ziehen. Der Graf wurde über Ihren Hintergrund informiert, und da es um eine zeitlich eng begrenzte Übereinkunft geht, sind Sie vielleicht geeignet.«
»Danke«, antwortete Alexandra angemessen demütig.
»Wir werden Ihre Referenzen überprüfen, und wenn sie nicht zufriedenstellend sind, werden Sie umgehend entlassen.«
Alexandra hatte Donnas Ehemann Bob und die Cousine mit dem eindrucksvollsten Namen, die zudem einen Titel trug, als Referenzen genannt. Sie hoffte sehr, dass ihre Cousine sie nicht bloßstellen würde. »Natürlich«, erwiderte Alexandra etwas kleinlaut.
»Sie sehen sehr jung aus für Ihr Alter, Mademoiselle.«
Madame Dubois’ scharfer Blick durchbohrte sie mit derartigem Hochmut, dass Alexandra ihr Selbstvertrauen wiederfand. Da sie das falsche Geburtsdatum in das Formular eingetragen hatte, war mit dieser Frage zu rechnen gewesen. Obwohl sie wusste, dass sie älter als zwanzig Jahre wirkte, kam sie vielleicht als Fünfundzwanzigjährige nicht durch. Sie schenkte der Frau ein strahlendes, Falten hervorrufendes Lächeln. »Ich weiß. Ich darf mich außerordentlich glücklich schätzen.«
Das hatte wiederum ein Hochziehen einer perfekt gezupften Augenbraue zur Folge. »Gut.« Madame Dubois öffnete eine Schublade und nahm einen dicken Umschlag heraus. »Das ist die Hälfte Ihres Gehaltes; die zweite Hälfte bekommen Sie am Ende des Monates. Und Ihre Zugfahrkarte.«
Alexandra hatte bereits die Hand ausgestreckt, um dem Umschlag entgegenzunehmen. »Zugfahrkarte?«
»Ja. Die Arbeitsstelle ist in der Provence, Sie reisen nach Marseille. Kann es sein, dass Sie überrascht sind?«
»Ja! Ich wusste nicht … Niemand hat es erwähnt … Ich dachte, der Arbeitsplatz sei in Paris.«
Madame Dubois sah sie an, als wäre diese Annahme vollkommen abwegig. »Aber nein, ich bin davon ausgegangen, das wäre geklärt worden, als man Ihnen vorschlug, zu diesem Gespräch zu kommen.«
Alexandra war verwirrt. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, der Arbeitsplatz könnte nicht in Paris sein. Jetzt hatte sie keine Ahnung, ob sie die Stelle antreten wollte oder nicht.
In dem Moment stand der Mann auf, der in der Ecke arbeitete, und durchquerte den Raum, um mit ihr zu sprechen. »Mademoiselle, Sie würden sich um meine Kinder kümmern, die mir natürlich lieb und teuer sind. Kann ich Ihnen meine Kinder anvertrauen?«
Mehrere Gedanken schossen Alexandra gleichzeitig durch den Kopf. Der erste war, dass dieser Mann außerordentlich attraktiv war, der zweite, dass er derjenige sein musste, den Donna bei der Dinnerparty kennengelernt hatte, und der letzte Gedanke war, dass sie ihn nicht im Stich lassen konnte. »Natürlich, Monsieur.« Zu spät fiel ihr ein, dass er ein Graf war, und korrigierte sich. »Monsieur le Comte.«
Er war groß, hatte nahezu schwarzes Haar und dunkle Augen mit langen Wimpern. Seine Nase war lang und leicht gekrümmt, und seine Mundwinkel hoben sich nun leicht.
Mit einem bangen Gefühl stellte Alexandra fest, dass es fast unmöglich war, sich nicht in ihn zu verlieben. In dem Moment wäre sie für ihn bis ans Ende der Welt gegangen, ganz zu schweigen von der Provence.
Monsieur le Comte verbeugte sich leicht. »Danke, Mademoiselle, ich bin Ihnen sehr dankbar.« Damit verließ er den Raum.
»Gut!«, sagte Madame Dubois, die sich ein wenig entspannt hatte, nachdem ihr Arbeitsgeber Alexandra offensichtlich als geeignet betrachtete. »Ich notiere Ihnen noch eine kurze Wegbeschreibung. Sie reisen vom Gare de Lyon. Ich schlage vor, dass Sie einige leichte Sommerkleider mitnehmen, da es in der Provence auch im Herbst noch sehr warm sein kann. Im Château gibt es eine Haushälterin. Ihre Arbeit wird daher nicht besonders schwer sein.« Sie informierte Alexandra noch über einige Dinge, die von ihr erwartet wurden.
Alexandra lächelte etwas mühsam. Je mehr Madame Dubois sich entspannte, desto angespannter wurde sie selbst. »Ich werde mein Bestes geben, um alle zufriedenzustellen.«
Madame Dubois verneigte sich leicht und erlaubte sich beinahe ein richtiges Lächeln. »Aber selbstverständlich!«
Donna wartete am vereinbarten Treffpunkt in einem Café in der Nähe des Gebäudes, in dem Alexandra sich vorgestellt hatte. Donna hüpfte beinahe vor Ungeduld auf und ab, weil sie unbedingt wissen wollte, wie es ihr ergangen war. Alexandra hingegen wollte sich einfach nur hinsetzen und ein Glas kaltes Wasser trinken. Und danach ein Glas Cognac, um ihre Nerven zu beruhigen.
»Und?«, fragte Donna. »Hast du die Stelle bekommen? Oder geben sie dir erst später Bescheid? Soll ich Champagner bestellen?«
Alexandra nickte. »Das wäre toll. Obwohl ich nicht sicher bin, ob es etwas zu feiern gibt.«
Donna gab die Bestellung auf und musterte Alexandra aufmerksam. »Warum nicht? Hast du den Job nicht bekommen? Antoine – der Mann, mit dem du dich getroffen hast – wirkte gestern Abend regelreicht verzweifelt.«
»Ich habe die Stelle.« Alexandra sah zu, wie der Kellner ihr einschenkte. »Aber es ist nicht ganz die Arbeit, von der ich ausgegangen bin.«
»Was musst du denn tun?«
»Ich soll Kindermädchen sein, doch das ist es nicht, was mir Sorgen bereitet. Der Arbeitsplatz ist nicht in Paris, sondern in der Provence!«
Donna machte ein langes Gesicht. »Oh. Ich hatte gehofft …«
»Ich weiß, ich auch! Ich dachte, wir könnten eine unvergessliche Zeit in dieser wunderbaren Stadt hier verbringen.«
Donna sah immer noch sehr enttäuscht aus. »Ich habe mich so darauf gefreut, eine Freundin in Paris zu haben. Jetzt werde ich dich nie wiedersehen!«
»Du wirst mich sehen, wenn ich zurückkomme. In einem Monat. Ich muss über Paris reisen, um mit dem Zug in die Schweiz zu fahren.« Alexandra sagte das nicht zuletzt um ihrer selbst willen. Obwohl sie die Aufgabe aus freien Stücken übernommen hatte, regten sich nun Zweifel in ihr. Die Provence war so abgelegen und weit entfernt von der Zivilisation; Alexandra hatte keine Ahnung, wie ihre Verwandten auf die Nachricht reagieren würden.
Als sie ihren Champagner getrunken hatte, sagte sie – auch um Donna aufzuheitern, die niedergeschlagen wirkte: »Lass uns einkaufen gehen. Ich brauche noch Kleidung und Unterwäsche.«
»Dann solltest du bei Monoprix schauen. Ich kann es dir zeigen.« Donna lächelte ein bisschen traurig. »Es ist nicht gerade die Champs-Élysées, aber genau da müssen wir hin.«
4. Kapitel
Als der Zug am folgenden Morgen Paris verließ, war Alexandra sehr gespannt. Sie wusste, dass die Fahrt lange dauern würde, und hatte sich darauf eingestellt.
Donna hatte darauf bestanden, Alexandra zum Bahnhof zu begleiten, und ihr zwei belegte Baguettes, Obst und eine Flasche Perrier gekauft. Am Vortag hatte Alexandra zusammen mit Donna das Rive Gauche, das linke Ufer der Seine, besucht und in dem bekannten englischen Buchladen Shakespeare and Company ein Französisch-Englisch-Wörterbuch und zwei Romane für die Reise erstanden. Donna hatte ihr den Larousse Gastronomique schenken wollen, doch Alexandra hatte erwidert, er sei zu schwer für den Transport und außerdem Teil des Inventars von Donnas Wohnung. Der Abschied war überraschend emotional ausgefallen, wenn man bedachte, dass sie sich erst seit sehr kurzer Zeit kannten.
Einige Stunden später hatte Alexandra ihren Proviant vertilgt. Die Äpfel hatte sie mit ihrem Schweizer Taschenmesser geschält und zerteilt, ohne das sie nie auf Reisen ging. Auf der anderen Seite des Gangs saß ein Paar; der Mann hatte ebenfalls ein Messer dabei. Es handelte sich um ein Opinel-Klappmesser, mit dem er einen Schinken am Knochen attackierte. Alexandras Taschenmesser wirkte im Vergleich dazu regelrecht zierlich.
Sie hatte eines der Bücher fast ausgelesen (sie hatte es sich eingeteilt, damit sie für den vor ihr liegenden Monat noch genug Lesestoff hatte) und das Wörterbuch mehrere Mal sorgfältig studiert. Außerdem hatte sie lange Zeit aus dem Fenster gesehen, bevor der Zug endlich in den Zielbahnhof einrollte.
Die Landschaft, insbesondere auf dem letzten Stück, war grandios gewesen. Die Sonne hatte zum Übergang in den Herbst alles in goldenes Licht getaucht. Sie hatten gelb-braune Sonnenblumenfelder und abgeerntete Lavendelfelder passiert. Die grauen Sträucher schienen wie dicke Raupen über die Hügel zu kriechen. Weinleser mit großen Strohhüten ernteten im Sonnenlicht scharlachrot leuchtende Weintrauben von den Reben und warfen sie in die Körbe auf ihrem Rücken. Dörfer aus goldenem Stein schmiegten sich an die Hügel. Und trotz der Jahreszeit war das Licht immer noch besonders.
Alexandra wusste, dass Künstler eigens wegen dieses Lichtes in die Provence reisten. Während sie aus dem Fenster blickte, gab sie sich große Mühe, nicht an den Mann im Büro zu denken, den Comte de Belleville, den Vater der Kinder, die sie betreuen würde.
Sie glaubte nicht an Liebe auf den ersten Blick. Auch wenn sie erst zwanzig war, verfügte sie schon über jede Menge Erfahrung aus erster Hand. Die zahlreichen Kindermädchen und Gouvernanten, die sich im Laufe der Jahre um sie gekümmert hatten, waren größtenteils jung gewesen und hatten nicht damit hinter dem Berg gehalten, wenn ein Mann ihnen das Herz gebrochen hatte. Schon sehr früh (sie war zehn gewesen) hatte Alexandra beschlossen, sich nicht zu verlieben, wenn sie es irgendwie verhindern konnte.
Seitdem hatte sie entdeckt, dass Verliebtsein nicht unbedingt schlecht war, doch an jemanden sein Herz zu verlieren, den man überhaupt nicht kannte, war pure Torheit. Das würde ihr nicht passieren, egal, wie gut der Mann auch aussehen mochte.
Sie war ganz steif von der langen Reise und taumelte ein bisschen, als sie aus dem Zug stieg. Ein Mann in einem blauen Arbeitsoverall, der das englische Kindermädchen irgendwie identifiziert hatte, begrüßte sie in einem starken französischen Dialekt, den sie gerade noch verstehen konnte.
»Mademoiselle! Sie kommen spät! Wir müssen uns beeilen. Jetzt bin ich auch spät dran! Ich heiße Bruno.«
»Bonjour, Bruno. Ich bin Alexandra«, sagte sie, doch er hörte ihr nicht zu. Stattdessen nahm er ihren kleinen neuen Koffer mit der neuen Kleidung, während sie ihr Handgepäck und ihre Handtasche umklammerte. In diesen beiden Taschen waren alle lebenswichtigen Dinge, ohne die sie verloren wäre.
Bruno wirkte nett, war allerdings in großer Eile. »Nun«, erklärte er, »es ist eine kleine Katastrophe passiert.«
Wie kann eine Katastrophe klein sein?, fragte Alexandra sich.
»Die Haushälterin, Madame Carrier, musste weg. Ihre Mutter ist krank.«
»Ach! Wie die Mutter des Kindermädchens?«
Davon wusste Bruno nichts, und es interessierte ihn auch nicht. »Sie müssen für die Kinder kochen. Aber verzweifeln Sie nicht.« Alexandra neigte nicht zum Verzweifeln und hatte auch nicht vor, jetzt damit anzufangen. »Der Gärtner wird Ihnen Gemüse und Hühner bringen. Lebensmittel vom Hof des Anwesens, wie immer.«
Obwohl sie damit kämpfte, Brunos Dialekt trotz seiner schnellen Sprechweise zu verstehen, hörte sie das Wort »Hühner« und hoffte, dass es sich um recht junge Tiere und keine müden alten Suppenhühner handelte. Sie zuckte innerlich mit den Schultern (allmählich zeigte das französische Umfeld Wirkung) und dachte, dass es im Château vielleicht auch einen Larousse Gastronomique gab. Sie würde genug Zeit haben, um alles in den Griff zu bekommen.
Bruno führte sie zu einem alten blauen Lieferwagen und stellte ihren Koffer hinten hinein. Dem Geruch nach zu urteilen, hatte er zuletzt Tiere darin transportiert. Alexandra kletterte in die Fahrerkabine. Während Bruno um den Wagen herumging, um auf der Fahrerseite einzusteigen, fragte sie sich, wie Madame Dubois in Paris dieses landwirtschaftliche Fahrzeug wohl beschrieben hätte.
Ihr Fahrer redete und gestikulierte und rief ab und zu etwas, während sie über kleinere Straßen ratterten, bis schließlich das Château am Ende einer von Bäumen gesäumten Allee auftauchte.
Im Vergleich zu anderen Châteaus war es nicht besonders groß, dennoch handelte es sich um ein beachtliches Anwesen. Der Grundriss war quadratisch, und an beiden Seiten befanden sich große, breite Türme, die aus dem Boden zu wachsen schienen.
Das Schloss war aus riesigen Steinquadern erbaut worden und sah aus, als wäre es darauf ausgelegt, allen Widrigkeiten zu trotzen. Ein großer Teil der Mauern war von Kletterpflanzen überrankt, die im Nachmittagslicht feuerrot leuchteten. Die Zinnen auf den Türmen könnten entweder reine Dekoration sein oder darauf hinweisen, dass das Château sehr alt war. Die dahinter liegenden Hügel boten dem Gebäude Schutz. Alexandra hatte plötzlich das merkwürdige Gefühl, dass es wie ein Zuhause aussah.
Doch als Bruno die Allee entlangfuhr, rief Alexandra sich in Erinnerung, dass es für sie kein Zuhause werden konnte, weil ihre Tätigkeit auf einen Monat begrenzt war. Trotzdem stellte sie fest, dass ihr Herz schneller schlug – sie wollte gute Arbeit leisten. Schließlich hatte sie dem Vater der Kinder versprochen, dass er ihr vertrauen konnte, und sie wollte ihn und auch seine Familie nicht enttäuschen.
Bruno hämmerte mit dem Türklopfer, der der Ring in der Nase eines aus Bronze gefertigten Stierkopfs war, gegen die Eingangstür des Châteaus. Sofort ertönte tiefes Bellen, offenbar von einem großen Hund. Alexandra zuckte zusammen, doch Bruno wirkte unbeeindruckt. Er schnaubte ungeduldig, als die Tür nicht sofort geöffnet wurde. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die schwere Tür aufging.
»Ah, bonjour!«, sagte Bruno, als die Haustür sich weiter öffnete. »Ich bringe euch euer neues Kindermädchen!«
Der Hund, in der Tat ein großes Tier mit schwarz-weißem Fell, Schlappohren und einem dünnen Schwanz, trottete heraus. Er schnüffelte kurz an Alexandra und leckte ihr flüchtig die Hand.
Sobald ihr klar war, dass der Hund sie nicht fressen würde, betrachtete Alexandra die drei Kinder, die die Tür deutlich wirksamer bewachten als das Tier. Das älteste Kind war ein ungefähr fünfzehn Jahre altes Mädchen in langer Hose und Rollkragenpullover – sie konnte kaum noch als »Kind« bezeichnet werden. Dann gab es einen Jungen, der fast genauso groß, doch offensichtlich jünger war, und ein kleineres Mädchen in einem ausgebleichten Kleid mit einem Faltenrock und Puffärmeln. Das jüngere Mädchen war offensichtlich das einzige Kind, das im richtigen Alter für eine Kinderfrau war.
Alexandra empfand unvermittelt Mitleid mit den Kindern. Sie selbst hatte noch Kindermädchen gehabt, als sie eigentlich aus dem Alter herausgewachsen war – das war kein Vergnügen gewesen. Daher verstand sie gut, warum das ältere Mädchen und ihr Bruder sie mit einer Mischung aus Feindseligkeit, Verärgerung und Trotz musterten. Die Kleine klammerte sich ängstlich an den Bruder.
Die beiden älteren Kinder hatten große Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Sie hatten seine fast schwarzen Haare und die gleichen dunklen, von dichten Wimpern bekränzten Augen und einen Mund, der zum Lächeln gemacht war. Jetzt allerdings lächelten sie nicht. Das jüngere Kind mit seinen blonden Locken sah ganz anders aus. Der große Bruder hatte beschützend den Arm um das kleine Mädchen gelegt. Sie muss nach ihrer Mutter kommen, dachte Alexandra.
»Wir brauchen kein Kindermädchen«, sagte die Älteste mit erhobenem Kinn auf Französisch.
»Das glaube ich dir«, erwiderte Bruno. »Aber euer Papa ist der Meinung, dass ihr eins brauchst. Und hier ist sie. Ich muss jetzt gehen.« Er kehrte im Laufschritt zu seinem Wagen zurück, hob Alexandras Koffer heraus und schubste sie beinahe durch die Haustür. Dann brauste er davon und ließ Alexandra mit dem Gefühl zurück, dass ihr einziger Freund sie gerade verlassen hatte.
Ihre drei Schützlinge musterten sie, und Alexandra erwiderte ihre Blicke. Sie erkannte sich selbst in ihren Mienen wieder und erinnerte sich an die Kindermädchen, mit denen sie gut ausgekommen war – es hatte eine ganze Reihe davon gegeben. Sie hatte sie gemocht, weil sie sie respektiert und ohne Herablassung mit ihr gesprochen hatten.
»Hallo«, sagte sie auf Englisch. »Sprecht ihr Englisch?« Man hatte sie informiert, dass das der Fall war, da die Mutter der Kinder Engländerin war. Das war der Grund, warum eine englische Muttersprachlerin als Kindermädchen gewünscht war.
Das ältere Mädchen hob herausfordernd das Kinn.
Alexandra wiederholte ihren Satz in langsamem Schulfranzösisch.
»Non!«, antwortete das Mädchen.
Auf die gleiche Art und Weise fragte Alexandra die drei nach ihren Namen, in sehr langsamem Französisch mit einem ausgeprägten englischen Akzent.
Das ältere Mädchen reagierte nicht, doch ihr Bruder erwiderte: »Félicité«, und deutete auf seine ältere Schwester. »Ich bin Henri. Und das ist die kleine Stéphanie. Der Hund heißt Milou.«
Alexandra nickte. So hieß auch der Hund von Tintin in der französischen Version von Tim und Struppi. Wenn die Kinder diese Bücher kannten, konnte sie sich mit ihnen darüber unterhalten, auch wenn sie entschlossen war, Englisch mit ihnen zu reden. Vielleicht wollten sie sie nicht wissen lassen, dass sie die englische Sprache beherrschten. Also beschloss sie, ihnen auch nicht zu verraten, dass sie mehr oder weniger fließend Französisch sprach. Menschen sollten ihre Geheimnisse haben, fand sie.
»Ich bin Alexandra«, sagte sie auf Französisch, bevor sie wieder ins Englische wechselte. »Ich bin sehr hungrig. Könnt ihr mir bitte erklären, wo ich die Küche finde?«
»Non!«, antwortete Félicité, die ihre trotzige Haltung noch nicht aufgegeben hatte.
»Auch gut«, meinte Alexandra, »ich werde sie schon finden. Vielleicht hilft Milou mir ja.«
Der Hund tat ihr den Gefallen. Gemeinsam gingen sie den langen Flur zur Rückseite des Gebäudes entlang; wahrscheinlich war Milou ebenfalls hungrig.
In der großen Küche stand ein riesiger schwarzer Herd an der Wand, und in der Mitte gab es einen großen, sauber geschrubbten Tisch. Neben dem Herd entdeckte Alexandra einen kleinen Sessel mit vielen platt gedrückten Kissen. In der Ecke tickte eine Standuhr vor sich hin. Außerdem waren da eine Spüle und mehrere große Geschirrschränke, deren Wände fast bis zur Decke reichten. Vor dem Herd lag ein Teppichläufer, auf dem Milou sich nun niederließ.
Über dem Herd war ein Holzregal angebracht, wahrscheinlich ursprünglich zum Trocknen von Kleidung bestimmt. Stattdessen hing heute alles daran, was man in einer Küche so brauchte. Es gab Kochtöpfe aus Kupfer, Bratpfannen jeglicher Größe, Suppenkellen, Kochsiebe und etwas, was wie eine mittelalterliche Kriegswaffe aussah. Außerdem entdeckte Alexandra Kräuterbüschel, Küchenhandtücher und einen Teddybär, der offenbar gewaschen und zum Trocknen aufgehängt worden war.
Zu Alexandras Erleichterung fand sich in einer Ecke auch ein ziemlich moderner Gasherd, daneben eine große Gasflasche. In einem offen stehenden Schrank entdeckte sie Schüsseln und Auflaufformen, Platten, Teller – alles, was man brauchte, um zu essen oder Essen zu servieren. Doch im Raum war es eiskalt, obwohl erst Oktober war.
Eins nach dem anderen, nahm Alexandra sich vor. Es war lange her, seit sie ihren Proviant im Zug gegessen hatte. »Ich habe großen Hunger«, sagte sie auf Englisch und wiederholte den Satz langsam und gewollt mühevoll auf Französisch.
Félicité zuckte mit den Schultern, doch Stéphanie, die offensichtlich vergessen hatte, dass sie nicht Englisch sprechen sollte, erwiderte in perfektem Englisch: »Ich habe auch Hunger!«
»Stéphie!«, sagte Henri eher betrübt als sauer, »wir sollen doch nur Französisch reden!«
»Es ist in Ordnung«, warf Alexandra ein. »Es ist lustig, jemandem einen Streich zu spielen, aber wenn es zu lange dauert, ist der Spaß irgendwann vorbei. Was willst du essen?«
Sie hatte ihre Frage an Stéphie gerichtet, die jedoch den Kopf schüttelte. Offensichtlich war ihr der kleine Ausrutscher peinlich.
»Okay«, murmelte Alexandra vor sich hin. »Gibt es einen Kühlschrank?«
Sie rechnete nicht mehr mit Unterstützung und begann, Schränke und Türen zu öffnen, bis sie in einem Durchgang auf einen großen Kühlschrank stieß. Hier fand sie ein Stück Butter auf einem Teller, eine Auswahl an Käse und eines der Hühner, von denen Bruno gesprochen hatte. Sie würde ein anderes Mal darüber nachdenken, wie sie es zubereiten konnte; jetzt wollte sie Brot.
Mit der Butter und etwas Käse, den sie für Comté hielt – von dem, was es in Frankreich an Käse gab, kam er Cheddar am nächsten –, kehrte sie in die Küche zurück. Erfreut stellte sie fest, dass die Kinder noch da waren.
»Wo verwahrt ihr das Brot?«, fragte sie in ihrem lauten, langsamen Französisch. Sie war sicher, dass das älteste Mädchen mitspielen würde. Alle wussten, dass die Kinder Englisch sprachen, doch weil Alexandra sie auf Französisch ansprach, mussten sie eigentlich antworten.
Félicité deutete mit dem Kopf in die Richtung, in der Alexandra nachsehen sollte. »In der Speisekammer«, gab sie auf Englisch zurück. »Aber es ist wahrscheinlich alt.«
»Wann habt ihr zuletzt etwas gegessen?« Alexandra war besorgt. Es war sechs Uhr. Hatten sie an dem Tag überhaupt schon etwas zu sich genommen?
»Wir hatten Croissants zum Frühstück«, antwortete Stéphie. »Und Äpfel zum Mittagessen.«
»Okay«, erwiderte Alexandra. »Dann suchen wir mal was Essbares.«
Die Speisekammer lag hinter dem Durchgang, wo der Kühlschrank stand. Alexandra fand einen hölzernen Brotkasten, in dem sich zwei harte Baguettes und ein pain de campagne befanden.
In der Hoffnung, dass es ein Sägemesser gab, mit dem sie das runde braune Brot schneiden konnte, nahm sie den Laib mit in die Küche. Falls die Haushälterin länger ausfallen sollte, würde sie ein paar Änderungen vornehmen; die Abläufe mussten deutlich praktischer werden.
Alexandra fand ein Brotmesser an einer magnetischen Halterung an der Wand. Sie schaffte es, vier anständige Scheiben von dem Brot abzuschneiden. Dann machte sie sich daran, überbackene Käsebrote zuzubereiten.
Der Geruch des schmelzenden Käses und der Anblick der appetitlichen Brotscheiben, die Alexandra auf ein rundes Holzbrett gelegt hatte, zogen ihre Schützlinge an den Tisch wie Motten zum Licht. Als sie sah, wie eifrig die drei sich auf die Brote stürzten, schnitt sie den Rest des Brotlaibs auf und verteilte den gesamten restlichen Käse auf den Scheiben. Sie hoffte, die vollen Bäuche würden dafür sorgen, dass die Kinder ein bisschen auftauten.
In der Küche zu sitzen, auch wenn es nur eine kalte französische Küche war, erinnerte Alexandra an ihr Leben in London, wo ihre Freunde und sie häufig rund um den Küchentisch gesessen hatten, um zu essen, zu lachen und zu plaudern. Sie hatten monatelang gemeinsam in dem großen Londoner Haus gewohnt und es zu einem glücklichen Ort gemacht. Würde ihr das auch mit diesem Haus gelingen? Sie alleine mit drei offenbar unglücklichen Kindern? Auch wenn Félicité eigentlich kein Kind mehr war. Es würde ein schwieriges Unterfangen werden.
Sie erhob sich vom Tisch, um den Ofen zu untersuchen. Sie öffnete die Feuerklappe. »Funktioniert der normalerweise?«
Henri nickte. »Er braucht jede Menge Holz, aber ja, er funktioniert. Es gibt einen Holzschuppen.«