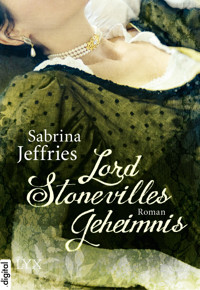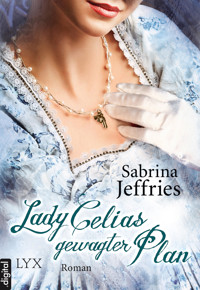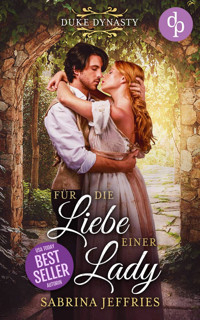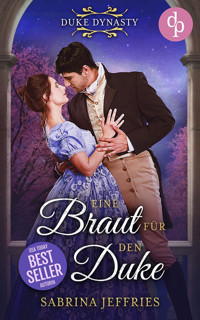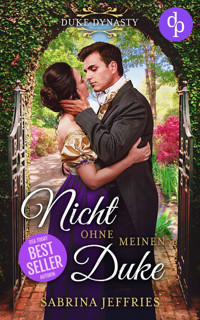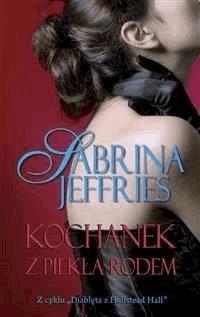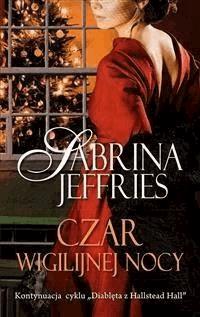9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dukes Men
- Sprache: Deutsch
Tristan Bonnauds einziges Ziel ist es, alles, was ihm lieb und teuer ist, vor seinem Halbbruder George zu beschützen - und sicherzustellen, dass dieser Tristans Leben kein zweites Mal zerstört. Als die gerissene Lady Zoe Kane, Tochter des Earls of Olivier, in der Detektei auftaucht und Tristan bittet, ihr auf der Suche nach einer geheimnisvollen Frau aus dem fahrenden Volk zu helfen, sieht er seine Chance gekommen, bei dieser auch Informationen über George zu finden, die seinen Bruder zu Fall bringen könnten. Tristan hat jedoch nicht damit gerechnet, dabei auch ein langgehütetes Geheimnis in Zoes Familie zu lüften - oder sich in die widerspenstige Lady zu verlieben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungStammbaumProlog1234567891011121314151617181920212223242526EpilogAnmerkung der AutorinDie AutorinDie Romane von Sabrina Jeffries bei LYXImpressumSABRINA JEFFRIES
Ein verführerischer Unhold
Roman
Ins Deutsche übertragen vonAndreas Fliedner
Zu diesem Buch
Tristan Bonnaud hat nur ein Ziel: das rechtmäßige Erbe seines Vaters, um das sein Halbbruder George ihn gebracht hat, zurückzuholen – und sicherzustellen, dass dieser Tristans Leben kein zweites Mal zerstört. Eines Tages taucht die faszinierende Lady Zoe Keane, wohlgeborene Tochter des Earls of Olivier, in der Detektei der Duke’s Men auf. Ihr Anliegen ist äußerst brisant: Es besteht der Verdacht, dass sie gar nicht das Kind ihrer Eltern ist. Wenn dies stimmen würde, wäre sie gezwungen, ihren Cousin zu heiraten, um ihr Erbe nicht zu verlieren. Tristan soll ihr nun bei der Suche nach ihren leiblichen Eltern, die sie beim fahrenden Volk vermutet, helfen. Ausgerechnet der Mann, der Zoe bei ihrer ersten Begegnung mit einer Pistole bedrohte. Tristan jedoch sieht seine Chance gekommen, bei den Zigeunern auch Informationen über George herauszufinden, um diesen endlich zu Fall zu bringen. Aber weder Zoe noch Tristan haben mit den Geheimnissen gerechnet, die dabei ans Licht kommen – und erst recht nicht mit den Gefühlen füreinander, die sie schon bald nicht mehr verleugnen können.
Für das wunderbare Team von Creative Living. Danke für alles, was ihr tut.
Prolog
Yorkshire 1816
Als das Tageslicht im Schlafgemach des Viscount Rathmoor schwächer wurde, versuchte der siebzehnjährige Tristan, seine Hand aus dem Griff seines Vaters zu befreien. Es war an der Zeit, eine Kerze anzuzünden und das Feuer zu schüren – und in Erfahrung zu bringen, ob der Arzt schon eingetroffen war.
Aber der Vater ließ es nicht zu. »Lass mich nicht allein.«
»Ich dachte nur, ich sollte …«
»Bleib bei mir.« Er umklammerte Tristans Hand so fest, dass es wehtat.
Tristan vermied es, auf den notdürftigen Verband zu schauen, den er und der Stallbursche dem Viscount angelegt hatten, und der jetzt von Blut getränkt war. Sein Vater hatte schon Schlimmeres überstanden. Auf Borneo hatte er einst gegen die Piraten gekämpft, die dort ihr Unwesen getrieben hatten, und er hatte jedem, der es hören wollte, davon erzählt. Sein Vater war gut darin, Abenteuer zu bestehen. Und er war ein guter Geschichtenerzähler.
Tristans Kehle zog sich zusammen. Sein Vater war gut in allem, was er tat … außer darin, sich um seine Familie zu kümmern. Oder besser gesagt: um seine beiden Familien.
Indem er Tristans Hand noch fester packte, versuchte der Vater jetzt, sich aufzusetzen.
»Nicht!«, rief Tristan. »Du musst dich schonen, bis der Doktor da ist.«
Der Viscount zitterte. »Es hat keinen Sinn, Junge. Ich sterbe. Jetzt bist du an der Reihe … dich um deine Mutter und deine Schwester … zu kümmern. Du bist jetzt … der Mann im Haus.«
Panik stieg in Tristan auf. »Das darfst du nicht sagen. Du wirst wieder gesund.«
Der Vater musste wieder gesund werden. Mutter und Lisette würden es nicht überstehen, wenn er starb.
Tristan schluckte seine Tränen hinunter. Er durfte jetzt keine Schwäche zeigen. Damit er aufhörte zu zittern, zog er seinem Vater die Bettdecke bis zum Kinn hoch. Gewiss fror der Vater nur. Es war wirklich höchste Zeit, dass jemand das Feuer schürte.
»Weg von ihm!«, befahl eine herrische Stimme von der Tür her. »Du hast kein Recht, ihn anzufassen.«
Tristan fuhr hoch, als er George Manton erblickte, seinen verhassten neun Jahre älteren Halbbruder. George würde den Adelstitel und das Anwesen der Rathmoors erben, weil er ehelich gezeugt worden war.
Tristan nicht. Das war der Grund, warum man ihn in der Stadt »den französischen Bastard« nannte, auch wenn er nur zur Hälfte Franzose und hier in Rathmoor Park geboren und aufgewachsen war.
»Lass den Jungen … in Ruhe«, keuchte der Viscount. »Ich will ihn bei mir haben.«
George betrat das Zimmer. Seine Augen funkelten im Kerzenschein. »Vielleicht ist dein verdammter Bastard schuld daran, dass du angeschossen wurdest.«
»Das ist eine Lüge!«, protestierte Tristan.
»Genug.« Der Atem des Vaters ging in kurzen Stößen, wie der eines Rennpferds kurz vor der Ziellinie.
»Niemand war schuld. Das Gewehr hatte eine Fehlzündung … Es war ein Unfall.«
»Das werden wir noch sehen«, entgegnete George. »Du kannst dich darauf verlassen, dass ich mit dem Stallburschen und allen, die sonst noch dabei waren, sprechen werde.«
»Wo ist Dom?«, fragte der Viscount. »Dom … soll herkommen.«
Als George das Gesicht verzog, wusste Tristan, dass er mit allem rechnen musste. George verabscheute Dominick, seinen legitimen jüngeren Bruder, fast so sehr wie seine Halbgeschwister. Vielleicht deshalb, weil Lady Rathmoor bei Doms Geburt gestorben war. George war damals erst sieben gewesen.
Dom und Tristan hielten wie Pech und Schwefel zusammen, der Grund dafür lag vermutlich darin, dass George mit keinem von beiden etwas zu tun haben wollte. Außerdem war Dom nach dem Buchstaben des Gesetzes als zweitgeborener Sohn kaum besser gestellt als ein Bastard. Letztlich hing ihrer beider Zukunft von der Laune ihres Vaters ab. Das reichte, um die beiden Halbbrüder zusammenzuschweißen.
»Dom ist noch in York«, erinnerte Tristan seinen Vater. »Er kommt erst heute Abend zurück.«
»Kann nicht warten«, stieß sein Vater hervor. »Ich muss es … jetzt tun. Holt mir … mein Schreibpult.«
Vaters abgehackte Sprechweise machte Tristan Angst. Als George nicht sofort reagierte, sprang Tristan auf und drängte sich an dem massigen Dreckskerl vorbei, um das tragbare Schreibpult zu holen, das ihren Vater durch Ägypten, Frankreich, Siam und all die anderen Länder begleitet hatte, in die seine Reiselust ihn in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten geführt hatte.
Als Tristan das Schreibpult herbeigebracht hatte, holte sein Vater mühsam Luft. »Schreib auf, was ich sage, Junge!«
Mit einem wachsamen Blick auf George, der vor Wut kochte, tauchte Tristan die Feder in das Tintenfass, um die Worte niederzuschreiben, die sein Vater ihm stockend diktierte: »Ich, Ambrose Manton … Viscount Rathmoor … im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte … füge … meinem letzten Willen und Testament … das Folgende hinzu.« Der Viscount hielt inne, um Atem zu schöpfen. »Meinem außerhalb der Ehe gezeugten Sohn Tristan Bonnaud vermache ich meinen Wallach … Blue Blazes …«
»Vater!«, unterbrach ihn George scharf. »Blue Blazes steht Dom oder mir zu.«
Der Blick des Viscount wurde eisig. »Ich habe ihn letztes Jahr … deinem Halbbruder versprochen. Tristan hat ihn für mich ausgesucht, also soll der Junge … ihn bekommen.«
George wurde rot, während Tristan hastig die Worte niederschrieb. Tristan liebte Blue Blazes. Seit sein Vater ihn bei einer Auktion in York gekauft hatte, hatte der Wallach die begehrtesten Preise gewonnen. Kein Wunder, dass George ihn unbedingt für sich wollte. Doch George würde alles andere erben, da musste er nicht auch noch Blue Blazes bekommen.
Aber bedeutete das etwa, dass der Vater sie in seinem Testament überhaupt nicht bedacht hatte? Wie konnte das sein?
Während sein Vater weiter diktierte und Verfügungen für Dom traf, bemühte sich Tristan, seine Bestürzung zu verbergen. Schlimm genug, dass der Vater sich nicht um seine unehelichen Kinder kümmerte. Aber dass er nicht an Dom gedacht hatte? Das war einfach nicht richtig.
Der Viscount diktierte weiter, verfügte, dass Tristans Schwester Lisette einige Andenken von seinen Reisen erhielt und ihrer beider Mutter, die über zwanzig Jahre lang seine Mätresse gewesen war, das Cottage sowie eine jährliche Leibrente von zweihundert Pfund. Seiner Mutter, der der Viscount immer wieder versprochen hatte, sie zu heiraten. Was er jedoch nie getan hatte, aus Angst vor dem möglichen Skandal. Und jetzt war es zu spät.
Nein. Der Vater würde überleben. Er musste einfach!
»Etwas noch, Junge«, sagte sein Vater rau. »Schreib auf, dass Fowler … dich als Gehilfen nimmt und dich … zum Verwalter ausbildet.«
Während George leise fluchte, brachte Tristan hastig die Worte zu Papier. Schon seit Jahren war davon die Rede, Tristan beim Gutsverwalter in die Lehre zu schicken, aber Tristan hatte nie zu hoffen gewagt, dass der Vater sein Versprechen wahrmachen würde. Er konnte sich nichts Großartigeres vorstellen, als Fowler bei seiner Arbeit zu helfen und vielleicht eines Tages selbst das Amt des Verwalters zu übernehmen.
Nachdem er alle Verfügungen getroffen hatte, überlas der Viscount das Schriftstück noch einmal und hielt es dann George hin. »Unterschreib … und setz ›Zeuge‹ unter deinen Namen. Wenn du unterschrieben hast … wird niemand den Nachtrag anzweifeln …. Er widerspricht schließlich … deinen Interessen.«
George verschränkte die Arme vor der Brust. »Allerdings. Das tut er. Und genau deshalb werde ich nicht unterschreiben.«
Ein berechnender Ausdruck flog über das Gesicht des Viscount. »Vielleicht … lebe ich ja doch noch ein wenig länger, mein Junge. Der Doktor … ist schon unterwegs. Wenn ich das hier überstehe … dann wirst du es bereuen … mir nicht gehorcht zu haben.«
Dem Viscount war es durchaus möglich, seine Drohung wahrzumachen. Er konnte die Ländereien verkaufen, die nicht zum Erbvermögen gehörten. Oder eine Hypothek auf das Anwesen aufnehmen, und George würde den Rest seiner Tage damit verbringen, sich aus den Schulden herauszuarbeiten. Und abgesehen davon war George so lange vom Geld des Vaters abhängig, bis er sein Erbe antreten konnte.
Tristan hielt den Atem an. Wenn George den Blutfleck nicht bemerkte, der sich, unter der Bettdecke verborgen, rasch ausbreitete, würde er vielleicht klein beigeben.
Das Geräusch von Pferdehufen vor dem Fenster gab offenbar den Ausschlag. George riss Tristan den Testamentsnachtrag und den Federkiel aus der Hand und unterschrieb. Doch dann stand er reglos da und starrte auf das Papier.
Der Vater streckte eine zitternde Hand aus. »Gib es mir.«
George zögerte.
»Gib … es … mir …«, stieß der Viscount hervor, doch seine Stimme wurde hörbar schwächer.
Tristan beugte sich vor, um den Kopf des Vaters anzuheben und das Kissen aufzuschütteln. »Halt durch, Vater.« Sein Magen zog sich zusammen. »Der Doktor ist gleich da. Du darfst uns jetzt nicht verlassen. Du darfst einfach nicht!«
Die Augen des Vaters trübten sich. »Nimm … das Papier … Tristan. Versprich mir … dass du … es Dom gibst.«
»Du darfst jetzt nicht mehr sprechen.« Ein eisiger Schauder überlief Tristan, als er sah, wie sein Vater um Worte rang.
»Versprich es mir«, presste sein Vater zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Ich verspreche es. Und jetzt musst du ruhig sein.« Tristan streckte George seine Hand entgegen. »Gib mir das Papier. Bitte. Du siehst doch, dass es Vater aufregt.«
Aber George stand immer noch da und starrte das verdammte Stück Papier an. Dann vernahmen sie plötzlich ein gurgelndes Geräusch, und Georg schreckte auf. »Vater?« Er trat an die andere Seite des Bettes. »Vater!«
Ein dünner Faden Blut rann aus des Vaters Mund, und Tristans Herz setzte einen Schlag lang aus. »Nein, das darf nicht sein! Nein, nein, nein … Vater!«
Er legte die Hände um den Kopf des Vaters, doch dessen Augen blickten starr, und sein Brustkorb hob und senkte sich nicht mehr.
»Wir müssen ihm helfen«, rief Tristan zu George. »Wir müssen irgendetwas tun!«
»Geh vom Bett weg!«
Tristan machte einen Schritt zurück. George legte den Testamentsnachtrag aus der Hand und beugte sich vor, um seinen Vater an den Schultern zu rütteln. »Vater«, sagte er fest. »Verdammt noch mal, wach auf!«
Als sich am glasigen Blick des Viscount nichts änderte, nahm George einen Handspiegel vom Ankleidetisch und hielt ihn ihm vor den Mund. Dann fluchte er leise.
»Und?«, fragte Tristan ängstlich.
Georges Gesicht sah aus wie versteinert. »Kein Atem mehr. Er ist tot.«
»Du lügst!« Tristan begann wie ein Wahnsinniger, die Hände seines Vaters zu reiben und dessen Brust zu massieren, doch der unheimliche glasige Blick wollte nicht weichen. Ein einziges Mal hatte George die Wahrheit gesagt.
Tristan glaubte, das Blut in seinen Adern würde zu Eis erstarren. Sein Vater war tot. Sie würden nie wieder zusammen zum Pferderennen gehen, nie wieder zusammen Graugänse oder Hirsche jagen. Es würde keine gemütlichen Abende mehr im Cottage geben, bei denen Vater ihnen mit aufregenden Geschichten von seinen Reisen die Zeit vertrieb.
Mit aller Macht unterdrückte Tristan seine Tränen. Er wollte seinem Halbbruder keinen Grund geben, sich über ihn lustig zu machen. Besonders, weil George nicht weinte – obwohl er den Toten unentwegt anstarrte, als wollte er ihn durch seinen Blick wieder zum Leben erwecken.
»Was machen wir jetzt?«, flüsterte Tristan.
»Wir machen gar nichts. Ich werde den Tod meines Vaters betrauern und mich um sein Begräbnis kümmern. Und du wirst dieses Haus verlassen. Auf der Stelle.«
Georges Worte trafen Tristan wie ein Schlag. »Du willst doch nicht … Du kannst mich doch nicht aus dem Haus werfen …«
George streckte den Arm aus, um seinem Vater die Augen zu schließen und ihm das Laken über das Gesicht zu ziehen. »Von heute an tue ich, was mir gefällt. Dieses Haus mit allem, was darin ist, gehört jetzt mir.« Er warf Tristan einen giftigen Blick zu. »Und du wirst von hier verschwinden und keinen Fuß mehr über meine Schwelle setzen.«
Ganz unerwartet kam dieser Befehl für Tristan nicht. Nur sein Vater und Dom hatten ihm die Tür von Rathmoor House geöffnet, und jetzt würde selbst Dom es sich zweimal überlegen, bevor er sich gegen George stellte.
Der Gedanke an Dom erinnerte Tristan an sein Versprechen. Dom studierte die Jurisprudenz, um einmal Anwalt zu werden, und kannte sich daher mit Erbschaftsangelegenheiten aus. Deshalb hatte der Vater gewollt, dass Dom den Testamentsnachtrag bekam.
Tristan ging um das Bett zum Nachttisch, auf dem George das Schriftstück abgelegt hatte, doch sein Halbbruder versperrte ihm den Weg.
»Lass mich vorbei«, sagte Tristan.
»Nur über meine Leiche.«
Eiskalte Angst schnürte Tristan die Brust zusammen. Was, wenn George das Dokument anfocht …
Nein. Nicht einmal George würde so etwas Gemeines tun. »Ich habe Vater versprochen, Dom den Testamentsnachtrag zu geben. Du willst mich doch nicht daran hindern, mein Versprechen zu halten?«
Wie eine Krähe, die sich über ein Stück Aas hermacht, hackte George auf seine Hoffnungen ein. »Wenn du glaubst, dass ich mich von dir und deiner Hure von einer Mutter auch nur um einen Penny meines Erbes betrügen lassen, dann hast du dich getäuscht.«
Hure von einer Mutter. Zur Hölle, Tristan hatte diese Worte schon zu oft aus Georges Mund gehört. Er starrte seinen Bruder an. »Wenn du meine Mutter noch einmal eine Hure nennst, dann schlage ich dich zu Brei.«
George schnaubte. »Versuch’s doch. Bis jetzt hast du gegen mich noch immer den Kürzeren gezogen. Und daran wird sich auch nichts ändern.«
Tristan war bereit, es darauf ankommen zu lassen. In der Hoffnung, George zu überrumpeln, hechtete er auf den Nachttisch zu, auf dem das Dokument lag, doch George war schneller, ergriff es und schleuderte es ins Feuer.
»Nein!«, rief Tristan und wollte zum Kamin stürzen.
Doch George umklammerte ihn von hinten und hielt ihn fest, so sehr Tristan auch versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien. »Du wirst Blue Blazes nie wiedersehen, hörst du?«, zischte George. »Und du wirst auch niemals zum Gutsverwalter ausgebildet werden, solange ich ein Wörtchen mitzureden habe.«
Tristans Herz zog sich zusammen, als er seine Hoffnungen in Flammen aufgehen sah. »Vater wollte, dass ich eine Zukunft habe.« Es war ein Beweis seiner Liebe gewesen, und davon hatte Tristan weiß Gott wenig genug erfahren. »Willst du seinen letzten Wunsch missachten?«
Jetzt, nachdem das Dokument zu Asche verbrannt war, ließ George Tristan los. »Er war nicht mehr bei Sinnen. Und ich werde es nicht dulden, dass du für den Rest meines Lebens auf Rathmoor Park herumschleichst und uns überall, wo wir hingehen, Schande machst.«
Schande. Tristan konnte es nicht mehr hören. Die Angst der Mantons, Schande über ihren Namen zu bringen, war schuld daran, dass Mutter niemals die Chance gehabt hatte, ein anständiges Leben zu führen. Er durfte nicht zulassen, dass George das tat!
»Warum willst du mir nicht wenigstens Blue Blazes geben?« Dann hätte Tristan mit dem Wallach an Rennen teilnehmen und so für seine Mutter und seine Schwester sorgen können. »Du hast jede Menge andere gute Pferde. Du brauchst nicht auch noch Blue Blazes!«
»Du könntest mit dem Tier doch nichts anfangen. Selbst wenn es dir gehören würde«, stieß George hervor. »Du hast doch nicht einmal genug Geld, um für Blue Blazes zu sorgen.«
»Wir könnten bei Rennen antreten …«
»Wo denn?« George maß Tristan mit einem kalten, verächtlichen Blick. »Glaubst du tatsächlich, dass die Gentlemen, die ihre Pferde bei Rennen starten lassen, einen Franzosenbastard wie dich in ihren Kreisen haben wollen? Sie haben dich immer nur Vater zuliebe geduldet.«
»Das ist nicht wahr!«, entgegnete Tristan wütend, obwohl er fürchtete, dass es sehr wohl wahr war. »Alle sagen, dass ich eine Menge von Pferden verstehe. Vater hat mir gesagt, dass seine Freunde beeindruckt von mir waren.«
»Vielleicht davon, wie geschickt du deinen Vater hinters Licht geführt hast. Aber selbst wenn ich dir den Wallach überlassen würde, gibt es sonst nichts, womit du sie beeindrucken könntest.« George sah ihn verächtlich an. »Warum, glaubst du, hat Vater dich nur auf die Grundschule in Ashcroft geschickt? Er wusste, dass es keinen Sinn hatte. Du bist zu dumm, um irgendetwas anderes zu tun, als der Familie auf der Tasche zu liegen. Und damit ist jetzt Schluss.«
Wut kochte in Tristan hoch. Wovon sollten sie leben, ohne die Leibrente, wenn ihnen nicht einmal das Pferd blieb? Was würde mit Mutter und Lisette geschehen? »Ich werde überall herumerzählen, was du getan hast.« Er konnte die Angst der Familie vor einem Skandal genauso gut als Waffe gegen George einsetzen. »Du wirst damit nicht durchkommen!«
George lachte. »Wem willst du es denn erzählen? Den Dienstboten? Den Leuten im Dorf? Dein Wort steht gegen meins. Und du bist nichts weiter als ein Bastard. Selbst wenn sie dir glauben würden – sie wissen genau, woher das Geld kommt, von dem sie leben, und deshalb werden sie nichts unternehmen.«
»Dom schon.« Tristan ballte die Hände zu Fäusten. »Er wird das niemals dulden. Du hast auch sein Erbe verbrannt.«
»Ich werde schon für meinen legitimen Bruder sorgen«, erwiderte George eisig. »Ich hätte den Testamentsnachtrag sowieso vor Gericht angefochten. Ihr hättet das Geld nie gesehen.«
»Dann hattest du keinen Grund, ihn zu verbrennen«, gab Tristan zurück.
George zuckte die Schultern. »So muss ich nicht monatelang auf den Ausgang eines Gerichtsverfahrens warten. Deshalb wird sich Dom auf meine Seite schlagen – weil er mein Geld braucht, um zu überleben. Jedenfalls wird er sich wegen Leuten wie dir und deiner Familie nicht gegen mich stellen.«
»Vergiss einmal einen Moment Gerichte und Testamente! Ich bin immer noch dein Blutsverwandter. Und Lisette auch.«
George erstarrte. »Nur wegen eines bedauerlichen Fehlverhaltens. Ihr bedeutet mir nichts. Und ich will, dass du dieses Haus verlässt. Sofort!«
Als Tristan sich nicht vom Fleck rührte, ging George mit großen Schritten an ihm vorbei zur Tür. »Hucker!«
Tristans Muskeln spannten sich. Georges brutaler Handlanger stand immer auf Abruf bereit und wartete nur auf einen Befehl seines Herren. Sekunden später erschien er auch schon in der Tür.
»Der Doktor ist noch nicht da, gnädiger Herr …«
»Von jetzt an heißt es ›Mylord‹. Merken Sie sich das«, stieß George hervor. Das schien selbst Hucker aus der Fassung zu bringen. Sein Blick wanderte an Tristan vorbei zum Bett, und er erbleichte. »Ich verstehe.«
»Nehmen Sie diesen Bastard«, fuhr George fort, »und schaffen Sie ihn mir aus den Augen. Er soll sich in Zukunft auf eine Meile von diesem Haus fernhalten.«
»Ja, Mylord.« Hucker straffte die Schultern und kam auf Tristan zu. Seine Gesichtszüge waren beängstigend ausdruckslos. »Komm jetzt, mein Junge. Du hast gehört, was der gnädige Herr … ich meine … Seine Lordschaft angeordnet hat.«
Tristan starrte George wütend an. »Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ich werde dafür sorgen, dass du für das hier bezahlst, und wenn es mich den Rest meines Lebens kosten wird.«
»Schaffen Sie ihn hier raus, Hucker, verdammt noch mal!« befahl George.
Als Hucker nach Tristans Arm greifen wollte, schüttelte Tristan seine Hand ab. »Ich gehe.« Dann stapfte er in den Korridor hinaus.
Während er die Treppe hinunterging und seine Wut mit jeder Stufe größer wurde, konnte er Huckers Schritte hinter sich hören. Zur Hölle mit George und Hucker! Und zur Hölle mit seinem Vater, der seine Pflicht seinen Kindern gegenüber so lange vernachlässigt hatte, bis es zu spät gewesen war.
Augenblicklich wurde Tristan von Schuldgefühlen ergriffen. Was war nur mit ihm los, dass er schlecht von seinem Vater dachte, noch bevor dessen Leichnam kalt und unter der Erde war? Vater konnte nichts dafür. George war an allem schuld. Ganz allein George.
Als sie ins Freie traten, erwartete Tristan eigentlich, dass Hucker ihn allein weitergehen lassen würde. Doch der verdammte Dreckskerl blieb dicht hinter ihm. Er hielt jetzt eine Laterne in der Hand.
»Sie müssen mir nicht leuchten«, knurrte Tristan. »Den Weg zum Cottage finde ich allein, der Mond scheint hell genug. Lassen Sie mich in Ruhe, verdammt noch mal.«
»Wenn Seine Lordschaft sagt, dass er Sie eine Meile vom Haus weghaben will, dann sorge ich dafür, dass Sie eine Meile vom Haus weg sind.«
»Sollen wir einen Zollstock holen und nachmessen?«, entgegnete Tristan gereizt.
Hucker gab keine Antwort, blieb aber den ganzen Weg über die weitläufige Rasenfläche stur an Tristans Seite.
Hucker war früher einmal ein halbwegs anständiger Kerl gewesen, damals, als er noch Vaters Haushofmeister gewesen war. George war schon im Internat gewesen, aber Dom war noch zu Hause, und Hucker hatte Tristan und Dom immer Süßigkeiten zugesteckt, wenn sie zu ihren Expeditionen in die Höhle bei Flamborough Head aufgebrochen waren. Hucker hatte Tristan die Grundlagen der Buchführung erklärt und ihm im zarten Alter von acht Jahren seinen ersten Zigarillo geschenkt.
Dann war George nach Hause zurückgekehrt, nachdem er die Schule in Harrow beendet hatte. Als Vater wieder einmal auf Reisen war und George die Leitung des Guts anvertraut hatte, hatte George Hucker zu seiner persönlichen rechten Hand befördert, und alles war anders geworden.
Jetzt war Hucker genauso gemein wie George. Dom sagte immer, dass Hucker sich bei George angesteckt habe und wohl nicht wieder gesund werden würde.
»Ich verstehe nicht, wie Sie für ihn arbeiten können«, sagte Tristan. »Er ist ein Lügner und ein Betrüger.«
»Er ist der Herr auf Rathmoor Park. Ich tue, was man mir sagt.« Hucker warf ihm aus dem Augenwinkel einen Blick zu. »Wenn Sie klug wären, würden Sie auch tun, was man Ihnen sagt. Es gibt nichts zu gewinnen, wenn man sich gegen ihn stellt. Das sollten Sie mittlerweile begriffen haben.«
»Also soll ich vergessen, dass er mir mein Erbe gestohlen hat und meine Familie zerstören will?«
Hucker fragte nicht einmal nach, was er damit meinte. »Sie sind ein Bastard. Für Sie war sowieso nicht viel übrig. So sind die Dinge eben.«
Tristan war daran gewöhnt, dass man ihn einen Bastard nannte, aber dass Hucker so kalt sein konnte, empörte ihn. Sie gingen an den Ställen vorbei, und Tristan straffte sich. Blue Blazes war da drin. Sein Blue Blazes. Es war nicht fair. Nichts von alledem war fair, verdammt noch mal!
Sie waren auf halbem Wege zum Cottage, als Hucker ihn endlich allein ließ. Tristan ging lange genug weiter, um sicher zu sein, dass der Schuft ihn nicht mehr beobachtete. Vielleicht war es das Beste zu warten, bis Dom zurückkehrte, und ihm zu berichten, was George getan hatte.
Und was dann? George hatte recht: Dom würde sich auf die Seite seines legitimen Bruders schlagen. Er hatte keine andere Wahl. Solange er sich auf Georges Seite stellte, war er sicher. Und Dom konnte im Grunde auch nichts tun, um Tristan zu helfen. Er verfügte weder über ein eigenes Vermögen noch über Grundbesitz.
Und das hieß, dass Tristan und seine Familie dem Hungertod entgegensahen. Das Cottage mit fast allem, was darin war, gehörte zu Rathmoor Park. Hölle und Verdammnis. Wenn George wollte, konnte er sie morgen vor die Tür setzen.
Wovon sollten sie leben? Wohin sollten sie gehen?
Der Klang von Geigen wehte durch den Wald zu ihm und riss ihn aus seinen düsteren Gedanken. Er kam aus dem Zigeunerlager ganz in der Nähe. Der Viscount, in seinem tiefsten Innern auch ein Nomade, hatte den Zigeunern – den Romany people, wie sie sich selbst nannten – immer erlaubt, auf seinem Land zu campieren. Aber das würde sich zweifellos ändern, jetzt, da George das Sagen hatte. Auch sie würden vom Gut gejagt werden, wenn nicht morgen, dann übermorgen. Vielleicht sollte er sie warnen.
Er ging durch den Wald auf ihre Lagerfeuer zu. Wenigstens sein Freund Milosh Corrie, der Pferdehändler, würde verstehen, was es für ihn bedeutete, Blue Blazes zu verlieren. Milosh wusste Schönheit und Charakter eines Pferdes wie Blue Blazes zu schätzen.
Zur Hölle mit George. Gut, vielleicht hätte Tristan es sich tatsächlich nicht leisten können, Blue Blazes zu halten, doch er hätte den Wallach immer noch für einen guten Preis an Milosh verkaufen können, und dann …
Der Gedanke ließ Tristan innehalten. Milosh würde einiges darum geben, ein so schönes Vollblut zu kaufen. Das Geld dafür hatte er, und vielleicht würde er genug für das Pferd bezahlen, damit sie überleben konnten, bis Tristan irgendeine Arbeit gefunden hatte. Und Tristan war schließlich der rechtmäßige Besitzer des Pferdes, ganz egal, was George sagte. Wenn Tristan sich Blue Blazes nahm, dann erfüllte er damit nur Vaters Wunsch.
Die Gelegenheit war günstig. Die Stallknechte waren um diese Zeit beim Abendessen. Er konnte in den Stall hinein- und mit Blue Blazes wieder hinausmarschieren, während sie oben über ihren Tellern saßen. Wenn er die Stalltür offen ließ, würden sie denken, dass der Wallach ausgerissen war.
Es ließ sich machen … aber nur, wenn er es jetzt tat. Und nur, wenn er Milosh davon überzeugen konnte, ein Pferd zu kaufen, dass jeder andere als gestohlen ansehen würde.
Ich habe ihn letztes Jahr … deinem Halbbruder versprochen. Tristan hat den Wallach für mich ausgesucht, also soll der Junge … ihn bekommen.
Die Worte seines Vaters gaben den Ausschlag. Zum Teufel mit den Leuten und ihren unfairen Gesetzen. Blue Blazes gehörte ihm, verdammt noch mal. Also hatte nur er allein das Recht, über das Schicksal des Pferdes zu entscheiden.
Eine Stunde später sah Tristan zu, wie Milosh den Wallach genau in Augenschein nahm. Der Zigeuner hatte Blue Blazes zwar schon einige Male gesehen, doch noch nie lange genug, um schätzen zu können, wie viel er wert war.
Milosh warf Tristan einen misstrauischen Blick zu. »Er gehört also dir? Dein Vater hat ihn dir geschenkt?«
Es war Zeit, zu dem zu stehen, was er getan hatte. Er würde das Leben seines Freundes nicht aufs Spiel setzen. Wenn Milosh sich auf den Handel einließ, dann musste er alles wissen.
Rasch schilderte Tristan die Ereignisse des Abends. Milosh murmelte etwas auf Romanes, der Sprache der Zigeuner. Tristan hatte während der Zeit, die er mit ihnen verbracht hatte, ein paar Worte ihrer Sprache aufgeschnappt, daher verstand er, dass Milosh so etwas wie »leichtsinniger Dummkopf« gesagt hatte.
Tristan sah dem Mann, der zwar nur ein paar Jahre älter war als er, der jedoch mehr über das Kaufen, Verkaufen und Ausbilden von Pferden wusste, als irgendjemand anders, den er kannte, fest in die Augen. »Wenn du willst, bringe ich Blue Blazes wieder zurück. Ich lasse ihn in der Nähe der Ställe stehen, damit die Stallburschen ihn finden.«
Milosh zögerte. Es war offensichtlich, dass er das Vollblut haben wollte. »Dein Halbbruder wird jeden aufhängen lassen, den er mit dem Pferd erwischt.«
»Dann lass dich nicht erwischen. Brecht bei Tagesanbruch euer Lager ab. Ihr müsst sowieso einen neuen Lagerplatz suchen, denn George wird euch auf keinen Fall hierbleiben lassen. Wenn er merkt, dass Blue Blazes weg ist, werden du und deine Leute längst über alle Berge sein, und niemand wird sich irgendetwas dabei denken, da jedermann weiß, dass George Zigeuner hasst.«
»Sie werden denken, dass wir das Pferd gestohlen haben.«
»Sie werden denken, dass ich Blue Blazes gestohlen habe, aber sie werden es nicht beweisen können. Weil Blue Blazes verschwunden sein wird.«
Milosh rieb sich das stopplige Kinn und betrachtete nachdenklich das Pferd. »Und du bist dir sicher, dass niemand gesehen hat, wie du ihn genommen hast?«
Tristan dachte an das Geräusch, dass er gehört hatte, als er mit Blue Blazes aus dem Stall gekommen war. Doch er kam zu dem Schluss, dass es nichts zu bedeuten gehabt hatte. Es war bestimmt nur ein Hund gewesen. »Ja. Ich bin mir sicher. Hätte mich jemand beobachtet, hätte er Alarm geschlagen. Und im Übrigen hat Hucker mit eigenen Augen gesehen, wie ich das Gut verlassen habe. Wenn etwas passiert, wird er der Erste sein, dem George die Schuld gibt.«
Miloshs Lippen wurden schmal. »Hucker wird lügen.«
»Du meinst, dass er George anlügen wird?«
»Ob er George anlügt oder für George lügt ist doch einerlei. Man kann Hucker auf keinen Fall trauen.«
Der überzeugte Unterton in Miloshs Stimme ließ Tristan aufhorchen. »Warum sagst du das?«
Miloshs Blick wurde verschlossen. »Du weißt, dass es die Wahrheit ist.«
»Ja. Aber es klingt so, als hättest du deine eigenen Erfahrungen mit Hucker gemacht.« Tristan sah Milosh forschend an. »Wenn du davon weißt, dass Hucker irgendwann einmal für George gelogen hat, und wenn es etwas ist, das ich gegen George verwenden könnte …«
»Was verlangst du für das Pferd?«, wechselte Milosh das Thema.
Tristan musterte ihn durchdringend, aber Milosh hatte offensichtlich nicht vor, ihn ins Vertrauen zu ziehen. Die Zigeuner konnten ziemlich verschwiegen sein, auch gegenüber jemandem, den sie mochten. Am Ende war Tristan auch nur ein Gadzo – ein Nicht-Zigeuner.
Er fluchte leise. »Zweihundertfünfzig Pfund. Es ist fünfhundert wert, also machst du einen hübschen Gewinn.«
»Nur, wenn die Leute seinen Stammbaum kennen, aber ich kann es nicht unter seinem richtigen Namen verkaufen. Und dann ist da noch das Risiko, dass ich eingehe, solange ich das Pferd bei mir habe. Ich muss es schließlich irgendwohin bringen, wo niemand von seinem Verschwinden gehört hat, damit ich es verkaufen kann.« Er warf Tristan einen verschmitzten Blick zu. »Ich gebe dir hundertfünfzig und keinen Penny mehr. Und nur, weil du es bist.«
»Und um George zu ärgern. Und Hucker.«
Milosh nickte knapp.
Von hundertfünfzig Pfund würden Mutter, Lisette und er in York ein paar Jahre leben können, und er konnte sich in Ruhe nach einer Arbeit umsehen.
Er warf Blue Blazes einen letzten wehmütigen Blick zu und streckte seine Hand aus. »Abgemacht.«
Milosh schlug ein. »Ich hoffe, dass du es nicht bereuen wirst, mein Freund.«
»Das werde ich nicht. Irgendwie muss ich für Mutter und Lisette sorgen. Denn sobald George sein Erbe antritt, haben wir nichts mehr zu essen und kein Dach mehr über dem Kopf. Und das kann ich nicht zulassen.«
Am nächsten Abend stand ein ernüchterter Tristan mit seiner Mutter und seiner Schwester am Strand von Flamborough Head. Er hatte hoch gespielt und verloren. Zwar hatte er noch das Geld, das Milosh ihm gegeben hatte, doch jetzt war er auf der Flucht, und die Verfolger waren ihm und seiner Familie auf den Fersen. Was er gehört hatte, als er Blue Blazes aus dem Stall geführt hatte, war kein Hund gewesen, sondern einer der Bediensteten. Und er hatte Tristan erkannt.
Jetzt durchkämmte George die Gegend nach ihm und Blue Blazes, und Mutter und Lisette hatten das Cottage verloren. Einen Teil des Geldes hatten sie für die heimliche Überfahrt nach Frankreich verwenden müssen. Von Biarritz wollten sie dann über Land nach Toulon weiterreisen, wo Mutters Familie lebte. Denn George setzte bereits alles daran, Tristan an den Galgen zu bringen.
Tristan blickte in das gramerfüllte Gesicht seiner Mutter und schluckte hart. Sie hatte an einem Tag ihr Heim und den Mann, den sie liebte, verloren, und er war für wenigstens die Hälfte ihres Verlusts verantwortlich.
Lisette ließ ihre Hand in seine gleiten und drückte sie. »Es wird alles gut, Tristan«, flüsterte sie. »Dom hat versprochen, uns regelmäßig zu schreiben und uns auf dem Laufenden halten. Und eines Tages werden wir bestimmt zurückkommen können.«
Tristans Brust schnürte sich zusammen. Das war das Schlimmste von allem. Dom hatte sich nicht auf Georges Seite gestellt. Er hatte für sie Partei ergriffen und dadurch alles verloren. Und alles wegen Tristans unbesonnenem Diebstahl.
Nein, nicht deswegen verdammt noch mal! Sondern weil ihr pflichtvergessener Vater nicht daran gedacht hatte, nach Doms Geburt sein Testament zu ändern. Nur deshalb hatte George den Nachtrag verbrennen und Dom und sie alle mittellos machen können. Selbst wenn Tristan das Pferd nicht gestohlen hätte, hätte George sie hinausgeworfen. Auch dann hätten sie das Cottage verlassen und alles aufgeben müssen – nur nicht so rasch.
Und auch wenn sie in England hätten bleiben können, was hätte es ihnen geholfen? George hätte Dom niemals erlaubt, ihnen auch nur einen Penny zu geben. Sie hätten so oder so alles verloren.
Vaters Worte kamen ihm in den Sinn: Jetzt bist du an der Reihe … dich um deine Mutter und deine Schwester … zu kümmern. Du bist jetzt … der Mann im Haus …
Ja das war er. Und er hatte getan, was er musste, um dafür zu sorgen, dass sie überlebten, bis er Arbeit gefunden hatte. Der wahre Schurke in diesem Stück war George.
Tristan straffte die Schultern und blickte hinaus aufs Meer, das ihn bald von dem einzigen Zuhause trennen würde, das er kannte. Doch das spielte jetzt keine Rolle mehr. Er würde es durchstehen. Sie würden es alle durchstehen, selbst wenn er wie ein Ochse schuften musste, um sie über die Runden zu bringen.
Aber niemand würde jemals wieder so mit ihm und Mutter und Lisette umspringen. Er würde lernen, sich in dieser vermaledeiten, heimtückischen Welt durchzusetzen. Mit allen Mitteln. Er würde lernen, zu kämpfen, und er würde lernen, zu gewinnen.
Und eines Tages, würde er mit diesem Wissen nach Yorkshire zurückkehren. Und dann sollte George sich besser vorsehen. Denn Tristan würde dafür sorgen, dass sein Halbbruder für seine Schurkereien bezahlte, und wenn es das Letzte war, was er tat.
1
London, Februar 1829
Als die Mietdroschke zum Stehen kam, schlug Lady Zoe Keane ihren Schleier zur Seite und blickte durch das schlierige Kutschenfenster, um sich das Haus, das gegenüber dem Theatre Royal in Covent Garden stand, genauer anzusehen.
Nein. Das konnte unmöglich der Sitz der Agentur Manton sein. Das Haus war viel zu unansehnlich und gewöhnlich für die berühmten »Männer des Herzogs«! Wo waren die Pferde, die vor der Freitreppe bereitstanden, um der Gefahr entgegenzugaloppieren? Wo war das beeindruckende Firmenschild mit den vergoldeten Lettern?
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte sie Ralph, den Lakaien, als er ihr aus der Kutsche half.
»Ja, Mylady. Das ist die Adresse, die Sie mir gegeben haben. Bow Street Nummer 29.«
Die Kälte kniff sie in die Wangen, und sie zog den Schleier vor das Gesicht. Besser, sie wurde nicht dabei gesehen, dass sie ein Haus betrat, in dem sich nur Männer aufhielten. Und schon gar nicht dieses Haus. »Irgendwie sieht es nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte.«
»Und sicher scheint es auch nicht zu sein.« Ralph ließ einen argwöhnischen Blick über die wenig vertrauenerweckende Nachbarschaft schweifen. »Wenn Ihr Vater wüsste, dass ich Sie in eine so schlechte Gegend fahre, würde er mich aus dem Haus jagen. Jawohl, das würde er.«
»Nein. Auf keinen Fall. Das würde ich nicht zulassen.« Wie Mama immer gesagt hatte: Eine Lady bekommt, was sie will, indem sie ihre Autorität in die Waagschale wirft … selbst wenn ihr unter ihrem Wollkleid die Knie schlotterten. »Außerdem wird er nichts davon erfahren. Du hast mich auf meinem Spaziergang im St. James’ Park begleitet, das ist alles. Etwas anderes wird ihm nie zu Ohren kommen.«
Das durfte es auch nicht, denn ihr Vater würde gewiss sofort erraten, warum sie eine Ermittlungsagentur aufgesucht hatte. Und dann würde er drakonische Maßnahmen ergreifen, um sie im Auge zu behalten. Er war nicht umsonst Major in der englischen Armee gewesen.
»Ich werde nicht lange brauchen«, sagte sie zu Ralph. »Wir werden auf jeden Fall rechtzeitig zum Abendessen zu Hause sein, und niemand wird etwas merken.«
»Wenn Sie es sagen, Mylady.«
»Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen, Ralph. Ich möchte keinesfalls, dass du in Schwierigkeiten gerätst.«
Er seufzte. »Ich weiß, Mylady.«
Sie meinte, was sie sagte. Sie hatte Ralph, der seit Mamas Tod im letzten Winter ihr persönlicher Hausdiener war, wirklich gern. Von Anfang an hatte er Mitleid mit Zoe gehabt, dem »armen Ding, das seine Mutter verloren hatte«. Und wenn sie das manchmal schamlos ausnutzte, dann nur, weil ihr nichts anderes übrig blieb. Die Zeit lief ihr davon. Sie hatte Monate warten müssen, bis Papa mit ihr und Tante Flo nach London gefahren war und sie endlich dieses heimliche Treffen arrangieren konnte.
Sie stiegen die Stufen zur Haustür empor und Ralph klopfte. Dann warteten sie. Und warteten. Zoe zupfte ihren Umhang zurecht, nahm ihre Handtasche von der rechten in die linke Hand und stampfte den Schnee von ihren Stiefeln.
Schließlich öffnete sich die Tür, und ein hagerer Mann in einem rotbraunen Wams erschien auf der Schwelle, der offensichtlich ausgehen wollte.
»Mr Shaw!«, rief sie überrascht aus.
Er musterte forschend ihr verschleiertes Gesicht. »Kenne ich Sie, Madam?«
»Mylady, wenn Sie belieben«, verbesserte ihn Ralph.
Als Mr Shaw die Stirn runzelte, schaltete sich Zoe ein. »Wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Sir, aber ich habe sie gestern Abend in Viel Lärm um Nichts gesehen. Sie waren großartig. Ich habe noch nie einen Schauspieler gesehen, der den Dogberry mit so viel Gefühl gespielt hat.«
Sein Gesichtsausdruck wurde einen Hauch freundlicher. »Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«
»Ich bin Lady Zoe Keane und habe heute Nachmittag um drei Uhr einen Termin mit den Männern des Herzogs.«
Das war keine allzu dreiste Lüge. Vor einigen Monaten war sie den berühmten Ermittlern dabei in die Quere gekommen, wie sie einen Diebstahl vorgetäuscht hatten, um einen Entführer zu fassen. Als Gegenleistung für ihr Schweigen hatten die Männer des Herzogs versprochen, ihr jederzeit eine Gefälligkeit zu erweisen.
Und jetzt war sie hier, um diese Gefälligkeit einzufordern.
Sie konnte nur hoffen, dass sie sich an ihr Versprechen erinnerten. Dominick Manton, der Inhaber der Ermittlungsagentur, und Victor Cale, einer der Ermittler, schienen beide verlässliche Männer zu sein, die ihre Versprechen halten würden.
Mr Tristan Bonnaud hingegen …
Sie versteifte sich. Dieser impertinente Kerl hatte sie überrumpelt, und sie hasste es, überrumpelt zu werden. Er hatte nicht einmal ihrer Abmachung zustimmen wollen! Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn man ihm ihren Fall überließ.
»Waren sie hier, um die Ermittler zu konsultieren?«, fragte sie Mr Shaw, der ihnen noch immer den Weg nach drinnen versperrte.
Er verzog das Gesicht. »Zu meinem Bedauern, nein. Da, wie der Dichter sagt, ›die ganze Welt eine Bühne ist‹, arbeite ich nicht nur im Theater, sondern auch hier. Ich bin Mr Mantons Butler und manchmal auch sein Sekretär.«
Ach du liebes bisschen. Hoffentlich hatte er den Terminkalender seines Arbeitgebers nicht allzu genau im Kopf. »Wenn das so ist, sollten Sie mich vielleicht Mr Manton melden.« Als er die Nase rümpfte, fügte sie hastig hinzu: »Es wäre mir eine große Ehre. Wie schade, dass ich nicht damit gerechnet hatte, Sie hier zu treffen. Sonst hätte ich mein Programmheft mitgenommen und Sie um ein Autogramm gebeten.«
An der Art, wie er die Augenbrauen hochzog, erkannte sie, dass sie vielleicht ein wenig zu dick aufgetragen hatte. »Ja, das ist wirklich schade«, erwiderte er, ließ sie jedoch eintreten.
Sie legte ihren Umhang und den Hut mit dem Schleier ab und blickte sich in der Eingangshalle um. Hier sah es schon eher so aus, wie sie erwartet hatte: Schlichte, aber elegante Mahagonimöbel, ein schön gemusterter, aber nicht übertrieben teurer spanischer Teppich und hübsche blassgelbe Damastgardinen. Die Einrichtung hätte ein bisschen spektakulärer sein können – ein paar alte Dolche an der Wand hätten sich gut gemacht –, aber um ehrlich zu sein hatte sie es schon immer etwas spektakulärer gemocht als andere Leute.
Außerdem waren die Zeitungen voll von haarsträubenden Geschichten über die Männer des Herzogs, die für die unspektakuläre Einrichtung ihres Büros entschädigten. Es hieß, dass es nichts und niemanden gab, den sie nicht aufspüren konnten. Hoffentlich stimmte das.
»Ich glaube nicht, dass die Gentlemen im Moment anwesend sind.« Mr Shaw fixierte die Eingangstür mit einem merkwürdig sehnsuchtsvollen Blick. »Möglicherweise haben sie die Verabredung vergessen. Vielleicht sollten Sie später wiederkommen.«
»Oh, aber das ist unmöglich!«, platzte sie heraus.
Als sich sein misstrauischer Blick auf sie heftete, hätte sie sich am liebsten geohrfeigt. Warum musste sie immer genau das sagen, was ihr gerade durch den Kopf ging? Ganz egal, wie sehr sie sich bemühte, sich so zu benehmen, wie Mama es sie gelehrt hatte. Ihr Mund sagte manchmal einfach das, was er wollte, und scherte sich einen Dreck um die Folgen.
Sie zuckte innerlich zusammen. »Dreck«. Da war es schon wieder passiert. Für eine Lady schickte es sich nicht, ein Wort wie »Dreck« auch nur zu denken. Nicht einmal für eine Lady, deren Vater das Wort regelmäßig benutzte, wenn er seine Tochter lehrte, wie man das Gut führte, das sie eines Tages erben würde.
Sie holte tief Luft und fügte in zuckersüßem Ton hinzu: »Ich kann mir nicht vorstellen, dass die berühmten Männer des Herzogs eine Verabredung vergessen. Vielleicht sind sie durch die Hintertür hereingekommen.«
Nach allem, was sie riskiert hatte, um die Ermittler zu treffen, hätte sie bei dem Gedanken, dass ausgerechnet jetzt keiner der Männer im Hause war, am liebsten laut geschrien.
Shaw seufzte. »Warten Sie hier. Ich werde nachschauen, ob jemand da ist.« Er schoss wie eine Spinne im Netz die Treppe hinauf.
Sobald er außer Hörweite war, brummte Ralph: »Ich verstehe immer noch nicht, warum Sie diese Ermittler beauftragen wollen, Mylady. Ihr Vater würde mit Vergnügen alles herausfinden, was Sie wissen wollen.«
Oh nein. Das würde er nicht. Das hatte sie bereits beschlossen. »Mach dir keine Sorgen, Ralph. Es ist nichts, was dich in irgendwelche Schwierigkeiten bringen könnte.«
Es ging nur um ihre gesamte Zukunft, aber das konnte sie Ralph unmöglich sagen. Niemand von der Dienerschaft durfte jemals davon erfahren.
In diesem Moment öffnete sich hinter ihrem Rücken die Eingangstür. »Sieh einer an, wen haben wir denn da?«
Sie erstarrte. Diese Stimme hätte sie unter Tausenden erkannt.
Verflixt und zugenäht, warum musste ausgerechnet er es sein?
Auf alles gefasst, drehte sie sich zu Mr Bonnaud um … und konnte ihn nur mit offenem Mund anstarren.
Das war nicht der Mr Bonnaud, dem sie im Wald bei Kinlaw Castle begegnet war, als sie den Männern des Herzogs ihr Versprechen abgenommen hatte. Der Mr Bonnaud von damals war ein vierschrötiger Kerl mit enormem Leibesumfang gewesen, dessen Gesicht fast völlig von einem zerknautschten Hut und einem Bart verdeckt worden war.
Ach ja, richtig. Vermutlich war das eine Verkleidung gewesen.
Eine äußerst wirkungsvolle Verkleidung, anscheinend. Denn der Mann, der jetzt vor ihr stand, war weder vierschrötig noch hatte er einen Bart, noch war er schlecht gekleidet. Er war schlank und gut aussehend und beinahe modisch angezogen, wenn man einen schlichten Herrenrock aus dunkelgrauem Wollstoff, eine schmucklose schwarze Weste, enge beigefarbene Hosen und abgewetzte Stiefel modisch nennen wollte.
Nicht dass irgendeine Frau auf seine Kleidung geachtet hätte, wo seine breiten Schultern und muskulösen Schenkel sie so beeindruckend ausfüllten. Gott bewahre.
Dann nahm er seinen grauen Zylinder aus Biberfilz ab, und eine Fülle dichter schwarzer Locken kam zum Vorschein, die einem griechischen Gott Ehre gemacht hätte. Beinahe hätte sie laut aufgeseufzt. Das Zusammenwirken seiner aristokratischen Nase und seines fein modellierten Kinns mit dieser Haarfülle war atemberaubend. Absolut atemberaubend.
Kein Wunder, dass sein Name so oft in einem Atemzug mit den Namen von Bühnenschönheiten und Tänzerinnen genannt wurde. Mit diesen leidenschaftlich funkelnden blauen Augen und diesem sinnlich wirkenden Mund verbrachte er wahrscheinlich die Hälfte seiner Zeit in den Betten irgendwelcher williger Gespielinnen.
Die Bilder, die in ihrem Kopf aufstiegen, ließen sie ihre allzu blühende Fantasie verfluchen. An derartige Dinge zu denken, schickte sich für eine Lady ganz und gar nicht.
Er musterte sie aufmerksam, und schließlich glomm ein Funke des Wiedererkennens in seinen faszinierenden Augen auf. »Lady Zoe«, sagte er und verbeugte sich.
»Guten Tag, Mr Bonnaud.«
Er zog eine Augenbraue hoch. »Also sind Sie gekommen, um Ihre Gefälligkeit einzufordern?«
Mit einem verstohlenen Seitenblick zu Ralph, der ihrem Wortwechsel aufmerksam folgte, entgegnete sie: »Ich würde mich gerne mit Ihnen und Ihren Kollegen beraten, das ist richtig.«
In diesem Moment kam Mr Shaw zurück. »Ah, da sind sie ja Mr Bonnaud. Ist Mr Manton mit Ihnen gekommen?«
»Er hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. Aber er sagte, dass er bald hier sein wird.«
»Ich verstehe. ›Die Zeit enthüllt, was Arglist jetzt verdeckt‹, wie es heißt.« Mr Shaw deutete mit einer Kopfbewegung auf Zoe. »Diese Dame behauptet, eine Verabredung mit … ähm … den Männern des Herzogs zu haben.«
Das Shakespeare-Zitat ließ Zoe aufhorchen. Ahnte Mr Shaw, dass sie etwas zu verbergen hatte?
Sie beobachtete Mr Bonnaud argwöhnisch und versuchte, auf alles vorbereitet zu sein. Doch als er die Dreistigkeit besaß, ihr zuzuzwinkern, kam das für sie völlig unerwartet – und ließ ihr einen äußerst ärgerlichen kleinen Schauer über den Rücken laufen.
»Allerdings hat sie eine Verabredung«, sagte Mr Bonnaud schließlich, und seine Augen funkelten schalkhaft. »Eine Verabredung, die schon vor ziemlich langer Zeit getroffen wurde. Seien Sie unbesorgt, Shaw. Ich sehe, dass sie rasch zu Ihrer Probe kommen wollen. Ich kümmere mich um Ihre Ladyschaft.«
»Ich danke Ihnen, Sir«, sagte Shaw und eilte zur Tür hinaus.
»Ich vermute, Mr Shaw ist weniger begeistert von seinen Pflichten als Butler als von seiner Schauspielerei«, bemerkte Zoe.
»So ist es. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er eigentlich Skrimshaw mit Nachnamen heißt, aber darauf besteht, mit seinem Bühnennamen angesprochen zu werden.«
»Oh! Das ist in der Tat ein bisschen seltsam. Allerdings kann ich ihm keinen Vorwurf daraus machen. Er ist wirklich ein ausgezeichneter Schauspieler. Als Butler verschwendet er sein Talent.«
»Was er uns bei jeder Gelegenheit spüren lässt, wie ich Ihnen versichern kann.« Mr Bonnaud deutete auf die Treppe. »Wollen wir in unser Büro gehen?«
Ralph wollte protestieren, doch Zoe sagte hastig: »Warte hier unten auf mich, Ralph.«
»Aber, Mylady …«
Sie reichte ihm ihren Hut und ihren Umhang. »Ich habe bereits die Bekanntschaft von Mr Bonnaud und seinen Kollegen gemacht, und ich versichere dir, dass sie absolut vertrauenswürdig sind.«
Manche von ihnen zumindest. Allerdings sah es so aus, als ob sie ausgerechnet an den geraten war, bei dem sie sich nicht so sicher war. Nicht dass es eine Rolle gespielt hätte. Sie war verzweifelt genug, um mit Mr Bonnaud vorliebzunehmen.
Sie raffte ihre Röcke und begann, die Treppe hinaufzusteigen. Bonnaud folgte ihr. Erst als sie den Treppenabsatz hinter sich hatten und Ralph sie nicht mehr hören konnte, sagte sie leise: »Ich ziehe es vor, zu warten, bis der Leiter der Männer des Herzogs eintrifft, bevor wir fortfahren.«
»Tatsächlich?«, erwiderte Bonnaud mit ironischem Unterton. »Dann lassen Sie sich von mir einen Rat geben. Wenn Sie sich mit Dom gut stellen wollen, dann hören Sie auf, uns ›die Männer des Herzogs‹ zu nennen. Es ärgert ihn, wenn die Leute von der Ermittlungsagentur, die er mit seiner eigenen Hände Arbeit aufgebaut hat, reden, als ob sie ein Außenposten des Imperiums Seiner Lordschaft wären.«
Wie erstaunlich. »Man sollte meinen, er ist froh über seine Verbindung mit einem Herzog.«
Mr Bonnaud schnaubte. »Nicht jeder hat eine so hohe Meinung von Ihresgleichen, wie Sie vielleicht denken, Mylady.«
Die Verachtung in seiner Stimme irritierte sie, besonders angesichts des Grundes, aus dem sie hier war. »Haben Sie darum versucht, mich zu erschießen, als wir uns das letzte Mal begegnet sind?« Es wurmte sie immer noch, dass es ihm nicht nur gelungen war, sie aus der Fassung zu bringen, sondern dass er sie auch dann noch aus der Fassung gebracht hatte, nachdem klar geworden war, dass er keine wirkliche Bedrohung für sie darstellte.
»Ich habe nicht versucht, Sie zu erschießen. Ich habe nur gedroht, Sie zu erschießen.«
»Drei Mal. Und beim ersten Mal haben Sie mit Ihrer Pistole vor meiner Nase herumgefuchtelt.«
»Sie war nicht geladen.«
Sie blieb auf der Treppe stehen und starrte wütend auf ihn hinab. »Also haben Sie mir absichtlich Todesangst eingejagt?«
Er grinste sie an. »Das geschah Ihnen ganz recht. Warum mussten Sie auch drei Männern nachreiten, von denen Sie wussten, dass sie einen Dieb verfolgen?«
Das Blut schoss ihr in die Wangen, was sie nur noch mehr ärgerte. Sie hatte keinen Grund, verlegen zu sein, verdammt noch mal! »Ich hatte meine Gründe.«
Er machte einen Schritt die Treppe hinauf und war jetzt viel zu dicht hinter ihr. »So, so. Und was für Gründe?«
In seine Augen zu blicken brachte sie kaum weniger aus der Fassung, als in den Lauf seiner Pistole zu schauen, wie damals vor einigen Monaten. Grundgütiger, war er groß. Obwohl er zwei Stufen tiefer stand als sie, waren sie auf Augenhöhe miteinander. Überraschenderweise löste das ein Prickeln in ihrem Bauch aus.
Sie reckte das Kinn. »Darüber spreche ich nur in Gegenwart Ihres Bruders. Falls Sie wieder damit drohen sollten, mich zu erschießen.«
Ein amüsiertes Funkeln blitzte in seinen Augen auf. »Das tue ich nur, wenn Sie sich in Dinge einmischen, die Sie nichts angehen.«
»Das verstehen Sie nicht, ich musste –«
»Still«, befahl er und neigte den Kopf zur Seite.
Gerade als sie gegen seinen arroganten Ton Protest erheben wollte, hörte sie Stimmen von unten.
»Dom ist da.« Mr Bonnaud machte eine Kopfbewegung die Treppe hinauf. »Wenn er also nicht den Eindruck bekommen soll, dass wir zwei hier auf der Treppe miteinander schäkern, schlage ich vor, dass wir nach oben gehen.«
Sie kniff die Augen zusammen. »Schäkern? Haben Sie schäkern gesagt?« Empört stapfte sie die letzten Stufen hinauf. »Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, mit Ihnen zu schäkern. Und wenn ich tausend Jahre alt würde.« Nein, das würde sie nicht. Ausgeschlossen! Auf gar keinen Fall!
Sein leises Lachen, das hinter ihr erklang, ließ sie plötzlich an ihren Worten zweifeln.
»Sagen Sie niemals nie, Mylady. Mit einem solchen Versprechen könnten Sie sich mit Ihrem Hinterteil leicht in die Nesseln setzen. Was schade wäre, da es doch so hübsch ist.«
Herrgott im Himmel, wie konnte er es wagen, aber er starrte auf ihr Gesäß!
Ganz zu schweigen davon, dass er es als »Hinterteil« bezeichnet hatte.
Kaum dass sie einen Treppenabsatz erreicht hatten, drehte sie sich zu Mr Bonnaud um, fest entschlossen, ihm gehörig die Meinung zu sagen. Doch beim Anblick seines selbstzufriedenen Gesichtsausdrucks erstarrte sie. Er versuchte absichtlich, sie aus der Reserve zu locken, der durchtriebene Schuft. Genau wie damals, als er gedroht hatte, sie zu erschießen.
Diesmal würde er keinen Erfolg damit haben. Sie warf ihm ein herablassendes Lächeln zu. »Ich habe gehört, dass Sie berühmt dafür sind, witzig und charmant gegenüber dem schönen Geschlecht zu sein, Mr Bonnaud. Wie enttäuschend, dass Sie offenbar nur die vulgärsten Vorstellungen davon haben, wie man einer Lady Komplimente macht.«
Obwohl sein Mund unmerklich schmaler wurde, maß er sie noch immer mit einem unverfroren schamlosen Blick. »Das Zauberwort heißt Lady. Und da Sie offenbar nur dem Titel nach eine Lady sind, wenn man an Ihren Hang denkt, Ihre Nase in Dinge zu stecken, die Sie nichts angehen –«
»Lady Zoe?« Mr Manton erschien am oberen Ende der Treppe.
Gott sei Dank, dass er endlich da war und sie sich nicht länger mit seinem impertinenten Halbbruder abgeben musste. Sie stieg die Stufen zu ihm hinauf und streckte ihm die Hand hin. »Mr Manton. Wie schön, Sie wiederzusehen.«
Während er ihr die Hand schüttelte, warf er Mr Bonnaud einen verstohlenen Blick zu. »Und erfreulicherweise unter weit angenehmeren Umständen als bei unserer letzten Begegnung.«
Sie lächelte ihn strahlend an, wobei sie sich nur allzu bewusst war, dass Mr Bonnauds Blick die ganze Zeit auf ihr ruhte. »Es hat mich gefreut, zu hören, dass Sie und Ihre Kollegen den wahren Schurken schließlich doch noch das Handwerk legen konnten.« Na also. Das klang wunderbar verbindlich und ladylike. Auch wenn Mr Bonnaud behauptet hatte, dass sie keine Lady sei. »Und ich war froh, zu erfahren, dass sie ihre verdiente Strafe erhalten haben.«
»Das haben sie in der Tat. Ich kann Ihnen versichern, dass wir Ihre Verschwiegenheit in dieser Angelegenheit sehr zu schätzen wissen.«
Ihr Puls schlug heftig. »Also erinnern Sie sich an Ihr Versprechen.«
»Natürlich. Und es ist mir eine Freude, es zu halten.«
Er deutete auf eine offene Tür. »Warum besprechen wir alles Weitere nicht in meinem Arbeitszimmer?«
»Danke sehr.« Als er sie in das Zimmer führte, folgte sein Bruder ihr, wobei er zweifellos wieder auf ihr »hübsches Hinterteil« starrte.
Sollte er doch. Jetzt, da sie wusste, dass er es nur tat, um sie zu provozieren, würde sie sich davon nicht mehr aus der Fassung bringen lassen. Es war klar, dass es ihm nichts bedeutete. Schließlich hing ein ganzes Gefolge stadtbekannter Schönheiten an seinen Rockschößen, und sie war nicht gerade eine gefeierte Schönheit.
Oh, natürlich flirteten die Männer mit ihr, aber das lag wohl eher daran, dass sie als reich galt. Es war allgemein bekannt, dass sie eine beträchtliche Erbschaft zu erwarten hatte. Es wäre ihr zwar am liebsten gewesen, wenn die Männer mit ihr geflirtet hätten, weil sie sie interessant fanden, aber es hätte ihr auch nicht missfallen, für ihre weiblichen Reize bewundert zu werden.
Unglücklicherweise entsprachen ein olivfarbener Teint und fremdländische Gesichtszüge nicht unbedingt dem Schönheitsideal englischer Gentlemen, ganz egal, wie sehr Mama auch ihr »exotisches« Äußeres gerühmt hatte. Und Tante Flo, Mamas Schwester, raufte sich die Haare angesichts der Wahl ihrer Garderobe. Sie meinte, dass sie entschieden zu auffallend war für die gute Gesellschaft.
Zoe seufzte. Selbst wenn Mr Bonnaud all das aus irgendeinem unerfindlichen Grund egal war und er sie tatsächlich attraktiv fand, machte das keinen Unterschied. Er wirkte nicht wie jemand, der auf der Suche nach einer Ehefrau war. Und für sie stand zu viel auf dem Spiel, um sich für die andere Sorte Männer zu interessieren – für die Schwerenöter und Schürzenjäger und Wüstlinge. Ganz egal, wie gut aussehend und draufgängerisch sie waren.
»Nun«, begann Mr Manton, während er auf einen Stuhl deutete und selbst hinter dem Schreibtisch Platz nahm, »was kann die Agentur Manton für Sie tun?«
Mr Bonnaud hatte sich unterdessen gegen die Wand neben dem Schreibtisch gelehnt und maß Zoe mit einem rätselhaften Blick.
Sie sah Mr Manton an, und ihr wurde klar, wie ungeheuerlich das war, was sie ihm gleich offenbaren würde. Wenn einer von den Männern des Herzogs auch nur einen Bruchteil von dem, was sie ihnen anvertraute, ausplaudern würde, dann war ihre Zukunft vorbei, bevor sie begonnen hatte, und Winborough, ihr Familiensitz für immer verloren.
»Mylady«, sagte Mr Manton. »Was führt Sie zu uns?«
Andererseits war es ebenso gut möglich, dass sie Winborough für immer verlor, wenn sie sich den Ermittlern nicht anvertraute. Es sah wirklich so aus, als hätte sie keine andere Wahl.
Sie umklammerte ihr Retikül und versuchte, ihrer Stimme einen ruhigen Klang zu verleihen. »Sie müssen meine wahren Eltern finden.«
2
Einen Augenblick stand Tristan vor Überraschung der Mund offen, dann brach er in Lachen aus. Als Dom und Lady Zoe ihn irritiert ansahen, sagte er leichthin: »Oh, Sie haben das ernst gemeint, nicht wahr?«
Sie sah ihn empört an und rümpfte ihr hübsches Näschen. Das war genau die Reaktion, die er von einer verhätschelten Aristokratin wie ihr erwartet hatte. »Vollkommen ernst. Das versichere ich Ihnen.«
Mit einem strengen Blick gebot ihm Dom zu schweigen. »Vielleicht sollten Sie uns erklären, wie Sie das meinen, Mylady.«
Tristan verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn Sie das können. Soweit ich weiß, ist Ihre ›wahre‹ Mutter tot, und Ihr ›wahrer‹ Vater lebt auf seinem Gut in Yorkshire. Allerdings vermute ich, dass er sich in diesem Moment in seinem Londoner Stadthaus aufhält, denn sonst wären Sie nicht hier, um uns mit diesem Unsinn die Zeit zu stehlen.«
Gott schütze ihn vor albernen jungen Aristokratinnen. Da sie nichts Besseres zu tun hatten, als Bälle zu besuchen und zu flirten, dachten sie sich dramatische Tragödien aus, um sich darüber hinwegzutrösten, dass ihr Leben sie langweilte.
Als sie auffuhr, mahnte Dom leise: »Tristan, versuche wenigstens, höflich zu sein.«
»Ich stelle lediglich Tatsachen fest. Dank Lady Zoes Leichtsinn müssen wir jetzt unsere Zeit damit verschwenden, uns um dieses lächerliche Ansinnen zu kümmern.«
Er hatte wirklich Besseres zu tun. Seit Dom und der Herzog ihn sicher nach England zurückgebracht hatten, juckte es Tristan in den Fingern, endlich an George Rache zu nehmen. Er brannte darauf, irgendetwas herausfinden, womit er dem Dreckskerl das Handwerk legen konnte. Da seine Nachforschungen in London ergebnislos geblieben waren, musste er seine Ermittlungen auf die Gegend von Ashcroft und Rathmoor Park ausdehnen. Und vielleicht sollte er versuchen, Milosh zu finden. Der Pferdehändler hatte damals schließlich angedeutet, dass er irgendetwas über George wusste.
»Wir haben Lady Zoe versprochen, ihr zu helfen«, sagte Dom mit Nachdruck.
»Bei einem offensichtlich albernen und aussichtslosen Unternehmen«, entgegnete Tristan brüsk. »Was sie von uns verlangt, kostet uns nur Zeit, und wir haben schon jetzt mehr Fälle, als wir bearbeiten können. Lukrative Fälle, wenn ich das hinzufügen darf.«
»Wenn es Ihnen ums Geld geht«, warf Lady Zoe ein, »so habe ich vor, Sie zu bezahlen.«
Beide sahen sie überrascht an.
»Und … ähm … worin besteht dann die Gefälligkeit?«, fragte Dom.
Sie zog eine ihrer dunklen Augenbrauen hoch. »Ist es üblich, dass Sie Ermittlungen für unverheiratete junge Damen durchführen, ohne dass deren Eltern davon wissen und ihre Zustimmung erteilt haben?«
»Eher nicht«, gab Dom zu.
»Das ist die Gefälligkeit.«
Tristan wechselte einen Blick mit seinem Bruder. Das änderte die Dinge und machte Lady Zoes Anliegen zugleich glaubwürdiger, aber auch wesentlich riskanter.
»Trotzdem ist die Frage meines Bruders nicht unberechtigt«, hakte Dom nach. »Haben Sie einen besonderen Grund, anzunehmen, dass Lord Olivier und seine verstorbene Gemahlin nicht ihre leiblichen Eltern sind?«
Sie seufzte. »Leider ja. Die Sache ist ein bisschen kompliziert, und ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll.«
»Am Anfang, Lady Zoe«, sagte Dom freundlich.
»Gute Idee«, warf Tristan weniger freundlich ein.
Dom war gewöhnlich derjenige, der die Gespräche mit neuen Klienten führte, da er Tristans Herangehensweise … problematisch fand. Da Leute von Stand eigentlich immer etwas zu verbergen hatten, und Tristan Lügen nicht ausstehen konnte, provozierte er sie gern so lange, bis sie die Wahrheit offenbarten. Als er noch Agent der französischen Geheimpolizei gewesen war, hatte er mit dieser Methode durchschlagenden Erfolg gehabt.
Aber auf der anderen Seite des Kanals, in Frankreich, hatte der Adel nur wenig Macht. In England hingegen war jeder Lord ein kleiner Tyrann. Weshalb Doms diplomatische Art ihnen viel Ärger ersparte.
Aber bei Lady Zoe pfiff Tristan auf die Diplomatie. Sie hatte ein gefährliches Spiel gespielt, indem sie sie erpresst hatte, und sie hatte verdammtes Glück, dass sie Gentlemen waren. Es war reiner Wahnsinn gewesen, dass ein attraktives junges Ding wie sie einer Bande von bewaffneten Männern Forderungen gestellt hatte.
Und attraktiv war sie, so wahr ihm Gott helfe, auch wenn das Muster ihres roten Wollkleids vielleicht etwas zu auffallend war. Um die Taille war es schmaler geschnitten, was ihre üppige Figur vorteilhaft zur Geltung brachte. Es stand ihr wirklich gut. Zu gut für seinen Seelenfrieden.
Und dann war da noch ihr voller roter Mund, der ihn an Himbeeren denken ließ, die saftig und süß auf der Zunge zergehen. Und das dichte haselnussbraune Haar, das zu einem Kranz gesteckt war und ihr Gesicht in Löckchen rahmte. Plötzlich kam ihm der abwegige Gedanke, diesen Kranz zu lösen, nur um zu sehen, wie weit ihr das Haar über die Schultern fiel.
Er runzelte die Stirn. Was war nur mit ihm los? Was änderte es, dass sie hübsch war? Sie war ohne jeden Zweifel ein naives junges Ding. Naiv und unschuldig und zudem lästig und unglaublich leichtsinnig. Eine Unschuld zu verführen kam für ihn nicht infrage, ganz egal, wie leichtsinnig sie war.
Sie warf ihm einen misstrauischen Blick zu und holte tief Luft. »Vor einigen Jahren, bevor Mama zum ersten Mal krank wurde, haben sich ihre Schwester – meine Tante Floria – und Papa in den Kopf gesetzt, dass ich meinen Cousin Jeremy Keane heiraten soll.«
»Den amerikanischen Künstler?«, fragte Dom.
»Sie haben von ihm gehört?«
»Wer hat das nicht. Mein frischgebackener Schwager, der Herzog von Lyons, redet von nichts anderem als von Keanes bevorstehender Ausstellung bei der Society of British Artists in der Suffolk Street. Ich habe gehört, dass der König persönlich zwei seiner Historienbilder für den Palast gekauft hat, und Max ist fest entschlossen, ebenfalls eins zu erwerben.«
»Ja«, sagte sie gereizt, »mein Cousin versteht offenbar sein Handwerk. Aber das heißt noch nicht, dass ich ihn heiraten will. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen, um Himmels willen! Außerdem, was weiß er schon davon, wie man ein Gut mit großen Ländereien verwaltet oder was es bedeutet, mich im House of Lords zu vertreten oder …«
»Moment mal«, fiel Tristan ihr ins Wort. »Sie sind eine Frau. Was haben Sie mit dem House of Lords zu schaffen?«