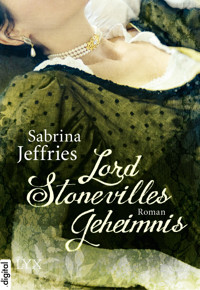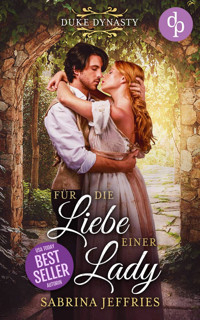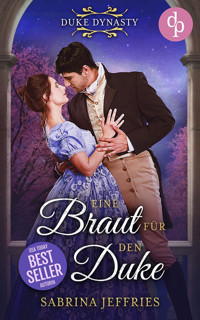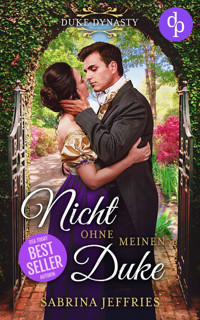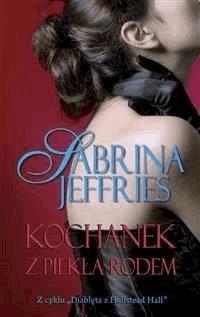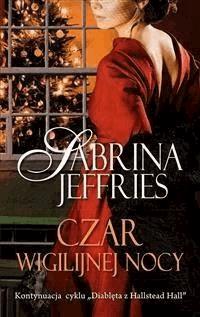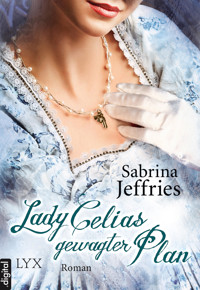
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hellions
- Sprache: Deutsch
Lady Celia Sharpe sucht nach einem passenden Ehemann, um das Ultimatum ihrer Großmutter zu erfüllen, die sie enterben will, sollte sie nicht bald heiraten. Sie beauftragt den Privatermittler Jackson Pinter, mögliche Kandidaten auszuspionieren, ohne jedoch zu ahnen, dass Pinter selbst ein Auge auf sie geworfen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Geneigte Leserin, geneigter Leser
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Sabrina Jeffries bei LYX
Impressum
SABRINA JEFFRIES
Lady Celias
gewagter Plan
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Andreas Fliedner
Zu diesem Buch
Lady Celia ist die Letzte der Sharpe-Geschwister, die noch nicht unter der Haube ist. Allerdings interessiert sie sich viel mehr für Schusswaffen als für Männer und fürs Flirten. Doch in wenigen Monaten läuft das Ultimatum ihrer Großmutter ab, die sie enterben will, sollte sie bis dahin keinen Ehemann gefunden haben. Zwar hat Celia keineswegs vor, einer Verlobung die Heirat folgen zu lassen, aber dennoch legt sie Wert darauf, keinen Schurken als Verehrer in ihr Haus zu holen. Daher kommt es ihr gerade recht, dass der Privatermittler Jackson Pinter zur Stelle ist, der den Tod ihrer Eltern vor zwanzig Jahren aufklären soll. Sie beauftragt ihn, mögliche Kandidaten für sie zu durchleuchten. Dabei ahnt sie nicht, dass Pinter selbst hoffnungslos in sie verliebt ist und deshalb nicht das geringste Interesse hat, ihr bei der Suche nach einem Ehemann zu helfen. Wegen des großen Standesunterschieds sieht er jedoch keine Chance, sie für sich zu gewinnen, ganz abgesehen davon, dass Celia fest entschlossen scheint, ihn abscheulich zu finden. Doch als Celia durch die Ermittlungen im Mordfall ihrer Eltern in Gefahr gerät, wird Jackson klar, dass er nicht bereit ist, sie einem anderen Mann zu überlassen.
Für meine liebe Schwester, Jamie McCalebb, die Lady Celia etwas von ihrem Charakter geliehen hat – du bist die beste Schwester, die man sich vorstellen kann!
Für meine Mutter, Gladys Martin, die einem Hurrikan entkam und stattdessen mein Buch redigieren musste! Danke, Mama, du bist die Beste.
Und für Becky Timblin, für alles, was du tust. Danke!
Geneigte Leserin, geneigter Leser
Gott sei Dank nimmt Celia meine Forderung, dass sie heiraten muss, endlich ernst. Sie hat mehrere Gentlemen zu einer Gesellschaft nach Halstead Hall eingeladen, damit sie ihre Wahl treffen kann.
Nur etwas bereitet mir Kopfzerbrechen – Jackson Pinter. Dieser Bow-Street-Ermittler zeigt ein ganz unziemliches Interesse an Celia. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Er ist anscheinend der Bastard irgendeines Adligen, der ihn jedoch nicht anerkannt hat. Daher muss er eine gute Partie machen, wenn er es irgendwann einmal zum Obermagistrat bringen will. Und Celia wäre eine sehr gute Partie für ihn.
Das alles würde mich nicht weiter beunruhigen, wenn ich nicht den Verdacht hätte, dass auch Celia an dem Mann heimlich Gefallen findet. Ich habe sie schon mehrfach zusammen erwischt, und manchmal sieht sie ihn mit so schwärmerischen Blicken an, dass ich aufs Höchste alarmiert bin.
Meine übrigen Enkel sind der Ansicht, ich solle mich nicht einmischen. Selbst mein lieber Isaac (ja, dieser stürmische Kavalleriegeneral und ich sind mittlerweile recht vertraut miteinander geworden) meint, ich mische mich in Angelegenheiten ein, die mich nichts angehen. Aber sie ist noch so jung und unerfahren! Ich kann nicht untätig zusehen, wenn er es nur auf ihren Titel und ihr Vermögen abgesehen hat. Ich habe das damals bei ihrer Mutter getan, und ich werde es nicht wieder tun.
Isaac, der alte Narr, ist fest davon überzeugt, dass Mr Pinters Interesse an ihr alles andere als finanzieller Natur ist. Er behauptet, der Kerl könne die Augen nicht von ihr lassen, wenn sie in seiner Nähe sei. Ich gebe zwar zu, dass Mr Pinter in der Tat recht … fasziniert von Celia zu sein scheint, aber das bedeutet noch nicht, dass er in sie verliebt ist. Er kann ihr Geld und ihren Körper begehren, ohne sich einen Deut für sie zu interessieren.
Unterdessen hat sie einen Herzog, einen Grafen und einen Viscount an ihren Rockzipfeln, von denen keiner ihr Geld braucht. Stellen Sie sich vor, meine Celia könnte eine Herzogin werden! Warum sollte sie sich da mit einem Bow-Street-Ermittler zufriedengeben, selbst wenn er wirklich hart daran arbeitet, den Mord an ihren Eltern aufzuklären? Kann man mir einen Vorwurf daraus machen, wenn ich etwas Besseres für sie will?
Ihre sehr ergebene
Hetty Plumtree
Prolog
Halstead Hall 1806
Celia wurde von den Stimmen von Erwachsenen geweckt, die im Kinderzimmer flüsterten. Es kitzelte sie furchtbar im Hals, und sie hätte gern gehustet. Aber wenn sie hustete, würden die Erwachsenen das Kindermädchen holen, und das Kindermädchen würde noch mehr von dem ekelhaften Zeug auf Celias Brust schmieren, und das konnte Celia gar nicht leiden. Das Kindermädchen nannte es ein Senfpflaster. Es war klebrig und gelb und roch schlecht.
Das Flüstern wurde lauter. Jetzt war es direkt hinter ihr. Sie lag ganz still. Waren das Mama und das Kindermädchen? Eine von beiden würde das Senfpflaster auf ihre Brust tun. Sie tat so, als würde sie schlafen, dann würden sie sie vielleicht in Ruhe lassen.
»Wir können uns in der Jagdhütte treffen«, flüsterte die eine Stimme.
»Pst, sie könnte dich hören«, flüsterte die andere.
»Sei nicht albern. Sie schläft. Und überhaupt, sie ist erst vier. Sie würde nichts verstehen.«
Celia legte die Stirn in Falten. Sie war schon fast fünf. Und verstehen konnte sie auch. Jede Menge. Zum Beispiel, dass sie zwei Großmütter hatte – Nonna Lucia im Himmel und Großmutter Plumtree in London – und dass sie das gelbe Zeug auf die Brust bekam, weil sie Husten hatte und dass sie die Kleinste von den Sharpes war. Papa nannte sie seine kleine Elfe. Und er sagte, dass sie spitze Ohren hatte, aber das stimmte gar nicht. Aber wenn sie ihm das sagte, lachte er bloß.
»Alle werden beim Picknick sein«, fuhr die zweite Stimme fort. »Wenn du Kopfschmerzen vortäuschst und nicht hingehst und ich mich im Trubel davonstehle, dann haben wir vor dem Dinner ein oder zwei Stunden für uns allein.«
»Ich weiß nicht …«
»Komm schon, du weißt, dass du es willst, mia dolce bellezza.«
Mia dolce bellezza? Papa nannte Mama so. Er hatte gesagt, dass bedeute »meine süße Schönheit«.
Ihr Herz machte einen Satz. Papa war da! Immer wenn er ins Kinderzimmer kam, erzählte er ihnen von Nonna Lucia, seiner Mama, und sagte lustige Worte auf Italienisch. Sie war sich zwar nicht ganz sicher, was Italienisch war, aber Papa sprach Italienisch, wenn er Geschichten von Nonna Lucia erzählte.
Also musste der andere Erwachsene Mama sein. Und das bedeutete, dass sie weiter mucksmäuschenstill sein musste, denn sonst gab es ein Senfpflaster.
»Nenn mich nicht so. Ich hasse das.«
Warum sagte Mama das? War sie wieder wütend auf Papa? Sie war oft wütend auf Papa. Großmutter Plumtree sagte, das sei wegen seiner »Huren«. Einmal hatte Celia das Kindermädchen gefragt, was eine »Hure« sei, und das Kindermädchen hatte ihr den Hintern versohlt und gesagt, das sei ein schlimmes Wort. Aber warum hatte Papa dann »Huren«?
Celia öffnete vorsichtig ein Auge, um zu schauen, ob Mama ein böses Gesicht machte, aber Mama und Papa waren hinter ihr, und sie hätte sich umdrehen müssen, um sie zu sehen. Dann hätten sie gemerkt, dass sie wach war.
»Es tut mir leid, mein Liebling«, flüsterte Papa. »Ich wollte dich nicht verletzen. Versprich mir, dass du da sein wirst.«
Celia hörte einen langen Seufzer. »Ich kann nicht. Ich möchte nicht, dass man uns erwischt.«
Erwischt bei was? Taten Mama und Papa etwas Verbotenes?
»Das möchte ich auch nicht«, flüsterte Papa. »Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für uns, um –«
»Ich weiß. Aber ich ertrage nicht, wie sie mich ansieht. Ich glaube, sie weiß Bescheid.«
»Du siehst Gespenster. Sie weiß gar nichts. Sie will es gar nicht wissen.«
»Da kommt jemand. Schnell … durch die andere Tür.«
Warum liefen Mama und Papa weg, wenn jemand kam?
Celia hob vorsichtig den Kopf, um nachzuschauen, aber sie konnte die große Tür nicht sehen. Dann wurde die Dienstbotentür geöffnet, und sie ließ ihren Kopf zurück auf das Kissen fallen und tat so, als ob sie schlief.
Das war allerdings gar nicht so einfach. Das Kitzeln in ihrem Hals war wirklich schlimm. Sie versuchte es zu unterdrücken, aber es war zu stark.
Das Kindermädchen beugte sich über ihr Bett. »Hast du immer noch diesen schlimmen Husten, mein Herzchen?«
Celia presste die Augenlider ganz fest zusammen. Aber gerade das musste sie verraten haben, denn das Kindermädchen drehte sie auf den Rücken und begann ihr Nachthemd aufzuknöpfen.
»Er geht schon wieder weg«, protestierte Celia.
»Mit dem Senfpflaster wird er noch schneller weggehen«, sagte das Kindermädchen.
»Ich mag das Senfpflaster nicht«, jammerte Celia.
»Ich weiß, Herzchen. Aber du willst doch auch, dass der Husten weggeht, oder nicht?«
Celia zog die Stirn kraus. »Vielleicht.«
Das Kindermädchen gluckste, dann nahm es ein Glas und schüttete aus einer Flasche etwas hinein. »Hier, das wird dir guttun.«
Sie hielt Celia das Glas hin. Es schmeckte komisch, aber sie war so durstig, dass sie alles austrank, während das Kindermädchen das Senfpflaster zubereitete.
Als das Kindermädchen ihr das Pflaster auf die Brust drückte, wurde Celia plötzlich furchtbar schläfrig. Ihre Lider wurden so schwer, dass sie das schlecht riechende Zeug auf ihrer Brust ganz vergaß.
Sie schlief lange. Als sie aufwachte, gab das Kindermädchen ihr Haferbrei zu essen und sagte, dass sie das Senfpflaster erst abends wieder aufzulegen brauche. Dann gab sie Celia noch etwas von der komischen Flüssigkeit aus der Flasche, und Celia wurde wieder müde. Als sie das nächste Mal aufwachte, war es dunkel. Während sie verwirrt in der Dunkelheit lag, hörte sie, wie ihre ältere Schwester Minerva und ihr älterer Bruder Gabe sich darum stritten, wer das letzte Birnentörtchen essen durfte. Sie hätte auch gern ein Birnentörtchen gehabt. Sie hatte Hunger.
Dann kam das Kindermädchen wieder herein. Zwei Männer begleiteten sie: Gabes Hauslehrer, Mr Virgil, und Tom, Celias Lieblingsdiener. »Minerva«, befahl das Kindermädchen, »du und Gabe, ihr geht jetzt mit Tom hinunter ins Arbeitszimmer. Eure Großmutter will mit euch sprechen.«
Nachdem sie weg waren, lag Celia ratlos da. Vielleicht bekamen Minerva und Gabe jetzt von ihrer Großmutter Süßigkeiten. Dann wollte sie auch welche. Aber wenn das Kindermädchen ihr ein neues Senfpflaster auflegen wollte …
Sie entschied sich dafür, still zu sein.
»Wollen Sie das Mädchen nicht wecken?«, hörte sie Mr Virgil fragen.
»Es ist besser, wenn sie schläft«, erwiderte das Kindermädchen. »Irgendwann wird sie es erfahren, aber jetzt würde das arme Ding es nicht verstehen. Wie soll ich ihr beibringen, dass ihre Eltern nicht mehr unter uns sind? Das ist einfach zu schrecklich.«
Nicht mehr unter uns? So wie damals, als Mama und Papa nach London gefahren waren und sie und Minerva und Gabe in Halstead Hall gelassen hatten?
»Und dass die gnädige Frau den gnädigen Herrn erschossen hat?«, fuhr das Kindermädchen fort. »Das kann ich ihr nicht sagen.«
Wenn sie Gäste hatten, ging Papa manchmal mit den anderen Gentlemen los, um Vögel zu schießen. Sie wusste darüber Bescheid, weil ihr älterer Bruder Jarrett es ihr erzählt hatte. Die Vögel fielen auf den Boden, und die Hunde hoben sie auf. Und sie flogen nie wieder. Aber Mama würde doch nicht auf Papa schießen. Das Kindermädchen musste eine andere »gnädige Frau« gemeint haben. Es waren schließlich jede Menge »gnädige Frauen« zu der Wochenendgesellschaft gekommen.
»Es ist erschütternd«, sagte Mr Virgil.
»Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass die gnädige Frau den gnädigen Herrn nicht mit einem Einbrecher verwechselt hat. Vermutlich hat sie ihn erschossen, weil sie wegen seiner Flittchen auf ihn wütend war.«
»Mrs Plumtree sagt, es war ein Unfall«, Mr Virgils Stimme klang streng. »An Ihrer Stelle, Madam, würde ich meine Zunge im Zaum halten.«
»Ich kenne meine Pflicht. Aber was die gnädige Frau getan hat, nachdem sie ihn erschossen hat … Wie konnte sie die armen Kinder ohne Vater und Mutter zurücklassen? Das ist verabscheungswürdig.«
Verabscheuungswürdig klang nach etwas Schlimmem. Celia bekam Angst, dass das Kindermädchen und Mr Virgil doch über Mama sprachen.
»Wie bereits Dr. Sewell in ›Der Selbstmörder‹ schreibt«, sagte Mr Virgil in seinem salbungsvollsten Ton, »›schleicht sich der Feigling durch die Pforte des Todes hinaus, der Tapfere aber lebt weiter.‹ Es ist die reine Feigheit und nichts anderes. Und ich bin bitter enttäuscht, dass die gnädige Frau eine solch feige Tat begangen hat.«
Celia begann zu weinen. Das konnte nicht Mama sein. Mama war nicht feige! Feige zu sein war etwas Schlechtes. Das hatte Papa ihr erklärt. Es bedeutete, nicht tapfer zu sein. Und Mama war immer tapfer.
»Jetzt sehen Sie, was Sie angerichtet haben«, sagte das Kindermädchen, »Sie haben die Kleine aufgeweckt.«
»Mama ist nicht feige!« Celia setzte sich in ihrem Bett auf. »Sie ist tapfer! Ich w-will, dass sie herkommt. Ich will, dass Mama kommt!«
Das Kindermädchen nahm sie auf den Arm und strich ihr die Haare zurück. »Schhh, mein Herzchen, beruhig dich. Es ist alles gut. Willst du etwas essen?«
»Nein, ich will Mama«, heulte sie.
»Ich bringe dich nach unten zu deiner Großmutter. Sie wird dir alles erklären.«
Panik schnürte ihr die Brust zusammen. Warum durfte sie nicht zu Mama? Wenn Celia Husten hatte, kam Mama immer, wenn sie nach ihr fragte. »Ich will nicht zu Großmutter! Ich will Mama!« Sie weinte bitterlich. »Ich-will-Mama-ich-will-Mama-ich-will-Mama –«
»Sie wird wieder krank, wenn sie so weint«, sagte das Kindermädchen. »Reichen Sie mir das paregorische Elixier, Mr Virgil.«
Mr Virgil machte ein komisches Gesicht, so als ob ihm jemand in den Magen geboxt hätte. »Irgendwann muss das Kind die Wahrheit erfahren.«
»Aber nicht jetzt. Das lässt ihr Zustand nicht zu.« Das Kindermädchen hielt Celia einen Becher an die Lippen und die Flüssigkeit, von der sie müde wurde, lief in ihren Mund. Sie erstickte beinahe daran, bevor es ihr gelang, sie hinunterzuschlucken. Das Weinen hörte auf.
Das Kindermädchen flößte ihr noch etwas mehr von der Flüssigkeit ein. Celia war es egal. Sie hatte Durst. Sie trank, dann flüsterte sie: »Ich will Mama.«
»Ja, Herzchen«, sagte das Kindermädchen beruhigend. »Aber zuerst singe ich dir ein Lied, ja?«
Celias Augenlider wurden schon wieder schwer. »Ich will kein Lied«, protestierte sie, während ihr Kopf auf die Schulter des Kindermädchens sank. Sie starrte Mr Virgil wütend an. »Mama ist nicht feige«, stieß sie hervor.
»Natürlich nicht«, sagte das Kindermädchen sanft. Sie legte Celia etwas in die Arme. »Da hast du die schöne neue Puppe, die deine Mutter dir geschenkt hat.«
»Lady Bell!« Celia presste sie an sich.
Das Kindermädchen trug sie hinüber zum Schaukelstuhl und setzte sich, um sie auf dem Schoß zu wiegen, vor und zurück, vor und zurück. »Möchtest du, dass ich dir und Lady Bell ein Lied vorsinge, mein Engel?«
»Sing mir das Lied von William Taylor vor.« Die Dame in »William Taylor« war nicht feige – und sie hatte tatsächlich jemanden erschossen.
Das Kindermädchen erschauerte. »Haben Sie gehört, was die Kleine will, Mr Virgil? Ist das nicht unheimlich?«
»Woher kennst du das Lied, Herzchen?«, fragte das Kindermädchen.
»Minerva hat es gesungen.«
»Ich werde dir ein anderes Lied vorsingen«, sagte das Kindermädchen und begann: »Schlaf mein Kindchen, es ruhn / Schäfchen und Vögelchen nun / Garten und Wiese verstummt / auch nicht ein Bienchen mehr summt …«
Celia trommelte wütend gegen die Brust des Kindermädchens. Eigentlich mochte sie das Lied mit den Schäfchen und Vögelchen, aber nicht jetzt. Jetzt wollte sie das Lied von der Dame hören, die eine Pistole nahm und »Ihren Schatz William Taylor mit der Braut an einem Arm« erschoss. In dem Lied bekam die Dame vom Kapitän das Kommando über ein Schiff, weil sie William erschossen hatte. Das bedeutete doch, die Dame war tapfer, oder? Und Mama hatte jemanden erschossen. Also war sie auch tapfer.
Aber sie hatte Papa erschossen.
Das konnte nicht stimmen. Mama konnte Papa nicht erschossen haben.
Ihre Augenlider wurden immer schwerer. Aber sie wollte nicht schlafen. Sie musste ihnen erklären, dass Mama nicht die »gnädige Frau« sein konnte. Mama war tapfer. Celia würde es ihnen sagen.
Weil Celia auch tapfer war. Nicht feige … niemals feige …
1
Ealing, November 1825
Als der Bow-Street-Ermittler Jackson Pinter die Bibliothek von Halstead Hall betrat, war er nicht besonders überrascht, dort nur eine einzige Person anzutreffen. Er war etwas zu früh gekommen, und die Sharpes kamen nie zu früh.
»Guten Morgen, Masters«, sagte Jackson und nickte dem Anwalt zu, der über einen Stapel Papiere gebeugt am Tisch saß. Giles Masters war mit der älteren der Sharpe-Schwestern verheiratet, Lady Minerva. Besser gesagt mit Mrs Masters, da sie diesen Namen vorzog.
Masters sah auf. »Pinter! Schön, Sie zu sehen, alter Knabe. Wie laufen die Dinge in der Bow Street?«
»Gut genug, dass ich mir Zeit nehmen kann, zu diesem Treffen zu kommen.«
»Es scheint, als hätten die Sharpes Sie mit der Untersuchung des Todes ihrer Eltern ganz schön strapaziert.«
»Des Mordes an ihren Eltern«, korrigierte ihn Jackson. »Wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass sie ermordet wurden.«
»Richtig. Ich vergaß, dass Minerva sagte, die Pistole, die man in der Jagdhütte fand, sei nie abgefeuert worden. Nur schade, dass niemand das vor neunzehn Jahren bemerkt hat. Dann hätte man sofort die Ermittlungen aufnehmen können. Und man hätte viel Leid vermeiden können.«
»Mrs Plumtree hat mit ihrem Geld alle weiteren Nachforschungen verhindert.«
Master seufzte. »Man kann ihr keinen Vorwurf machen. Sie wollte nur einen Skandal verhindern.«
Jackson runzelte die Stirn. Stattdessen hatte sie verhindert, dass die Wahrheit ans Licht kam. Und am Ende hatte sie mit fünf Enkelkindern dagestanden, die die Vergangenheit nicht hinter sich lassen konnten und deshalb ihren Platz im Leben nicht fanden. Das war der Grund, weshalb sie ihr Ultimatum gestellt hatte: Am Ende des Jahres mussten alle ihre Enkelkinder verheiratet sein, oder sie würde sie alle enterben. Alle hatten ihr Ultimatum erfüllt. Bis auf eine.
Vor seinem geistigen Auge stieg das Bild von Lady Celia auf, doch er schob es rasch beiseite.
»Wo sind die anderen?«
»Noch beim Frühstück. Sie werden sicherlich bald herüberkommen. Setzen Sie sich.«
»Ich stehe lieber.« Er schlenderte hinüber zum Fenster, das auf den sogenannten Roten Hof hinausging, der seinen Namen dem purpurfarbenen Pflaster verdankte.
Jackson fühlte sich auf Halstead Hall immer unbehaglich. Jeder Stein des weitläufigen Herrenhauses rief dem Besucher »Adel« entgegen.
Für jemanden wie ihn, der seine frühe Kindheit in einem Slum in Liverpool verbracht hatte und dann mit zehn Jahren in ein Reihenhaus in Cheapside gezogen war, war Halstead Hall entschieden zu groß und zu luxuriös – und zu voll mit Mitgliedern der Familie Sharpe.
Nachdem er nun schon fast ein Jahr lang als Ermittler für sie arbeitete, war er sich immer noch nicht sicher, was er von den Sharpes halten sollte. Auch jetzt, als er sie unter einem wolkenverhangenen Novemberhimmel den Roten Hof überqueren sah, spürte er eine gewisse Anspannung.
Dabei sahen sie keineswegs so aus, als ob sie irgendeinen Anschlag auf ihn vorhatten. Sie wirkten vielmehr glücklich und zufrieden.
Allen voran schritt der ehrenwerte Lord in eigener Person – Oliver Sharpe, der neunte Marquess von Stoneville, von dem man sagte, dass er mit seinem olivfarbenen Teint, seinen dunklen Haaren und dunklen Augen ein ziemlich exaktes Ebenbild seines Vaters sei. Anfangs hatte Jackson den Marquess verachtet, da er den Fehler gemacht hatte, dem Klatsch Glauben zu schenken, der über ihn im Umlauf war. Er war zwar immer noch davon überzeugt, dass Stoneville nach dem Tod seiner Eltern auf die schiefe Bahn geraten war, aber da der Marquess offensichtlich versuchte, jetzt alles wiedergutzumachen, hatte er wohl doch seine guten Seiten.
Neben ihm ging Lord Jarret, der, wie es hieß, mit seinen blaugrünen Augen und seinem schwarzen Haar wie eine Mischung aus seinem Vater, der Halbitaliener war, und seiner blonden Mutter aussah. Ihn mochte Jackson von den Sharpe-Brüdern am liebsten. Jarret hatte einen nüchternen und ausgeglichenen Charakter, und daher ließ sich mit ihm am besten reden. Und nachdem seine intrigante Großmutter mütterlicherseits, Mrs Hester Plumtree, ihm erlaubt hatte, die Familienbrauerei zu übernehmen, war Jarret regelrecht aufgeblüht. Er arbeitete hart, damit die Brauerei erfolgreich war, und das gefiel Jackson.
Hinter ihm folgte Lord Gabriel mit seiner frischangetrauten Ehefrau, Lady Gabriel, am Arm. Die Frauen von Oliver und Jarret waren nicht mitgekommen, da sie beide hochschwanger waren. Lady Stoneville sollte noch in diesem Monat niederkommen, und bei Lady Jarret würde es nur wenig länger dauern. Doch es hätte Jackson nicht überrascht, wenn auch der jüngste der Sharpe-Brüder bald verkündet hätte, dass seine Frau guter Hoffnung sei. Die beiden schienen sehr verliebt ineinander zu sein, was einigermaßen erstaunlich war, wenn man bedachte, dass ihre Hochzeit ursprünglich nur dazu dienen sollte, Mrs Plumtrees albernes Ultimatum zu erfüllen. Diese illustre Person ging an Gabes anderem Arm. Jackson bewunderte Mrs Plumtree wegen ihrer Entschlossenheit und ihres Schneids. Darin erinnerte sie ihn an seine geliebte Tante Ada, die ihn aufgezogen hatte und jetzt mit ihm zusammenlebte. Doch was die alte Dame von ihren Enkelkindern verlangte, ging in Jacksons Augen zu weit. Niemand durfte sich eine solche Macht über seine Nachkommen anmaßen, nicht einmal eine lebende Legende wie Hetty Plumtree, die nach dem Tod ihres Gatten ganz auf sich gestellt aus der Familienbrauerei eines der größten Brauereiunternehmen Englands gemacht hatte.
Hinter ihr traten die beiden Sharpe-Schwestern ins Freie und schickten sich an, den Hof zu überqueren. Er sog hörbar die Luft ein, als er die Jüngere der beiden erblickte.
Masters trat neben ihn, um ebenfalls aus dem Fenster zu schauen. »Da kommt sie. Die schönste Frau der Welt.«
»Ja, sie kann einen in den Wahnsinn treiben«, murmelte Jackson.
»Vorsicht, Pinter«, sagte Masters mit amüsiertem Unterton. »Sie sprechen über meine Gemahlin.«
Jackson fuhr zusammen. Es war nicht Mrs Masters gewesen, der sein Blick und seine Bemerkung gegolten hatten. »Ich bitte um Verzeihung«, murmelte er. Er hielt es für das Beste, das Missverständnis nicht aufzuklären.
Masters würde nie begreifen, dass seine Frau neben ihrer jüngeren Schwester wie eine Zuchtstute neben einer Gazelle wirkte. Im Gegensatz zu Jackson war der frischverheiratete Anwalt blind vor Liebe. Jeder Dummkopf sah sofort, dass Lady Celia die attraktivere der beiden Schwestern war. Während Mrs Masters den üppigen Charme eines Hafenmädchens versprühte, glich Lady Celia einer griechischen Göttin – groß und biegsam wie eine Weide, mit kleinen Brüsten und schmalen Gliedmaßen, den elegant geschwungenen Augenbrauenbögen einer echten Dame, den sanften Augen einer Taube …
Und einem unbezähmbaren Temperament. Das verdammte Frauenzimmer konnte mit ihrer scharfen Zunge einem Mann die Haut bei lebendigem Leibe abziehen.
Und sie konnte mit einem achtlos hingeworfenen Lächeln sein Blut zum Kochen bringen.
Gott sei Dank hatte sie ihn bisher noch keines Lächelns gewürdigt. Sonst hätte er vielleicht jenen Tagtraum in die Tat umgesetzt, der ihn quälte, seitdem er ihr zum ersten Mal begegnet war: sie in eine unbeobachtete Ecke zu drängen, wo er sich ungestraft über ihren Mund hermachen konnte. Wo sie ihre schlanken Arme um seinen Hals legen und sich seinen Liebkosungen überlassen würde.
Zur Hölle mit ihr! Bevor er ihr begegnet war, hatte er es sich niemals gestattet, eine Frau zu begehren, die er nicht besitzen konnte. Er hatte sich überhaupt nur selten gestattet, irgendjemanden zu begehren, nur manchmal irgendein Freudenmädchen, wenn das Verlangen nach der Gegenwart einer Frau zu mächtig geworden war. Jetzt schien es ihm, dass er gar nicht mehr damit aufhören konnte.
Es musste daran liegen, dass er sie in letzter Zeit zu selten gesehen hatte. Was er brauchte, war eine Überdosis Lady Celia, damit er ihrer endlich überdrüssig wurde. Dann würde es ihm vielleicht gelingen, diese tiefe Sehnsucht nach dem Unmöglichen loszuwerden.
Mit finsterer Miene wandte er sich vom Fenster ab, aber es war zu spät. Der Anblick von Lady Celia, die in einem atemberaubend eleganten Kleid den Innenhof überquerte, hatte sein Blut schon in Wallung versetzt. Sonst trug sie nie derart bezaubernde Kleider. Gewöhnlich verbarg sie ihre schlanke Gestalt unter einer Art Kittel, um ihre Alltagskleider vor Schmauchspuren zu schützen, wenn sie zu Schießübungen ging.
Aber heute Morgen, in ihrem zitronengelben Kleid, mit ihrem sorgfältig hochgesteckten Haar und dem juwelenbesetzten Armband an ihrem zarten Handgelenkt, war sie ein Sommertag mitten im trostlosen Winter, ein Sonnenstrahl in tiefster Nacht, Musik in der Stille eines verlassenen Konzertsaals.
Und er war ein Narr.
»Ich kann verstehen, dass sie einen Mann zum Wahnsinn treiben kann«, sagte Masters leise. Jackson straffte sich. »Ihre Frau?«, fragte er mit gespielter Begriffsstutzigkeit.
»Lady Celia.«
Hölle und Verdammnis. Offensichtlich hatte er seine Gefühle verraten. Er hatte seine Kindheit damit verbracht, zu lernen, sie zu verbergen, damit die anderen Kinder nicht merkten, wie sehr ihr Spott ihn verletzte. Als Ermittler hatte er dieses Talent perfektioniert, denn in diesem Beruf war eine undurchschaubare Maske Gold wert.
Er machte davon Gebrauch, als er sich dem Anwalt zuwandte. »Dem würde wohl jeder Mann zustimmen. Sie ist leichtsinnig und verdorben, und sie wird ihrem zukünftigen Ehemann sicherlich eine Menge Ärger machen.«
Wenn sie ihn nicht gerade um den Verstand brachte.
Masters zog eine Augenbraue hoch. »Aber Sie beobachten sie ständig. Gefällt sie Ihnen?«
Jackson zwang sich zu einem gleichgültigen Schulterzucken. »Ganz bestimmt nicht. Sie müssen sich jemand anderen suchen, der Ihnen hilft, an das Vermögen Ihrer Frau zu kommen.«
Er hatte gehofft, Masters damit in seinem Stolz zu treffen und so das Thema wechseln zu können, doch der Anwalt lachte nur: »Sie als Ehemann meiner Schwägerin? Das würde ich gern sehen. Abgesehen davon, dass ihre Großmutter niemals zustimmen würde, hasst Lady Celia Sie.«
Das stimmte. Sie hatte eine spontane Abneigung gegen ihn gefasst, als er ein improvisiertes Wettschießen, das sie mit ihrem Bruder und dessen Freunden in einem öffentlichen Park veranstaltete, unterbunden hatte. Er hätte schon damals gewarnt sein sollen.
Leider hatte er die Warnung in den Wind geschlagen. Denn selbst wenn sie ihn nicht verabscheut und der himmelweite Standesunterschied zwischen ihnen nicht bestanden hätte, würde sie ihm niemals eine gute Ehefrau sein können. Sie war jung und verwöhnt und ganz bestimmt nicht die Art Frau, die mit dem Gehalt eines Bow-Street-Ermittlers auskommen würde.
Aber sie wird ein hübsches Erbe antreten, wenn sie heiratet.
Er knirschte mit den Zähnen. Das machte alles nur noch schlimmer. Sie würde annehmen, dass er sie nur wegen ihres Erbes heiraten wollte. Das würden auch alle anderen denken. Und das würde sein Stolz nicht zulassen.
Dreckiger Bastard. Kind der Schande. Hurensohn. Bankert.
Das hatten sie ihm als Kind hinterhergerufen. Später, als er an der Bow Street Karriere gemacht hatte, hatten die Neider, die ihm seinen raschen Aufstieg missgönnten, ihn hinter seinem Rücken einen »Emporkömmling von zweifelhafter Herkunft« genannt. Er hatte nicht vor, dieser Liste noch »raffgieriger Mitgiftjäger«hinzuzufügen.
»Im Übrigen«, fuhr Masters fort, »haben Sie es vielleicht noch nicht mitbekommen, da Sie in den letzten Wochen nicht oft hier waren, aber Minerva behauptet, dass Celia einen Blick auf drei vielversprechende Verehrer geworfen hat.«
Jackson sah ihn verblüfft an. Verehrer? Die Frage: Welche Verehrer?, lag ihm schon auf der Zunge, als sich die Tür öffnete und Lord Stoneville hereinkam, dicht gefolgt vom Rest der Familie. Jackson zwang sich zu einem Lächeln und tauschte höfliche Worte mit den Sharpes aus, während sie um den Tisch herum Platz nahmen, doch in Gedanken wiederholte er immer wieder Masters’ Worte.
Lady Celia hatte also Bewerber. Vielversprechende Bewerber. Gut – sehr gut. Jetzt musste er sich über sein Verhältnis zu ihr keine Gedanken mehr machen. Sie war außer Reichweite, Gott sei Dank. Nicht, dass sie für ihn jemals tatsächlich in Reichweite gewesen wäre, aber –
»Haben Sie Neuigkeiten für uns?«, fragte Stoneville.
Jackson fuhr zusammen. »Ja.« Er holte tief Luft und zwang sich, sich auf den eigentlichen Grund seiner Anwesenheit zu konzentrieren. »Wie Sie wissen, behauptet der Kammerdiener Ihres Vaters, dass Ihr Vater damals, vor neunzehn Jahren, keine Affäre mit Mrs Rawdon gehabt habe.«
»Was ich immer noch nicht glaube«, warf Stoneville ein. »Sie ließ mich ganz gewiss etwas anderes annehmen, als sie … ähm … in meinem Zimmer angetroffen wurde.«
Im Bett Seiner Lordschaft, um genau zu sein. Obwohl die gesamte Familie mittlerweile darüber Bescheid wusste, dass Mrs Rawdon am Tage des Todes ihrer Eltern den sechzehnjährigen Lord Oliver verführt hatte, war es etwas, was die Sharpes nicht gern erwähnten, am wenigsten Stoneville selbst.
»Das weiß ich«, sagte Jackson. »Deshalb wollte ich es mir aus einer weiteren Quelle bestätigen lassen.«
»Aus was für einer weiteren Quelle?«, fragte Mrs Masters.
»Von Mrs Rawdons ehemaliger Zofe, Elsie. Der Kammerdiener war ja wahrscheinlich nicht der einzige Bedienstete, der über das Privatleben seiner Herrschaft Bescheid wusste …. Wenn Ihr Vater und Mrs Rawdon ein Verhältnis hatten, dann wusste ihre Zofe vielleicht auch davon.« Er sog die Luft ein. »Leider ist es mir noch nicht gelungen, Elsie ausfindig zu machen.«
»Und warum sind wir dann hier?«, fragte Jarret, der die Sache wie immer auf den Punkt bringen wollte.
»Weil mir auf der Suche nach Elsie etwas Seltsames aufgefallen ist. Sie war offenbar zuletzt bei einem reichen Gentleman in Manchester in Stellung.«
Während die anderen einen Augenblick benötigten, um zu begreifen, was er damit sagen wollte, verstanden ihn Jarret und Gabe sofort. Sie hatten gemeinsam mit Jackson an der Untersuchung des Todes von Benny May, des ehemaligen Stallmeisters von Halstead Hall teilgenommen. Man hatte seine Leiche gefunden, nachdem er nach Manchester gefahren war, um dort einen angeblichen »Freund« zu besuchen.
»Sie glauben doch nicht, dass Elsie etwas mit Bennys Tod zu tun hatte«, rief Mrs Plumtree aus, und Entsetzen malte sich auf ihrem faltigen Gesicht.
»Ich weiß es nicht«, sagte Jackson. »Aber es ist zumindest ein bemerkenswerter Zufall, dass Benny nach Manchester reiste, wo Elsie bis vor Kurzem gewohnt hatte, um dann, kurz nachdem er die Stadt verließ, den Tod zu finden.«
»Gewohnt hatte?«, fragte Gabe. »Hat Elsie denn Manchester verlassen?«
»Ja, das hat sie. Mir kommt das verdächtig vor. Ihre Familie sagt, Elsie habe ihnen eine kurze Nachricht geschickt, dass sie ihre Stellung aufgegeben habe und nach London wollte, um sich dort etwas Neues zu suchen. Offenbar hat sie ihnen die ganze Zeit über verheimlicht, bei wem sie in Manchester in Stellung gewesen war. Sie vermuten daher, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Arbeitgeber hatte. Wie dem auch sei, es ist mir nicht gelungen, sie ausfindig zu machen. Niemand in Manchester scheint irgendetwas zu wissen. Aber sie hat ihrer Familie versprochen, ihnen Nachricht zu geben, sobald sie in London eine Stellung gefunden hat.«
»Sind wir mit Elsie und Benny vielleicht auf dem Holzweg?«, fragte Stoneville. »Die Behörden haben immer daran gezweifelt, dass Benny ermordet wurde. Vielleicht ist er bei einem Jagdunfall zu Tode gekommen. Elsie hat ihre Stellung vielleicht nur deshalb gekündigt, weil sie dort unzufrieden war. Es könnte reiner Zufall gewesen sein, dass beide zur gleichen Zeit in Manchester waren.«
»Wohl wahr.« Doch in Jacksons Beruf waren reine Zufälle selten. »Ich habe gehört, dass Elsie jünger als Ihre Mutter war.«
»Und ziemlich hübsch dazu, wenn ich mich recht erinnere«, fügte Stoneville hinzu.
»Ich finde es seltsam, dass Mrs Rawdon eine junge und attraktive Zofe hatte«, warf Mrs Plumtree ein. »Das heißt, das Schicksal herausfordern, so wie die Männer sind.«
»Nicht alle Männer, Großmutter«, sagte Mrs Masters entschieden.
Mrs Plumtree warf einen Blick in die Runde, dann lächelte sie. »Nein, nicht alle Männer.«
Jackson versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, was er dachte. Masters schien in der Tat ein ausgezeichneter Ehemann zu sein, aber er war schon auf dem Weg der Besserung gewesen, als er begonnen hatte, seiner Frau den Hof zu machen. Und die drei Sharpe-Brüder schienen ihre Frauen zu vergöttern. Aber wie lange würde das so bleiben?
Seine Mutter war in Liverpool von einem Adligen verführt worden, einem ungestümen jungen Lord mit einer Vorliebe für Jungfrauen. Statt sie zu heiraten, hatte der Dreckskerl eine reiche Frau geehelicht und Jacksons Mutter zur Mätresse genommen. Als Jackson zwei Jahre alt war, hatte er sie fallen gelassen. Jackson machte sich also keine Illusionen darüber, was die Institution der Ehe in Adelskreisen bedeutete.
Mach deinem Vater keine Vorwürfe, hatte seine Mutter gesagt, als sie im Haus seiner Tante und seines Onkels im Sterben lag. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich dich nicht gehabt. Und das war alles wert.
Er war davon nicht überzeugt. Die Erinnerung an ihren ausgemergelten Körper auf dem Bett …
Er zwang sich, seinen Groll zu unterdrücken und sich auf den Gegenstand ihrer Zusammenkunft zu konzentrieren. »Ich warte darauf, dass mir Elsies Familie ihren Aufenthaltsort in London mitteilt. Außerdem habe ich Nachricht von Major Rawdons Regiment in Indien erhalten, dass er für drei Jahre einen Posten in Gibraltar angenommen hat. Ich habe einen Brief dorthin geschickt, um ihm einige Fragen über die damalige Wochenendgesellschaft zu stellen. Solange ich auf die Antworten warte, sollte ich lieber in der Stadt bleiben, anstatt nochmals nach Manchester zu fahren, um dort einer Spur zu folgen, die möglicherweise ins Nichts führt.« Er warf dem Marquess einenBlick zu. »Vorausgesetzt, Eure Lordschaft sind einverstanden.«
»Tun Sie, was Sie für das Beste halten«, murmelte Stoneville. »Halten Sie uns nur auf dem Laufenden.«
»Natürlich.«
Jackson nahm an, dass er damit entlassen war, und verließ die Bibliothek. Er hatte am Nachmittag noch einen Termin und musste vorher nach Hause, um den Bericht abzuholen, den seine Tante für ihn abgeschrieben hatte. Sie war der einzige Mensch, der aus seinem Gekritzel lesbare und verständliche Sätze machen konnte. Wenn er jetzt aufbrach, dann fand er unterwegs vielleicht noch Zeit, etwas zu essen –
»Mr Pinter!«
Er drehte sich um und sah Lady Celia auf sich zukommen. »Ja, Mylady?«
Zu seiner Überraschung warf sie nervöse Blicke zur offenen Tür der Bibliothek hinüber und senkte die Stimme. »Ich muss Sie allein sprechen. Haben Sie einen Moment Zeit?«
Sein Herz machte einen Satz, den er gewaltsam unterdrückte. Lady Celia hatte ihn noch nie um eine Unterredung unter vier Augen gebeten. Angesichts ihres ungewöhnlichen Anliegens nickte er knapp und deutete auf einen angrenzenden Salon.
Sie ging ihm voran und sah sich dann mit einer für sie ganz uncharakteristischen Ängstlichkeit in dem Raum um, während er hinter ihr eintrat. Die Tür ließ er offen, damit niemand ihm unschickliches Verhalten vorwerfen konnte.
»Worum geht es?«, fragte er und bemühte sich, nicht ungeduldig zu klingen. Oder fasziniert. Er hatte Lady Celia noch nie unsicher erlebt. Ärgerlicherweise war es ihm keineswegs gleichgültig.
»Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Traum war. Ich meine, natürlich war es ein Traum, aber …«
»Worauf wollen Sie hinaus, Madam?«
Sie reckte das Kinn empor, und ein ihm vertrautes kriegerisches Funkeln glomm in ihren Augen auf. »Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden, Mr Pinter.«
Er konnte nichts dagegen tun. Er fühlte sich unbehaglich, wenn er ihr so nahe war. Er konnte ihr Parfüm riechen, eine verführerische Mischung aus … ach zur Hölle, er hatte nicht die Spur einer Ahnung, was das für Wohlgerüche waren, mit denen adlige Frauen ihre Reize unterstrichen.
Dabei hatten ihre Reize es keineswegs nötig, unterstrichen zu werden.
»Verzeihen Sie mir«, stieß er hervor. »Ich habe es eilig, in die Stadt zurückzukehren.«
Sie nickte. Offenbar schenkte sie seiner Entschuldigung Glauben. »Letzte Nacht hatte ich einen Traum, den ich oft als Kind gehabt habe. Vielleicht lag es daran, dass wir uns mit der Ausstattung der Kinderzimmer beschäftigt hatten, oder dass Annabel und Maria sich über …« Als er die Augenbrauen hochzog, straffte sie die Schultern. »Egal. Wenn ich diesen Traum früher träumte, kam er mir so unwirklich vor, deshalb nahm ich an, dass es nur ein Traum sei, aber jetzt …« Sie schluckte. »Es könnte auch eine Erinnerung an den Tag sein, an dem meine Eltern starben.«
Er horchte auf. »Aber Sie waren erst vier.«
»Fast fünf, um genau zu sein.«
Richtig. Sie war jetzt vierundzwanzig, und ihre Eltern waren im April vor neunzehn Jahren ermordet worden. »Wie kommen Sie darauf, dass es eine Erinnerung sein könnte?«
»Weil ich hörte, wie Papa mit einer Frau ein Treffen in der Jagdhütte verabredete.«
Ein Schauer lief ihm über den Rücken.
»In dem Traum glaube ich, dass es Mama ist, aber irgendwie verhält sie sich komisch.«
»Wieso?«
»Papa nannte Mama immer ›mia dolce bellezza‹. Dann errötete sie und sagte, dass er blind sei. In dem Traum nannte der Mann die Frau ›mia dolce bellezza‹, und sie wurde deswegen wütend. Sie sagte ihm, dass sie es nicht leiden könne, wenn er sie so nenne. Begreifen Sie? Papa sollte sie nicht so nennen wie seine Frau.«
»Ich vermute, Sie konnten an der Stimme nicht erkennen, wer die Frau war?«
Sie seufzte. »Leider haben sie geflüstert. Ich bin mir nur deshalb sicher, dass es Papa war, weil er die Frau ›mia dolce bellezza‹ nannte.«
»Ich verstehe.«
»Wenn es wirklich so war, dann bedeutet das, dass Mama irgendwie von Papas Stelldichein in der Jagdhütte erfahren hat. Deshalb bat sie Benny, Papa nicht zu sagen, wohin sie geritten war. Weil sie ihn und seine Geliebte in flagranti erwischen wollte. Und wer auch immer die Frau war, die Papa in der Jagdhütte treffen wollte, sie war als Erste da und erschoss Mama.«
»Und als Ihr Vater auftauchte, hat sie auch ihn erschossen?«, fragte er skeptisch. »Jetzt, nachdem der Weg dafür frei war, dass ihr Geliebter sie heiraten konnte?«
Lady Celia schien verwirrt. »Vielleicht war Papa zornig, dass sie Mama erschossen hatte. Vielleicht haben sie um das Gewehr gekämpft, und es ging versehentlich los.«
»Dann müsste die Frau das Gewehr nachgeladen haben, nachdem sie Ihre Mutter erschossen hat. Sie hätte also mit einem geladenen Gewehr in der Hand auf ihren Liebhaber – Ihren Vater – gewartet.«
»I-Ich weiß nicht. Ich weiß nur, was ich gehört habe.«
»Im Traum.«
Sie seufzte. »Vielleicht. Deshalb bin ich damit zu Ihnen gekommen, statt es bei unserem Familientreffen zur Sprache zu bringen. Ich wollte die anderen nicht damit beunruhigen, bevor wir uns nicht sicher sind.«
»Wir?«
»Ja. Ich will, dass Sie der Sache nachgehen und herausfinden, ob das, was ich gehört habe, Wirklichkeit war.«
Der flehende Ausdruck in ihren reizenden haselnussbraunen Augen ließ ihn keineswegs gleichgültig, aber sie verlangte etwas Unmögliches von ihm. »Ich sehe nicht, wie ich –«
»In dem Traum geschahen noch andere Dinge«, sagte sie hastig. »Später kam Gabes Hauslehrer, Mr Virgil, herein, und mein Kindermädchen hat mir ein Lied vorgesungen. Ich habe verschiedene Dinge mitangehört.« Sie zog ein zusammengefaltetes Stück Papier aus ihrer Tasche und hielt es ihm hin.
Zögernd nahm er es.
»Ich habe alles aufgeschrieben, woran ich mich erinnern kann«, fuhr sie fort. »Ich habe mir überlegt, dass Sie mit Mr Virgil und dem Kindermädchen sprechen könnten, um herauszufinden, ob ich mich an diese Dinge richtig erinnere. Wenn nicht, dann ist auch alles andere bestimmt nur Einbildung. Aber wenn …«
»Ich verstehe.« Vielleicht hatte ihr Gedächtnis tatsächlich irgendetwas Wichtiges aufgehoben. Aber welcher Teil ihres Traums war real? Wie sollte er die Spreu vom Weizen trennen?
Er überflog die in einer sauberen Handschrift geschriebenen Zeilen, als ihm etwas ins Auge sprang. »Das Kindermädchen hat Ihnen eine Medizin gegeben?«
Lady Celia nickte. »Sie nannte es paregorisches Elixier. Vermutlich wurde mein Traum dadurch ausgelöst, dass sich Annabel und Maria gestern darüber unterhalten haben.«
»Sie wissen, dass paregorisches Elixier Opium enthält?«
»Tatsächlich?« Sie legte beunruhigt die Stirn in Falten. »Meine Schwägerinnen sagten, sie würden es niemals ihren Kindern geben.«
»Ich habe gehört, dass sich die Ärzte über den Nutzen uneins sind.« Er wählte seine Worte sorgfältig: »Es ist Ihnen vielleicht nicht bekannt, aber Opium kann unter Umständen –«
»Träume und Halluzinationen hervorrufen, ich weiß«, unterbrach sie ihn. Sie sah ihm fest in die Augen. »Aber ich spüre mit jeder Faser meines Körpers, dass mein Traum real war. Ich kann es nicht erklären, und ich weiß, dass ich mich vielleicht täusche, aber ich glaube, wir sollten ihn wenigstens überprüfen, meinen Sie nicht? Wenn wir herausfinden, dass es tatsächlich eine Erinnerung ist, dann können wir vielleicht herausfinden, wer Papas Geliebte war, indem wir herausbekommen, wer an jenem Morgen in der Gesellschaft fehlte.« Sie reckte das Kinn vor. »Außerdem gab mir das Kindermädchen das paregorische Elixir erst, nachdem ich die Unterhaltung mitangehört hatte.«
»Es sei denn, sie hat Ihnen bereits in der Nacht zuvor etwas davon gegeben«, sagte er sanft.
Sie sah ihn betroffen an, und er spürte ihre Enttäuschung wie einen Schlag in die Magengrube.
Er räusperte sich. »Ich stimme Ihnen zu, dass der Hinweis es wert ist, dass ihm nachgegangen wird. Ihr Kindermädchen steht sowieso auf der Liste der Personen, die ich ausfindig machen will, und Mr Virgil ist ganz zweifellos ein wichtiger Zeuge. Ich werde mit beiden reden, und dann sehen wir weiter.« Er schob das Blatt Papier in die Tasche seines Gehrocks. »Es war richtig von Ihnen, mit dieser Sache zu mir zu kommen.«
Sie lächelte ihn an. Es war das erste Lächeln, das sie ihm je geschenkt hatte. Es ließ ihr Gesicht auf eine wunderbare Art lebendig werden und verlieh ihren Zügen eine Weichheit, die sich geradewegs in seine Seele brannte.
»Danke«, sagte sie.
Gott im Himmel, dachte er, ich muss einen kühlen Kopf bewahren. »Zu Ihren Diensten.« Er wandte sich zur Tür. Er musste zusehen, dass er hier wegkam. Wenn sie jemals erriet, was sie in ihm auslöste, würde sie ihn wegen seiner Anmaßung, sie zu begehren, gnadenlos verspotten.
»Wenn das alles ist –«
»Genau genommen«, sagte sie, »wollte ich Sie noch um etwas anderes bitten.«
Verdammt, er hatte es schon beinahe geschafft, ihr zu entkommen. Langsam drehte er sich zu ihr um. »Ja?«
Sie holte tief Luft und reckte das Kinn entschlossen in die Höhe. »Ich will, dass Sie meine Verehrer durchleuchten.«
2
Als sich seine buschigen schwarzen Augenbrauen düster zusammenzogen, wusste Celia, dass sie Mr Pinter schockiert hatte. Seine schlanke Gestalt schien sich noch gerader als sonst aufzurichten, und sein kantiges Gesicht mit der scharfgeschnittenen Nase und dem markanten Kinn erschien ihr noch abweisender als sonst. In seinem strengen Tagesanzug aus schwarzem Serge und weißem Leinen war er ganz Missbilligung.
Aber warum? Er wusste doch, dass sie als Einzige der »Höllenbrut« noch unverheiratet war. Dachte er, sie würde zulassen, dass ihre Geschwister ihr Erbe verloren, nur weil sie nicht willens war, sich den Bedingungen ihrer Großmutter zu unterwerfen?
Offensichtlich dachte er genau das. Als sie ihm von ihrem Traum erzählt hatte, war er so freundlich und aufmerksam gewesen, dass sie beinahe vergessen hatte, dass er sie verabscheute. Warum sonst blickten seine schiefergrauen Augen, deren Farbe sie an das Meer nach einem Sturm erinnerte, jetzt so kalt und unbeteiligt? Der verdammte Kerl war immer so herablassend und selbstsicher, so … so …
Männlich.
»Verzeihen Sie, Mylady«, sagte er mit seiner seltsam heiseren Stimme, »aber mir war nicht bekannt, dass Ihnen jemand den Hof macht.«
Zur Hölle mit ihm, er hatte recht. »Nun, es ist nicht direkt so, dass … Es gibt Männer, die möglicherweise interessiert wären, aber sie sind noch nicht so weit gegangen, sich zu erklären.« Oder auch nur eine entsprechende Andeutung zu machen.
»Und Sie haben sich vorgestellt, dass ich sie unter Druck setze, damit sie es tun?«, fragte er in sarkastischem Ton.
Sie errötete unter seinem forschenden Blick. »Seien Sie nicht albern.«
Das war wieder der Mr Pinter, den sie kannte, der Mr Pinter, der sie eine »leichtsinnige Dame der Gesellschaft« und eine »Unruhestifterin« genannt hatte.
Nicht, dass es sie auch nur im Geringsten kümmerte, was er von ihr dachte. Er war genauso wie die Freunde ihrer Brüder, die in ihr bloß eine Amazone sahen – und das nur, weil sie ihnen zeigen konnte, was in einem guten Gewehr steckte. Und wie ihr Cousin Ned. Dürres Flittchen ohne Tittchen. Du bist ja gar keine richtige Frau.
Zur Hölle mit Ned. Gewiss hatte sie in den zehn Jahren seit ihrem … Tête-à-Tête … etwas an Rundungen zugelegt. Gewiss hatten ihre scharfen Gesichtszüge seitdem eine gewisse weibliche Weichheit gewonnen.
Aber sie hatte immer noch Papas unmodernen olivfarbenen Teint und seinen uneleganten Riesenwuchs und dazu noch Mamas jungenhafte Figur. Sie hatte immer noch dieselben unansehnlichen glatten, braunen Haare, ganz zu schweigen von ihren höchst langweiligen haselnussfarbenen Augen.
Celia hätte alles darum gegeben, wie ihre Schwester auszusehen. Ein Kleid an den richtigen Stellen auszufüllen. Prächtige, mit goldenen Strähnen durchwirkte Locken und glitzernde Jadeaugen zu haben und ein Gesicht von so klassischem Ebenmaß wie eine Porzellanpuppe. Manchmal hörte Celia zwar, dass sie hübsch sei, aber neben Minerva …
Sie schluckte ihren Neid hinunter. Sie war zwar vielleicht nicht so attraktiv wie ihre Schwester, aber dafür hatte sie andere Qualitäten, die sie anziehend machten. Zum Beispiel fühlten sich Männer in ihrer Gesellschaft wohl, weil sie sich für Gewehre und Zielschießen interessierte.
»Es fällt Ihnen vielleicht schwer, das zu glauben, Mr Pinter«, fuhr sie verdrossen fort, »aber manche Männer schätzen meine Gesellschaft. Sie finden, dass man sich gut mit mir unterhalten kann.«
Ein unmerkliches Lächeln flog über sein markantes Gesicht. »Sie haben recht. Es fällt mir schwer, das zu glauben.«
Arroganter Schuft. »Wie dem auch sei, es gibt drei Männer, die möglicherweise in Betracht ziehen könnten, mich zu heiraten. Und Sie könnten mir behilflich sein, ihre Entschlusskraft zu stärken.«
Es war ihr in höchstem Maße zuwider, ihn darum zu bitten, aber für ihren Plan war sie auf seine Hilfe angewiesen. Sie brauchte nur einen guten Heiratsantrag, und zwar einen beeindruckenden Heiratsantrag, um ihrer Großmutter zu beweisen, dass sie fähig war, einen annehmbaren Ehemann zu finden.
Ihre Großmutter traute ihr das offensichtlich nicht zu, sonst hätte sie ihr verdammtes Ultimatum nicht aufrechterhalten. Wenn Celia ihr beweisen konnte, dass sie unrecht hatte, dann würde ihre Großmutter ihr vielleicht etwas mehr Zeit für die Suche nach einem Ehemann einräumen.
Und wenn dieser Plan nicht aufgehen sollte, dann hatte Celia zumindest einen Mann, den sie heiraten konnte, um die Bedingungen ihrer Großmutter zu erfüllen.
»Also haben Sie sich entschlossen, auf Mrs Plumtrees Forderungen einzugehen«, sagte er mit undurchdringlicher Miene.
Sie hatte nicht die Absicht, ihn in ihren geheimen Plan einzuweihen. Auch wenn Oliver Mr Pinter engagiert hatte, so war sie doch sicher, dass Mr Pinter auch für ihre Großmutter spionierte. Er würde sofort zu ihr laufen und ihr alles brühwarm erzählen. »Als ob ich eine andere Wahl hätte.« Bitterkeit mischte sich in ihre Stimme. »Wenn ich nicht heirate, verlieren meine Geschwister in nicht einmal zwei Monaten ihr Erbe. Das kann ich ihnen nicht antun, auch wenn ich die Intrigen meiner Großmutter noch so sehr verabscheue.«
Etwas, das man für Sympathie hätte halten können, flackerte in seiner Miene auf. »Wollen Sie denn nicht heiraten?«
»Natürlich will ich heiraten. Will das nicht jede Frau?«
»Bisher haben Sie wenig Neigung dazu gezeigt«, entgegnete er skeptisch.
Nur, weil die Männer bisher ihrerseits wenig Neigung dazu gezeigt hatten. Oh, Gabes Freunde standen bei Bällen gern mit ihr herum, um sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Waffentechnik mit ihr zu unterhalten, aber sie forderten sie so gut wie nie zum Tanzen auf, und wenn, dann nur, um ihre Meinung über ein bestimmtes Gewehr in Erfahrung zu bringen. Sie hatte es mit Flirten versucht, aber es war ihr nicht besonders gut gelungen. Es schien ihr so … unehrlich. So wie die Komplimente, die sie – selten genug – von den Männern bekam. Besser, sie mit einem Lachen beiseitezuwischen, als sich den Kopf darüber zu zerbrechen, welche ehrlich gemeint waren. Es war einfacher, so zu tun, als ob sie ein Junge wäre.
Heimlich wünschte sie sich, einmal einem Mann zu begegnen, den sie lieben könnte, dem die Skandale, die sich um den Namen ihrer Familie rankten, gleichgültig wären, und der bereit wäre, sich mit ihrem Hobby, dem Zielschießen, abzufinden. Einen Mann, der genauso gut schießen könnte wie sie. Denn sie würde niemals einen Mann respektieren können, der sein Ziel verfehlte.
Ich könnte wetten, Mr Pinter weiß, wie man mit einem Gewehr umgeht.
Sie zog die Stirn kraus. Er hieltsich vielleicht für einen guten Schützen. Für einen Mann von so zweifelhafter Herkunft saß Mr Pinter auf einem ziemlich hohen Ross. Bei sich nannte sie ihn deshalb den stolzen Mr Pinter oder den korrekten Mr Pinter. Erst letzte Woche hatte er zu Gabe gesagt, dass die meisten Lords nur zu zwei Dingen gut seien: die Einkünfte aus ihren Besitzungen gleichmäßig über die Spielhöllen und Bordelle Londons zu verteilen und ihre Pflichten gegenüber Gott und Vaterland zu vernachlässigen.
Sie war sich sicher, dass er nur um des Geldes und des Prestiges willen für Oliver arbeitete. Heimlich verachtete er sie sicher alle. Das war vielleicht auch der Grund für seine abfälligen Bemerkungen über ihre Heiratspläne.
»Wie dem auch sei«, fuhr sie fort, »jetzt bin ich geneigt, zu heiraten.« Sie ging mit großen Schritten zum Kamin hinüber, um sich die Hände zu wärmen. »Deshalb möchte ich, dass Sie die privaten und finanziellen Angelegenheiten meiner drei Auserwählten durchleuchten.«
»Warum ich?«
Sie sah ihn von der Seite an. »Haben Sie vergessen, dass Oliver Sie ursprünglich zu genau diesem Zweck engagiert hat?«
An der Art, wie sich seine Gestalt straffte, erkannte sie, dass er es tatsächlich vergessen hatte. Mit finsterer Miene zog er Notizbuch und Bleistift hervor, die er offensichtlich immer in seiner Tasche trug. »Also gut. Was genau soll ich herausfinden?«
Aufatmend trat sie vom Feuer zurück. »Dieselben Dinge, die Sie auch für meine Geschwister herausgefunden haben: die Wahrheit über die finanzielle Situation dieser Herren, ob sie als Heiratskandidaten geeignet sind und … nun …«
Er hielt mit seinen Notizen inne und zog eine Augenbraue hoch. »Ja?«
Sie zupfte nervös an ihrem goldenen Armband. Gegen das, was jetzt kam, würde er vielleicht Einwände erheben. »Und ihre Geheimnisse. Dinge, die mir bei meinem … äh … Unternehmen nützlich sein können. Ihre Vorlieben, ihre Schwächen, alles, was sie vor der Welt verbergen.«
Sein Gesichtsausdruck ließ sie trotz des Kaminfeuers in ihrem Rücken erschauern. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe.«
»Stellen Sie sich vor, Sie finden heraus, dass einer von ihnen Frauen in Rot mag. Das könnte mir nützlich sein. Ich würde so oft wie möglich rote Kleider tragen.«
Ein Anflug von Belustigung blitzte in seinen Augen auf. »Und was tun Sie, wenn jeder Ihrer Verehrer eine andere Farbe bevorzugt?«
»Das war nur ein Beispiel«, erwiderte sie gereizt. »Natürlich hoffe ich, dass Sie mir wichtigere Informationen liefern. Zum Beispiel, ob einer von ihnen für einen Bankert sorgt. Dann könnte ich –«
»Ihr Bruder bezahlt mich, um sich zu vergewissern, dass die Männer, die um Ihre Hand anhalten, akzeptabel und heiratswürdig sind«, stieß er hervor, »nicht, um Ihnen dabei zu helfen, potenzielle Heiratskandidaten zu erpressen.«
Sie hatte zu spät daran gedacht, dass er ja auch ein Bankert war. »So habe ich es nicht gemeint! Wenn ich wüsste, dass einer dieser Männer ein uneheliches Kind hat, für das er sorgt, dann wüsste ich, dass er Kinder mag. Dann könnte ich durchblicken lassen, wie sehr auch ich Kinder mag. Das ist alles.«
Doch ihre Erklärung schien ihn kaum milder zu stimmen. »Mit anderen Worten, Sie wollen vorgeben, jemand zu sein, der Sie nicht sind, um sich einen Ehemann zu schnappen.«
»Oh, um Himmels willen«, sagte sie unwillig. »Die Hälfte aller Frauen der guten Gesellschaft tut nichts anderes, um sich einen Mann zu angeln. Ich will meine Zeit nicht mit sinnlosen Flirts vergeuden, wenn ich mit ein bisschen Hintergrundwissen meine Treffergenauigkeit verbessern kann.«
Ein herablassendes Lächeln erschien auf seinem Gesicht.
»Was habe ich denn gesagt?«, fragte sie spitz.
»Sie sind bestimmt der einzige Mensch auf der Welt, der eine Werbung wie ein Wettschießen angeht.« Seine Zunge fuhr über die Spitze seines Bleistifts. »Also, wer sind Ihre bedauernswerten Ziele?«
»Der Graf von Devonmont, der Herzog von Lyons und Fernandez Valdes, der Visconde de Basto.«
Seine Miene drohte ihm zu entgleisen. »Sind Sie von Sinnen?«
»Ich weiß, dass diese Herren gesellschaftlich höher stehen als ich, aber sie scheinen meine Gesellschaft zu mögen –«
»Das kann ich mir vorstellen!« Er kam mit langen Schritten auf sie zu. Seltsamerweise schien er wütend zu ein. »Der Graf ist ein notorischer Wüstling, der im Ruf steht, keinen Weiberrock auszulassen. Der Vater des Herzogs ist verrückt geworden, und es heißt, dass der Wahnsinn in der Familie erblich sei, weshalb die meisten Frauen einen weiten Bogen um Lyons machen. Und Basto ist ein portugiesischer Idiot, der zu alt für Sie ist und ganz offensichtlich nach irgendeinem süßen jungen Ding Ausschau hält, das ihn auf seine alten Tage pflegen soll.«
»Wie können Sie solche Sachen sagen? Der Einzige, den Sie persönlich kennen, ist Lord Devonmont, und auch den nur flüchtig.«
»Ich muss sie gar nicht persönlich kennen. Ihr Ruf sagt mir, dass sie völlig unakzeptabel sind.«
Unakzeptabel? Drei der begehrtesten Junggesellen von London? Wenn hier jemand von Sinnen war, dann war es Mr Pinter und nicht sie. »Lord Devonmont ist der Cousin von Gabes Frau. Der Herzog ist Gabes bester Freund. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Und der Viscount … nun …«
»Scheint ein ziemlich schmieriger Typ zu sein, nach allem, was ich gehört habe«, entfuhr es ihm.
»Nein, das ist er nicht. Er ist ein sehr angenehmer Gesellschafter.« Wirklich, diese Unterhaltung wurde immer unmöglicher. »Wen zur Hölle soll ich denn IhrerMeinung nach heiraten?«
Das schien ihn einen Moment lang sprachlos zu machen. Er wandte den Blick ab. »Ich weiß nicht«, murmelte er. »Aber nein … das heißt, Sie sollten nicht …« Er rückte sein Halstuch zurecht. »Diese Männer sind nicht die Richtigen für Sie, das ist alles.«
Sie hatte Mr Pinter aus dem Gleichgewicht gebracht. Wie erstaunlich! Eigentlich konnte nichts Mr Pinter aus dem Gleichgewicht bringen. Es ließ ihn irgendwie verletzlich wirken und viel weniger … steif. Das gefiel ihr.
Aber es hätte ihr noch besser gefallen, wenn sie gewusst hätte, was ihn aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. »Warum interessieren Sie sich dafür, wen ich mir als Ehemann aussuche, solange Sie bezahlt werden? Ich bin bereit, Ihr Honorar zu erhöhen, damit Sie auch wirklich alles herausfinden, was ich wissen will.«
Flugs verwandelte er sich wieder in den stolzen Mr Pinter. »Das ist keine Frage des Honorars, Madam. Ich suche mir meine Aufträge selbst aus, und dieser ist nicht nach meinem Geschmack. Guten Tag.« Er drehte sich auf dem Absatz um und ging zur Tür.
Du liebe Güte, sie hatte nicht vorgehabt, ihn ganz und gar zu verjagen. »Also widerrufen Sie ihre Vereinbarung mit Oliver?«, rief sie ihm hinterher.
Er stutzte.
Sie nutzte ihren Vorteil: »Sie schulden es mir zumindest, die finanziellen Verhältnisse meiner potenziellen Ehekandidaten zu durchleuchten. Wenn Sie nicht wenigstens das für mich tun, dann sage ich meinem Bruder, dass Sie sich weigern, zu tun, wofür er Sie engagiert hat.«
Als sich seine Hände zu Fäusten ballten, bedauerte sie einen Moment lang ihre Worte. Er war vorhin so freundlich gewesen, als sie ihm ihren Traum erzählt hatte, dass sie ein schlechtes Gewissen bekam, solche Mittel anzuwenden. Aber zur Hölle damit – es war schließlich seine Arbeit. Mr Pinter hatte dasselbe für Minerva und für Gabe getan. Warum zum Teufel sollte er es nicht auch für sietun wollen?
Er drehte sich wieder zu ihr um, mit einer Miene, aus der er sorgsam jede Emotion verbannt hatte. »Wenn ich Lord Stoneville darüber aufkläre, wen Sie als Heiratskandidaten in Betracht ziehen, wird er mir vermutlich recht geben. Er war keineswegs erfreut, als sich Ihre Schwester für Mr Masters entschieden hat.«
»Aber es war eine gute Entscheidung, und daran werde ich ihn erinnern, wenn er Einspruch erhebt. Doch das wird er nicht – er weiß, wie wichtig es ist, dass ich einen Ehemann finde.«
Mr Pinter studierte ihr Gesicht so aufmerksam, dass ihr unbehaglich wurde. »Und was ist mit der Liebe?«, fragte er mit seiner dunklen, heiseren Stimme. »Lieben Sie einen dieser Herren?«
Er wagte es, von Liebe zu sprechen, obwohl er ihre Situation kannte? »Meine Großmutter hat mir keine Zeit gegeben, mich zu verlieben.«
»Dann sagen Sie ihr, dass Sie mehr Zeit brauchen. Solange sie sicher sein kann, dass Sie sich einer Heirat nicht verweigern, wird sie Ihnen sicherlich –«
»Einen Aufschub gewähren? Glauben Sie das wirklich? Das Einzige, was sie sagen wird, ist, dass ich fast ein Jahr Zeit hatte und dass ich sie verplempert habe.«
Und zu allem Überfluss hatte ihre Großmutter recht damit. Aber Celia hatte gehofft, dass es ihren Geschwistern gelingen würde, sie von ihrer teuflischen Entscheidung abzubringen. Stattdessen hatten ihre Geschwister eins nach dem anderen klein beigegeben und geheiratet.
Oder genau genommen: Sie hatten sich verliebt. Es war nicht fair. Für ihre bildschöne Schwester war es leicht gewesen, einen Ehemann zu finden – sie hatte sich einfach den Mann ausgesucht, den sie schon immer gewollt hatte. Gabe hatte die Schwester seines besten Freundes geheiratet, und Oliver war praktisch über die perfekte Frau gestolpert.
Aber Celia hatte weder alte Verehrer in der Hinterhand noch beste Freundinnen mit heiratsfähigen Brüdern und auch keine Schützenbrüder, die sich zu ihr hingezogen fühlten. Sie verfügte nur über drei Männer, die möglicherweise in Erwägung ziehen würden, sie zu heiraten. Ihr blieb nichts anderes übrig, als das Beste aus diesem Blatt zu machen.
»Für die Liebe ist es zu spät, Mr Pinter«, sagte sie verdrießlich. »Meine Großmutter sitzt mir im Nacken, und es ist keine gute Jahreszeit, um einen Ehemann zu finden. Außer ein paar Landbällen gibt es vor Ende des Jahres kaum noch Gelegenheiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch über einen geeigneten Gentleman stolpere, ist ziemlich gering.«
»Es muss doch noch jemand anderen geben, jemanden, der –«
»Niemand, den ich kenne, niemand, den ich mir als Ehemann vorstellen kann. Wenigstens sind diese drei Gentlemen mir sympathisch. Ich kann mich mit dem Gedanken, einen von ihnen zu heiraten, durchaus anfreunden.« Vielleicht. Wenn es gar nicht anders geht. »Und da sie alle adlig und reich sind, wird meine Großmutter keine Einwände erheben.« Und das war es, worauf es ihr eigentlich ankam – aber das konnte sie ihmdoch nicht verraten.
Sein Gesicht nahm einen zynischen Ausdruck an. »So also sieht Ihr idealer Ehemann aus«, sagte er kühl. »Ein reicher Adliger.«
»Nein!« Das sah ihm ähnlich, anzunehmen, dass es ihr auf das Geld ankam.
»So sieht der ideale Ehemann meiner Großmutter aus. Ich will bloß einen Mann, mit dem ich es aushalten kann. Aber wenn die Männer, die mir den Hof machen, reich sind, dann heiraten sie mich zumindest nicht um meines Vermögens willen.« Wie Papa es mit Mama getan hat. »Ich möchte keinen Mitgiftjäger zum Ehemann.«
»Ich verstehe.« Ein Muskel zuckte in seiner Wange. »Aber Sie müssen sich nicht zwischen reichen Adligen und Mitgiftjägern entscheiden. Es gibt doch sicherlich noch andere ehrbare Gentlemen?«
»Warum sind Sie so stur, was das angeht?« Plötzlich dämmerte es ihr. »Ich hab’s. Weil meine Verehrer Adlige sind. Ich weiß, dass Sie adlige Gentlemen samt und sonders für Schufte halten, aber –«
»Das ist nicht wahr«, knurrte er. »Ich zähle Lord Kirkpatrick und seine Brüder zu meinen Freunden und auch, ohne unbescheiden sein zu wollen, Ihre Brüder. Ich halte nicht alle Männer von Stand für Schufte. Nur diejenigen, die Frauen nachstellen. Wie Devonmont. Und die beiden anderen möglicherweise auch.«
»Soweit ich weiß, ist niemand von ihnen jemals einer ehrbaren Frau zu nahegetreten. Selbst meine Brüder hatten als Junggesellen ihre … Abenteuer.«
»Wie Ihr Vater.«
Darauf hatte sie gewartet. »Das ist etwas anderes. Mein Vater hat die Ehe gebrochen. Das bedeutet nicht, dass meine Kandidaten dasselbe tun würden.« Sie schluckte. »Außer Sie meinen, dass eine Frau wie ich es nicht vermag, Männer wie sie glücklich und zufrieden zu machen.«
Er fuhr zusammen. »Nein! Das wollte ich keinesfalls andeuten … Das heißt –«
»Es ist schon gut, Mr Pinter«, sagte sie und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie verletzt sie war. »Ich weiß, was Sie von mir halten.«
Sein Blick bohrte sich mit einer Glut, die sie verwirrte, in ihren. »Sie haben nicht die mindeste Ahnung, wie ich über Sie denke.«
Sie nestelte nervös an ihrem Armband, und ihre Bewegung ließ seinen Blick hinab zu ihren Händen wandern. Doch als er ihn wieder hob, geschah das sehr langsam, um auf ihrem Busen länger zu verweilen.
Sollte Mr Pinter etwa … War es möglich, dass …
Ausgeschlossen! Der korrekte Mr Pinter würde sich niemals für eine leichtsinnige Frau von ihrer Sorte interessieren. Er mochte sie ja nicht einmal.
Sie hatte ihre Garderobe heute mit besonderer Sorgfalt ausgewählt, um ihn dazu zu bringen, zu tun, was sie wollte. Sie hatte ihm zeigen wollen, dass sie es verstand, sich wie eine Lady zu kleiden und zu benehmen, und sie hatte gehofft, damit seinen Respekt zu gewinnen.
Aber die Art, wie sein Blick nun von ihren Busen hinauf zu ihrem Hals wanderte, um dann erneut auf ihrem Mund zu verharren, glich mehr der Art, wie ihre Brüder ihre Frauen ansahen. Er war nicht respektlos, er war … interessiert.
Nein, sie bildete sich das alles nur ein. Er versuchte bloß, sie durcheinanderzubringen, und sie deutete die scheinbare Glut in seinem Blick sicherlich falsch. Sie würde sich nicht hinters Licht führen lassen, indem sie sich Dinge einbildete, die nicht existierten. Nicht nach den gemeinen Sachen, die Ned zu ihr gesagt hatte, als sie vierzehn war.
Ich habe dich nur geküsst, um eine Wette zu gewinnen.