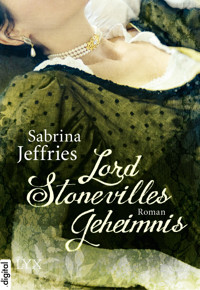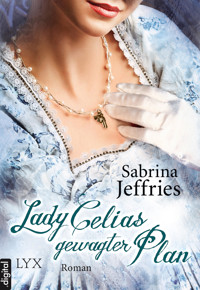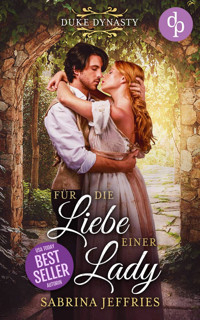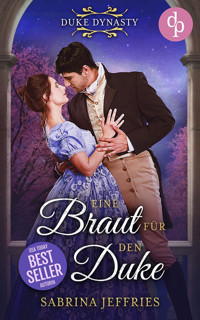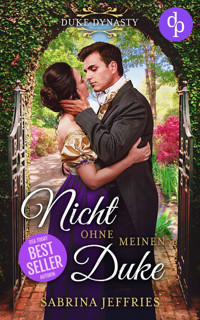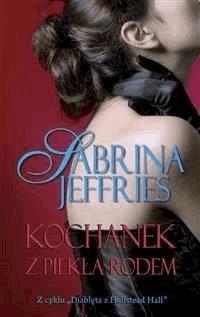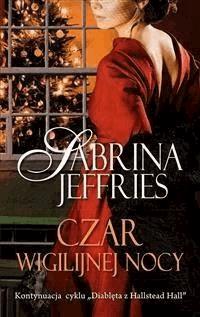9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hellions
- Sprache: Deutsch
Lord Gabriel Sharpe ist einer der besten Reiter Englands, der keinem Pferderennen widerstehen kann. Umso überraschter ist er jedoch, als ihn die junge Virginia Waverly herausfordert, deren Bruder bei einem Rennen ums Leben kam. Sie will sich an Gabriel rächen, den sie für den Tod ihres Bruders verantwortlich macht. Doch Gabriel will nicht nur das Rennen gewinnen, sondern auch Virginias Herz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
SABRINA JEFFRIES
Eine Lady zu gewinnen …
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Andreas Fliedner
Zu diesem Buch
Lord Gabriel Sharpe ist ein waghalsiger Draufgänger, der keinem Kutschenrennen widerstehen kann. Doch seit sein Freund Roger Waverly bei einem Rennen ums Leben kam, nennt man ihn hinter vorgehaltener Hand den »Engel des Todes«. Nur wenige wissen, wie tief Gabriel diese Tragödie getroffen hat – schließlich lässt er niemanden hinter seine scheinbar so sorglose Fassade blicken. Und so ist er auch nicht überrascht, als die temperamentvolle Virginia Waverly ihn zu einem Wettstreit auf derselben berüchtigten Strecke herausfordert, die Roger einst das Leben kostete. Virginia gibt ihm die Schuld am Tod ihres Bruders und will Gabriel um jeden Preis demütigen. Gabriel hingegen fühlt sich für die schöne junge Frau verantwortlich und ist entschlossen, sie zu heiraten. Daher willigt er ein, sich auf einer unge-fährlichen Strecke mit ihr zu messen – unter der Bedingung, dass er ihr den Hof machen darf, sollte er siegen. Virginia ist empört über sein Ansinnen. Wie könnte sie den Mann ehelichen, den sie aus tiefstem Herzen zu hassen glaubt? Insgeheim jedoch lässt Sharpe ihr verräterisches Herz bei jeder Begegnung höher schlagen … Und auch Gabriel merkt schon bald, dass er Virginias Nähe nicht nur aus Pflichtbewusstsein sucht.
Für Susan Williams, die immer für mich da war.
Danke für all die wunderbaren Jahre!
Und für meinen geliebten Bruder Craig Martin, den Adrenalinjunkie unserer Familie, der sich in Gabe vielleicht wiedererkennen wird.
Pass auf dich auf!
Geneigte Leserin, geneigter Leser,
ich weiß mit meinem Enkel Gabriel einfach nicht mehr weiter. Nur seinetwegen habe ich alle meine Enkelinnen und Enkel vor die Wahl gestellt, entweder innerhalb eines Jahres zu heiraten oder enterbt zu werden. Sein bester Freund ist bei einem Kutschenrennen mit Gabe ums Leben gekommen, und sieben Jahre später bricht sich dieser Heißsporn auf derselben heimtückischen Strecke beim Rennen gegen einen anderen Dummkopf den Arm! Da konnte ich nicht länger untätig zusehen. Es wundert mich nicht, dass die Leute Gabe den »Todesengel« nennen, denn er setzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit sein Leben aufs Spiel.
Jetzt hat sich die Schwester seines besten Freundes, Virginia Waverly, in den Kopf gesetzt, ihren Bruder zu rächen, indem sie Gabe bei einem Rennen auf derselben Strecke besiegt. Und anstatt diese verrückte Herausforderung einfach zu ignorieren, macht Gabe ihr den Hof. Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Gut, sie ist ein hübsches, feuriges kleines Ding, aber ihr Großvater, General Waverly, wird niemals seine Einwilligung zu einer Heirat geben. Der Mann ist ein unglaublicher Starrkopf. Stellen Sie sich vor, er hat es gewagt, mich eine »Teufelin« zu nennen! Das lasse ich keinem Mann durchgehen, egal wie gut aussehend und stattlich er für sein Alter ist!
Aber zurück zur Sache. (General Waverly lenkt mich unerhörterweise ab.) Ich weiß nicht, was ich von Gabes Interesse an dieser kessen Miss Waverly halten soll. Natürlich will ich, dass er heiratet. Aber er plagt sich immer noch mit seiner Schuld herum, weil ihr Bruder verunglückt ist. Woher weiß ich, ob sie nicht alles nur noch schlimmer macht? Mein einziger Trost ist, dass sie offenbar genauso hingerissen von meinem Enkel ist wie er von ihr. Gerade heute haben General Waverly und ich die beiden in einer Situation überrascht, die … nun, sagen wir, ziemlich verfänglich wirkte! Ihre Lippen waren verräterisch gerötet, und Gabe sah aus, als hätte ihm gerade jemand das Pferd unterm Sattel weggezogen. Dieser Kerl weiß offenbar nicht, wie man mit ehrbaren Frauen umgeht.
Aber ich werde langsam zu alt für diese Dinge. Wenn er sich jetzt nicht unter die Haube bringen lässt, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als Gabe so lange in der Scheune anzubinden, bis er zur Vernunft kommt. Wünschen Sie mir Glück, liebe Freunde!
Ihre sehr ergebene
Hetty Plumtree
Prolog
Ealing, April 1806
Es gab wieder Geschrei.
Der siebenjährige Gabriel Sharpe, der dritte Sohn des Marquess von Stoneville, hielt sich die Ohren zu. Er hasste Geschrei – er bekam davon Magengrimmen, besonders wenn seine Mutter seinen Vater anschrie.
Diesmal jedoch schrie seine Mutter seinen ältesten Bruder an. Gabe bekam alles mit, weil Olivers Zimmer genau über dem Unterrichtsraum lag. Die einzelnen Worte verstand er nicht, aber sie klangen wütend. Es war ungewöhnlich, dass Oliver angeschrien wurde – schließlich war er doch Mutters Liebling. Na ja, meistens jedenfalls. Sie nannte Gabe »mein kleiner Schatz«. So nannte sie seine Brüder nie.
War das, weil seine Brüder schon fast erwachsen waren? Gabe blickte finster vor sich hin. Er sollte Mutter sagen, dass er nicht »mein kleiner Schatz« genannt werden wollte, außer … dass das nicht stimmte. Wenn sie das sagte, dann gab es danach immer Zitronentörtchen, sein Leibgericht.
Eine Tür knallte. Das Geschrei verstummte. Er atmete aus, und der Knoten in seinem Magen löste sich. Vielleicht würde jetzt ja alles gut werden.
Er starrte auf die Fibel, die vor ihm lag. Er sollte ein Gedicht auswendig lernen. Aber es war ein albernes Gedicht. Es ging um ein totes Rotkehlchen:
Hier ruht Herr Rotkehl,
steif und starr.
Wie er dahin kam,
legt dies Buch dar.
Dann wurde von all den Vögeln berichtet, die sich um den toten Herrn Rotkehl kümmerten, darunter die Eule, die an seiner Bahre Wache hielt, und der Rabe, der ihn zu Grabe trug. In der Geschichte stand zwar, wie Herr Rotkehl starb – die Dohle erschoss ihn mit einer Pistole –, aber nicht, warum. Warum sollte eine Dohle ein Rotkehlchen erschießen? Das ergab keinen Sinn.
Und vor allem kamen keine Pferde in der Geschichte vor. Er hatte schon vorgeblättert und sich die Bilder angesehen, deshalb wusste er das genau. Jede Menge Vögel und ein Fisch und eine Fliege und ein Käfer, aber keine Pferde. Er hätte lieber eine Geschichte über ein Pferd gelesen, das ein Rennen lief, aber über so etwas gab es natürlich keine Geschichten für Kinder.
Gelangweilt schaute er aus dem Fenster und sah seine Mutter mit weit ausgreifenden Schritten zum Stall eilen. Wollte sie zum Picknick, um Vater zu erzählen, dass Oliver unartig gewesen war?
Da wäre Gabe gern dabei gewesen. Oliver bekam nie Ärger, Gabe hingegen ständig. Darum saß er auch hier in diesem albernen Zimmer mit diesem albernen Buch, anstatt sich beim Picknick zu amüsieren – weil er unartig gewesen war und Vater ihm Stubenarrest verordnet hatte.
Aber vielleicht würde Vater seine Meinung ändern, wenn er sich stattdessen über Oliver ärgerte. Falls Mutter zum Picknick wollte, könnte er sie vielleicht sogar dazu bewegen, ihn mitzunehmen.
Er spähte hinüber zu Mr Virgil, dem Hauslehrer, der in seinem Sessel vor sich hin döste. Es würde ein Leichtes für Gabe sein, sich hinauszuschleichen und Mutter zu fragen. Aber er musste sich beeilen.
Mit einem Auge auf Mr Virgil glitt er vom Stuhl und schlich sich Richtung Tür. Im Flur fing er an zu rennen. Halb rannte, halb fiel er die Treppe hinunter, schlitterte über die Marmorfliesen der Eingangshalle und war im Nu draußen im Freien.
Wie ein Blitz schoss er über den Roten Hof, und schon war er an seinem liebsten Ort auf der ganzen Welt – im Pferdestall. Er liebte den schweißigen Geruch der Pferde, das Rascheln und Knistern des Heus unter seinen Füßen und das Gemurmel der Stallburschen. Die Stallungen waren ein verwunschener Ort, wo alle mit leiser, ruhiger Stimme sprachen. Hier gab es kein Geschrei, denn das hätte die Pferde nervös gemacht.
Er sah sich um und seufzte dann enttäuscht. Die Box von Mutters Lieblingsstute war leer, sie war also schon losgeritten. Aber er wollte nicht zurück zu Mr Virgil und dem albernen Buch über Herrn Rotkehl.
»Guten Tag, junger Herr«, sagte der Stallmeister, Benny May, der gerade dabei war, ein Pferd zu beschlagen. Er hatte für Gabes Großvater als Jockey gearbeitet, damals, als die Sharpes noch jede Menge Pferde zu den Rennen schickten. »Suchst du jemanden?«
Gabe wollte nicht zugeben, dass er seine Mutter gesucht hatte. Stattdessen straffte er die Schultern und klemmte die Daumen unter den Bund seiner Kniehosen, wie er es bei den Stallburschen gesehen hatte. »Wollte nur schauen, ob Sie Hilfe gebrauchen können. Sieht so aus, als ob die Burschen alle draußen sind.«
»Ja, beim Picknick. Schätze, heute Nachmittag werden wir ’ne Menge Leute hin- und herfahren müssen. Die feinen Damen und Herren haben bestimmt bald genug von der frischen Luft.« Benny betrachtete konzentriert den Huf, den er bearbeitete. »Warum bist du nicht beim Picknick?«
»Vater hat es verboten, weil ich Minerva eine Spinne ins Haar gesetzt hab und mich nicht entschuldigen wollte.«
Benny gab einen erstickten Laut von sich, der in einem Husten endete. »Also hat er gesagt, dass du stattdessen im Stall helfen sollst?«
Gabe starrte auf seine Schuhspitzen.
»Ah, du bist mal wieder bei Mr Virgil ausgebüxt, was?«
»Schon möglich«, murmelte Gabe.
»Du solltest ein bisschen netter zu deiner Schwester sein. Sie ist ein liebes Mädchen.«
Gabe schnaubte. »Sie ist ein Plappermaul. Egal, eigentlich wollte ich nach Jacky Boy sehen.« Jacky Boy war Gabes Pony. Sein Vater hatte es ihm letzten Sommer zum Geburtstag geschenkt. »Er macht manchmal Zicken.«
Ein unmerkliches Lächeln huschte über Bennys gegerbtes Gesicht. »Ja, das kann man sagen, mein Junge. Aber wenn du da bist, ist er sanft wie’n Lamm, stimmt’s?«
Gabe zuckte mit den Schultern und versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie stolz er auf das Kompliment war. »Ich weiß schon, was er mag. Muss er … hm … vielleicht gestriegelt werden?«
»Nun ja, komisch, dass du fragst, weil ich grad dachte, dass er ein bisschen Pflege nötig hätte.« Benny wies mit einer knappen Kopfbewegung in Richtung Sattelkammer. »Du weißt ja, wo alles ist.«
Gabe schlenderte zur Sattelkammer hinüber. Schnell hatte er gefunden, was er brauchte, und öffnete das Gitter von Jacky Boys Box. Das Pony stupste ihn, in der Hoffnung auf ein Stück Zucker, mit den Nüstern an.
»Tut mir leid, alter Kumpel«, murmelte Gabe. »War in Eile. Hab nichts für dich.« Er begann das Pony zu striegeln, und Jacky Boy entspannte sich.
Es gab nichts Besseres auf der ganzen Welt, als sich um Jacky Boy zu kümmern: die gleichmäßige Bewegung des Striegels, der Atem des Ponys, der zu einem ruhigen, weichen Rhythmus fand, Jacky Boys seidiges Fell unter seinen Fingerspitzen … Davon bekam Gabe niemals genug.
Draußen im Stall herrschte ein Kommen und Gehen, aber hier in der Box gab es nur Gabe und Jacky Boy. Manchmal riss ihn etwas aus seiner Träumerei – ein hochnäsiger Gentleman, der ein anderes Pferd wollte, oder ein Stallbursche, der sich bei einer ungehaltenen Lady entschuldigte, weil ihr Pferd nicht schnell genug bereitstand –, aber die meiste Zeit herrschte Stille, und man hörte nur den Klang von Bennys Hammer auf dem Metall eines Hufeisens.
Selbst dieses Geräusch erstarb, als Benny nach draußen gerufen wurde, weil eine Kutsche vorfuhr. Für eine Weile war Gabe im siebten Himmel, allein mit seinem Pony. Dann hörte er schwere Schritte in der Stallgasse.
»Ist hier jemand?«, rief eine Männerstimme. »Ich brauche ein Pferd.«
Gabe kauerte sich in der vorderen Ecke der Box zusammen und hoffte, nicht bemerkt zu werden.
Doch der Mann musste ihn gehört haben, denn er rief: »Heda, Bursche, ich brauche ein Pferd.«
Er war entdeckt worden. Als der Mann näher kam, sagte Gabe: »Verzeihen Sie, Sir, aber ich bin kein Stallbursche. Ich sehe nur nach meinem Pferd.«
Der Mann blieb draußen vor der Box stehen. Da Gabe mit dem Rücken zum Eingang der Box auf dem Boden saß, konnte er den Mann nicht sehen. Er hoffte nur, dass es umgekehrt genauso war.
»Aha«, sagte der Mann, »du bist wohl eines von den Sharpe-Kindern?«
Gabes Magen krampfte sich zusammen. »W-woher wissen Sie das?«
»Die einzigen Kinder, denen hier im Stall ein eigenes Pferd gehört, sind die Sharpe-Kinder.«
»Oh.« Das hatte Gabe nicht bedacht.
»Und du bist Gabriel, nicht wahr?«
Gabe erstarrte. Er fürchtete sich vor diesem klugen Mann. Wenn Vater davon erfuhr, würde es was setzen. »Ich … ich …«
»Lord Jarret ist draußen beim Picknick, und Lord Oliver wollte nicht hingehen. Bleibt also nur noch Lord Gabriel übrig. Und das musst du sein.«
Die Stimme des Mannes war sanft, ja, freundlich. Sie hatte nicht diesen herablassenden Tonfall, in dem Erwachsene sonst mit Kindern redeten. Die Stimme klang nicht so, als ob der Mann Gabe in Schwierigkeiten bringen wollte.
»Weißt du, wo die Stallburschen alle sind?«, fragte er, und seine Stimme entfernte sich.
Da es jetzt in dem Gespräch nicht mehr um ihn ging, entspannte sich Gabe. »Sie kümmern sich um die Kutsche.«
»Dann hätten sie vermutlich nichts dagegen, wenn ich mir selbst ein Pferd sattle.«
»Wahrscheinlich nicht, Sir.«
Oliver sattelte sein Pferd immer selbst. Und Jarret auch. Gabe konnte es kaum erwarten, bis er endlich auch alt genug war, um ein Pferd satteln zu dürfen. Dann würde er Vater nicht mehr um Erlaubnis bitten müssen, wenn er mit Jacky Boy ausreiten wollte.
Der Mann hatte sich das Pferd in der benachbarten Box ausgesucht. Alles, was Gabe von ihm sehen konnte, war die Spitze seines hohen Kastorhutes.
Nachdem er fortgeritten war, fiel Gabe ein, dass er den Mann vielleicht nach seinem Namen hätte fragen oder zumindest versuchen sollen, ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Plötzliche Panik ergriff ihn. Vielleicht war der Mann ein Pferdedieb, und Gabe hatte ihn gerade eben entwischen lassen?
Nein, der Mann hatte Gabes Namen gekannt und die Namen seiner Brüder. Er gehörte bestimmt zu den Gästen.
Benny kam wieder in den Stall. Bevor Gabe etwas sagen konnte, rief er: »Die Gäste kommen vom Picknick zurück, mein Junge. Lauf besser schnell ins Haus, wenn dein Vater dich hier nicht erwischen soll.«
Eine neue Welle der Panik stieg in Gabe auf. Wenn Vater herausfand, dass er Mr Virgil wieder entwischt war, dann würde er ihm den Hintern versohlen. Was den Unterricht bei Mr Virgil anging, verstand Vater keinen Spaß.
Er rannte zurück zum Haus. Als er ins Unterrichtszimmer schlüpfte, schnarchte Mr Virgil immer noch vor sich hin. Mit einem Seufzer der Erleichterung machte Gabe es sich auf seinem Stuhl bequem und steckte seine Nase wieder in das langweilige Buch.
Aber er konnte sich nicht auf den toten Herrn Rotkehl konzentrieren. Er musste die ganze Zeit an den fremden Mann im Stall denken. Hätte er Benny etwas sagen sollen? Wenn der Fremde ein Pferd gestohlen hatte, würde es Zeter und Mordio geben, und Gabe würde jede Menge Ärger bekommen. Darüber zerbrach er sich immer noch den Kopf, als er nach dem Essen mit Minerva im Kinderzimmer war. Celia, die mit Husten im Bett lag, schlief schon, als ein Diener, das Kindermädchen und Mr Virgil kamen, um sie zu holen. Großmutter Plumtree wollte unten mit ihm und Minerva sprechen, sagte der Diener ernst.
Gabes Puls begann zu rasen. Der Mann im Stall hatte ein Pferd gestohlen, und Großmutter hatte irgendwie herausgefunden, dass Gabe es hatte geschehen lassen. Aber warum zog man dann Minerva mit hinein?
Der Diener führte sie in die Bibliothek, während Celia mit dem Kindermädchen und Mr Virgil zurückblieb. Als er Oliver dort stehen sah, mit nassen Haaren und roten Augen und in anderen Kleidern als denen, die er am Morgen getragen hatte, wusste Gabe nicht, was er davon halten sollte.
Dann kam Jarret herein, begleitet von einem weiteren Diener. »Wo sind Mutter und Vater?«
Olivers Züge versteinerten, und sein Blick wurde dunkel vor Angst.
»Ich habe euch etwas zu sagen, Kinder.« Großmutters Stimme war weicher als sonst. »Es hat einen Unfall gegeben.« Etwas schien in ihrem Hals festzustecken, und sie räusperte sich.
Weinte sie etwa? Großmutter weinte nie. Vater behauptete, sie habe ein Herz aus Stahl.
»Eure Eltern …«
Ihre Stimme versagte, und Oliver fuhr zusammen, als hätte ihm jemand einen Schlag versetzt. »Mutter und Vater sind tot«, führte er ihren Satz zu Ende. Seine Stimme klang wie die eines Fremden.
Die Worte ergaben für Gabe keinen Sinn. Tot? Wie Herr Rotkehl? Gabe starrte in die Runde. Gleich würde jemand sagen, dass sie nur Spaß gemacht hatten.
Aber niemand sagte etwas dergleichen.
Großmutter rieb sich die Augen und straffte sich. »Eure Mutter hat euren Vater in der Jagdhütte erschossen. Sie hielt ihn für einen Einbrecher. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, da … da hat sie sich ebenfalls erschossen.«
Neben ihm begann Minerva zu weinen. Jarret schüttelte die ganze Zeit über den Kopf und murmelte: »Nein, nein, das ist unmöglich. Wie kann das möglich sein?« Oliver ging zum Fenster; seine Schultern bebten.
Gabe musste die ganze Zeit an das alberne Gedicht denken:
Und bei den Vögeln
war Jammern und Klagen,
als der Herr Rotkehl
wurde begraben.
Es war genau wie in dem Gedicht, nur dass sie keine Vögel waren. Gabe wusste nicht, was er tun sollte. Großmutter sagte gerade, dass sie mit niemandem darüber sprechen dürften, weil der Skandal so schon groß genug sein würde. Aber ihre Worte ergaben keinen Sinn. Warum sollte er mit irgendjemandem darüber sprechen? Er konnte ja nicht einmal glauben, dass es passiert war.
Vielleicht war alles nur ein Albtraum. Er würde aufwachen, und Vater würde da sein.
»Bist du sicher, dass sie es waren?«, fragte er mit zitternder Stimme. »Vielleicht wurde jemand anders erschossen.«
Großmutter wirkte zutiefst erschüttert. »Ich bin sicher. Oliver und ich waren …« Mit verzerrtem Gesicht kam Großmutter zu ihnen herüber und schlang die Arme um Gabe und Minerva. »Es tut mir leid, meine kleinen Lieblinge. Versucht jetzt, stark zu sein. Ich weiß, wie schwer es ist.«
Minerva hörte nicht auf zu weinen. Großmutter drückte sie an sich.
Gabe dachte an das letzte Mal, als er seine Eltern gesehen hatte: Vater war ausgeritten zum Picknick, und Mutter war auf den Stall zugeeilt. Wie konnte das das letzte Mal gewesen sein? Jetzt würde er Vater nie mehr sagen können, dass es ihm leidtat, wegen der Spinne in Minervas Haar. Vater war mit dem Gedanken gestorben, dass er ein unartiger Junge war, der sich nicht entschuldigen wollte.
Da stiegen ihm die Tränen in die Augen. Jarret und Oliver durften das nicht sehen – sie würden ihn für eine Heulsuse halten. Er stürzte aus der Bibliothek, hörte nicht auf Großmutters überraschten Ausruf und rannte in Richtung der Stallungen.
Es war still. Die Stallburschen waren alle beim Abendessen. Sobald er Jacky Boys Box erreichte, warf er sich auf den Boden und fing an zu weinen. Es war nicht richtig! Wie konnten sie tot sein?
Er wusste nicht, wie lange er dort schluchzend gelegen hatte. Irgendwann bemerkte er, dass Jarret die Box betreten hatte und seine Hand auf Gabes Schulter legte. »Komm schon, Junge, reiß dich zusammen.«
Gabe schob Jarrets Hand weg. »Ich kann nicht. Sie … sie sind weg und werden nie … nie wiederkommen!«
»Ich weiß«, sagte Jarret mit brüchiger Stimme.
»Es ist nicht fair.« Gabe sah zu Jarret hoch. »Andere Eltern sterben nicht. Warum … warum unsere?«
Jarret biss sich auf die Lippen. »Manchmal passiert so was eben.«
»Es ist wie in diesem albernen Buch über Herrn Rotkehl. Es … es ergibt keinen Sinn.«
»Das ganze Leben ergibt keinen Sinn«, sagte Jarret leise. »Das kannst du nicht erwarten. Alles hängt vom Schicksal ab, und niemand weiß, was das Schicksal als Nächstes bringt.«
Jarret weinte immer noch nicht, obwohl dunkle Ringe unter seinen Augen lagen und sein Gesicht einen seltsam verzerrten Ausdruck angenommen hatte, so, als hätte ihm gerade jemand heftig auf den Fuß getreten. Gabe hatte Jarret immer am liebsten von allen gemocht, aber jetzt hasste er ihn. Weil er so ruhig war. Warum war sein Bruder nicht wütend?
»Wir müssen stark sein«, fuhr Jarret fort.
»Warum?«, brach es aus Gabe heraus. »Was ändert das? Sie sind trotzdem tot, und wir sind trotzdem ganz allein.«
»Ja, aber wenn du dich vom Schicksal überwältigen lässt, dann zwingt es dich zu Boden. Du darfst dich nicht einschüchtern lassen. Lach ihm ins Gesicht und sag ihm, es soll sich zur Hölle scheren. Nur so kann man ihm beikommen.«
Nicht das Leben war sinnlos, sondern der Tod. Er riss die Menschen aus dem Leben, einfach so, ohne Grund. Mutter hätte Vater nicht erschießen dürfen, und die Dohle hätte Herrn Rotkehl nicht erschießen dürfen. Aber tot waren sie trotzdem alle. Auch ihn konnte der Tod einfach so aus dem Leben reißen, ohne Vorwarnung. Eine eisige Furcht stieg in ihm auf. Er konnte jeden Moment sterben. Einfach so.
Was konnte er dagegen tun? Der Tod gehörte offenbar zu diesen Mistkerlen, die sich von hinten anschlichen und einen ohne Vorwarnung in den Schwitzkasten nahmen. Vielleicht schlich er sich in diesem Augenblick schon an ihn heran …
Aber vielleicht hatte Jarret recht. Man musste dem Tod die Stirn bieten – oder ihn einfach ignorieren. Gabe hatte schon mit einem ganzen Haufen von hinterlistigen Mistkerlen zu tun gehabt, und die einzige Chance, die man gegen sie hatte, war, sich nicht einschüchtern und sich nicht anmerken zu lassen, dass sie einem wehtaten. Dann ließen sie einen in Ruhe, um jemand anderen zu tyrannisieren.
Er dachte an Mutter und Vater, wie sie irgendwo tot dalagen, und Tränen schossen ihm in die Augen. Mit einer heftigen Bewegung wischte er sie weg und schob die Unterlippe vor. Vielleicht würde ihn der Tod kriegen, so wie er Mutter und Vater gekriegt hatte, aber er würde sich nicht kampflos ergeben.
Wenn der Tod ihn haben wollte, würde er kein leichtes Opfer sein. Er würde sich mit Händen und Füßen wehren.
1
Eastcote, August 1825
Virginia Waverly konnte ihre Aufregung kaum bezähmen, während die Kutsche auf Marsbury House zuraste. Ein Ball! Zum ersten Mal in ihrem Leben würde sie auf einen Ball gehen. Jetzt würde sie endlich Gelegenheit haben, die Walzerschritte auszuprobieren, die ihr Cousin Pierce Waverly, der Graf von Devonmont, ihr beigebracht hatte.
Für einen Moment gab sie sich der herrlichen Vorstellung hin, wie sie in den Armen eines gut aussehenden Kavallerieoffiziers durch den Saal schwebte. Oder vielleicht würde sogar der Gastgeber selbst, der Herzog von Lyons, sie zum Tanz auffordern! Wäre das nicht grandios? Sie wusste, was die Leute über seinen Vater erzählten – sie nannten ihn »den verrückten Herzog« –, aber sie pflegte solchem Gerede keine Beachtung zu schenken.
Wenn sie nur ein modischeres Kleid gehabt hätte – so wie das aus rosafarbener neapolitanischer Seide, das sie im Lady’s Magazine gesehen hatte. Aber modische Kleider waren kostspielig, und darum musste sie mit diesem alten Fetzen aus Tartanstoff vorliebnehmen, der aus einer Zeit stammte, als Schottenmuster der letzte Schrei gewesen waren. Hätte sie doch nur etwas weniger Auffälliges zum Umarbeiten ausgesucht. Jeder würde auf den ersten Blick sehen, wie arm sie war.
»Du siehst besorgt aus«, bemerkte Pierce.
Virginia blickte ihn überrascht an. So viel Feingefühl hatte sie von ihm nicht erwartet. »Nur ein bisschen. Ich habe versucht, das Kleid mit einem Tüllüberwurf ein bisschen flotter zu machen, aber die Ärmel sind immer noch zu kurz, und jetzt sieht es aus wie ein Kleid von vorgestern mit komischen Ärmeln.«
»Nein, ich meinte …«
»Aber bestimmt wird man mich deshalb nicht schief ansehen.« Sie schob herausfordernd das Kinn vor. »Und wenn doch, dann ist es mir auch egal. Ich bin wahrscheinlich die einzige Frau, die mit zwanzig noch nie auf einem Ball war. Selbst die Tochter des Farmers von nebenan war schon mal auf einem, in Bath, und sie ist erst achtzehn!«
»Was ich sagen wollte …«
»Jedenfalls werden mich weder mein Kleid noch die Tatsache, dass ich noch nie getanzt habe, davon abhalten, mich zu amüsieren«, sagte sie tapfer. »Ich werde Kaviar essen und Champagner trinken und einen Abend lang so tun, als wäre ich reich. Und ich werde endlich mit einem Mann tanzen.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!