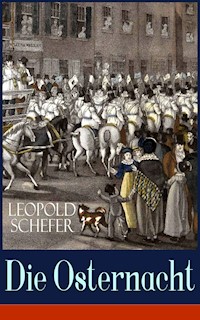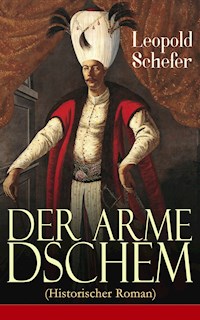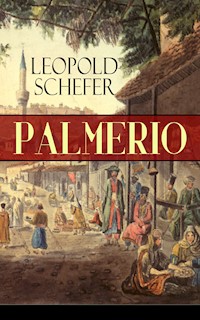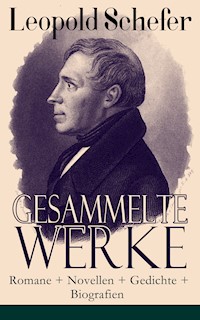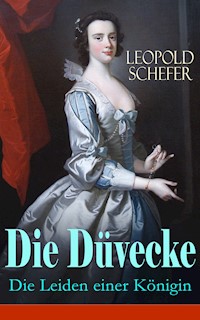1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Leopold Schefer, ein deutscher Dichter und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, präsentiert in seinem Werk 'Ein Weihnachtsfest in Rom' eine faszinierende Erzählung, die von Liebe, Sehnsucht und Romantik durchdrungen ist. Das Buch erzählt die Geschichte einer unerfüllten Liebe zwischen einem jungen Maler und einer schönen Italienerin in der prachtvollen Kulisse Roms. Schefer verleiht seinem Werk eine lyrische Note, die durch feinsinnige Beschreibungen und poetische Sprache beeindruckt. Der Autor schafft es, die Emotionen und Gedanken seiner Figuren auf eindrucksvolle Weise darzustellen, was dem Leser ein intensives Leseerlebnis beschert. 'Ein Weihnachtsfest in Rom' ist ein Meisterwerk des romantischen Erzählens, das mit seiner Tiefe und Sinnlichkeit den Leser in seinen Bann zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Ein Weihnachtsfest in Rom
Books
Inhaltsverzeichnis
Abend ward über Rom, heiliger Christabend, Aber es war keine Erwartung der Kinder, keine Freude in der Stadt, in keinem Hause, wie zu dieser erfreulichen Zeit im heiligen deutschen Reich. Denn in Rom bescheren erst die heiligen drei Könige an ihrem Tage, und das Weihnachtsfest ist in Rom ein trauriges, still vorüberziehendes Fest. Diesmal war aber auch der Himmel traurig, umwölkt mit tiefziehenden Wolken, die Regengüsse drohten. Ja, es tröpfelte schon jetzt, während die, wie auf die Erde gefallene Sonne unter der schwarzen Wolkendecke in einem hellen, blaßgrünen Himmelstreifen golden unterging, und die Berge von Albano, den beschneiten Sorakte, die sieben Hügel Roms mit ihren Kirchen und Palästen vergoldete.
Der Anblick war schön, ja entzückend, besonders dem breiten, bunten, prachtvollen Regenbogen gegenüber, vom hohen und festen Thurme des edlen Stefano Cenci, auf dessen flacher Zinne ein fremdes Weib mit ihrem Knäbchen saß, das sie in ihr Gewand gehüllt und an ihre Brust gedrückt umarmt hielt. Sie hatte sich angelehnt und schien zu schlafen, während sie jedoch nur von Schmerz und Kummer gebeugt, die Welt umher, das verhaßte unglückliche Rom zu ihren Füßen nicht merken wollte; ja ihr schöner kleiner Knabe selbst schien ihr erst der äußerste Gram. Deswegen hatte sie vor seinem Anblick die Augen geschlossen. Ihr gegenüber saß des Stefano Cenci Gemahlin Livia, welche sie hier oben aufgesucht und gefunden hatte; aber sie getraute sich nicht, das unglückliche Weib aufzuwecken, um sie zu trösten, da ihr Schlaf, ja Tod, das beste Labsal, die sicherste Ruhe für sie schien.
Denn durch Europa war ein ungeheures, ein unerhörtes Wort erschollen: „Kein Geistlicher soll eine Frau haben. Wer eine hat, soll sie verstoßen, und sie ist für eine Concubine zu achten, ihre Kinder gleich Bastarden.“ Das Wort war nur unmenschlich. Aber ein zweites Wort war noch entsetzender: „Keinem Fürsten gehört eine Handbreit Land; Jeder hat Alles, was er hat, nur zu Lehen vom heiligen Stuhl; und kein Fürst darf einen Bischof oder Priester einsetzen, absetzen aber gar nicht. Denn Gott hat Himmel und Erde gemacht; darum freilich gehört sie Gott dem Herrn. Und Gott hat die Erde an seinen Sohn gegeben. Sein Sohn aber hat den einzigen Apostel Petrus darüber gesetzt, und Petrus, dieser Jünger, stirbet nicht; und so gehört die Erde dem heiligen Stuhle desselben zu Rom, Wer darauf sitzt, er sei und heiße wie er will, der setzt Bischöfe und Fürsten ein und ab.“ —
Und so hatte der heilige Stuhl, aus Hildebrand's, als Gregor des Siebenten, Munde, jetzt zum Schrecken der vielen hundert Frau Bischöfinnen und der vielen tausend Frau Priesterinnen sie abgesetzt vom Stande ehrlicher Ehefrauen, und die unzähligen Kinder vom Range ehrlicher Kinder.
So war denn auch dem Bischof Burkard geschehen, welcher die reichste, edelste Jungfrau, eines schwäbischen Grafen Tochter, die schöne verständige Irmengard, zur Frau hatte. Sie sollte nun eine Concubine sein; ihr lieber, kleiner Otto, ein Knäbchen von drei Jahren, sollte ein unnennbares Wesen sein, welches der Schandname „Bastard“ noch am besten bezeichnete. Aber das war ihrem mütterlichen Gefühl unerträglich, ja unerträglicher als tausend andern Frauen, die sich in Frankreich, Spanien und Italien mit ihr in derselben Lage befanden; denn sie war ein deutsches Weib, voll Ehre und Redlichkeit.
Ein solcher Sturz von ihrer hohen ehrwürdigen Stellung der Frau eines Bischofs, ja eines Mannes Frau und einer Menschenmutter überhaupt, war niederbeugend bis tief, tief unter das Geschick der geringsten Bäuerin, und stieß sie unter die Frauen, ja unter die Menschheit, in vernichtende, unabwerfliche Schande. Ob aber nicht abwerflich, das war die Frage.
Denn in allen andern überirdischen und irdischen Dingen hatte Rom den Menschen für ein Loch des Himmels gegolten, aus welchem nichts als Weisheit und Seligkeit wenigstens heraus töne, mehr, wie einst aus dem Loche zu Delphi, in dessen betäubenden Dämpfen die Wahrsagerin Pythia nur zu gewissen Tagen des Mondes saß. Aber der heilige Vater saß immerwährend Tag und Nacht auf dem heiligen Stuhl, auch wenn er im Bett lag und schlief.
Diesmal aber waren die Frauen an ihrem Wesen und Dasein angegriffen, gekränkt, entwürdigt, vernichtet; nicht Alle, aber Unzählige; Vornehme, in denen reiche, mächtige, hohe Geschlechter entehrt waren; Stolze, in welche das Gefühl der Würde der Männer im Volke hinübergezogen war, wie eine blühende Rose den Duft eines blühenden Mohnhauptes annimmt, das Regen oder Wind an sie gedrückt. Wie die Weiber der Türken nicht zum Gebet in eine türkische Kirche gehen dürfen, und dereinst einmal nicht in das Paradies eingehen sollen, also auch, bei wegfallender Ursache, nicht vom Tode aufzustehen brauchen; so schien den Jungfrauen auf Erden das schönste tröstlichste Loos verwehrt, nicht einen Mittelsmann des Himmels zum Manne bekommen zu dürfen. Der Ingrimm, die Wuth war allgemein.
Die Fürsten dagegen, auch an ihrem Wesen und Sein, an ihrem blutig und schwer erworbenen Recht, dem Eigenthum des Landes angegriffen, reizten die Geistlichen zu heimlichem und offenem Widerstand gegen eine Stimme, welche der Welt durch ihre Unmenschlichkeit zum erstenmal aus einem ganz anderen, als einem himmlischen Loche zu kommen schien. Der Bischof Burkard ehrte und liebte seine schöne Frau, sein schönes Kind viel zu sehr, war von Herzen und Geist viel zu sehr Ehrenmann, als daß es bei ihm erst bedurft hätte, ihm die wahrsten, menschlichsten Worte laut vor dem Volke aus der Seele zu locken oder zu pressen. Weit und breit in Schwaben hatte kein Bischof, kein Priester sein Weib, seine Kinder verstoßen. Burkard sprach weise, sprach wahr, und so war er fürchterlich. Er sollte kommen, in Rom sich vertheidigen gegen Ungehorsam.
Muthvoll zog er nach Rom, um seinem Worte den Sieg, das Recht zu erkämpfen. Aber man wollte ihn nicht hören. Er ward in den Kerker geworfen, nicht, um die Wahrheit zu sagen, damit er leide oder büße, sondern, damit er nicht nach Deutschland, nach dem muthigen Schwaben zurückkehre, seinen Trotz ausbreite, mit seinem Worte das Land erleuchte, wie die Sonne durch helle Wolken.
So war er zur gesetzten Frist, und lange nachher nicht wiedergekommen. So hatte sein Weib Irmengard sammt ihrem Knaben, sicher geleitet von ihrem Bruder, und wohlversehen mit Gold und Juwelen, sich nach Rom aufgemacht, ihren Mann zu suchen, loszukaufen aus der geistlichen Sclaverei. Der bucklige Gottfried, Gozzelo, Herzog von Lothringen und Markgraf von Mailand, der verachtete Mann der schönen Markgräfin Mathilde, die stets fern von ihm, meist in Rom, bei und mit dem Papst Hildebrand lebte, hatte ihn an seinen heimlichen mächtigen Freund Stefano Cenci empfohlen; er hatte sie wohl aufgenommen, gegen alle Ränke wohl beschützt; aber ihren Mann hatte sie nicht gefunden, in keinem Kerker entdeckt, denn man hatte ihr keinen aufgeschlossen.
Und rathlos, hoffnungslos, ehrlos in ihrem Gefühl, hatte sie sich von allen Menschen fern, auch heut' auf ihren liebsten Aufenthalt, auf die einsame Zinne des Thurmes gerettet, wo sie, so lange die Wehmuth ihr es zuließ, unter allen Dächern sich ihren gefangenen Mann denken konnte: in Ketten; ohne Sie; ohne seinen kleinen Otto, dessen er heut gewiß dachte am heiligen Weihnachtsfest! Denn so eben läuteten viele hundert Glocken von allen Thürmen Roms das menschlichste aller Feste ein: die Geburt des göttlichen Kindes! Und drunten in den Straßen bliesen die Hirten aus der Campagna fromme Lieder auf ihren Schalmeien. Aber sie waren jetzt nicht zu hören.
Livia, die Gattin des Präfecten Stefano Cenci, eine kleine, untersetzte, feurige Frau, brach endlich das Schweigen und sagte zu Irmengard: „Aber ihr sprecht auch gar nicht, arme Gräfin! Ihr weint nicht einmal!“
„Gräfin nennt Ihr mich!“ entgegnete Irmengard, erröthend und mit Bitterkeit im Antlitz, „o ich verstehe — auch Euch bin ich schon eine Geschiedene, eine Wittwe, die man wieder nach dem Rang ihres Vaters benennt; auch Euch bin ich keines Bischofs Weib mehr, und mein Kind ist eine Waise und sein Name Burkard ein Schandname für ihn. O wehe über die Welt! Zu wem soll ich rufen um Hülfe?
O ich möchte sagen: es ist umsonst, Gott zum Freunde zu haben, wenn die Menschen uns nicht Freunde sind; denn im menschlichen Geschlechte wie begraben leben wir, und regt sich in menschlichen Herzen um uns nicht der Gott, der allgegenwärtige Gott, der doch in ihnen lebet, und in ihnen gleichsam ermordet wird, so hört uns der blaue unendliche Himmel nicht, und die Sterne des Nachts und die Sonne am Tage, nicht Wind und Wärme und Frühlingsblühen und Säuseln!
Wir sind verloren, wir Menschen sind ohne Menschenhülfe verloren. Doch wo wahre Menschen leben, da ist auch Gottes- und Menschenhülfe; Gotteshülfe durch Menschenhand, Gottesweisheit durch Menschensinn! Und bin ich hülflos, sind es Tausende mit mir, so sind diese Gestalten hier keine Menschen! von Gott verlassene Menschen! Nichtswürdige, die Gott richten wird, Elendere, als ich und Alle, die durch sie in die Erde getreten werden — aber dennoch bin ich elend, und nur an einem Orte, wo ich nicht mehr bin, da kann ich sein, nur im Grabe, nur in der Erde, die alle die Unglückseligen verbirgt, seit langer, langer Zeit, und ach, gewiß noch lange, lange!
Aber auch diesen Schmerz verbirgt sie mit mir in ihrem Schooß. Nur meinen holden lieben Knaben kann ich nicht lassen! Er muß sich mit mir in die Erde retten, aber in meinen Armen. O Weib, rief sie begeistert, siehe, wie er mich anblickt! O Mutter, siehe, wie er mich anblickt! O Mutter siehe, wie er vor mir stehend mit seinen kleinen Armen mich umhalset, wie er mich drückt, daß ihm die Locken schüttern und daß er ganz roth wird bis an die Stirn! O, die Liebe im Elend scheint ein Trost, aber sie ist nur herzzerreißende Qual!“
„So höre ich Euch gern, armes Weib, liebe Frau Bischöfin!“ sagte ihr Livia. „Gern, meine ich, weil Ihr Euch doch das Herz erleichtert. Schmäht; klagt an; zürnt; brütet Rache; nur schweigt nicht, verschweigt nicht unmenschlich, was Euch zu Boden drückt, Ihr habt geklagt, und Ihr kommt mir wieder menschlich vor, als ein Weib. Und hört, hört wohl: Nicht alle Menschen sind dem Unglücklichen gottlos, erbarmungslos; nein, es giebt auch gottvolle, gottweise, gottthätige, gottkräftige Menschen, die für die Elenden fühlen, denken, entschließen, handeln.
Wahrlich, säßen wir hier so allein, ohne die Tausende gleich Unglücklicher umher, aber auch ohne die Millionen vernünftiger und kraftvoller Männer, deren Herzen für sie bereit schlagen. dann, dann wollt' ich mit Euch verzweifeln! Aber gebt Euch nicht auf! Wer hofft, sagt mein Cenci, der hat noch Kern, Leben, Geist, Vernunft und Kraft, der fühlt sie über sich, um sich, in sich; der Gute muß hoffen und kann es allein; wer ohne Hoffnung lebt, und wär's in der Hölle, den muß ich verachten! An dem ist kein gutes Haar, in dem fließt kein guter Tropfen Blutes mehr! Den hat der Teufel besiegt, der ist des Teufels! so sagt er.“
Irmengard sahe Livia groß an. Dann aber schüttelte sie ihre blonden Locken und sprach: „Hört und sagt, wer mir noch hilft aus Noth und Schande, oder blos aus der Schande — denn die Schande ist die größte Noth — und mir hilft, so lange ich noch lebe. Im Tode wird freilich uns Allen ein Anderer helfen, das weiß ich, darum eben will ich ja weg von dieser wahnsinnig gemachten Erde! weg aus dem verrathenen, gepeinigten Vaterlande! Ich habe es wollen verschweigen; aber Ihr seid ein Weib, so mögt Ihr es hören.“
Sie hielt einige Zeit inne, wie um Athem oder Muth zu schöpfen, dann blickte sie starr zur Erde und erzählte der Freundin: „Gestern morgen zog ich mich sauber an, ja ich putzte den kleinen Knaben, denn ich hoffte vielleicht doch endlich meinen Mann wo zu sehen; hoffte, daß er uns doch vielleicht aus seinem Kerkerfenster sähe; und als ich leise fortgeschlichen, bat ich den armen kleinen Otto, ja mit scharfen Augen recht aufmerksam in alle solche kleine Maueröffnungen zu sehen, in welchen eiserne Gitter wären; nicht in die hellen Scheiben der großen belebten Paläste! So führte ich ihn an der Hand, ich kaufte ihm unterwegs einige Orangen und geröstete Kastanien in sein Täschchen. So gingen wir, die belebten Straßen vermeidend, und kamen vor den Palast am Lateran, nicht weit von hier.
Der Kleine hatte, nach allen Fenstern sehend, das Köpfchen in die Höhe getragen, und war mir, an der Hand gehalten, dennoch gefallen. Es hatte geregnet. Er war naß. Ich trat in eine Thür des Lateranischen Palastes, und wischte ihm sein rechtes Händchen ab, sein rechtes Knie und die rechte Seite trocken. Da umringen uns nach und nach eine Menge lustige, freundliche, wohlgekleidete Weiber. Denn es waren Weiber, es waren junge, mitunter schöne Mütter, mit allerliebsten kleinen Kindern auf dem Arm, oder an der Hand; ja mehrere hatten das Kleinste auf dem Arm, oder säugend an der wenig verhüllten Brust, und das Größere an der Hand, oder es hielt sich doch an die Kleider der Mutter an. Sie aßen allerhand Gebackenes, wie es die Nonnen sehr schmackhaft in den Klöstern zu bereiten verstehen, und aus langer Weile oder zum Vergnügen für sich und Andere täglich frisch backen. Sie hatten die Taschen voll und fütterten damit die Kinder so ergötzlich. Ich sehe sie sehnsuchtsvoll und bewundernd, ihres Glückes und ihrer Freude wegen, an.
Da drängten sie sich gleichsam, auch meinem Knäbchen zu geben, das alle Taschen, alle Winkel an sich voll steckte; ja die Eine hing ihm ein ganzes, volles, sauber genähtes Kindertäschchen um und freute sich herzlich an ihm. Sie liebkoseten den kleinen goldlockigen Fremden; sie fühlten sein weiches Haar mit zwei es reibenden Fingern, sie kniffen ihm zart in die Rosenwangen, sie knieten vor ihm, bewunderten die himmlisch blauen Augen, sie mußten es küssen! Sie hoben es empor, sie gaben es sich von Arm zu Arm; sie hießen es einen Engel, einen schönen kleinen Johannes, nur ohne sein kleines Kreuz; sie versicherten, schöner kann der aus den Windeln entlaufene Bambino der heiligsten Jungfrau Maria nicht gewesen sein; und wo noch so! Sie frugen nicht erst, ob ich die Mutter sei, sie priesen mich glücklich, unaussprechlich glücklich.
O, wie that mir das so wohl! Wie liebkosete ich endlich selber wieder einmal mein armes Kind. Aber ich weinte dazu! Ihre Augen frugen mich, sie begriffen nicht, wie Ich weinen konnte, und frugen so lieb, wer ich sei?
Da mußte ich ihnen sagen: Ich bin eines Bischofs Weib, ein in Schmach gestoßenes Bischofsweib aus Deutschland … Mir versagte die Sprache.
Und darüber weinst Du? Du Liebe! frugen sie erstaunt. Und Eine setzte dann hinzu: Hat Dich denn Dein Mann verstoßen?
O, der nicht! rief ich, die Hand erhebend. Da lachten sie alle wie im Chore.
Still da, Ihr Lachtauben! fuhr die eine, schlanke Frau wieder fort, trat mir näher und sprach: Arme Seele, so siehe einmal mit deinen klaren Augen hier alle die Lachtauben an! Siehe sie recht an! und nun höre: Ich, und sie Alle, die hier stehen, und noch mehr als zweihundert in diesem geräumigen Hause, wir Alle sind Bischofsweiber! Decanenweiber! Priesterweiber! welchen der heilige Vater vergönnt, hier im Hause die Weiber unsrer Männer zu sein, damit gleichsam der Scandal — denn ihn ärgert das, oder vielmehr auch seine geistige Frau Gräfin Mathilde ärgert das — damit es nicht in der ganzen Gegend, oder in den vielen Kirchspielen von Rom getrieben werde, sondern gleichsam hierher gebannt, nur an einem Orte sei; aber hier ist es gewiß kein Scandal, sondern dieselbe alte Liebe! das lustigste Leben, wie Du siehst!