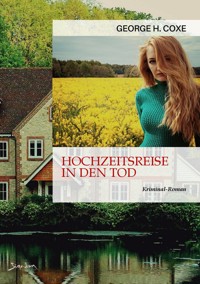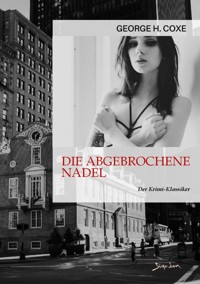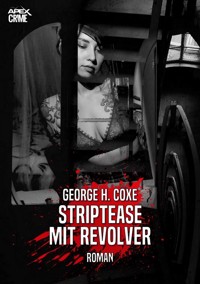5,99 €
Mehr erfahren.
Privatdetektiv Jack Fenner arbeitet für zwei Klienten: Der eine ist Ben Clayton, Direktor im Haskell-Konzern, die andere ist Nancy Moore, Erbin der Haskell-Millionen. Beide fühlen sich von Mark Haskell, Nancys Halbbruder, bedroht.
Doch dann wird Mark Haskell ermordet...
Der Roman Ein Zeuge schweigt von George H. Coxe (* 23. April 1901 in Olean/New York; † 31. Januar 1984 in Old Lyme/Connecticut) erschien erstmals im Jahr 1956; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1972.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
GEORGE H. COXE
Ein Zeuge schweigt
Roman
Apex Crime, Band 98
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
EIN ZEUGE SCHWEIGT
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
Privatdetektiv Jack Fenner arbeitet für zwei Klienten: Der eine ist Ben Clayton, Direktor im Haskell-Konzern, die andere ist Nancy Moore, Erbin der Haskell-Millionen. Beide fühlen sich von Mark Haskell, Nancys Halbbruder, bedroht.
Doch dann wird Mark Haskell ermordet...
Der Roman Ein Zeuge schweigt von George H. Coxe (* 23. April 1901 in Olean/New York; † 31. Januar 1984 in Old Lyme/Connecticut) erschien erstmals im Jahr 1956; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1972.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
EIN ZEUGE SCHWEIGT
Erstes Kapitel
Die Büros der Anwaltskanzlei Esterbrook & Warren nahmen den sechsten Stock eines der älteren und weniger imposanten Gebäude in der State Street ein. Man hatte noch nicht auf Selbstbedienungslifts umgestellt, und der Aufzugführer, der Jack Fenner an jenem Dienstagmorgen im späten Frühling in den sechsten Stock hinaufbeförderte, war wahrscheinlich älter als das Haus.
Das Wartezimmer, das man direkt vom Aufzug aus betrat, hätte einem Fernsehregisseur oder Bühnenbildner niemals als repräsentative Kulisse für eine traditionsreiche und angesehene Anwaltskanzlei genügt. Es war knapp dreißig Quadratmeter groß, mit holzgetäfelten Wänden und vier Beistelltischen, die echte Antiquitäten waren. Doch der Teppich, mit dem der Raum ausgelegt war, begann schon fadenscheinig zu werden, die beiden einander gegenüberstehenden Polsterbänke waren mehr zweckvoll als bequem.
Unmittelbar rechts neben der Tür befand sich ein Käfig aus Glas und Holz mit einem Schalterfenster. Dahinter saß eine rundliche, brünette Dame ungewissen Alters, die, obwohl nicht sonderlich attraktiv, doch ausgesprochen tüchtig wirkte. Sie nickte, als Fenner ihr den Grund seines Besuchs mitteilte, stöpselte ein, sprach kurz.
»Mr. Tyler kommt sofort«, verkündete sie dann.
Fenner dankte ihr. Er war ein wenig verwundert. Bisher war es immer so gewesen, dass man ihn, wenn er bestellt gewesen war, direkt in das Büro Tylers, eines der Juniorpartner, geführt hatte; offenbar sollte diese Besprechung jedoch im Wartezimmer stattfinden, und er fragte sich, weshalb.
Er brauchte nicht lange zu warten. Tyler begrüßte ihn mit einem freundschaftlichen »Tag, Jack« und schüttelte ihm die Hand. Er war ein Mann Mitte Dreißig, immer wie aus dem Ei gepellt, mit kurzem braunem Haar, dunkelgeränderter Brille und gesundem, sportlichem Aussehen.
»Setzen wir uns da drüben hin.« Er wies auf eine der Polsterbänke, machte es sich so bequem wie möglich und schien dann Schwierigkeiten zu haben, die rechte Einleitung zu finden. Er bekannte das schließlich auch. »Ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll und werde wohl hin und wieder vom Kernpunkt abschweifen müssen. Haben Sie also bitte Geduld. Ich habe zwei Mandanten, mit denen ich Sie bekannt machen möchte. Beide mögliche Auftraggeber, falls die Sache Sie interessiert. Der eine sitzt in meinem Büro...« Er machte eine Pause und sah auf seine Uhr. »...der andere wird etwas später kommen. Beide Aufträge stehen miteinander in Verbindung.«
Fenner nickte, die dunklen, grünen Augen aufmerksam und interessiert auf Tyler gerichtet.
»Sie haben schon von der Firma Haskell und Co. gehört?«
»Hat sie nicht südlich von hier ein Werk?«
»In Weymouth.«
»Sie stellt Messgeräte her, nicht wahr?«
»Unter anderem. Sie haben vielleicht auch im Wall Street Journal gelesen, dass Allied General Industries beabsichtigt, die Firma zu übernehmen. Das heißt, wenn die Teilhaber auf einer Sondersitzung am Montag sich dafür entscheiden. Es geht bei der Transaktion nicht um Geld, vielmehr handelt es sich im Grund nur um einen Austausch von Anteilen. So wie die Dinge jetzt liegen, dürfte es einem Teilhaber der Firma Haskell, der seine Anteile verkaufen will, nicht ganz leichtfallen, sie loszuwerden. Die Firma ist nicht an der Börse zugelassen. Wenn aber Allied General das Unternehmen übernimmt, erfolgt die Börsenzulassung automatisch, und die Anteile können ohne Schwierigkeiten gehandelt werden. Das nun betrachtet unsere Kanzlei als großen Vorteil.«
Er hatte Fenner aufmerksam beobachtet und lächelte.
»Abschweifung Nummer eins. Kennen Sie Mark Haskell?«
»Ganz flüchtig, aber ich habe ihn schon in Aktion gesehen. Ein Mann, der, wenn er etwas getrunken hat, beim geringsten Anlass zuschlägt und dann hofft, dass Freunde oder der Wirt eingreifen, bevor der andere eine Chance hat, sich zu revanchieren. Ein paarmal wurde, glaube ich, sogar Anzeige gegen ihn erstattet.«
»Richtig. Und kennen Sie auch Ben Clayton?«
»Nur vom Sehen. Wenn ich mich recht erinnere, war er früher mit Haskells jetziger Frau verheiratet.«
»Ebenfalls richtig.« Wieder das Lächeln. »Abschweifung Nummer zwei. Wissen Sie etwas über die seit langem verschwundene Tochter des alten Haskell? Nein? Das dachte ich mir. Also, es ist so. Mark ist das einzige Kind des Alten aus erster Ehe. Später heiratete der alte Haskell noch einmal, und aus dieser Ehe ging eine Tochter hervor. Sie wissen vielleicht, dass der alte Mann in dem Ruf stand, ein Griesgram und Geizhals zu sein. Die zweite Ehe jedenfalls hielt sechs oder sieben Jahre, dann verschwand die Frau eines Nachts spurlos mit ihrer Tochter.
Der alte Knabe, stolz und hochmütig wie er war, machte niemals auch nur die geringste Anstrengung, sie zu finden, unternahm aber auch nichts, um eine Scheidung herbeizuführen. Erst als er unheilbar krank im Krankenhaus lag, erinnerte er sich plötzlich seiner Tochter. Vielleicht plagte ihn sein Gewissen, vielleicht empfand er Reue, auf jeden Fall fügte er seinem Testament eine Zusatzklausel an, die besagte, dass seine Tochter, wenn es gelingen sollte, sie innerhalb von neunzig Tagen nach seinem Tod zu finden, als gesetzliche Erbin anerkannt werden sollte und ihr vierundzwanzig Prozent der Firmenanteile zufallen sollten. Das ist der gleiche Prozentsatz, den sein Sohn Mark erbte.
Wir fanden mit Hilfe einer internationalen Detektei die Tochter in Beverly Hills, wo sie als Maniküre in einem Herrensalon arbeitete.«
»Und an ihrer Identität besteht kein Zweifel?«
»Nicht der geringste. Sie sitzt jetzt in meinem Büro. Ihre Mutter hat wieder geheiratet, und sie hat den Namen ihres Stiefvaters angenommen. Nancy Moore. Ich halte es für das Beste, wenn sie Ihnen selbst alle Auskünfte gibt, die Sie brauchen. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass sie die Tochter ist.«
»Ich weiß immer noch nicht, worum es nun eigentlich geht«, bemerkte Fenner. »Sie sagten, es bestünde da ein Zusammenhang. Zwischen dieser Nancy Moore und Haskell?«
»Nein. Nancy Moore und Ben Clayton. Er wird um elf hier sein, aber er kann warten, bis Sie mit Miss Moore gesprochen haben.«
»Warum brauchen mich die beiden?«
»Sie sind beide bedroht worden.«
»Von wem denn?«
»Mark Haskell.«
Fenner wartete. Seine Augen verengten sich, während er überlegte. Er kramte seine Zigaretten heraus, bot Tyler eine an, und als dieser ablehnte, steckte er sich selbst eine an.
»Hat der Mann denn plötzlich den Verstand verloren?«, fragte er schließlich.
»Es sieht beinahe so aus - wenn das, was man mir erzählt hat, der Wahrheit entspricht.«
»Okay. Aber ehe wir auf Einzelheiten zu sprechen kommen, warum bedroht er die beiden?«
»Haskell ist gegen die Fusion mit Allied General. Er will sie verhindern.«
»Warum?«
»Weil es ihm dank des großen Einflusses seines Vaters, der nicht mehr lange zu leben hatte, gelungen ist, als Präsident der Firma Haskell und Co. für sich ein Jahresgehalt von hundertfünfundzwanzigtausend Dollar herauszuschinden. Lieber Himmel, Jack, das ist mehr, als die Präsidenten ungleich größerer Unternehmen im Allgemeinen verdienen. Ben Clayton, der Vizepräsident ist und die ganze Arbeit macht, bekommt fünfundvierzigtausend. Selbst fünfzigtausend wären zu viel für Haskell.«
»Und?«
»Ganz einfach. Wenn die Fusion zustande kommt, dann sitzt er an der Luft. Sicher, seine Anteile bleiben ihm, aber die Stellung ist er los. Auf Ben ist er ganz schlecht zu sprechen, weil Ben die Fusionsgespräche in Gang brachte, obwohl er selbst nur fünf Prozent der Anteile besitzt. Wenn Haskell die Anteile seiner Stiefschwester an sich bringen kann oder von ihr die Vollmacht bekommt, in ihrem Namen zu stimmen, dann kann er die Übernahme verhindern. Wenn er zudem die zehn Prozent seiner Frau erhält, dann könnte er einige der Gesellschafter mit kleineren Anteilen unter Druck setzen.«
Er machte Pause, holte Atem und zuckte die Achseln.
»Ich hatte gar nicht vor, so sehr ins Detail zu gehen, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Dann wissen Sie wenigstens über den Stand der Dinge Bescheid, wenn Sie mit Clayton sprechen. Die Verteilung der Anteile sieht folgendermaßen aus: Mark gehören vierundzwanzig Prozent. Nancy Moore gehören ebenfalls vierundzwanzig Prozent, macht zusammen achtundvierzig Prozent für die beiden Kinder. Weitere zehn Prozent hinterließ der alte Haskell Marion Haskell, die er sehr gern hatte. Er war überzeugt, dass sie mit der Zeit einen zuverlässigen und vernünftigen Menschen aus Mark machen würde. Ben Clayton und drei andere leitende Angestellte, die bereits im Ruhestand sind, erhielten je fünf Prozent.«
»Zusammen achtundsiebzig Prozent bis jetzt«, stellte Fenner fest.
»Richtig. Weitere zwölf Prozent hat der alte Mann an verschiedene Angestellte verteilt, die er besonders schätzte. Hier ein Prozent, da zwei Prozent.«
»Neunzig Prozent.«
»Wir, unsere Kanzlei, verwalten treuhänderisch die letzten zehn Prozent und haben auch das Stimmrecht dafür. Sie sind für mögliche Enkel gedacht. Wir sind für die Fusion, da das Wachstum der Firma Haskell erheblich nachgelassen hat und wir von der gegenwärtigen Geschäftsleitung nicht sonderlich beeindruckt sind. Wir würden die Anteile an der Allied General abstoßen und für den Trust einen Wertpapierbestand mit breiterer Streuung anlegen.«
Fenner drückte seine Zigarette aus.
»Okay. Nancy Moore ist also nicht bereit, mit Mark Haskell gegen die Fusion zu stimmen, und er hat ihr daraufhin gedroht.«
»Zuerst stellte sie eines Abends fest, dass die Reifen ihres Wagens aufgeschlitzt waren. Natürlich, derartiges kommt alle Tage vor. Dann wurde sie überfallen.«
»Auch das kommt alle Tage vor.«
»Ja, nur wurde ihr nichts geraubt. Sie wurde von zwei Männern, die sie von hinten ansprangen, zu Boden gerissen und ziemlich unsanft behandelt. Einer der Kerle sagte, das wäre nur eine Kostprobe, das nächste Mal würde sie nicht so glimpflich davonkommen. Und gestern Morgen wurde dann ihr Wagen auf der Bundesstraße achtundzwanzig von der Fahrbahn gedrängt. Es war reines Glück, dass sie nicht einen schweren, vielleicht sogar tödlichen Unfall erlitt. Doch diesmal hatte sie einen Zeugen. Ihr Freund saß bei ihr im Wagen, er saß selbst am Steuer. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Fahrer des anderen Wagens vorsätzlich handelte.«
Fenner nickte zerstreut. »Ich habe den Eindruck, Sie suchen einen Leibwächter für Miss Moore.«
»Ständiger Begleiter wäre ein besseres Wort. Ich dachte mir, Sie wüssten vielleicht eine umgängliche junge Frau, die bereit wäre, von morgens bis abends mit Miss Moore zusammenzubleiben.«
»Da weiß ich mehrere. Aber wie steht es denn mit dem Freund? Warum kann der sie nicht beschützen?«
»Das möchte Miss Moore nicht. Offenbar ist er ein aufbrausender junger Mann, und sie hat Angst, er könnte eine Dummheit machen. Als sie nach dem Unfall wieder in Boston waren, machte er sich sofort auf die Suche nach Haskell. Er entdeckte ihn schließlich in der Bar des University-Club und knöpfte ihn sich vor. Noch eine Drohung, erklärte er Haskell, und wenn auch nur per Telefon, und er würde dafür sorgen, dass Haskell die Lust daran für immer verginge. Haskell ließ die Tirade über sich ergehen, bis der junge Mann sich umdrehte, dann schlug er ihn nieder. Wie gewöhnlich griffen die anderen ein, und der Junge sagte, wenn Haskell ihm noch einmal unter die Augen träte, dann sollte er lieber eine kugelsichere Weste tragen.«
Fenner zog sein ledergebundenes Notizbuch heraus und seinen Drehbleistift.
»Wer ist der junge Mann? Ist er von hier?«
»Nein, aus Kalifornien. Schauspieler, in erster Linie Fernsehen. Ich glaube, ich habe ihn ein- oder zweimal gesehen. Er ist, wenn ich recht unterrichtet bin, viel beschäftigt, im Moment jedoch frei und kam deshalb mit Miss Moore hierher.«
»Name?«
»Barry Wilbur. Er wohnt im Adams House.«
»Schön«, meinte Fenner, nachdem er sich das notiert hatte, »ich werde mich mit ihr unterhalten. Und was ist nun mit Ben Clayton? Der ist doch auch bedroht worden, nicht wahr?«
»Nur telefonisch, anonym, aber er erkannte die Stimme. Einmal hörte Miss Moore einen solchen Anruf mit, als sie gerade bei Clayton zu Besuch war.«
»Auch wegen der geplanten Fusion?«
»Nur zum Teil. Da spielt noch eine persönliche Sache mit. Marion Haskell war früher mit Clayton verheiratet. Clayton behauptet, Haskell sei schuld an der Scheidung - er kann Ihnen Einzelheiten erzählen -, und sie hätte Haskell nur aus einer Trotzreaktion heraus geheiratet. Kurz und gut, seit diese Fusionspläne im Gange sind, hat er sie draußen in seinem Haus in Dedham praktisch wie eine Gefangene gehalten. Irgendwie ist es Clayton dann gelungen, sie da herauszuholen. Haskell weiß es, kann sie aber nicht finden. Er hat Clayton damit gedroht, dass er ihn umbringen wolle, dabei sind Haskell und Clayton seit ihrer Schulzeit befreundet.«
Fenner seufzte hörbar und schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nicht recht, George. Als Leibwächter eigne ich mich nicht.«
»Das habe ich Clayton schon gesagt.«
»Wenn Haskell wirklich so außer sich ist, momentan vielleicht gar nicht bei Vernunft, dann brauchte man eine ganze Armee, um Clayton zu beschützen, und selbst dann wäre nicht garantiert...«
»Natürlich, sagen Sie das Clayton ruhig. Aber er hat einen Vorschlag, den Sie sich meiner Meinung nach anhören sollten. Sind Sie dazu bereit?«
»Natürlich.« Fenner stand auf. »Sie bezahlen mich ja für meine Zeit. Warum also nicht?«
Zweites Kapitel
Nancy Moore saß in dem Sessel gegenüber von Tylers Schreibtisch, die Beine übereinandergeschlagen, eine Zigarette zwischen den Fingern, den Blick zum Fenster hinaus gerichtet. Sie richtete sich auf, als die Tür sich öffnete, und maß Fenner mit einem langen, ruhigen Blick, als Tyler ihn vorstellte. Sie nickte, bot ihm jedoch nicht die Hand und wartete, die blauen Augen unverwandt auf ihn gerichtet, bis er Platz genommen hatte.
Als sie leicht den Kopf drehte, um Tyler anzusehen, der sich hinter seinem Schreibtisch niederließ, benutzte Fenner die Gelegenheit, sie zu mustern, um sich ein erstes Bild von ihr zu machen. Ende Zwanzig, dachte er, schlank, etwa eins sechzig groß, honigblondes Haar, in der Mitte gescheitelt, straff nach hinten gekämmt und hochgesteckt. Das Gesicht war schmal, beinahe knochig, mit einem spitzen Kinn und einem sinnlich wirkenden Mund. Sie war eine interessante Frau, apart, beinahe exotisch wirkend.
Nachdem Tyler ihnen Zeit zur gegenseitigen Musterung gelassen hatte, lehnte er sich in seinem Sessel zurück.
»Ich habe Mr. Fenner unterrichtet, Nancy, und er ist ebenfalls der Auffassung, dass es ratsam wäre, Sie nicht allein zu lassen. Er meint, er könne eine junge Frau finden, die bereit wäre, Ihnen für die Dauer Ihres Aufenthalts hier Gesellschaft zu leisten.«
Fenner wartete, bis sie ihn ansah.
»Was halten Sie davon?«
»Wovon?«
»Sind Sie bereit, eine ständige Begleiterin zu akzeptieren und gegebenenfalls auch Ratschläge von ihr anzunehmen?«
Ihr Achselzucken war ausdrucksvoll, ihre Erwiderung beiläufig und gleichgültig.
»Warum nicht? Ich bin noch nie gern allein gewesen, selbst wenn kein Verrückter wie Mark Haskell mir das Leben sauer macht. Ich esse nicht gern allein, ich gehe nicht gern allein ins Kino. Kann sie Rommé spielen?«
»Wenn nicht, dann können Sie es ihr ja beibringen«, versetzte Fenner trocken.
»Also gut. Es ist ja nur für fünf Tage.«
Fenner rückte seinen Sessel näher zum Schreibtisch und wies mit fragendem Blick auf das Telefon.
»Selbstverständlich«, sagte Tyler und schob ihm den Apparat zu.
Fenner wählte und wartete. Dann sagte er: »Ed? Können Sie mir für die nächsten fünf oder sechs Tage Kathy Kennedy ausleihen? - Können Sie nicht umdisponieren? Ich rufe für eine auswärtige Mandantin von Esterbrook und Warren an. - Nein, keine Detektivarbeit. Sie soll nur einer jungen Frau in ihrem Alter Gesellschaft leisten. - Okay, warten Sie einen Moment.« Er wandte sich Nancy Moore zu: »Können Sie sich zum Mittagessen mit ihr treffen?«
»Warum nicht?«
»Gut, Ed, zum Mittagessen. Sagen wir um eins.« Nachdem er den Namen eines kleinen, in der Nähe gelegenen Restaurants genannt hatte, legte er auf.
Gerade hatte er Tyler das Telefon wieder hingeschoben, da begann es zu summen. Tyler griff nach dem Hörer.
»Ja, natürlich. Bitten Sie ihn in Dave Johnsons Büro. Der ist doch verreist, nicht wahr? - Gut.« Er stand auf. »Ben Clayton«, bemerkte er. »Ich werde ihm Gesellschaft leisten, bis Sie soweit sind, Jack. Zwei Türen weiter.« Zu der jungen Frau sagte er: »Sie brauchen mich jetzt nicht mehr, Nancy. Ich denke, Jack wird Sie verschiedenes fragen wollen.« Er lächelte. »Seien Sie nett und beantworten Sie alle seine Fragen, ja?«
Nachdem Tyler gegangen war, ließ Fenner sich hinter dem Schreibtisch nieder und klappte sein Notizbuch auf. In den blauen Augen, die ihn anblickten, stand leichte Neugier.
»Das soll kein Kreuzverhör werden«, bemerkte er, »aber ich möchte gern einige Fragen klären. George hat mich über die Gründe Ihres Hierseins schon unterrichtet. Ich weiß von den aufgeschlitzten Autoreifen und dem Überfall auf der Straße. Sie hatten Ihre Handtasche bei sich? Und die beiden Männer haben sie Ihnen nicht entrissen, haben es nicht einmal versucht?«
»Nein, ich habe die beiden überhaupt nicht gesehen. Es war dunkel. Gar nicht weit von meinem Hotel. Dort ist eine niedrige Hecke, und ich vermute, dass sie mir da aufgelauert haben. Als sie mich ansprangen, wollte ich schreien, doch ich lag praktisch mit dem Gesicht auf dem Boden. Sie schlugen mich auf den Kopf und verpassten mir einen kräftigen Rippenstoß und ließen mich dann einfach liegen.«
»George erzählte mir, dass sie etwas zu Ihnen sagten. Können Sie sich an den Wortlaut erinnern?«
»Der eine sagte: Nur eine Kostprobe, Schwester. Nächstes Mal landest du im Krankenhaus, und der andere fügte hinzu: Wenn du nicht parierst.«
»Kann einer von ihnen Haskell gewesen sein?«
»Bestimmt nicht. Ich kenne seine Stimme.«
Fenner nickte. »Und die Geschichte gestern auf der Bundesstraße achtundzwanzig?«, fragte er.
»Wir waren in Dedham gewesen...«
»Sie und Ihr Freund?«
»Ja. Er heißt Barry Wilbur. Das hat Ihnen Mr. Tyler vielleicht schon gesagt. Er wohnt im Adams House«, fügte sie kühl hinzu, »falls Sie seine Version hören wollen.«
»Sie waren also in Dedham gewesen?«
»Ja, ich wollte das Haus sehen, in dem ich gelebt hatte, bis meine Mutter mit mir von hier wegging.«
Sie berichtete, was sich auf der Rückfahrt nach Boston zugetragen hatte. Der mit hoher Geschwindigkeit fahrende Wagen, der vor ihnen plötzlich scharf ausgeschert war; der Betonpfeiler der Überführung, auf den sie zurasten; das dichte Gestrüpp aus niedrigem Buschwerk und Geißblatt, das die Wucht des Aufpralls gedämpft hatte wie ein Polster.
Sie sah ihm direkt ins Gesicht während sie sprach, doch ihr Blick schien in die Ferne zu gehen, und Fenner lauschte auf Nuancen und Untertöne, wie er das seit Jahren gewohnt war. Hier, fand er, war nichts Unechtes. Es hatte sich so zugetragen, ihrer Überzeugung nach zumindest, wie sie ihm berichtet hatte.
»Wir kamen mit einer verbogenen Stoßstange und eingedrücktem Kühlergrill davon«, schloss sie. »Nein«, kam sie sogleich seiner nächsten Frage zuvor, »wir können Ihnen weder eine Autonummer noch eine Beschreibung des Fahrers geben.
Das erklärten wir auch dem Polizeibeamten, der keine fünf Minuten nach dem Unfall auftauchte.
Barry hatte alle Hände voll damit zu tun, den Wagen einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Er hatte gar keine Zeit, auf das andere Fahrzeug zu achten. Und ich sah, ehe ich den Kopf einzog, nur einen dunklen Wagen, ziemlich neu, und einen Mann mit dunkler Brille und einem Hut am Steuer. Der Beamte ließ einen Abschleppwagen kommen, und wir riefen von der Werkstatt aus ein Taxi an.«
Sie lehnte sich zurück und griff nach einer Zigarette. Als Fenner ihr Feuer gab, dankte sie ihm, legte den linken Ellbogen auf die Rückenlehne ihres Sessels und betrachtete ihn mit Aufmerksamkeit.
Fenner begegnete offen und direkt ihrem Blick, aufs Neue beeindruckt von der Sachlichkeit ihres Tons und ihres Gebarens.
»Vom aufbrausenden Temperament Ihres Freundes habe ich schon gehört. Ich habe mir erzählen lassen, dass er sich sogleich auf die Suche nach Haskell machte und ihn auch fand.«
»Er war nach dem Unfall ganz außer sich. Man kann es ihm wohl kaum verübeln. Er sagte, er würde sich Haskell vorknöpfen und ihm einen Denkzettel geben, den dieser nicht so schnell vergessen würde. Während der ganzen Heimfahrt habe ich versucht, ihm Vernunft beizubringen. Und ich dachte, es wäre mir auch gelungen. Als er mich dann gestern Abend noch anrief, sagte er, er hätte Haskell nur gedroht, Haskell aber hätte zugeschlagen, als er sich zum Gehen wandte. Er hat eine Pistole«, fügte sie in gleichgültigem Tonfall hinzu, »und er hat mir auch eine besorgt.«
Sie beugte sich vor und griff nach ihrer Handtasche, die auf dem Schreibtisch stand. Sie klappte sie kurz auf, so dass Fenner flüchtig die kleine Waffe sehen konnte. Dann stellte sie die Tasche wieder weg. Er konnte das Modell nicht erkennen, doch es handelte sich wahrscheinlich um ein ausländisches Fabrikat, Kaliber 22 oder 25.
Diese unerwartete Enthüllung machte ihm zu schaffen, und er sagte das offen.
»Haben Sie einen Waffenschein für die Pistole?«
»Nein.«
»Da könnten Sie aber Scherereien bekommen.«
»Lieber Scherereien, als diesem Menschen wehrlos ausgeliefert sein«, versetzte sie mit Entschiedenheit. »Ich habe Barry versprochen, dass ich ohne die Pistole nicht ausgehen werde. Gleichzeitig habe ich ihm gesagt, dass ich ihn bis zur Aufsichtsratssitzung nicht mehr sehen wolle. Er erklärte, er würde trotzdem in meiner Nähe bleiben, und ich könnte ihn daran nicht hindern, wenn ich mir nicht eine ständige Begleiterin zulegte. Ich versprach ihm, dass ich das tun würde, und deshalb wandte ich mich an Mr. Tyler.«
»Wilbur ist Schauspieler?«
»Ja, und ein guter.«
»Wie lange kennen Sie ihn schon?«
»Ungefähr drei Monate.«
»Er kam eines Tages in Ihren Laden und verlangte eine Maniküre.«
Zum ersten Mal entspannte sich das schmale Gesicht. Das leichte Lachen war sympathisch.