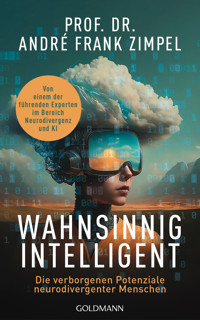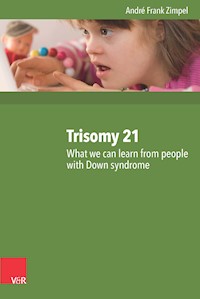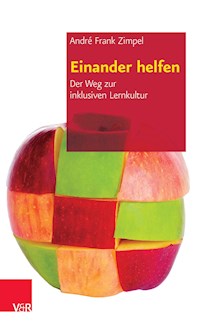
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wer viel hat, dem wird gegeben; wer wenig hat, dem wird genommen. Diese Faustformel, auch Matthäus-Effekt genannt, untergräbt die Demokratie und droht unsere Gesellschaft zu spalten.Sinnvolle Maßnahmen zielen deshalb immer auf Normalisierung: Stärkere helfen Schwächeren.Dasselbe sollte natürlich auch für unser Bildungssystem gelten. Chancengleichheit allein genügt nicht, weil sie viele Fragen offen lässt, wie zum Beispiel: Wie stärkt man möglichst alle Lernenden im gemeinsamen Unterricht? Wie pluralisiert man die Lernwege so, dass niemand auf der Strecke bleibt? Wie vermeidet man bei möglichst allen Lernenden schwächende Frustrationserlebnisse, die als Aversionen die weitere Lernbiografie beeinträchtigen könnten?Diesen Fragen geht das Buch nach und klärt sie in drei Schritten. Die Teilfragen lauten:• Welche Faktoren stärken und welche Faktoren schwächen das Lernen nach dem aktuellen Stand der Hirnforschung?• Welche Bedeutung haben die typisch menschlichen Fähigkeiten, Hilfe anzunehmen und zu helfen, für die geistige Entwicklung von Kindern?• Wie kann gemeinsames Lernen in (integrativen / inklusiven) Schulen so gelingen, dass alle davon profitieren?Für diesen Titel ist eine Schullizenz erhältlich!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André Frank Zimpel
Einander helfen
Der Weg zur inklusiven Lernkultur
Vandenhoeck & Ruprecht
2., erweiterte Auflage
Mit 27 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99655-4
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter www.v-r.de
Umschlagabbildung: dibrova/shutterstock.com
© 2014, 2012, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen /
Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.
www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Umschlag: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Vorwort zur zweiten Auflage
Einleitung
1 Teil I: Anthropologische Wurzeln des Lernens
Hilfsbereitschaft und Inklusion
Ich helfe, also bin ich
Inklusion in der Bronzezeit
Zum Helfen geboren
Kulturspezifische Einflüsse
Helfen und Unterrichten
Hilfe zur Selbsthilfe
Zone der nächsten Entwicklung
Hilfen erkennen und nutzen
Unterricht als Entwicklungshilfe
Lernen durch Nachahmung
Der kleine Unterschied
Imitationslernen
Der unbewusste Drang zur Nachahmung
Sozialorgan Gehirn
Lernen durch Nachbildung
Emulationslernen
Autismus und Sozialkompetenz
Fragile Potenziale
Ein Sonderschüler als Gelehrter
Emulationslernen als Entlastung
Zusammenfassung Teil I
2 Teil II: Lernkultur und Hyperzyklus
Eine Schule für alle
Hamburger Volksentscheid
Leistungsdruck
Soziale Brennpunkte
Chancengleichheit
Der Matthäuseffekt
Die Taufliege der Begabungsforschung
Der Normalisierungseffekt
Helfen kann glücklich machen
Der Hyperzyklus
Die Ökonomie des Teilens
Die Pluralität des Lernens
Teilen
Das faire Stirnhirn
Das sich entwickelnde Stirnhirn
Mitteilen
Lernkultur
Das werden Berufsverbrecher
Vertrauen
Das Wie bestimmt das Was
Baustelle Stirnhirn und wilde Zeiten
Zusammenfassung Teil II
3 Teil III: Beim Helfen lernen – beim Lernen helfen
Lernschwierigkeiten
Auf Hilfe angewiesen
Gut gemeinte Hilfe
Die didaktische Schleife
Aufmerksamkeitsforschung und Trisomie 21
Anschaulichkeit und Abstraktion
Mehr Raum für Soziales
Schulalltag und Hirnforschung
Kompetenzraster und Gegenstandsanalysen
Nachwort
Literaturverzeichnis
Vorwort zur zweiten Auflage
Es ist wichtig, dass Lehrpersonen das Lernen durch die Brille der Schülerinnen und Schüler sehen, um Überzeugungen und Wissen zum Ziel der Lehrsequenz aufzubauen. All das ist niemals linear und nicht immer einfach. (John Hattie)1
Timo, ein Jugendlicher mit freier Trisomie 21 (Down-Syndrom), ist begeisterter Schwimmer. 2011 legte er in Hamburg erfolgreich die praktischen und theoretischen Rettungsschwimmprüfungen ab.2 Hat er mehr geleistet als andere Prüflinge? Ich meine ja!
Erwiesen ist, dass eine Trisomie 21 mit verminderter Muskelspannung einhergeht. Damit aber nicht genug:
Im Hamburger Aufmerksamkeits-Computer-Laboratorium (ACL) führen wir derzeit eine Studie zur Verbesserung des Lernerfolgs für Menschen mit einer Trisomie 21 durch. Unser Ziel ist die Untersuchung von 1.000 Menschen mit diesem Syndrom im Vergleich zu 1.000 Menschen ohne Syndrom. Unsere Experimente belegen u. a., dass eine Trisomie 21 mit einer Einengung des Aufmerksamkeitsumfangs auf weniger als drei Objekte zur selben Zeit einhergeht.3
Für einen gelingenden Perspektivwechsel ist das eine entscheidende Information, denn daraus folgt: Der anschauungsgebundene, kleinschrittige und Abstraktionen vermeidende Unterricht an Förderschulen kann den neuropsychologischen Besonderheiten von Menschen mit einer Trisomie 21 kaum Rechnung tragen.
Eine erste experimentelle Bestätigung für die pädagogischpraktische Bedeutung dieses empirischen Ergebnisses liefert die Wissenschaftlerin Hefziba Lifshitz-Vahav in Tel Aviv. An der Bar Ilan Universität bereitet sie gegenwärtig 24 Personen mit der Diagnose »geistige Beeinträchtigung« auf ein Bachelorstudium in Erziehungswissenschaft vor. Ein Beispiel ist die 27-jährige Odelia Gabay mit freier Trisomie 21 (Downsyndrom), die wie die meisten im Programm glücklich darüber ist, weiterlernen zu können. An der Bar Ilan Universität steht im nächsten Jahr ein Computerkurs an. Danach sollen die Studierenden auch im Büro arbeiten können.4
Im persönlichen Austausch bestätigte mir Lifshitz-Vahav, dass die Anerkennung der Fähigkeit zur Abstraktion bei Menschen mit Trisomie 21 und die geglückte gegenseitige Perspektivübernahme entscheidend für das Gelingen dieses Projektes sind. Die Verbindung zwischen Menschen beruht geradezu auf der Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Wo könnten Menschen diese Fähigkeit besser entwickeln und üben als beim Einanderhelfen?
Bildung beeinflusst Gehirne nur indirekt. Dazwischen existiert ein vermittelndes Drittes, das in wissenschaftlichen Untersuchungen gern übersehen oder kleingeredet wird: das subjektive Erleben, die menschliche Innensicht. Unser Erleben ist der Kitt zwischen Kultur und Natur.
Zu Recht unterstellen wir allen Menschen eine individuelle Innensicht. Direkt erleben können wir jedoch nur unsere eigene Innenwelt. Insofern verbindet uns mit anderen Menschen etwas, das wir nur über kulturelle Umwege miteinander teilen können. Ohne Schrift, Bilder, Sprache, Mimik, Gestik und andere Zeichen wäre unsere Innenwelt ein einsamer Kerker.5
Im Inklusionsindex findet man unter den Indikatoren der Dimension A »Inklusive Kulturen schaffen« schon an zweiter Stelle (nach »Jede(r) fühlt sich willkommen«) den Indikator A. 1.2 »Die SchülerInnen helfen einander«.6 Dazu gehören elf Fragen. Die erste lautet: »Bitten sich die SchülerInnen gegenseitig um Hilfe und bieten sie Hilfe an, wenn sie gebraucht wird?«7
Erst als letzte Frage folgt: »Erhalten alle – also auch leistungsschwächere – SchülerInnen die Chance, anderen zu helfen?«8 Meiner Ansicht nach ist diese letzte Frage nicht eine unter vielen, sondern die zentrale Frage für das Gelingen von Inklusion.
Meine Argumentation in diesem Buch basiert unter anderem auf Kalkulationen des Mathematikers John Nash zur Spieltheorie, denen das Nash-Gleichgewicht9 zugrunde liegt und die zu Fehrs10 Experimenten zur Verhaltensökonomie führten. Ihre Bedeutung spiegelt sich eindrucksvoll in anthropologischen Experimenten von Tomasello zur geteilten Intentionalität11 und in der Entdeckung der Spiegelneuronen durch Rizolatti12 wider. Diese interdisziplinären Forschungsprojekte tragen wesentlich dazu bei, Emotionen wie das Gefühl für Fairness, Gemeinschaftssinn und Gegenseitigkeit als einen verlässlichen Eigenwert menschlicher Kulturen sichtbar zu machen.
Gibt es auch Meta-Studien, die den Effekt dieses Eigenwertes auf das Lernen in integrativen und inklusiven Schulen messen? Es seien zwei angeführt, die nur scheinbar zu gegensätzlichen Ergebnissen führen:
1. Die Studie von de Graaf, van Hove und Havemann13 zu internationalen Erfahrungen mit der Integration und Inklusion von 1970–2010. Exemplarisch wählten sie für diese Studie Schülerinnen und Schüler mit einer Trisomie 21 aus. Ergebnis: Heranwachsende mit Trisomie 21 werden von Gleichaltrigen in Regelklassen gut akzeptiert. Davon profitieren vor allem deren Lernfähigkeit und Sprachentwicklung.
2. Die Studie des neuseeländischen Pädagogen John Hattie (*1950), die 816 Metaanalysen von 52.649 Einzelstudien umfasst, an denen 83.033.433 Lernende beteiligt waren.14 Die stärksten Lerneffekte haben die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus und die kognitive Entwicklungsstufe nach Piaget. Der Lerneffekt inklusiver Beschulung rangiert dagegen weit hinten (knapp unter dem Effekt von Hausbesuchen durch Lehrpersonen und knapp über dem Effekt der Nutzung von Taschenrechnern).
Hattie selbst schreibt dazu: »Vollständige Inklusion bedeutet, dass Lernende mit besonderem Förderbedarf unter denselben Bedingungen (mit der angemessenen Unterstützung) wie andere Peers unterrichtet werden sollen. Dies, so die Befürworter, führt zu erhöhten Erwartungen durch die Lehrpersonen, mehr Interaktion unter den Lernenden, vermehrtem Lernen und einem höheren Selbstwertgefühl.«15
Werden diese Erwartungen erfüllt? Hattie zufolge ja – und zwar am stärksten für Lernende mit der Diagnose »geistige Beeinträchtigung«.16 Unter der Fragestellung »Wie bringt man alles zusammen?« kommt Hattie in seiner epochalen Studie zu einem Modell des sichtbaren Lehrens und Lernens, das vor allem auf Perspektivwechsel beruht: »Wenn Lehrer das Lernen durch die Augen ihrer Schüler SEHEN, wenn Lernende sich selbst als ihre eigenen Lehrpersonen SEHEN.«17
Die Ergebnisse beider Studien bestätigen:
1. Die geistige Entwicklung (einschließlich Sprach- und Lernfähigkeit) ist abhängig von der Lernkultur, deren Gewährleistung in Förderschulen an strukturelle Grenzen stößt.
2. Die Sozialbeziehungen in inklusiven Klassen bedürfen einer sensiblen pädagogischen Beobachtung und Gestaltung.
3. Sich selbst als hilfreich für andere erleben zu können ist genauso wichtig wie die Fähigkeit, Hilfe annehmen und finden zu können. Denn eine der ärgerlichsten Botschaften an sogenannte »I-Kinder« in Hamburger Inklusionsklassen ist: Du bist auf Hilfe angewiesen, aber für andere alles andere als hilfreich!
André Frank Zimpel
Hamburg, im Januar 2014
Einleitung
Einer hat immer Unrecht: aber mit zweien beginnt die Wahrheit. – Einer kann sich nicht beweisen: aber zweie kann man bereits nicht widerlegen. (Friedrich Nietzsche 1887)1
Das Thema Helfen ist überfrachtet mit moralischen Erwartungen. Nicht nur das Christentum – alle Religionen drehen sich um Erwartungen und Erwartungserwartungen: Wer sollte wem, wann, wie und warum helfen? Hilfserwartungen künden von Heldentaten und menschlichen Abgründen, lassen Menschen weit über sich selbst hinauswachsen und wecken in ihnen tiefe Schuldgefühle. Kurz: Helfen ist der Stoff für die ganz großen Dramen.
Niemals hätte ich mich an ein so großes Thema herangewagt, wenn es nicht überraschend neue experimentelle Befunde geben würde. Gemeint sind mathematische und experimentelle Überprüfungen von Spekulationen zur Kooperation. Schließlich ist die individuelle Nutzenmaximierung eine evolutionsbiologische Notwendigkeit. Wie passt das zur tatsächlichen Tendenz vieler Lebewesen, insbesondere des Menschen, zur Kooperation?
Spieltheoretische Kalkulationen zeigen, wann Kooperation zur individuellen Nutzenmaximierung beiträgt und wann nicht. Ausgeklügelte Experimente verschiedener Wissenschaftsdisziplinen, wie zum Beispiel der Verhaltensökonomie, der Anthropologie und der Hirnforschung, können auf dieser mathematischen Basis prüfen, wie weit die Erklärungskraft dieser Kalkulationen reicht. Wenn sie zutreffen, wäre die individuelle Nutzenmaximierung der einzige Grund, der Menschen zur Kooperation veranlasst. Wenn nicht, müsste es neben getarntem Egoismus noch andere Gründe zur Kooperation geben. Die Ergebnisse dieser transdisziplinären Forschung sind schwerwiegend, atemberaubend und folgenreich.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!