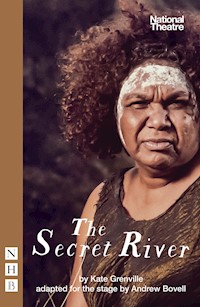Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Danksagung
Copyright
FÜR TOM UND FÜR ALICE IN LIEBE
»Ein Bogen besteht aus zwei Schwächen die gemeinsam eine Stärke bilden.«
LEONARDO DA VINCI
1
In den schlauen Einrichtungsmagazinen seiner Exfrau hatte Douglas Cheeseman gelesen, Matratzendrillich habe Pfiff. Douglas Cheeseman gelesen, Matratzendrillich habe Pfiff. Vorhänge aus Matratzendrillich, hatte Marjorie ihm erklärt, wirkten ähnlich pfiffig wie eine alte Singer mit Fußantrieb als Blumenständer für Frauenhaarfarn. Allerdings bezweifelte Dou- glas, dass es sich bis ins Caledonian Hotel von Karakarook, New South Wales, 1374 Einwohner, herumgesprochen hatte, wie viel Pfiff Vorhänge aus Matratzendrillich hatten. Als er den Stoff zurückschob, um aus dem Fenster zu schauen, spürte er den kalten, darin haftenden Staub.
Über das Wellblechdach des Nachbargebäudes hinweg konnte er fast ganz Karakarook überblicken. Das Städtchen sah aus, als wäre es einfach in den Talgrund entlang des Flusses hinabgerutscht und dort liegen geblieben. Hinter den letzten versprengten Häusern am Hang wölbten sich baumlose Viehkoppeln, und weiter oben verschwanden die Hügelkuppen unter dunklem Buschgelände. Über allem spannte sich ein blassblauer, von der Hitze gebleichter Himmel.
Vom Fenster aus war ein Teil der Parnassus Road zu sehen, die breit und leer wie eine Flugzeuglandebahn in der Nachmittagshitze brütete. Vor der Ladenzeile parkten ein paar Autos diagonal zum Bordstein, als stupsten Kaulquappen an einen Stein. Ein Hund lag leblos ausgestreckt vor dem Eingang eines leeren Ladens. Die Markisen über den Geschäften warfen gezackte schwarze Schattenfelder, und eine glühende Sonnenschei be brannte unbarmherzig vom Himmel herab.
Ein Pick-up kam in langsamem Tempo die Straße hochgefahren und rangierte an den Bordstein. Seine Farbe war vor lauter Staub nicht mehr zu erkennen. Ein Mann, über dessen gewaltigem rundem Bauch sich ein blaues Hemd spannte, stieg aus und verschwand unter den Ladenmarkisen gegenüber dem Caledonian. Douglas hörte, wie eine Tür quietschend aufgeschoben wurde und mit einem dumpfen Geräusch wieder zufiel. GENERAL STORE EST 1905 war auf der Fassade oberhalb der Markise zu lesen, die glänzende Markise jedoch trug den Schriftzug MINI-MART.
Douglas sah sich weiter um, doch nichts bewegte sich mehr. Er stand am Fenster, die Hand auf den Rahmen gestützt, und spürte die Hitze, die vom grauen Wellblechdach des Ladens unter ihm aufstieg.
Nachdem lange Zeit nichts passiert war, tauchte am Ende der Straße ganz klein ein altes braunes Auto auf, das langsam grö ßer wurde und zögernd am Bordstein vor dem General Store einscherte. Eine Frau stieg aus, stemmte die Hände in die Hüften und blickte die Straße hinauf und hinunter. Unbekümmert stand sie einfach nur da und schaute. Sie wirkte streng, gleichzeitig aber auch erfreut und interessiert, als wäre die Parnassus Road in Karakarook ein eigens zu ihrem Vergnügen ausgestelltes Diorama.
Sie war eine große, hagere, farblose Person, hoch gewachsen und eigentümlich, trug einen fransigen Haarschnitt und ein weißes T-Shirt, an dem sich die Schulternaht löste. Die besten Jahre hatte sie längst hinter sich, und dass sie jemals hübsch gewesen war, schien eher unwahrscheinlich. Breitbeinig wie ein Mann stand sie da. Ihre Brüste zeichneten sich unter dem alten T-Shirt ab, doch ihrer Haltung nach zu urteilen, hatte sie vergessen, dass Brüste sexy waren. Sie beulten das T-Shirt einfach auf die gleiche Art aus wie ihre Knie die schwarze Jogginghose.
Sie war schmucklos. Das T-Shirt hing ihr von den Schultern und schloss oben am Hals gerade ab. Kein Kragen, kein Schal, keine Perlen, keine Ohrringe. Ihr Kopf ragte einfach aus dem T-Shirt, als wollte er sagen: Hier bin ich.Was dagegen?
Douglas stand da, den Vorhang in der Hand, und beobachtete, wie die Frau auf die ungeschützt unter dem Himmel liegende Parnassus Road schaute. Ein Salz-der-Erde-Typ.
Salz der Erde. Das war eine von Marjories Formulierungen. Was sie damit meinte, war: schlecht gekleidet.
Aus der Körperhaltung der Frau, die mit den Händen in den Hüften dastand und über die Straße blickte, als gehörte sie ihr, konnte er auf ihr Leben schließen. Ein ordentliches Leben mit guter Bodenhaftung, einem großen, fröhlichen Ehemann, unkomplizierten Kindern und pummeligen rotbackigen Enkeln, die sie Nanna nannten. Er stellte sich die Küche einer Farm vor, die Arbeitsplatte, auf der das Radio dudelte, den großen Korb voller Eier, an denen noch Hühnerdreck klebte, und die Kühlschranktür mit Magnethaltern, auf denen Sätze wie Gott segne dieses Chaos standen.
Von irgendwo tauchte ein Hund auf und bellte die Frau an, worauf von einer der Markisen Tauben hochflogen und auseinanderstoben. Sie blickte auf das Tier hinab, und Douglas sah, wie sie missbilligend die Stirn runzelte.
Er ließ den Vorhang fallen und trat vom Fenster weg. Dann stand er im Dämmerlicht des Zimmers und fragte sich, warum er das getan hatte.
Ein Blick auf die Armbanduhr half ihm nicht weiter. Er setzte sich aufs Bett und zog seine Stiefel aus, überlegte es sich anders und zog sie wieder an. Gerne hätte er noch einmal aus dem Fenster geschaut, wollte sich dabei aber nicht erwischen lassen. Es war nur eine Art Hunger, doch man hätte es missverstehen können.
Douglas Cheeseman war kein Mann, nach dem man sich umschaute. Seine Augen hatten eine undefinierbare Farbe und standen zu dicht beisammen. Lippen und Wangen schienen aus dem gleichen Material zu sein, und seine große Nase war trotz der Kappen, die er ständig trug, von Sommersprossen übersät. Im Sommer war er auf jeder Baustelle an der Zinksalbe zu erkennen. Die Jüngeren lachten. Er wusste, dass sie lachten. Bei jedem Bauprojekt gab es ein paar junge Kerle, die nur eine Woche blieben, um ein bisschen Geld mitzunehmen, und dann weiterzogen. Sie machten sich lustig über den Ingenieur, der mit seinen zusammengerollten Bauplänen unter dem Arm ernst herumstand: Die Jungs mit den braun gebrannten Gesichtern warfen sich die Ziegelsteine zu und lachten über den ängstlichen Ingenieur mit seiner Zinksalbe.
Er war fünfundfünfzig, hätte aber genauso gut zehn Jahre jünger oder älter sein können. Dünnes, sandblondes Haar, Segelohren und ein großer, seltsam verzerrter Mund, in dem sich, wenn er lächelte, schief und dunkel die schlechten Zähne zeigten. Als Junge hatte er Hemmungen wegen seiner abstehenden Ohren gehabt und alles Mögliche gegen sie unternommen. Er hatte sich Lederlappen gebastelt und mit einem Gummiband am Kopf befestigt, um die Ohren im Schlaf enger an den Kopf zu drücken. Er hatte es mit kurzen Haaren versucht und mit langen. Alle möglichen Hüte ausprobiert. Und schließlich hatte er sich als Ablenkungsmanöver einen Schnurrbart wachsen lassen, bei dem er geblieben war.
Mittlerweile waren ihm seine Ohren egal. Er verschwendete keinen Gedanken mehr daran, ob er sie lieber kleiner, das Haar dichter und den Mund schöner gehabt hätte.
Douglas bemerkte jetzt, dass sich das Zimmer 8 auf der falschen Seite des Gebäudes befand, wo es die volle Nachmittagssonne abbekam und die Hitze noch dazu vom Dach des benachbarten Ladens reflektiert wurde. Der Linoleumboden und die klebrigen gelben Möbel glänzten, und es roch nach Bier und Staub. Das Bett unter der dunklen Chenille-Tagesdecke hing durch. Drei Fliegen kreisten lahm durch die heiße Luft der Zimmermitte.
Natürlich hätte er um ein anderes Zimmer bitten können, aber er wusste, dass er das nicht tun würde.
Trotz der Vorhänge aus Matratzendrillich hatte das Caledonian keinen Pfiff. Es war auch kein richtiges Hotel, sondern einfach nur ein Pub, eines von der altmodischen Sorte, die von schwärmerischen Stadtbewohnern gern authentisch genannt wurde. Unten auf der Tafel hatte er gelesen, dass es als Tagesmenü Corned Beef mit weißer Sauce & dreierlei Gemüse gab, gefolgt von einem Stück Biskuitrolle mit Vanillesauce. Das war authentisches Landessen, wie er es aus seiner Kindheit kannte. Hier draußen im Busch war es immer noch beliebt, aber Pfiff hatte es auch nicht gerade, was man schnell merkte, wenn man es tatsächlich essen musste.
Da er andere Caledonians in anderen Provinzstädten kannte, wusste er genau, wie das Bad am Ende des Flurs aussehen würde: Cremefarbene Fliesen, kaltes Neonlicht, grüne Flecken unter dem Wasserhahn, ein tröpfelnder Spülkasten und eine Dusche mit Wassersparkopf, unter dem man kaum nass wurde.
Gut, es herrschte eine Dürreperiode, doch eine anständige Dusche war bei dieser Hitze einfach eine Wohltat.
Sicher hätte ein anderer Mann das Beste aus seinem Aufenthalt im Caledonian gemacht. Ein anderer Mann wäre auf ein Bier runter in die Bar gegangen, in der es bestimmt kühler war. Er hätte die Zeitung gelesen, sich die Trabrennen im Fernsehen angeschaut und mit dem Mann, der an der Bar neben ihm stand, ein Gespräch darüber angefangen, wie das Land allmählich vor die Hunde ging.
Er wünschte sich, er wäre so ein Mann.
Langsam erhob er sich vom Bett. Das Gestell ächzte, und eine Sprungfeder schnappte, als wollte sie sich über ihn lustig machen.
Harley hatte ihn gesehen. Der Mann, über dessen Kopf das D aus dem Wort CALEDONIAN verkehrt herum an seiner Schraube baumelte, hatte den Vorhang zurückgeschoben und sie beobachtet. Dann hatte er den Vorhang losgelassen und war vom Fenster weggetreten, doch sie wusste, dass er immer noch da war und sie vielleicht noch immer beobachtete, genau wie dieser Hund, der aus dem Nichts gekommen war.
Sie hatte vergessen, wie leer so eine Provinzstadt sein konnte und wie blind die Fenster. Man kam sich vor wie auf dem Präsentierteller.
Während sie sich umsah, tauchte plötzlich eine Frau auf, blieb zögernd am Rand des Gehsteigs stehen und blickte die Parnassus Road hoch und runter, als wäre sie wie Harley eine Fremde. Als sie Harley bemerkte, wechselte sie schnell ihren Korb von der einen in die andere Hand, strich sich das Haar hinters Ohr und überquerte vor der Metzgerei Alfred Chang Fleischund Wurstwaren, die im tiefen Schatten einer Markise lag, zügig und entschlossen die Straße. Harley hörte die Türglocke ping machen, als die Frau die Fliegengittertür aufdrückte, die mit einem dumpfen Knall hinter ihr zufiel. Dann war alles wieder still.
Sie überlegte, ob sie sich die Frau mit dem Korb bloß eingebildet hatte.
Weiter unten in der Straße entdeckte sie hinter dem Caledonian das alte Kino. Die Form des Gebäudes, das vorne breit und hoch war und sich nach hinten stark verjüngte, verriet seine ehemalige Nutzung. An der Straßenseite hing nach wie vor die Halterung des einstigen Schildes, auf dem sicher Odeon oder Starlight gestanden hatte. Der ganze Komplex war in einem sachlichen Grau gestrichen.
An die Hauswand hatte man eine Holzfaserplatte geschraubt, auf der kaum lesbar von Hand etwas geschrieben stand. Sie kniff die Augen zusammen. SPINNWEB KUNSTGEWERBE, entzifferte sie, MI UND DO GEÖFFNET. Daneben hing eine weitere Tafel, die noch aus dem vergangenen Monat stammte und der eine Ecke fehlte: FROHE WEIHNACHT FRIEDE AUF ERD.
Unwillkürlich musste sie lachen, worauf der Hund mit Bellen reagierte. Dann hörte er auf, als wäre jetzt sie wieder dran.
»Hau ab«, sagte sie.
Seine Rute schwang hin und her. Er öffnete die Schnauze, ließ die Zunge heraushängen und hechelte heftig. Offensichtlich rechnete er damit, dass sie gleich einen Zaubertrick vorführte, denn er ließ sie nicht aus den Augen.
Er machte keinerlei Anstalten abzuhauen.
Der ehemalige Kartenschalter des Kinos bildete die Fensterfront des Kunstgewerbeladens. Hinter der Scheibe sah Harley zwei Quilts, die wie Pflanzen um das Licht konkurrierten.
Sie blickte zu ihrem Auto. Noch war es nicht zu spät, sie konnte einfach wieder einsteigen und wegfahren. Niemand würde es wissen, außer diesem Hund und jemand hinter einem Vorhang. Während sie noch zögerte, krähte irgendwo ausdauernd ein Hahn, und in der Ferne machte eine Autohupe da-diddidi-da-da. Dann erstickte die Stille wieder alle Geräusche.
Sie straffte die Schultern und räusperte sich.
»Hau ab«, sagte sie noch einmal zu dem Hund.
In der alles durchdringenden Stille klang es laut und grob.
Der Hund beobachtete sie, wie sie erst nach rechts, dann nach links und dann wieder nach rechts schaute. Auf der Parnassus Road war weit und breit nicht die geringste Bewegung auszumachen. Hier gab es nur sie und ihren Schatten, und den Hund und seinen Schatten, der mit ihr zusammen die Straße überquerte. Unter der Markise des Caledonian wurden ihre Schatten von dem größeren Schatten geschluckt.
Da sie in Richtung Kunstgewerbeladen schaute und nicht auf den Weg, stieß sie mit einem Mann zusammen, der gerade aus der Tür des Caledonian kam. Im Moment des Zusammenpralls taumelte er zurück und wäre beinahe gestürzt. Sie griff nach seinem Unterarm, bekam Stoff und darunter ein Stück Arm zu fassen, während er wild umherruderte, um sein Gleichgewicht wiederzufinden, und sie dabei an der Schulter traf. Dann standen sie in dem biergetränkten kühlen Luftzug, der von der Tür kam, und entschuldigten sich.
Der Mann hatte ein nervöses Zucken um die Mundwinkel und wollte unbedingt sich die Schuld geben.
»Meine Schuld«, wiederholte er mehrmals. »Alles meine Schuld. Wie dumm.«
Sie hatte das Gefühl, dass es derselbe Mann war, der sie vom Fenster aus beobachtet hatte, aber da er jetzt einen Hut trug, war sie sich nicht ganz sicher.
»Wirklich zu dumm. Einfach nicht aufgepasst.«
»Wie ungeschickt«, sagte Harley. »Oh, ich meine mich.«
Sie schaute nicht ihn an, sondern auf den Boden, wo sich ihre Schuhe auf dem Gehweg gegenüberstanden wie in einem Lehrbuch für Standardtänze. Ihm gehörten die Buschmann-Stiefel mit dem elastischen Gewebe an den Seiten, die brandneu aussahen.
»Habe ich Ihnen wehgetan?«
Sie schaute ihn überrascht an.
»Mir wehgetan?«
Ohne sie zu berühren, zeigte er auf die Stelle, die er mit seinem Arm getroffen hatte.
»Ich habe Sie verletzt«, sagte er zerknirscht. »Da.«
»Nein, nein«, erwiderte sie, obwohl die Stelle jetzt, wo er es erwähnte, tatsächlich wehtat.
Sie schaute auf ihre große, schmucklose Hand, mit der sie ihn gepackt hatte, und überlegte, ob sie nun ihrerseits fragen müsste, ob sie ihm wehgetan habe.
»Na ja«, sagte er und lachte, obwohl es nichts zu lachen gab.
Die Situation zog sich peinlich in die Länge.
»Na ja«, wiederholte er im gleichen Moment wie sie.
Laut hallten ihre beiden Stimmen unter der Markise. Ihr kam es so vor, als stände ganz Karakarook hinter den Fenstern und beobachtete dieses Ereignis, das in die nachmittägliche Stille geplatzt war. Zwei Körper, die gegeneinanderprallten, zwei Menschen, die voreinander standen und sich entschuldigten.
»Entschuldigung«, sagte er noch einmal.
Jetzt wich er zurück, wobei er fahrige kleine Handbewegungen machte. Sie setzte ihren Weg auf dem Gehsteig fort und bemühte sich um einen weniger strengen Zug um den Mund und einen beschwingten Schritt, lässig, als wäre nichts passiert. Doch der Hund, der neben ihr herlief und ängstlich zu ihr hochschaute, verdarb alles.
Niemand sollte sie ängstlich anschauen, das mochte sie nicht. Sie schritt aus und ignorierte den Hund.
Von derselben unsicheren Hand, die SPINNWEB KUNSTGEWERBE auf die Holzfaserplatte geschrieben hatte, stammte auch die Aufschrift auf der Tafel hinter der Tür. SOUVENIRS AUS KARAKAROOK – DEM TOR ZU DEN FOOTHILLS! Vom Ausrufezeichen lief eine lange, verschmierte Tropfspur nach unten.
Es roch nach Duft-Potpourri, und die mit weichen, formlosen Stoffsachen gefüllten Regale wirkten wie Puffer, die eine gedämpfte Raumatmosphäre schufen. Über einen Schaukelstuhl drapiert lagen Häkeldecken, Marmeladengläser standen in Regalen, und es gab Waschlappen, in deren Ecken mit Kreuzstich KARAKAROOK NSW eingestickt war.
Im Laden war es noch wesentlich heißer und stickiger als draußen auf der Straße. In einer Ecke schnurrte ein großer Ventilator, der sich mal in diese, mal in jene Richtung drehte, ohne etwas zu bewirken.
An einem Ladentisch stand eine kleine Frau mittleren Alters und zählte einen Stapel Zierdeckchen durch.
»Einundvierzig, zweiundvierzig, dreiundvierzig.«
Um nicht unterbrochen zu werden, hob sie die Stimme.
»Vierundvierzig, fünfundvierzig.«
Sie wendete das letzte Deckchen, legte es auf den Stapel und blickte auf.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Ihr Blick fiel auf die aufgeplatzte Schulternaht und das flächige, ungeschminkte Gesicht.
Harley lächelte breit und dachte zu spät daran, dass ihre Eckzähne dabei wie Hauer aussahen.
»Hallo«, sagte sie und korrigierte das Lächeln.
In dem stillen Laden klang ihre Stimme unnatürlich laut.
»Ich bin Harley Savage«, sagte sie leiser. »Vom Museum für Angewandte Kunst. In Sydney. Sie haben uns geschrieben.«
Sie lächelte immer noch, allerdings verhalten. Eine Pause trat ein.
»Ich komme wegen des Heimatmuseums.«
»Oh!«, rief die Frau hinter dem Tisch. Es war ein lang gezogener Laut, der überrascht anfing und bestürzt endete.
»Sie sind Harley Savage!«
Ein kurzer, peinlicher Moment. Harley lächelte weiter, hatte aber das Gefühl, dass ihr das Lächeln gefror. Die Frau hinter dem Ladentisch trug eine rote Brille und farblich dazu passenden roten Lippenstift. Ihr Haar war so pechschwarz gefärbt, dass es fast violett glänzte. Sie wirkte wie ein wachsamer kleiner Vogel.
Nach kurzem Zögern kam sie hinter dem Tisch hervor und wollte allem Anschein nach ihr Starren und das enttäuschte Oh durch Händeschütteln wieder wettmachen.
»Ich bin Coralie, Coralie Henderson. Ich war es, die den Brief geschrieben hat.«
Sie machte eine vage Geste, und Harley streckte ihr die Hand entgegen, doch da sie zu spät reagiert hatte, trafen sich ihre Hände nicht. Die Geste stand zwischen ihnen wie ein Fehler.
»Wir haben noch nicht mit Ihnen gerechnet«, rief Coralie und legte ihre unschlüssigen Hände auf den Hüften ab.
»Erst später. Zum Tee.«
Sie schrie förmlich und stand viel zu dicht vor Harley, wie zum Beweis, dass sie keine Angst vor ihr hatte.
»Ich habe unterwegs übernachtet«, sagte Harley. »In Badham.«
Der unausgesprochene Gedanke schien in der Luft geschrieben zu stehen: Dort, wo die Gefängnisfarm ist.
Die Worte waren ihr einfach über die Lippen gekommen, wie ein Husten und wieder zu laut.
»Ich hatte mal Verwandte dort«, sprudelte es weiter aus ihr heraus, und sie verwünschte sich dafür.
»Aber jetzt sind sie nicht mehr da«, fügte sie rasch hinzu.
Die Frau aus dem Laden sagte wieder Oh! Dann wartete sie auf mehr. Da sie so dicht vor ihr stand und so klein war, musste sie den Kopf in den Nacken legen, um Harley anzusehen.
Sie konnte warten. Zeit hatte sie genug. Für die Kurzversion einer Lebensgeschichte wartete sie gerne, insbesondere nachdem die Worte Familie und Badham gefallen waren. Harley spürte, dass der Frau das erste Oh leidtat und sie ihr die aufgeplatzte T-Shirt-Naht verziehen hatte. Jetzt wollte sie freundlich sein. Ihr Blick war warm und aufmerksam und rechnete damit, alles zu erfahren.
Doch so einfach fand Harley das nicht. Sie merkte, dass diese Coralie Henderson auf andere Menschen zugehen konnte und immer ein offenes Ohr für deren Geschichten hatte. Wahrscheinlich war sie eine alte Klatschbase, auch wenn das nur eine gemeine Umschreibung dafür war, dass sie sich für ihre Mitmenschen und deren Leben interessierte.
Harley spürte, wie sie sich gegen Coralies warmherzige Neugierde sperrte. Sie wusste, dass ihr Gesicht jetzt eine hässliche, intensiv rote Farbe annahm und ihre Augen darin klein und verzweifelt wirkten.
Als wäre die Luft plötzlich dicker geworden, veränderte sich das Geräusch des Ventilators. Eine gestrickte Babyhaube rutschte von einem Stapel und fiel auf den Boden. Coralie bückte sich, um sie wieder aufzuheben.
»Hören Sie«, sagte sie, als würde sie zu einem Geständnis ansetzen. »Lorraine Smart ist eine sehr nette Frau. Ich kenne sie schon mein ganzes Leben. Sie würde alles für einen tun.«
Krampfhaft strich sie die Haube glatt, an der eine Ohrenklappe immer wieder hochsprang.
»Aber Lorraines Haus, in dem Sie wohnen werden, na ja, ist nicht gerade eine Luxusvilla.«
Harley wollte etwas Positives sagen und suchte nach den richtigen Worten. »Das ist schon in Ordnung, ich mag es gar nicht so vornehm.«
Coralie schien noch nicht überzeugt zu sein. Sie nahm ihre Brille ab und putzte sie mit einem Zierdeckchen.
»Sie könnten natürlich auch mein Gästezimmer haben«, meinte sie. »Mit frischen Gardinen und allem.«
Sie schaute Harley an.
»Aber vielleicht sind Sie ja lieber für sich.«
Harley spürte, dass sie sich in sie hineinzuversetzen versuchte. Sie machte einen liebenswürdigen Eindruck, diese Coralie, und sie tat alles, damit Harley sich in Karakarook wohlfühlte. Es war nicht ihre Schuld, dass sich Harley Savage nie wohlfühlte.
Wieder trat eine Pause ein.
»Die Sache mit dem Heimatmuseum stößt auf relativ viel Interesse«, sagte Coralie.
Als wollte sie den Lippenstift besser verteilen, presste sie nachdenklich die Lippen zusammen.
»Leith Cousens, Glad Fowler und Felicity Porcelline machen mit. Außerdem noch Freddy Chang und natürlich die kleine Helen Banks. Bert Cutcliffe von der Schule. Und die alte Mrs. Trimm, die stammt noch aus der Zeit vor dem Krieg.«
Coralie nickte und lächelte, als würde alle Welt die kleine Helen Banks und die alte Mrs. Trimm kennen.
Harley versuchte einen interessierten Laut von sich zu geben. Er geriet ihr ein wenig zu hoch und klang ziemlich unangemessen.
»Das ist gut«, sagte sie.
Sie räusperte sich.
»Wunderbar.«
Irgendwo draußen war das lang gezogene, gequälte Krächzen einer Krähe zu hören. Es klang, als würde jemand langsam erwürgt.
2
In der Metzgerei herrschte neuerdings immer eine etwas delikate Stimmung. Es war schon so weit gekommen, dass Felicity nur noch ungern dort hinging. Das Problem war nämlich, dass der Metzger in sie verliebt war.
Zögernd blieb sie vor dem staubigen Schaufenster der ehemaligen Bäckerei von Karakarook stehen. Sie wünschte, es hätte etwas zum Anschauen gegeben, damit ihr Zögern normal wirkte, doch in der Bäckerei von Karakarook konnte man schon lange nichts mehr kaufen. Außer ein paar Regalen mit Unmengen toter Fliegen gab es im Fenster nichts zu sehen.
Aus der Schule weiter hinter ihr drangen die Klänge der Nationalhymne an ihr Ohr. Our land is girt by sea. Weil sie als Kind eine Tante hatte, die Gert hieß, eine dicke, nach Gesichtspuder riechende Frau, fand sie diesen Text lange Zeit verwirrend. Als dann William vor ein paar Jahren in die Schule kam, hatte sie die Hymne gewissenhaft mit ihm geübt und ihm auch die Geschichte von Tante Gert erzählt, was ihn aber nur zu irritieren schien.
Noch einmal schaute sie die Parnassus Road hoch. Wenn sie lange genug trödelte, kam manchmal doch noch jemand, und sie musste nicht allein in die Metzgerei gehen. Fiona oder Christine. Christines Mann war LKW-Fahrer und aß am liebsten dreimal am Tag Fleisch, daher ging seine Frau ständig beim Metzger ein und aus.
Das Problem in einer Kleinstadt wie dieser war, dass man nicht ewig in der Parnassus Road herumtrödeln konnte, ohne aufzufallen. Wozu sollte man in Karakarook wohl einen Schaufensterbummel machen? Es sei denn, man brauchte gerade tote Fliegen. Man konnte sich auch nirgends hinsetzen und die Welt an sich vorbeiflanieren lassen. Die Welt flanierte einfach nicht über die Parnassus Road in Karakarook.
Die Metzgerei hatte eine Markise, die bis über den Gehsteig reichte und auf alten gedrechselten Holzpfosten ruhte. Auf dem Schild stand in geschwungener Kursivschrift ALFRED CHANG FLEISCH- UND WURSTWAREN. Darüber war in dick bemaltem Stuck die Zahl 1889 angebracht wie Zuckerguss auf einer Hochzeitstorte, und jede der erhabenen Zahlen warf einen kleinen schwarzen Schatten.
Wegen der Markise lag die Ladenfront im Dunkeln. Man hatte keine Möglichkeit, ins Geschäft zu sehen, während der Metzger sicherlich hinausschauen konnte, falls er zufällig am Fenster stand. Welchen Eindruck würde er von ihr bekommen, wenn er durchs Fenster sah, wie sie draußen trödelte, um seinen Laden noch nicht betreten zu müssen?
Sie wedelte eine Fliege weg, die um ihr Gesicht kreiste, und schüttelte ihren Arm, als sie dort landete. Dann bückte sie sich und strich über ihr Bein, obwohl die Fliege noch gar nicht dort saß. Manchmal waren einem sogar die nervenden Fliegen willkommen.
Zum Teil lag es daran, dass der Metzger Chinese war. Sie war keine Rassistin und wollte ihm gerne vermitteln, dass sie keine Probleme mit seiner chinesischen Herkunft hatte. Doch gerade weil sie nicht für rassistisch gehalten werden wollte, war sie dummerweise zu freundlich. In dem stillen Laden hörte sie, wie ihre Stimme immer ein wenig zu laut und munter klang. Sie lächelte zu viel und konnte trotzdem nicht damit aufhören.
Sie war keine Rassistin, doch wenn er etwas sagte, fiel ihr jedes Mal auf, dass er genauso klang wie alle anderen. Obwohl sie keine Rassistin war, erwartete sie immer etwas Chinesisches in seinem Tonfall, diese kleine fremdartige Note. Aber seltsamerweise gab es die nicht. Sie hatte auch schon versucht, die Augen zu schlie ßen, wenn er mit ihr redete – man wäre nie darauf gekommen. Wäre man aus irgendeinem Grund mit ihm im Dunkeln gewesen, hätte man ihn niemals für einen Chinesen gehalten.
Im Dunkeln würde er wie jeder andere Mann klingen.
Die Frau aus dem Kunstgewerbeladen hatte ihr mal erzählt, dass die Changs schon seit Ewigkeiten hier seien. Mit hier hatte sie Karakarook gemeint. Ursprünglich seien sie wegen des Goldes gekommen, doch schlau, wie sie waren, hätten sie schnell erkannt, dass man mit Lebensmitteln mehr Geld verdienen konnte. Felicity hatte sich bei dem Gedanken ertappt, dass dies nicht dasselbe sei. Ihre eigene Familie war erst seit zwei Generationen australisch, aber das war irgendwie anders.
Sie war keine Rassistin, ganz gewiss nicht. Trotzdem gelang es ihr nicht, Alfred Chang als genauso australisch zu sehen wie sich selbst. Egal, wie lange die Changs schon in Karakarook lebten – er war Chinese.
Und dann gab es noch etwas, das ein kleines bisschen heikel war, nämlich die Sache mit der Brücke. Als sie die Straße überquerte, sah sie das Plakat, das im Fenster seines Ladens klebte. Selbst von hier konnte sie die Überschrift lesen: RETTET DIE KRUMME BRÜCKE. Der restliche Quatsch über Kulturerbe und so weiter war zu klein gedruckt, um es von ihrem Standort aus zu entziffern. Aus der Ferne betrachtet sah die alte Brücke, die krumm und schief in den dahinter liegenden Busch führte, auf dem Foto wie ein Fragezeichen aus.
Gesehen hatte sie die Krumme Brücke noch nie, denn die lag außerhalb der Stadt an einem Nebenfluss. Die Straße zur Brücke führte an keinen Ort, an den sie jemals hingewollt hätte. Es war jedoch offensichtlich, dass diese Brücke, wie schon zuvor die in der Stadt, durch eine neue ersetzt werden musste. Sie war zu alt und zu einem Schandfleck geworden. Außerdem stellte sie eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Hugh hatte ihr erklärt, dass es Probleme wegen der Haftpflicht des Landkreises gebe. Solche Dinge interessierten ihn, und deshalb hatte er sich auch eingehend mit der Brücke beschäftigt.
Kulturerbe mochte gut und schön sein, aber alles hatte seine Grenzen. Felicity hielt selbst sehr viel von kulturellem Erbe und alten Sachen. Allein wie sie sich um Urgroßmutter Fergusons alten Quilt bemühte. Der war wirklich ein Stück Kulturerbe. Alles Mögliche hatte sie dafür unternommen und sogar an die Bibliothek geschrieben, um etwas über ein besonderes säurefreies Seidenpapier in Erfahrung zu bringen, in dem sie den Quilt aufbewahren konnte. Aber nicht alles Alte war automatisch ein Stück Kulturerbe, und wenn es um die Verwendung von Steuergeldern ging, war es sinnvoll, die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen.
Wie auch immer, in der Metzgerei war es ein kleines bisschen schwierig geworden. Es gab mehrere Themen, die Felicity möglichst nicht ansprechen durfte: die Brücke oder die Landkreisverwaltung. Chinesisch sein. Oder australisch sein. Oder Liebe.
Natürlich könnte sie der leicht delikaten Stimmung im Metzgerladen jederzeit entgehen, wenn sie ihr Fleisch in Livingstone kaufte. Das lag nur eine halbe Autostunde entfernt, außerdem besaß sie eine Tiefkühltruhe.
Doch als Zweigstellenleiter der einzigen Bank, die es noch in Karakarook gab, glaubte Hugh, die Stadt unterstützen zu müssen. Die Zweigstelle der Land & Pastoral sollte zwar Ende des Jahres geschlossen werden, aber das durfte in der Stadt noch niemand wissen. Gerade deshalb wollte Hugh unbedingt den Eindruck erwecken, dass er sich für Belange der Gemeinde wie die Sache mit der Brücke interessierte und das lokale Gewerbe unterstützte.
Wenn die Zweigstelle erst geschlossen war, würde man sie zurück nach Sydney versetzen, wo William eine anständige Schule besuchen konnte und sie ein hübsches Haus in Lindfield oder Strathfield beziehen würden. Dann wäre sie endlich diese Hitze und die Fliegen los. Ehrlich gesagt, zählte sie schon die Tage. Manchmal war sie sich jedoch nicht sicher, ob es Hugh womöglich in Karakarook gefiel. Vielleicht würde es ihm schwerfallen, die Niederlassung zu schließen und von hier wegzuziehen. Schon mehrmals hatte er angedeutet, dass es für die Stadt das Ende wäre, wenn die Zweigstelle geschlossen würde. Insgeheim dachte sie, dass es für ein Kaff wie Karakarook vielleicht das Beste war, wenn man einen Schlussstrich darunter zog, aber das sagte sie natürlich nicht laut.
Die Straße blieb leer. Nur weiter unten stand noch eine ungepflegte Frau herum, die sie zu beobachten schien. Felicity schaute nach rechts, nach links und wieder nach rechts. Nichts bewegte sich. Wenn die Frau dort hinten doch nur aufhören würde, sie zu beobachten.
Sie strich sich das dichte blonde Haar hinters Ohr, doch es rutschte sofort wieder vor. Es fühlte sich angenehm weich und glatt an.Wenn es so an ihrer Wange vorbeischwang, kam sie sich wie ein junges Mädchen vor.
Sie wusste, dass sie, nun ja, attraktiv war. Attraktiv war das Wort, mit dem sie sich beschreiben würde. In letzter Zeit dauerte es länger, bis sie attraktiv aussah, und ihre Schönheitspflege war aufwendiger geworden. Was einem mit zwanzig die Natur schenkte, musste man sich mit einundvierzig erarbeiten. Sie war aber erst vor Kurzem einundvierzig geworden. Ein Monat zählte kaum. Eigentlich war sie immer noch vierzig.
In Karakarook schienen sich auffällig viele Frauen ab einem gewissen Alter gehen zu lassen. Sie nahmen zu, man sah ihre grauen Haaransätze, oder sie trugen diese schrecklich steifen Dauerwellen, die so alt machten.
Von der Seite überprüfte sie ihr Spiegelbild im Schaufenster der Bäckerei. Sie hatte schon immer einen schönen Busen gehabt, und das kleine blaue Top brachte ihn vorteilhaft zur Geltung. Ihr Spiegelbild ließ wirklich nicht vermuten, dass sie gerade einundvierzig geworden war.
Die Frau mit den Händen in den Hüften blickte nach wie vor in ihre Richtung. Felicity ließ den Korb von der einen in die andere Hand gleiten, strich das Haar noch einmal zurück und überquerte die Straße.
Hugh hatte an diesem Morgen irgendetwas zu ihr gesagt, bevor er zur Arbeit ging. Eigentlich hatte sie zugehört, doch jetzt konnte sie sich irgendwie nicht mehr richtig erinnern. Hatte er ein schönes T-Bone-Steak gesagt? Oder: Ich hätte Lust auf ein paar Würstchen? Nein, das war gestern. Oder schon vorgestern?
Das menschliche Hirn kann sich nur etwa sieben Dinge merken. So hatte sie es in ihrem letzten Schuljahr gelernt, aus dem Kapitel über die Funktionsweise des Gehirns im Biologiebuch. Sie hatte es nicht vergessen. Offensichtlich gehörte es zu den etwa sieben Dingen.
Auch an die Zeit vor ihrer Hochzeit erinnerte sie sich noch sehr genau, sogar besser als an das, was Hugh am Morgen zu ihr gesagt hatte. Wie sie, nach ihrem Schulabschluss, auf dem Weg zur Arbeit in der Abteilung für Damenmoden des Kaufhauses Honeycutt’s im Bus saß und die lindgrüne Bluse, die sie sich zusammengespart hatte, mit lindgrünem Kettstich bestickte. Honeycutt’s war für sie nur eine Zwischenstation gewesen, bis ihre Karriere als Fotomodell richtig in Schwung kam. Die Palmolive-Werbung hatte man in ganz Australien sehen können.
Die grüne Bluse war aus reinem Leinen gewesen. Trotz des Mitarbeiterrabatts hatte Felicity wochenlang dafür sparen müssen. Weil sie sich das bestickte Modell nicht leisten konnte, hatte sie selbst zu Nadel und Faden gegriffen. Hugh hatte die Bluse gefallen. Mehr noch, an dem Tag, als sie die Bluse zum ersten Mal trug, hatte er um ihre Hand angehalten. Bald danach hatte er seine Ausbildung abgeschlossen, und die Land & Pastoral schickte ihn nach Campbelltown. Sie hatten geheiratet. Das Hochzeitskleid war ganz entzückend auf Taille gearbeitet und hatte einen Herzausschnitt, der ihren Busen optimal zur Geltung brachte.
Anfangs hatte sie gedacht, sie könnte auch nach der Hochzeit als Fotomodell arbeiten, aber Sydney war so weit weg, und dann kam eins zum andern, und es wurde immer schwieriger. Hugh unterstützte sie, wo er nur konnte, hatte sie jedoch darauf hingewiesen, wie unsicher das Einkommen eines Fotomodells sei. Eine Bankkarriere hingegen sei etwas Verlässliches, und deshalb müsse sein Job vernünftigerweise vorgehen. Als er dann bei der Land & Pastoral Karriere machte, seine erste Beförderung bekam und sie nach Dubbo versetzt wurden, musste sie einsehen, dass es mit der Arbeit als Fotomodell endgültig vorbei war.
Nicht, dass sie es bedauert hätte. Nicht eine Minute. Es machte sie vollkommen glücklich, dafür zu sorgen, dass alles schön war, und man hätte sich keinen besseren Ehemann als Hugh wünschen können. Und dann gab es natürlich noch William, und der hielt sie nun wirklich auf Trab.
Es gab absolut keinen Grund, nicht rundum zufrieden zu sein.
Sie ging zur Fliegentür, wedelte die dort versammelte Fliegenwolke weg und betrat die mit Sägemehl ausgestreute Metzgerei. Die Tür fiel hinter ihr zu, aber eine Fliege hatte es noch mit hinein geschafft und flog zur Decke empor. Nach dem Sonnenlicht draußen wirkte es im Laden dunkel, und der strenge Fleischgeruch hing schwer in der Luft. Sie schaute zu der Stelle hoch, an der das raumhohe Fliegengitter auf die weiße Nutund-Feder-Verschalung der Decke traf. Ein Ventilator rotierte langsam neben einer blauen Insektenlampe. Felicity konnte die Fliege, die mit ihr hereingekommen war, nicht sehen, doch lange würde sie es nicht mehr machen.
Auf der anderen Seite des Fliegendrahts zeichnete sich etwas ab, das nach Größe und Kontur ein Mensch sein konnte. Im Dämmerlicht war sie unsicher, ob es der Metzger war oder ein am Haken hängender Tierrumpf. Als sie genauer hinsah, bewegte sich der Schatten auf sie zu.
»Mrs. Porcelline!«
Es schien ihm jedes Mal Vergnügen zu bereiten, ihren Namen auszusprechen. Bei ihm hörte man den Zischlaut irgendwie deutlicher als bei anderen.
Jetzt konnte sie seine durch das Fliegengitter gekörnte Gestalt genauer erkennen. Er drehte sich vom Hackblock weg, steckte ein Messer in das Halfter, das er um die Hüfte trug, und wischte sich die Hände an der blau-weißen Schürze ab.
Seine Bewegungen waren langsam wie immer, als stünde er hinter seinem Fliegengitter auf einer Bühne. Wahrscheinlich lernten sie in der Metzgerschule, dass sie keine hastigen Bewegungen machen durften, wenn sie ihre Finger behalten wollten. Endlich hörte er auf, seine Hände abzuwischen, und kam zur Ladentheke vor. Die weiße Laminatfläche zwischen ihnen war durch das Fliegengitter, das sich von der Decke spannte, in zwei Bereiche geteilt. Sie konnte sein breites gleichförmiges Gesicht hinter dem Drahtgewebe sehen, aber nicht den Ausdruck darin.
So musste es sein, wenn man jemanden im Gefängnis besuchte. Nur stellte sich die Frage, wer hier der Sträfling war. Alfred Chang schien sich in seinem Käfig und neben dem Rumpf mit dem roten Fleischstempel wohlzufühlen. Sie war diejenige, die sich wie in der Falle vorkam.
»Mrs. Porcelline«, sagte er noch einmal.
So, wie er es aussprach, war der Name ein einziger Zischlaut. Lächelnd stand er da. Sie wusste nicht, wie sie seinem Blick ausweichen sollte.
Würde er sie für eine Rassistin halten, wenn sie wegblickte?
Ihre Augen gewöhnten sich allmählich an das Dämmerlicht, und sie konnte ihn besser sehen. Er war ein muskulöser, kräftiger Mann, der sicher immer viel rotes Fleisch zu essen bekommen hatte, aber er war nicht sehr groß. Sein schwarzes Haar war so glatt, dass es steif über seinem Kragen abstand.Wie fühlte es sich wohl an, wenn man es berührte? Rau wie Hundehaar oder weich?
»Hallo, Mr. Chang«, sagte sie. »Ich hätte gern sechs Koteletts aus der Lende.«
Etwas an dem Wort Lende gefiel ihr nicht. Irgendwie klang es leicht anzüglich. Besonders hier in Gegenwart von Alfred Chang, der sie so anstarrte.
Lieber hätte sie bei Woolies in Livingstone eingekauft, wo das Fleisch in ordentliche kleine Styroporschalen verpackt war.Viel hygienischer. Ihr Umzug nach Karakarook war wie eine Reise in die Vergangenheit gewesen. Hier wurde das Fleisch noch wie vor dreißig Jahren für jeden Kunden extra geschnitten, auf dem Boden lag Sägemehl, und das Schlachtfleisch hing für jeden sichtbar von der Decke.
Das machte alles sehr persönlich. Es hatte etwas Intimes, wenn der Metzger genau wusste, was man am Abend essen würde.
Er trat durch die weiß gestrichene Holztür an der rückwärtigen Wand und schloss sie hinter sich. Als Felicity zum ersten Mal hierherkam, hatte sie ihm ihre Wünsche genannt und gesehen, wie er durch die kleine Tür verschwand. Dann musste sie ewig lange warten. Ungeduldig war sie von einem Fuß auf den anderen getreten. Ob er sie vergessen hatte? Oder hockte er womöglich in aller Seelenruhe rauchend auf einem Baumstumpf im Hof?
Jetzt, zwölf Monate und viele Koteletts später, wusste sie, dass die Tür in den Kühlraum führte und man am besten auf einem der extra dafür bereitgestellten Stühle Platz nahm. Allerdings blieb er manchmal so lange weg, dass sie sich fragte, ob er dort drinnen gestorben oder erfroren sei.
Doch an diesem Tag kam er wenig später mit einem Fleischklumpen zurück, den er auf den Hackblock legte, auf dem sich durch die Abnutzung schon eine tiefe Delle gebildet hatte.
Er stand seitlich zu ihr und griff in den großen Köcher voller Messer, der an seinem Gürtel hing. Er zog eins heraus, machte den Wetzstahl von seinem Halfter los und begann dann mit langsamen Bewegungen das Messer zu schleifen. Während er gemächlich die Klinge schwang, konnte sie sehen, wie sich seine Schultermuskeln unter dem Hemd bewegten.
Er sagte etwas, aber es verhallte hinter dem Fliegendraht, im weiten Raum über ihm, in der trüben Kühle des Ladens und der vom Ventilator bewegten Luft.
Für eine Unterhaltung war es ein seltsamer Ort. Man konnte zwar durch das Fliegengitter sprechen, doch dabei redete man mit einem Gesicht, das grau und verschwommen war wie in einem unscharfen Film. Man hätte sich auch mit seitlich geneigtem Kopf runterbeugen können, um durch die kleine Klappe zu sprechen, die sich auf Thekenhöhe befand und durch die man das Geld hinein- und er das eingewickelte Fleisch herausreichte.
»Wie bitte?«
Bedächtig legte er das Messer auf dem Block ab, steckte den Wetzstahl in den Gürtel zurück wie ein Schwert in seine Scheide und trat ans Gitter.
»Haben Sie schon mal Hammelfleisch probiert?«
Er stand jetzt so dicht vor ihr, dass sie seine dunklen Augen in dem glatten Gesicht sehen konnte, doch sie erkannte keinerlei Ausdruck in ihnen. So etwas, ging ihr in dem Moment auf, nannte man wohl unergründlich.
»Oh, nein«, sagte sie. »Nein, noch nie.«
Irgendwie hatte sie den falschen Ton getroffen. In ihrer Stimme hatte mehr Bedauern gelegen, als für die Tatsache, dass sie noch nie Hammelfleisch probiert hatte, angemessen war.
Sie redete schnell weiter, um es zu überspielen.
»Ein bisschen zäh, oder?«
Zu spät bemerkte sie, wie taktlos das klingen könnte.
Sie spürte, wie ihr die Röte langsam den Rücken hochkroch.
Alfred Chang strich über die Laminattheke und schaute lächelnd auf seine große Hand hinunter.
»Hängt vom Metzger ab«, sagte er. »Wenn es vom richtigen Metzger kommt, hat Hammelfleisch einen süßen Nussgeschmack.«
Jetzt blickte er nicht mehr auf seine Hand, sondern schaute Felicity durch das Drahtgewebe an.
»Oh!«, rief sie. »Ja! Das kann ich mir vorstellen.«
Schrecklich, wie sie dauernd diese Ausrufe von sich gab und lächelte, aber was sollte sie denn sonst tun? Hinter einem Lächeln konnte man sich verstecken, und niemand konnte einem etwas vorwerfen oder ahnen, was man dachte. Sie blinzelte, um zu signalisieren, wie lustig sie das alles fand, aber dann fiel ihr ein, dass man vom Blinzeln Falten bekam.
Niemand, nicht mal ein chinesischer Metzger, würde sie noch wollen, wenn sie Falten hatte.
Er hatte die Koteletts jetzt fertig eingewickelt. Sie zuckte zusammen, als die Klappe der Durchreiche mit einem Knall aufflog.
»Bitte sehr, Mrs. Porcelline.«
Sein Blick ruhte auf ihr, und seine Stimme klang irgendwie sehnsuchtsvoll. Wegen des Fliegendrahts konnte man nicht sicher sein, aber sie hielt es für möglich, dass er ihr zuzwinkerte.
»Für Sie nur das Beste vom Besten, Mrs. Porcelline.«
Als sie durch die Klappe nach dem Päckchen griff, hielt er es noch fest, und einen Moment lang waren sie durch das kleine weiche Fleischpaket miteinander verbunden.
Ein bisschen so, als würden sie sich an den Händen halten.
Sie haben ein besonderes Faible für weiße Frauen, schoss es ihr durch den Kopf, doch sie verdrängte den Gedanken gleich wieder.
Endlich ließ er das Päckchen los und bückte sich, um etwas unter der Theke hervorzuholen.
»Ich hatte gehofft, dass Sie vorbeikommen, Mrs. Porcelline«, sagte er in seinem sehnsuchtsvollen Ton. »Ich habe etwas für Sie.«
Er streckte seine große Hand durch die Klappe und hielt ihr eine braune Papiertüte hin wie ein schmutziges Geheimnis.
»Oh! Wirklich! Was ist das?«, rief sie und hörte, wie ihre Sätze in der fleischgetränkten Luft aufstiegen und sich im ganzen Laden ausbreiteten. Schrie sie etwa?
Als sie die Tüte öffnete, rollte etwas Kühles an ihre Hand. Sie gab einen kleinen Schreckensschrei von sich, und ihre Hand zuckte zurück. Das Ding war kühl, feucht und knallrot. Ein winziges Herz, dachte sie verwirrt und schockiert. Sie essen Hunde. Hundeherzen.
Sie hörte, wie ihr ein unwillkürliches Arrggh! entfuhr. Das war der Laut, den ihre Mutter immer von sich gab, wenn sie sich überrumpelt fühlte.Vor langer Zeit hatte Felicity ihn selbst benutzt, damals, auf den tristen und staubigen Spielplätzen ihrer Kindheit. Ordinär. Eigentlich hatte sie geglaubt, sie hätte sich dieses Arrggh schon längst abgewöhnt.
Jetzt erkannte sie, dass das kleine Ding doch kein Hundeherz war. Es war nur eine Erdbeere.
»Aus meinem Garten«, sagte der Metzger.
Wirklich zu dumm, dass sie ihn nicht richtig sehen konnte.
»Selbst gepflückt. Heute Morgen um sechs.«
Sie lächelte das Drahtgewebe an, hinter dem er sich undeutlich als eckiger dunkler Schatten abzeichnete.
»Vielen herzlichen Dank«, hörte sie es aus sich hervorsprudeln. »Die sind wirklich wunderbar.«
Sie waren schrecklich. Zu groß, zu fest, zu fleischig. Fleischig und fest wie ein Herz. Eklig.
»Ochsenherz«, sagte der Metzger und verwirrte sie damit endgültig.
»Wie? Wie bitte?«
Panisch überlegte sie, ob sie vielleicht laut gedacht hatte.
»So heißt diese Sorte«, sagte er. »Ochsenherz.«
Sie war wie vom Donner gerührt. Er beugte sich zur Klappe hinunter und schob seinen Kopf seitlich hinein, um aus seinem breiten Gesicht zu ihr hochzublicken, wobei seine Augen zur Seite schielten.
»Ochsenherz«, sagte er klar und deutlich. »Das Herz vom Ochsen.«
Er blieb mit dem Kopf in der Klappe und sah zu ihr hoch. Die Öffnung war gerade groß genug für sein breites gleichförmiges Gesicht. Auch sie neigte den Kopf zur Seite, denn das schien nur höflich zu sein. Sie spürte, wie ihr das Lächeln in den Mundwinkel hinabrutschte, und kam sich vor wie ein riesiger Spatz mit schräg gelegtem Kopf.
»Wie groß die sind!«, rief sie. »Einfach riesig. Was für Riesendinger!«
Allmählich glaubte sie zu begreifen, worum es bei dieser Unterhaltung überhaupt ging. Es waren Erdbeeren. Keine Hundeherzen, auch wenn sie Ochsenherzen hießen. Doch ihr Gehirn arbeitete sehr langsam. Ihr fiel nichts ein, was sie sagen konnte, außer dass sie groß waren.
Sie hielt eine der Erdbeeren hoch und drehte sie mehrmals herum. Eigentlich war sie nicht so besonders interessant.
»Wie schaffen Sie es, dass sie so groß werden? Ich habe noch nie so große gesehen! Wirklich unglaublich! So riesig. Wunderbar!«
Plötzlich kam es ihr so vor, als würde sie sich die ganze Zeit begeistert darüber auslassen, wie groß und wunderbar sein – nun ja – Organ war.
Sie begann zu schwitzen.
Natürlich dachte sie nicht an sein – na ja – Organ.
»Sie schmecken bestimmt ganz köstlich!«
Sie errötete noch mehr und wünschte sich Rettung herbei. Wo waren die Frauen all der Fleischesser, wenn man sie brauchte?
Sie brachte ihren Mann ins Spiel.
»Hugh wird begeistert sein«, sagte sie. »Und William auch. Sie lieben Erdbeeren.«
Das große gleichförmige Gesicht des Metzgers in der Klappe bewegte sich nicht, doch seine Augen zwinkerten.
»Ach«, sagte er. »Aber ich habe sie extra für Sie gepflückt.«
Er schaute zu ihr hoch, und sie glaubte, dass er lächelte, aber da sie sein Gesicht nur von der Seite sah, konnte sie nicht ganz sicher sein. Wenn doch nur dieses Gesicht verschwände und diese Augen sie nicht länger anstarren würden! Krampfhaft lächelnd stellte sie sich vor, wie sie ihre Einkaufstasche gegen die Klappe schleuderte. Sie würde direkt vor seinem Gesicht landen und hätte genau die richtige Größe, um es ganz zu verdecken.
»Oh, aber ich bin allergisch, wissen Sie«, erwiderte sie heftig. »Allergisch gegen Erdbeeren.«
Jetzt wurde ihr ganz heiß im Gesicht. Er sah sie immer noch unverwandt an. Als hätte er sich den Kopf abgeschraubt und ihn in die Klappe geklemmt. Diese Stille, und wie er sie beobachtete, war unerträglich.
»Nur gegen Erdbeeren«, rief sie. »Zum Glück eigentlich, sonst gegen nichts. Nur gegen Erdbeeren.«
Sie schichtete weiter Wörter vor seinem Gesicht auf.
»Ich bekomme davon einen Hautausschlag. Einen ziemlich schlimmen Ausschlag sogar. Fast schon … eine Krankheit.«
Das Wort klang wie ein Fauchen.
Lepra, hatte sie gedacht.
Sein Gesicht wich zurück und verschwand aus der Klappe. Natürlich hatte sie damit nicht sagen wollen, dass Chinesen einen mit Lepra ansteckten.
»Eine Art pusteliger Ausschlag«, verbesserte sie sich. »Wie Eiterbläschen.«
Sie hörte sich das Wort aussprechen, war sich aber trotzdem nicht sicher, ob sie genau das hatte sagen wollen. Eigentlich wollte sie nicht von Eiter reden.
»Und juckend«, fügte sie schnell hinzu. »Fürchterlich juckend. Oh, Sie würden es nicht glauben.«
Durch das Drahtgewebe konnte sie nicht erkennen, ob er ihr nun glaubte oder nicht. Die Klappe fiel zu, und sie sah seine großen Hände, die das weiße Papier auf der Theke glatt strichen und ein Eselsohr in einer Ecke hinunterdrückten.
»Also, das möchte ich nicht, dass Sie Ausschlag kriegen«, sagte er.
Sie konnte nicht erkennen, ob er lächelte.
Ein Kichern brach aus ihr heraus.
»Nein«, sagte sie, und dann fiel ihr nichts mehr ein.
»Sicher nicht.«
»Hoffentlich bekommt Mr. Porcelline keinen Ausschlag davon«, sagte er. »Oder William. Sind die beiden auch allergisch, Mrs. Porcelline?«
»O nein! Mr. Porcelline liebt Erdbeeren!«, beeilte sie sich zu sagen. »Und William auch!«
Warum stand er nur so da und schaute sie an, während sie verzweifelt nach Worten suchte? Das machte sie wütend.
Immer noch krampfhaft lächelnd, verließ sie den Laden. Erst als sie außer Sichtweite seines Schaufensters war, stellte sie das Lächeln ein. Durch das Papier der Tüte spürte sie die kühlen und feuchten Erdbeeren. Flotten Schrittes ging sie die Parnassus Road entlang, schwenkte lässig die Erdbeeren, lächelte den alten Mr. Anderson an, der auf der anderen Straßenseite in der Tür des Mini-Mart stand, rief einer Mutter aus der Schule, deren Namen sie sich einfach nicht merken konnte, sehr herzlich »Hallo, wie geht’s?« zu und winkte Fiona, die natürlich jetzt, wo sie ihr nicht mehr nutzen konnte, zur Metzgerei hinüberlief. Sie lächelte und winkte und hielt die Tüte mit den Erdbeeren, als gäbe es auf der ganzen Welt nichts Unbedeutenderes.
Es gab nur ein Problem: Hugh würde wissen wollen, woher sie die Erdbeeren hatte. Und es wäre doch etwas seltsam, wenn sie dann sagte, der Metzger hätte sie ihr geschenkt. Warum sollte der Metzger ihr Erdbeeren schenken?Warum Erdbeeren? Warum ihr?
Genau genommen wäre es ein bisschen peinlich, wenn Hugh es erfuhr.
Und deshalb war es besser, die Erdbeeren einfach verschwinden zu lassen.
Nur war es gar nicht so leicht, in einem Kaff wie Karakarook, wo nichts unbeobachtet blieb, eine Papiertüte voller Erdbeeren, das ungewollte Geschenk eines chinesischen Metzgers, verschwinden zu lassen. Wenn sie die Tüte zu Hause in die Mülltonne steckte, könnte Hugh sie bemerken. Er nahm das Recyceln sehr ernst und hatte die Angewohnheit, den Müll zu kontrollieren. Wie würde das aussehen, wenn sie absolut einwandfreie Erdbeeren weggeschmissen hatte? Möglicherweise würde sie sich damit sogar verdächtig machen.
Sie hatte jetzt das Ende der Ladenzeile erreicht und ging auf die Grünanlage an der Ecke zur Virgil Street zu. Vor der öffentlichen Toilette in der Grünanlage hing ein Abfalleimer. Sie könnte einfach schnell durchs Tor huschen, die Tüte in den Eimer werfen, wieder hinauslaufen, und fertig.
Sie schaute sich um. Draußen vor dem Mini-Mart stand noch immer der alte Mr. Anderson auf dem Gehweg, allerdings war schwer zu sagen, ob er sie beobachtete. Sie konnte zwar nicht hineinsehen, aber das Acropolis-Café gegenüber vom Park war geöffnet, und so wie sie ihr Pech kannte, würde Ellen ausgerechnet in dem Moment aus dem Fenster schauen, in dem Felicity die Tüte in den Abfalleimer warf. Griechen steckten ihre Nasen doch in alles hinein. In einem kleinen Kaff wie diesem gab es immer jemanden, der einen beobachtete. Es würde komisch aussehen, wenn sie etwas in einen öffentlichen Abfalleimer warf. Möglicherweise war Ellen neugierig genug, um hinzugehen und nachzuschauen, und sicher wusste sowieso ganz Karakarook, bei wem diese Ochsenherzerdbeeren wuchsen. Ellen würde bei Coralie im Kunstgewerbeladen vorbeischauen, denn eigentlich mussten auch Australier ihre Nase in alles stecken. Und bevor man sich’s versah, wusste ganz Karakarook Bescheid.
So war das eben in einem kleinen Ort.
Am besten, sie vernichtete alles zu Hause im Abfallverbrenner. Die Erdbeeren würden zwar beim Verbrennen stinken, doch wenn sie jetzt sofort nach Hause ging und es schnell erledigte, wäre der Geruch verflogen, bis Hugh nach Hause kam. Mittlerweile wusste sie, wie der Abfallverbrenner funktionierte. Man sollte nicht glauben, wie oft es etwas gab, das aus irgendeinem Grund verbrannt werden musste.
Hugh könnte den Rauch in seinem Büro bei der Land & Pastoral riechen, aber er würde niemals darauf kommen, dass der Geruch aus seinem eigenen Garten kam.
Verbrennen war immer die beste Lösung. Danach war alles wunderbar aufgeräumt. Und Asche konnte nie zu peinlichen Situationen führen.
3
Coralie hatte recht, das Haus von Lorraine Smart war nicht gerade eine Luxusvilla. Das Gartentor hing nur noch in einer Angel, und an der Front der Eingangsveranda lief eine schiefe Abflussrinne hinab wie zur Demonstration eines geometrischen Lehrsatzes. Im Haus war alles kaputt, verblichen, abgenutzt, improvisiert: Aus dem Schiebefenster der Küche hing ein weißes Kabelende wie eine ausgestreckte Zunge, der Kaminsims war mit Glasschwänen und Porzellanpferdchen vollgestellt, allesamt schon einmal zerbrochen und wieder zusammengeklebt, über die Wasserhähne in der Waschküche hatte jemand braune Papiertüten gestülpt, auf denen in Großbuchstaben NICHT BENUTZEN stand.
Harley hatte sich vor Lorraine Smarts Haus gefürchtet. Sie hatte farblich aufeinander abgestimmte Teetassen und polierte Tische erwartet, die sie anschlagen oder zerkratzen konnte, ein Elternschlafzimmer, in dessen Schrank Schuhe mit den ganz eigenen Ausbuchtungen fremder Füße standen, und Betten, deren Matratzen Mulden von fremden Menschen hatten.
Doch wer immer diese Lorraine Smart sein mochte, allmählich begann sie Harley sympathisch zu werden. Es gefiel ihr, dass alles Dekorative im Haus schon mindestens einmal zerbrochen war und der Wasserhahn in der Küche bei der ersten Berührung abfiel und sie ihn wieder festschrauben musste. Es war wie zu Hause. An der Kühlschranktür, die wegen ihrer vielen Rostflecken aussah, als hätte sie die Masern, hingen unzählige Fotos von Menschen, die, in Positur gestellt, lächelnd in die Kamera blinzelten. Auf einigen Bildern konnte man den Schatten des Fotografen erkennen, der lang über den Rasen und bis in die Menschengruppe hineinfiel.
Zwischen den Fotos war Platz für eine Nachricht freigeräumt worden: Herzlich willkommen, fühlen Sie sich wie zu Hause. Alles Gute, Lorraine. Der Zettel steckte unter einem Magnethalter in Form einer Ananas, auf dem Grüße aus Rockhampton stand.
Das Küchenfenster ging zum Garten hinaus, der auch nicht gerade ein Luxusgarten war. Der Rasen hatte unter der Dürre gelitten und war braun und strohtrocken. Harley sah ein paar halbtote Sträucher und die abgestorbenen Stängel von Stauden, die bereits aufgegeben hatten.Von einem großen, wild wuchernden Eukalyptusbaum hingen ausgefranste Rindenstreifen herab. Unter dem Baum befand sich eine Garnitur weißer Gartenmöbel aus Plastik, die auf dem steinharten Boden leicht schräg stand. Ein Ziegelsteinpfad führte zu einer Wäschespinne mit einer hellroten Betonplatte darunter, auf die man beim Wäscheaufhängen treten konnte. Ein kahler Metallbogen, an dem noch etwas vertrocknetes Gestrüpp hing, war offensichtlich einmal als Gerüst für Kletterrosen gedacht gewesen.
Harley öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Es war immer noch heiß, doch die Sonne versank langsam hinter den Hügeln, und das Licht verdichtete sich zu einem goldenen Ton.
Sie fühlte sich wie auf einem anderen Planeten. Sydney war zu einem Traum verblasst oder schien so wenig mit ihr zu tun zu haben, als hätte Harley nur in einem Buch darüber gelesen. Ein Text, an den man sich erinnern konnte oder auch nicht, ganz wie man wollte. Hier auf dem Land kam einem die Großstadt mit all ihren Sorgen und Nöten plötzlich unbedeutend und dumm vor. Doch wer zu lange in der Stadt lebte, konnte vergessen, was für ein Schauspiel es war, wenn die Sonne langsam und träge ihre Bahn zog, und wie unendlich dieser Himmel in seiner Weite und Gelassenheit war.
Als C. Henderson, in Klammern Mrs., in ihrer Eigenschaft als ehrenamtliche Schriftführerin des Heimatvereins Karakarook an das Museum für Angewandte Kunst in Sydney geschrieben hatte, war sie dort auf wenig Interesse gestoßen. Die Einrichtung eines Heimatmuseums in Karakarook mochte ein ehrenwertes Projekt sein, aber leider eine Nummer zu klein, außerdem sah es auf der Landkarte sehr weit weg aus.
Der Brief war nur eine Fotokopie. Wahrscheinlich hatte C. Henderson, in Klammern Mrs., ihn nicht nur an das Museum für Angewandte Kunst in Sydney geschickt, sondern auch an den National Trust, die Historische Gesellschaft von New South Wales und alle anderen Adressen, die ihr eingefallen waren.
Doch C. Henderson, in Klammern Mrs., hatte sich beim Kulturausschuss erfolgreich um Fördermittel für die Gründung eines Heimatmuseums in Karakarook beworben, und diese Fördermittel beinhalteten das Honorar für einen Experten, der die Einrichtung des Heimatmuseums betreuen sollte.
Die Kuratorin, in Klammern Textilien, des Museums hatte es zufällig gegenüber der Fachkraft, in Klammern Teilzeit, erwähnt, und diese hatte Interesse gezeigt.Von der Arbeit als Textilkünstlerin im Bereich Patchwork konnte man nicht reich werden, genauso wenig als Fachkraft, in Klammern Teilzeit. Außerdem waren da ein paar Arztrechnungen, die dringend bezahlt werden mussten.
Da die Fördermittel nicht die Kosten für die Unterbringung der bestellten Expertin abdeckten, hatte C. Henderson, in KlammernMrs., vorgeschlagen, die Dame privat unterzubringen, doch damit war die Fachkraft, in Klammern Teilzeit, nicht einverstanden. Die verschiedenen komplizierten Gepäckteile, die von der Fachkraft, in Klammern Teilzeit, mitgeschleppt wurden, nahmen für ein privates Gästezimmer zu viel Platz ein.
Eine Zeit lang hatte es so ausgesehen, als wäre die Sache damit vom Tisch. Die Kuratorin, in Klammern Textilien, hatte die Briefe von C. Henderson, in Klammern Mrs., zu den Akten gelegt und die Fachkraft, in Klammern Teilzeit, die Straßenkarte von New South Wales zurück ins Handschuhfach.
Doch dann war noch ein Brief von C. Henderson, in Klammern Mrs., eingetroffen. Die Tochter einer Frau namens Lorraine Smart, ohne Klammern, hatte gerade Zwillinge bekommen, und Lorraine Smart wollte nach Sydney fahren, um ihr zu helfen. Wir können Ihnen die Nutzung eines mittelgroßen Hauses anbieten, hieß es in dem Brief. Und wir werden Sie in jeder Hinsicht unterstützen.
Auf die Fachkraft, in Klammern Teilzeit, hatte die schicksalhafte Ankunft der Zwillinge von Lorraine Smarts Tochter wie ein kleiner Stups gewirkt. Fahr hin. Fahr.
Der Hund war immer noch da. Er streifte durch Lorraine Smarts Garten, schnüffelte an den Gartenmöbeln und hob sein Bein am Rosenbogen. Sie hatte ihn nicht zum Mitkommen aufgefordert. Als Coralie draußen vor dem Kunstgewerbeladen ernst und mit blitzenden Brillengläsern zu ihr aufschaute und den Weg beschrieb – erste rechts, erste links, an der Kirche vorbei, noch mal nach links, Sie können es nicht verfehlen -, war der Hund ins Auto gesprungen, hatte auf dem Rücksitz Platz genommen und von dort wie die englische Königin aus dem Fenster geblickt.
Harley hatte in dem Moment keine Lust gehabt, sich mitten auf der Parnassus Road mit einem Hund zu streiten und dabei von all denen, die hinter Schaufenstern lauerten, beobachtet zu werden. Deshalb hatte sie den Motor angelassen, noch einmal erste rechts, erste links, an der Kirche vorbei wiederholt, Coralie aus dem Fenster zugewinkt und im Rückspiegel gesehen, wie diese zurückwinkte.
Der Hund schnüffelte gerade am Zaun entlang, als plötzlich eine schrille Stimme Komm her! Komm her! rief. Wie ertappt zuckten der Hund und Harley zusammen.
Johnny? Johnny? Komm her!
Der Ruf kam aus dem Nachbargarten. Vorsichtig lehnte sie sich wieder aus dem Fenster und entdeckte in einem Käfig beim Zaun einen großen weißen Kakadu, der sich an seinem Schnabel hochhangelte und den Kopf durch die Käfigstäbe steckte. Sie sah, wie der Kropf unter seinem Schnabel auf und ab hüpfte, als er wieder rief: Johnny? Komm her, Johnny! Der Mensch im Fenster interessierte ihn nicht, er hatte nur Augen für den Hund.
Harley war keine Hundeexpertin, aber an diesem Exemplar schien wirklich nichts Besonderes zu sein. Er war recht groß, am ganzen Körper gräulich gefleckt, als trüge er einen Tarnanzug, und hatte eine buschige Rute. Über die Mitte seiner Stirn lief vertikal ein dünner weißer Streifen, und seine gelbbraunen Augenbrauen zeichneten sich deutlich ab.
Sicher würde er bald heimlaufen. Ihre Jungs hatten es als Kinder genauso gemacht und waren einfach losgezogen, um sich irgendwelchen Leuten anzuschließen und Abenteuer zu erleben. Der Mittlere hatte einmal mit einem kleinen Koffer voller Unterhosen die Straße überquert und der Frau von Gegenüber erklärt, er wolle bei ihr einziehen. Wie schön, mein Kleiner, hatte sie geantwortet. Und als der Verschluss des Köfferchens aufsprang und alle Unterhosen auf den Boden fielen, hatte die Frau sie aufgesammelt und Harleys Sohn auf einen Schokoladenkeks mit ins Haus genommen.
Harley hatte pflichtschuldig gelacht, als die Nachbarin ihr die Geschichte erzählte. Sie hätten den Ausdruck auf seinem süßen Gesichtchen sehen sollen, als alle Unterhosen herausfielen! Aber sie hatte einen Stich verspürt. Glaubte er etwa, dass diese Frau mit ihren Schokoladenkeksen eine bessere Mutter war als sie?
Doch selbst von den tollsten Abenteuern waren die Jungs abends immer nach Hause zurückgekehrt. Nach den Schokoladenkeksen oder der Wanderung zum Eisenbahndamm, von dem aus sie die Züge beobachteten, oder auch der Unterhaltung mit der lächelnden Frau an der Bushaltestelle, die einen Hut mit Blumen trug: Zum Abendbrot waren die Jungs stets wieder zu Hause gewesen.
Vermutlich war es mit Hunden ähnlich.
Die andere Hälfte der Hausrückwand neben der Küche nahm eine verglaste, von den Smarts vermutlich Sonnenzimmer genannte Veranda ein. In ihr stand eine Bettcouch, über die eine verblichene indische Tagesdecke geworfen war. Durch die Fenster flutete warmes Nachmittagslicht in den Raum. Ein honiggelber Sonnenstreifen lief über eine Wand und dann den versiegelten Dielenboden entlang. Von außen strichen die Blätter eines Baums flüsternd über die Scheiben. Man hatte das Gefühl, draußen und trotzdem drinnen zu sein.
Auf der Bettcouch lag der Livingstone & Shire Weekly Clarion, auf dem eine fette Schlagzeile prangte: STADT IM STREIT ÜBER BRÜCKE. Ein grobkörniges Foto zeigte einen kleinen Fluss und eine Holzbrücke, darunter stand eine weitere, nicht ganz so große Schlagzeile: Stadträte mahnen zur Mäßigung.
Harley lachte. In dem stillen Zimmer klang es sehr laut und abrupt. Sie schaute sich um. Aus einem Spiegel blickte ihr verstohlen eine Frau entgegen, die nur sie selbst sein konnte.
Die Spiegel. Sie waren das einzige Problem im Haus von Lorraine Smart. Harley war bereits im Wohnzimmer über ihren finsteren Blick erschrocken und erst recht vor dem Vergrößerungsspiegel in der Küche, aus dem sie ein riesiges kaltes Auge anstarrte.
Fünfzig Jahre lang hatte sie in Spiegel geschaut und eines Tages beschlossen, dass es genug war. Sie wusste alles über das breite flache Gesicht, die fleischigen Wangen, die hohe Stirn und das dünne Haar. Ihr Leben lang hatte sie sich Ratschläge anhören müssen, was sie aus diesem Haar machen sollte. Lass dir eine Dauerwelle legen, und sie hatte sich eine Dauerwelle machen lassen. Lass sie auswachsen, und sie hatte sie auswachsen lassen. Doch was sie auch mit ihrem Haar anstellte, ihr Gesicht war stets dasselbe geblieben.
Sie wusste, dass sie mit den beiden tiefen Falten um den Mund streng und unnahbar wirkte.Weil sie immer um eine ernste und distanzierte Miene bemüht war, hatten sich diese Falten im Lauf der Jahre dort eingegraben. Die Augen sind die Fenster der Seele, hatte einmal ein Verehrer zu ihr gesagt. Und da sie unbedingt verhindern wollte, dass ihr jemand durch die Augen in die Seele blickte, hatte sie sich diesen eisigen Ausdruck zugelegt.
Jetzt starrte ihr aus dem Spiegel ein trotziges Gesicht entgegen. Mit den Jahren formte die Mimik, die man sich als Selbstschutz zugelegt hatte, die ganze Persönlichkeit.
Sie näherte sich ihrem Spiegelbild, bis es sie verschluckte, nahm den Spiegel in beide Hände, hängte ihn ab und lehnte ihn mit der Vorderseite gegen die Wand.
Die Bettcouch quietschte, als sie sich daraufsetzte. Wenig später streckte sie sich lang aus, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und blickte zur weißen Decke empor, wo der Sonnenstreifen von der Wand in einem schrägen Winkel weiterlief. Licht und Schatten bildeten ein großes einfaches Muster. Hell, dunkel.