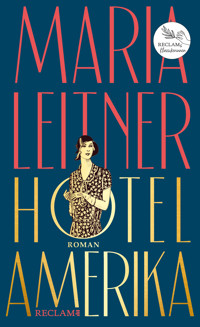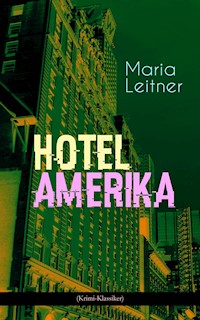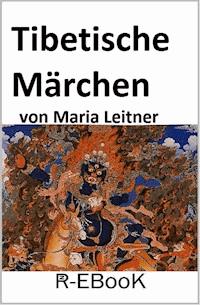Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Maria Leitner hatte Zeit, genauer hinzusehen und sich in die verschiedensten Lebenswelten zwischen New York und Richmond, Cayenne und Havanna einzuarbeiten: Als erste deutschsprachige Under-Cover-Journalistin nahm Maria Leitner 'Knochenjobs' an, um darüber zu berichten; Zeit aber auch, den Provinzalltag zu erkunden, abseits der damaligen Texter-Trampelpfade nach Detroit, Chicago oder Hollywood. Zeit schließlich, sich mit den Menschen zu beschäftigen, die sie in lakonischem Tonfall und knapper Diktion treffend beschrieb. Sei es in der Berliner Zeitung oder dem Lifestyle-Magazin UHU: Die Veröffentlichung ihrer Reiseberichte in diesen liberalen Blättern ist ein Glücksfall gewesen. War doch die Sozialistin Maria Leitner gehalten, auf allzu plakative Ideologie zu verzichten, zugunsten von Lebendigkeit, Spannung und Realitätsgehalt. 1932 dann wurden rund 50 ihrer längeren und kürzeren Sozial- und Reisereportagen in Buchform gegossen. Zu spät, um ihnen nachhaltig – angesichts des bald herrschenden Ungeists – den Weg zum Leser zu ebnen. Seit dieser Zeit reist nicht nur eine Frau, sondern auch ein Buch – als ein noch zu entdeckender Klassiker deutschsprachiger Reportageliteratur – durch die Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Leitner
Eine Frau reist durch die Welt
Impressum
heptagon Verlag, Berlin 2016 www.heptagon.de ISBN: 978-934616-22-6
Erstausgabe: 1932
I. Als Arbeiterin im Schatten der Wolkenkratzer
Als Scheuerfrau im größten Hotel der Welt
Das ging eigentlich ganz gut – dachte ich, während ich das Formular mit den vielen neugierigen Fragen der Hotelleitung ausfüllte. Wo ich schon überall angestellt war, ob ich die Absicht habe, falls ich nicht Amerikanerin sein sollte, eine zu werden. Und vor allem, wen man verständigen solle für den Fall, dass ich erkranke. Dass man gleich auf das Schlimmste gefasst ist, klingt zwar nicht gerade ermutigend, aber sonst scheine ich es gar nicht so schlecht getroffen zu haben. Ich hätte zwar nicht verraten sollen, dass ich erst seit einigen Tagen in Amerika bin. Es wäre vielleicht doch besser gewesen, Stubenmädchen zu werden, obgleich zwanzig Zimmer und zwanzig Badezimmer in sieben Stunden zu reinigen keine Kleinigkeit ist. Ob ich das fertiggebracht hätte? Und die Beruhigung, dass ich später fünfundzwanzig Zimmer und fünfundzwanzig Badezimmer in Ordnung zu bringen hätte? Nun werde ich wenigstens leichte Arbeit haben, nur die Ordinationszimmer des Zahnarztes reinigen, die Nickelinstrumente putzen, was kann daran schon schwer sein? Viel verdiene ich gerade nicht. Täglich einen Dollar. – Aber ich habe volle Verpflegung und »Zimmer mit Bad«, sagte die freundliche, alte Dame, die mich aufgenommen hat. Auf dem Löschpapier, auf dem Formular, überhaupt wohin man nur blickt, steht zu lesen, dass man sich in dem größten Hotel der Welt befindet mit zweitausendundzweihundert Zimmern und zweitausendundzweihundert Badezimmern, und ich bin nicht wenig stolz, dass es mir gelungen ist, hier eine, wenn auch bescheidene Stellung zu finden.
Ich erscheine deshalb sehr erwartungsvoll am nächsten Morgen um acht Uhr. Es dauerte eine Weile, bis wieder alle Formalitäten erledigt sind und ich aufs Zimmer geführt werde, das »Zimmer mit Bad« ist ein langer, stockfinsterer Raum, in dem acht Betten stehen. Ich bekomme das Fach eines langen Blechkastens als Kleiderschrank zugewiesen. Dann gibt man mir eine Nummer, ich bin Nummer 952, eine Esskarte, eine blauweißgestreifte Uniform und eine Karte, die ich bei Beginn und Ende meiner Arbeit abstempeln lassen muss. Schließlich erhalte ich einen Eimer, Seife, Tücher, eine Scheuerbürste und einen kleinen Teppich (wozu dies alles?), während die freundliche, alte Dame, die mir heute schon weniger freundlich erscheint, mich in einen etwas geräumigen Vorraum führt und mir erklärt, dass ich diesen aufwischen muss. (Aber wie ist es mit den Ordinationszimmern des Zahnarztes?)
Der kleine Teppich und seine Berufung
Wie wischt man eigentlich einen Fußboden auf? Ich frage jedenfalls vorsichtigerweise, wie man dies in Amerika beziehungsweise im Hotel »Pennsylvania« zu machen gewohnt ist. Aber ich merke, dass diese Frage keinen guten Eindruck hervorgerufen hat. »Also seifen Sie doch endlich die Bürste ein und fürchten Sie sich nicht so vor dem Wasser. – So, und dann mit dem nassen Tuch aufwischen. – Und knien Sie sich doch hin!« Auch das noch. Adieu, Schuhe und Strümpfe. Muss ich aber meine Knie auch noch kaputt machen? Ich dachte, die Amerikaner sind so praktisch und machen alles mit der Maschine. Zum Glück fällt mir der kleine Teppich ein. Bisher ist er in keiner Weise in Erscheinung getreten, aber da man ihn mir gegeben hat, muss er doch irgendeine Berufung haben. Ich nehme ihn also, und während ich aufwische, knie ich mich auf ihn. (Scheint so eine Art Gebetteppich zu sein.) Wenn ich mit einem Stück fertig bin, ziehe ich mit ihm weiter. Es ist ein bisschen umständlich, aber es geht doch besser so als vorhin. Nur an dem Ausdruck der alten Dame merke ich, dass irgend etwas nicht ganz stimmt. Endlich erklärt sie mir mit einer Stimme, die zwar sanft ist, aber deren Sanftheit man anhört, dass sie nicht geringe Selbstbeherrschung gekostet hat, dass der kleine Teppich keineswegs dazu da sei, meine Knie zu schützen, sondern die Umgebung, die im gegebenen Fall aus feinen Teppichen bestehen kann, vor den Spuren des Eimers.
Ich stand beschämt auf, während ich mir gestehen musste, dass an dem Boden nach dem Schrubben nur geringe Veränderungen zu entdecken waren.
Perspektiven und Plakate
Zum Glück wurde es bald elf, was den Beginn des Lunches bedeutet.
Im Speisesaal musste ich meine Esskarte, die gelocht wurde, vorweisen. Auf ihr stand zu lesen, dass es für die Nachtschicht auch während der Nacht drei Mahlzeiten gebe, dass sie unübertragbar sei und dass sie nur zu täglich drei Mahlzeiten berechtige. Ich nahm wie die anderen vom Büfett der Reihe nach, was man mir reichte, Suppe, Fleisch, Speise, Kaffee und Milch. Das Essen war genießbar, wenn man auch anerkennen musste, dass dem Koch ein überaus scharfes Messer zur Verfügung stellen musste. Ich habe noch nie ein ähnlich dünnes Stück Fleisch gesehen.
Aber schwere Arbeit trägt nicht zur Hebung des Appetits bei, und so ließen die meisten trotz der kleinen Portionen den größten Teil stehen.
Die Frau, die mit mir am selben Tisch saß, war mit dem Essen sehr zufrieden. Sie erzählte, dass sie bisher im Hotel »Plaza« gearbeitet hat.
»Oh«, sagte ich, »das ist wirklich ein entzückendes Hotel.« (Es ist wirklich eines der schönsten und vornehmsten Hotels der Welt, dicht am Zentralpark gelegen, mit allem erdenklichen Komfort und Luxus.)
elVe
Die Frau mir gegenüber sah mich mit kugelrunden Augen an, als wäre ich nicht ganz bei Verstand.
»Das sagen Sie doch nicht im Ernst. Oder Sie haben wohl da nie gearbeitet. Entzückend mag es vielleicht für die Gäste sein, aber nicht für unsereinen, der dort arbeitet. Wir bekamen ganz ungenießbares Essen und mussten fast alles, was wir verdienten, für Lebensmittel ausgeben, und Arbeit gab es nicht zu knapp.« (Es kommt eben auf die Perspektive an, ob man ein Hotel schön finden kann oder nicht.)
Hier in unserem Speisesaal saßen die Stubenmädchen, die Reinemache- und Badefrauen, alle in verschiedenen Uniformen, man konnte ihre Beschäftigung an ihren Kleidern erkennen. Die Angestellten, die schon eine höhere Stellung einnahmen, saßen im Nebenraum, von dieser niederen Stufe getrennt. Während es um ihr leibliches Wohl besser bestellt war als um unseres, legte die Hotelleitung größeren Wert auf Hebung unserer moralischen Kräfte.
In unserem Speisesaal befand sich ein großes Plakat, auf dem ein Orchester abgebildet war und ein eigenmächtiger Bläser, der den Dirigenten und die Zuhörerschaft zur Verzweiflung brachte. Darunter aber war zu lesen: »Ich, mir, mich, mein gibt keine Harmonie, nur wer sich dem Ganzen fügt, kann den Menschen Freude bringen.«
Wir können also die Genugtuung haben, die Menschen zu erfreuen, denn fügen tun wir uns ja, ob wir wollen oder nicht. Die Plakate wechselten jeden zweiten, dritten Tag. Einmal war eins ausgestellt, das weniger die Interessen eines Hotelkonzerns seinen Angestellten gegenüber wahrzunehmen schien; ein Mann grub mit bloßer Hand Erde. Die Aufschrift lautete: »Scheue keine Mühe, grabe nach der Wahrheit. Was du selbst erfahren hast, nur daran glaube.« Eine gefährliche und seltsame Aufforderung in dieser Umgebung.
Während uns die Plakate versicherten, dass wir auch in niedriger Stellung nützliche Mitglieder der Gesellschaft sein können, zeigte uns eine Photographie, dass uns auch die Wege, die nach oben führen, offenstehen. Auf der Photographie waren Männer und Frauen in Overalls, d. h. in Arbeitskleidern, abgebildet. Darunter stand der vielversprechende Satz: »Diese Delegation hat in Overalls verschiedene Fabriken und Bergwerke im Auftrage der Regierung inspiziert. Mehrere Mitglieder der Delegation haben ihre Karriere selbst in Overalls begonnen.«
Der Ballsaal auf dem Dach und die Marmorsäulen
Den Ballsaal lernte ich nach dem Lunch kennen. Es war ein Riesensaal, zweiundzwanzig Stockwerke hoch über New York, umgeben von Säulen, die mir sofort, bevor ich noch mein zukünftiges Verhältnis zu ihnen ahnte, unsympathisch waren. Sie sahen aus, als wären sie aus Papiermaché und imitiertem Marmor, sie waren aber aus Marmor und imitierten nur Papiermaché. Diese Säulen aber sollte ich reinigen. Nur die unteren Teile, beruhigte man mich, ich brauchte nicht hinaufzuklettern. »Und wenn Sie fertig sind, bekommen Sie neue Arbeit.« Darauf verließ man mich, und ich blieb allein mit den Säulen, zur Säule erstarrt. Wenn ich fertig bin! Ich versprach mir, nie fertig zu werden. Ich versuchte die Säulen abzustauben, aber es war vergeblich, ich rieb sie mit einem nassen Tuch, es half nichts. Und was ging mich überhaupt eine so blöde, überflüssige Arbeit an? Wenn die Leute zwischen reinen Säulen tanzen wollen, sollen sie sie gefälligst selbst putzen. Soll ich mich zu Tode arbeiten, damit einige gelangweilte Leute in ihnen entsprechender Umgebung« irgendwie ihre Zeit totschlagen? Wäre ich zufällig Simson gewesen, so hätte jetzt leicht ein Unglück im Hotel »Pennsylvania« geschehen können.
Endlich kamen Leute, um die Marmorfliesen aufzuwischen. Sie begrüßten mich mit Hallos. Ich musste gleich erzählen, seit wann ich in New York lebe, welcher Nationalität ich bin, wo ich früher gearbeitet habe und ob ich die Arbeit liebe. Diese Frage: »How do you like it?«, die sich immer auf den »Job« bezieht, ist unter den Arbeitern genauso allgemein wie das »How do you do?« in der Gesellschaft. Wird sie von dem »boss« gestellt – »boss« heißt nicht nur der eigentliche »Arbeitgeber«, sondern jeder, der einem übergeordnet ist –, muss man sie mit einem fröhlichen »Yes, I like it« beantworten, andernfalls bedeutet es, dass man einen Bruch der Beziehungen wünsche. Diesmal durfte ich bekennen, dass ich sie nur wenig liebe. Meine Arbeitskollegen zeigten mir dann, wie man die Säulen mit einer Bürste behandeln muss. Sie halfen mir redlich. Ich erfuhr auch, dass meine Vorgängerin acht bis zehn Tage sich für diese Arbeit nahm, nach einer anderen Version sogar zwei Wochen. »Nur immer langsam«, klärten sie mich auf, »wenn Sie in dem Tempo arbeiten, wie man es von Ihnen verlangt, können Sie sich halb zu Tode arbeiten.« Und es ist wirklich notwendig, das Tempo »nur immer langsam« dem »schnell, schnell« der Gegenseite entgegenzustellen.
Wolkenkratzer ringsherum – und der Dichter im Lehnsessel
Meine Hand schmerzte, ich war müde, am liebsten hätte ich geheult. Oder habe ich wirklich geheult?
Denn ein alter Ire, der auch oben arbeitete, kam auf mich zu und sagte mir: »Kommen Sie doch, schauen Sie.« Er wies hinunter auf New York. Die Stadt zeigte sich uns ganz: dort, wo sie festlich gepflegt war, am oberen Hudson, und dort, wo dichte Fabrikschlote den Himmel verdunkelten. Und von allen Seiten sahen Wolkenkratzer zu uns herein. »Dear old New York«, sagte der Ire, liebes, altes New York. Das konnte ich nicht gerade finden.
Ja, es ist ungeheuer, dieses gigantische Durcheinander von Warenhäusern, Fabriken, Banken, Bürohäusern, alles voll Arbeit, Menschen, Hast. Und tief unten rasen die Autos, Menschen, Hochbahnen, rasen, halten, rasen, halten, ohne Pause. Die Wolkenkratzer sind zum Teil so nahe, dass wir in sie hineinsehen können. Überall sitzen, stehen, gehen Menschen, ein wahrer Schwarm von Menschen. Sie hantieren alle sehr geschäftig. Vielleicht packen sie Kaugummi, oder sie machen Seidenkleider, jeder täglich ein Dutzend, oder Kunstblumen oder Fransen.
Ist hier nicht Leere, das Nichts in höchster Potenz, fieberhafte Zwecklosigkeit?
Aber wie sie aufleuchten, die Wolkenkratzer, und unten welches Leben, welche Bewegung, welches Tempo! Die Leere, das Nichts können nicht groß sein. Und sicher bereitet sich auch hier die Zukunft vor.
Später kommen immer mehr Leute hinauf. Sie bewundern, in Begleitung des Hotelführers, die Aussicht.
In der Mitte des Saales sitzt sehr bequem ein junger Mann. Vielleicht würde ich es nicht bemerken, wie sehr bequem er sitzt, wenn ich nicht so müde wäre. Er sitzt in einem bequemen Lehnsessel, der jedenfalls sehr bequem aussieht. Vielleicht ist er ein Dichter, denn er hält einen Füllhalter in der Hand und schreibt in ein Büchlein. Es könnte natürlich auch sein, dass er seine Ausgaben zusammenrechnet. Aber wenn man das tut, blickt man nicht so versonnen, so gedankenvoll auf die Wolkenkratzer ringsherum. Auch schaut er sich angelegentlich immer nach uns um, die hier arbeiten. Ich weiß nicht, ich habe die feste Überzeugung: Der junge Mann im Lehnsessel ist ein Dichter, eine Hymne auf die Arbeit.
Die Zufriedene und die anderen
Das Zimmer sah jetzt aus wie ein Hospitalsaal für Schwerkranke. Die Frauen lagen da wie Tote, vollkommen unbeweglich. Es waren außer meinem nur noch vier Betten besetzt. Mein Kommen erregte nicht die geringste Aufmerksamkeit. Das Zimmer war denkbar einfach: die Betten rein, aber wie waren sie schmal und leicht. Überdies standen sie auf Rädern, so dass man, wenn man sich umdrehte, in die Mitte des Zimmers rollte. Außer dem Blechschrank waren noch zwei Kommoden im Zimmer; die eine war mit Heiligenbildern und dem Bildnis des Papstes geziert, außerdem gab es noch zwei winzige Schaukelstühle als Belohnung für diejenigen, die schon lange hier waren. Das »Bad« existierte zufällig wirklich, man konnte jederzeit baden, und die Badezimmer waren rein und modern. Meine Nachbarin war die Zufriedene, am Anfang war sie mir unheimlich. Sie zog sich nie aus; sie lag mit Schuhen und Kleidern in ihrem Bett. Unter der Uniform trug sie noch ein schwarzes Kleid. Ihr Gesicht war erschreckend mager und gelb, und ihre Hände schienen nur aus Adern zu bestehen. Nachts schlief sie nicht, sie saß unbeweglich und starrte ins Dunkle, oder sie stand auf und ging zum Fenster und blickte hinaus, unbeweglich, stundenlang, aber draußen war nur der dunkle Schacht und nichts zu sehen.
Als ich sie fragte, warum sie nicht schläft, war sie überrascht. Wieso? Sie schliefe doch immer ausgezeichnet. Ich fragte sie, ob sie nicht müde sei. Ein bisschen war sie schon müde, aber das wäre nicht der Rede wert. Sie hätte überhaupt immer Glück im Leben gehabt, immer wäre es ihr gut ergangen. Sie war vor einem Jahr aus Irland herübergekommen. Es gefällt ihr hier sehr gut. New York ist eine sehr schöne Stadt. Während ich dort war, ging sie nie aus. Wenn man aus unserem Zimmer blickte, sah man nur Wände. Sie war Badefrau und arbeitete im Dampfbad. Viel konnte sie von der Außenwelt auch hier nicht sehen. Ich erkundigte mich, ob sie sonst öfter ausging. Ach nein, das nicht. Was sollte sie draußen in den Straßen umherlaufen. Nein, nicht wegen der Müdigkeit, aber hier war es doch nett. Anfangs mochte sie nicht so gern hier sein, aber jetzt gefiel es ihr. Später würde es mir auch sehr gefallen, versicherte sie. Sie hatte hier eine Schwester, aber sie wohnte leider so weit. Aber sie besuche sie doch manchmal, das wäre dann immer sehr nett. Sie verdiene hier im Monat dreißig Dollar, das wäre doch schön. Mit den Trinkgeldern sei nicht viel los. Sie sei seit vier Monaten hier und habe im ganzen nicht mehr bekommen als drei Dollar. Aber sie erinnert sich genau an das Datum, wann sie ein »tip« bekommen hat, wieviel und von wem. Besonders ausführlich beschreibt sie eine Frau, die ihr fünfzig Cent gegeben hat. »Ja, die Reichen«, sagt sie, »ich habe mein ganzes Leben lang für die Reichen gearbeitet, aber ich habe mich dabei immer gut gestanden.« Und sie sieht auf sich herab, auf ihre Magerkeit, auf ihre abgearbeiteten Hände, und lächelt zufrieden und heiter. Ist sie ironisch? Sie ist es auf ganz ahnungslose Weise. Oder ist auch diese Ahnungslosigkeit Ironie?
Das Gegenspiel der Irländerin ist die »Dame«. Sie kleidet sich immerfort um. In der Arbeitspause von einer halben Stunde wechselt sie zweimal die Kleider. Wenn sie ihre Freundin besucht, die einige Zimmer weiter wohnt, zieht sie ihr Jackenkleid an, Hut, Handschuhe und Pelzboa. Sie sagt, wenn ich nicht arbeite, bin ich keine Badefrau, sondern eine »lady«. Zum Abendessen, um fünf, kommen die meisten in Zivil, in Seidenkleidern, und vergessen nicht das Eitelkeitstäschchen, »the vanity case«, mit Schminke und Puder. Sie gehen nicht jeden Tag aus, sie sind zu müde, und das kostet auch zuviel; wenn sie eingeladen werden von dem »fellow«, das ist was anderes. Sie gehen gern zum »dancing«, doch das kann man nicht alle Tage. »Aber«, sagt die eine, »wir sind keine Fabrikmädchen. Wir haben es nicht nötig, uns einladen zu lassen. Wir haben doch unser Essen!« Ob sie gern hier ist, frage ich die Deutsche. Sie ist schon in Amerika geboren, war noch nie in Deutschland, sagt aber, sie sei eine Deutsche. Sie kam zu mir, weil sie gehört hatte, ich sei vor kurzem aus Deutschland gekommen. Sie arbeitet schon seit sechs Jahren in diesem Hotel. Nun, meint sie, man darf vom Leben nicht zuviel erwarten. Man hat jeden zweiten Sonntag frei, aber erst, wenn man einen vollen Monat hier gearbeitet hat, und nach einem Jahr bekommt man sogar eine Woche frei, und es gibt einen Arzt frei für die Angestellten, Trinkgeld bekommt sie auch hie und da. Sie hat schon viel Schlimmeres erlebt. Aber wie gesagt, man darf vom Leben nicht zuviel erwarten.
Wir sitzen jetzt im »Salon der Dienstmädchen«, der genau, aber haarscharf genauso aussieht, wie man sich ein »drawingroom for maids« in dem »größten Hotel der Welt« vorstellt. Mit ebensolchen abgenutzten, schiefen, zerdrückten, billigen Möbeln, mit so schmutzig farblosen Wänden, mit so grauer, abgestandener Luft! Die Mädchen kauern in ihren Seidenkleidern todmüde auf den Stühlen. »Keinen Schritt mehr könnte ich weitergehen«, sagt eine, die Pantoffeln anhat. »Ich habe morgen frei«, sagte ihre Freundin. »Ach, wie ich mich freue. Ich werde den ganzen Tag einkaufen, die Schaufenster angucken.«
Zwei Neue kommen herein. Sie sind sehr gut angezogen und sehr hübsch. Sie sind eingeladen. Müde? Das wird schon beim Tanzen vergehen. Man muss doch auch etwas vom Leben haben.
Die mit den Pantoffeln schüttelt missbilligend den Kopf: »Wenn das nur nicht schlecht endet.« Und auch die anderen, die müde auf den Stühlen kauern, schütteln die Köpfe. Die Irländerin sitzt angezogen im Bett. Auf der Kommode stehen die Heiligenbilder und das Bildnis des Papstes und sehen mich an. Die Wecker ticken sehr laut. Links von der Kommode schläft die Besitzerin der Heiligenbilder, rechts die des Papstes.
Die Besitzerin der Heiligenbilder ist sehr gutmütig und still, aber sie schnarcht sehr laut. Wenn sie nachts erwacht, kniet sie sich hin vor ihrem Bett und betet flüsternd. Sie steht um halb sechs Uhr auf. Jeden Tag geht sie vor dem Frühstück in die Kirche.
Die Besitzerin des Papstes ist weniger gutmütig, aber auch sie schnarcht.
Die Luft ist sehr schlecht. Und es ist schwer, einzuschlafen.
Die Hotelgalerie
Ich kann mir etwas Amüsanteres vorstellen, als künstliche Blumen abzuwaschen. Aber die Hotelgalerie, wo das geschieht, ist ganz amüsant. Man kann von ihr hinunterblicken auf die Hotelhalle. Unten kommen Reisende an, Telegraphenjungen schreien Namen, Koffer werden gebracht, Boys laufen mit Zeitungen umher. Die Hotelgalerie erinnert an die Galerie eines Konzertsaales, nur ist sie viel breiter, und Teppiche und künstliche Blumen »schmücken« sie. Von hier führen die Wege zur Kunstausstellung, zur Bibliothek, zu den Schreibzimmern, zur Hotelbank und zum Zahnarzt. (Es stellte sich übrigens heraus, dass die Ordinationszimmer des Zahnarztes existierten. Nur musste ich die Arbeit, von der mir allein etwas gesagt wurde, von acht bis neun Uhr in der Früh erledigen.) In der Hotelgalerie ist ein ständiges Kommen und Gehen. Leider muss auch ich ständig kommen und gehen, mit einem Eimer Wasser, das abwechselnd rein oder schmutzig ist. Die Leute sitzen ringsumher. Sie langweilen sich und rekeln sich in den Sesseln. Sie sehen zu, wie ich arbeite. Wahrscheinlich denken sie: Die strengt sich aber auch nicht sehr an. Und die Frauen: Die Perle möchte ich auch nicht zu Hause haben. Denn ich beeile mich nicht. Ich gebe mir das Tempo an: sehr langsam, und befolge es auf das gewissenhafteste. Ich hätte nicht übel Lust, wenn ich mit dem Eimer voll schmutzigem Wasser vorbeigehe, »zufällig« einige Leute abzuschütten. Es gelang mir nur einmal, und da dachte ich gar nicht daran. Oh, die Lackschuhe, und die wütenden Augen, und obendrein musste ich auch noch lachen.
Vincent Lopez spielt Jazz
Sie sitzen im Grillroom, gesittet, gelangweilt, gut angezogen, wie es sich ziemt.
Vincent Lopez aber, berühmtester Jazzbandspieler der Welt, lässt eine quiekende, heulende Meute von exotischen Tieren in den Saal springen, wilde Afrikaner zu Kriegstrommeln tanzen, eine besoffene Bauernhochzeitsgesellschaft vorbeigrölen.
Wenn ich im Grillroom säße, würde diese Musik wahrscheinlich auch meine Magennerven wohltuend beeinflussen, denn sie essen sehr ausgiebig, die Gesitteten. Ihr Gesicht bleibt zwar gelangweilt, aber die wilden Naturinstinkte zeigen sich im Vertilgen von lebendem und totem Getier.
Wenn man aber im Vorraum dieses Grillrooms Nickel reinigt, befeuert die wilde Musik der Neger nur wenig zur Tat, wenn diese Tat Nickelputzen sein soll. Man möchte schon eher eine richtige, quiekende, heulende Meute von exotischen Tieren in den Grillroom springen lassen und sehen, ob auch dann die Gesitteten so gelangweilt blieben.
Ein ganz kleiner Dialog zwischen zwei Stubenmädchen
Szene: Ein Ordinationszimmer des Zahnarztes. Auf dem Schreibtisch stehen in einer Vase sehr zarte Teerosen. Das eine Stubenmädchen: »Hast du die schönen Rosen gesehen, die der Doktor wieder bekommen hat?«
Das andere Stubenmädchen (es ist seit vier Jahren im Hotel Pennsylvania): »Hast du sie schon abgestaubt?« –
Wenn man ein Hotel, in dem man Angestellte war, für immer verlässt, so ist das umständlich wie ein Grenzübertritt.
Man wird von mehreren Damen einem wahren Kreuzverhör unterworfen. Wie? Warum? Wieso? Man bleibt doch nicht so kurze Zeit in einer »guten« Stellung.
Ich erkläre ihnen, dass ich die Dame, die mich aufgenommen hatte, missverstanden habe.
Aber ich scheine doch etwas verdächtig zu sein. Ich muss meine Nummer, meine Esskarte, meine Uniform, meine Arbeitskarte übergeben, dann meinen Koffer herunterholen, dann warten. Das alles nimmt fast einen ganzen Tag in Anspruch. Endlich kommt eine Dame, lässt mich den Koffer öffnen, schaut in ihn hinein. Ich schließe ihn, denke, die Sache ist erledigt. Eine andere Dame kommt aber, lässt mich den Koffer wieder öffnen, untersucht ihn. Erinnerungen an Reisen in der Nachkriegszeit erwachen. Endlich erscheint eine dritte Dame mit Bindfaden und Blei und plombiert den Koffer. Es ist Vorschrift, dass Angestellte nur mit plombierten Paketen oder Koffern das Hotel verlassen dürfen, obgleich man sich nicht recht vorstellen kann, dass jemand auf die Idee verfiele, einen Topf künstlicher Palmen in seinen Koffer einzupacken, und die Juwelen, um die es sich schon eher lohnen würde, hätte man schon längst jederzeit in der Tasche wegtragen können. Draußen sieht der Portier die Plombe an und schneidet den Bindfaden ab. Ich stehe draußen vor der Pennsylvania-Station. Ganz so, als hätte ich eben die Grenze eines fremden Landes überschritten.
Automat unter Automaten
Eine der größten über ganz New York verstreuten Massenabfütterungsanstalten ist das Automatenrestaurant Horn & Hardart. Hier versuchte ich, Arbeit zu erhalten.
Die Zentrale für Angestellten-Beschaffung
Warteräume. Für Männer und für Frauen. Der Warteraum für Männer erinnert an ein Schulzimmer. Die Stühle alle nach einer Richtung gestellt. Auf einer Erhöhung, wie der Herr Lehrer, sitzt der Mächtige, der den Angestelltenstab zusammenstellt. Die Männer sitzen da, lesen Zeitungen und warten anscheinend auf etwas. Man kann nicht gleich herausbekommen, worauf. Der Mächtige hält einen Telephonhörer in der Hand und ruft zwischendurch etwas ins Zimmer hinein: »Ein Salatmann! Kein Sandwichmann hier?« Da sich niemand meldet, ärgert er sich. »Nie kommen solche, die man brauchen kann.« Nachdem ich vergeblich versuche, mich irgendwie bemerkbar zu machen, gehe ich in das Wartezimmer für Frauen. Hier ähnelt es mehr dem Warteraum eines Zahnarztes, mit dem Unterschied, dass die Wartenden zahlreicher sind und dass sich die Lektüre nicht auf den Tischen, sondern an den Wänden befindet.
Goldene Sprüche an der Wand
Wohin man blickt, überall Weisheit. Man kann sich die Zeit auf die nützlichste Art und Weise vertreiben. So kann man z. B. lesen: »Eine Dummheit ist nur dann wirklich eine, wenn man sie zum zweitenmal begeht.« (Dieser Spruch stammt, wie mitgeteilt wird, von Lincoln.) Nicht weniger beherzenswert scheint ein anderer: »Wenn du erregt bist, zähle bis zehn und dann schweige.«
Ich konnte aber nur wenig in dieser kleinen Weisheitsschule profitieren, ja nicht einmal recht meine mitwartenden Genossinnen betrachten, denn der Allmächtige stieg von seinem Thronsessel und begab sich in unser Zimmer. Diesmal bin ich es, die er aus der Menge herauspikt. Er fragt mich nur nach meiner Adresse, dann gibt er mir einen Zettel für die Filiale in der 14. Straße.
Erst in der 14. Straße, wo ich sofort eine Nummer, diesmal bin ich nur Nummer zwölf, und eine Uniform, die mir zweimal zu groß ist, erhalte, erfahre ich, dass ich angestellt wurde. Ein ganzer Schwarm Mädchen umgibt mich, die mein Kleid mit Hilfe von Stecknadeln zurechtmachen, eine drückt mir eine weiße Haube auf den Kopf, eine andere zupft an meiner Schürze. Dann werde ich in den Saal geschoben, und man drückt mir ein Tablett in die Hand. Ich weiß nun, dass ich ein »busgirl« bin, d. h. ein Omnibus, der mit Geschirr vollgepackt hin- und herrollt; ganz einfach ausgedrückt, ist meine Lebensaufgabe von nun an, Geschirr abzuräumen.
Ich stehe da mit einem Tablett, und draußen lärmt, schreit, rast die 14. Straße, mit ihrem Dutzend Kinos, mit ihren Vaudeville-Theatern, Dancings und Schießgalerien, mit Radios, Grammophonen, Pianolas, mit Dutzenden Lunchrooms, Coffee Pots, mit Fünf- und Zehncent-Geschäften und »noch nie dagewesenen Gelegenheitsverkäufen«. Aber auch mit besonderen Überraschungen: einer laut spielenden Jazzband im Schaufenster eines Herrenbekleidungsgeschäftes oder einem anderen Schaufenster, in dem ein schwarzmaskierter Mann erscheint und auf eine schwarze Tafel schreibt: »Wollen Sie Erfolg haben? Wollen Sie eine gut bezahlte Arbeit? Dann müssen Sie sich gut kleiden. Gut kleiden können Sie sich nur bei uns. Kommen Sie herein. Überzeugen Sie sich.«
Und die Menge der Straßenverkäufer. Der Muskelmensch mit dem leberkranken Gesicht, der auch bei schlechtestem Wetter, nur mit einem Trikot angetan, seine einzig erfolgreiche Gesundheitsmethode demonstriert und gleichzeitig seine eigenen Werke über gesunde Lebensweise verkauft. Und der Mann mit wallendem Haar bis auf die Schultern, der unfehlbare Haarwuchsmittel feilbietet. Und da sind eine Unmenge Bettlerinnen, Blinde und Straßenredner. Die Menge, die hier auf und ab flutet, besteht aus allen Nationen der Welt. Sie alle aber jagen im gleichen Tempo den gleichen Vergnügungen, den gleichen Erfolgen nach.
Die Roboter
Die ganze Straße strömt in das Automatenrestaurant hinein, von früh morgens bis spät in die Nacht. Aber hier wird nicht zum Vergnügen gegessen. Hier essen die Roboter, Deutsche, Amerikaner, Juden, Chinesen, Ungarn, Italiener, Neger. Jede Rasse ist vertreten. Man hört alle Sprachen der Welt, es bleiben Zeitungen liegen mit hebräischen und chinesischen, mit armenischen und griechischen Zeichen und in exotischen Sprachen, die man gar nicht erraten kann. Man wird durch unverfälschte sächsische und bayerische Dialekte überrascht, und man sieht Leute Tee schlürfen, wie nur russische Bauern ihren Tee trinken.
Und doch sind sie sich alle so ähnlich, wie zwei Brüder sich ähnlich sein können. Sie tragen alle die gleichen billigen Kleider, die gleichen Hemden, die gleichen Ausverkaufsschuhe, sie essen alle jeden Tag die gleiche Tomatensuppe, die gleichen Sandwiches: Schinken mit Salat, Ei mit Salat, Käse mit Salat, Sardinen mit Salat, sie verdienen den gleichen Wochenlohn, sie arbeiten alle gleich schwer, gleich lang.
Die Roboter essen meist stehend, oder sie sitzen nur gerade so lange, bis sie die nötigen Kalorien und Vitaminmengen zur Instandhaltung der Maschine zu sich genommen haben. Sie werden von klein auf zu dem Tempo erzogen, das sie, wenn sie in dieser Welt vorwärtskommen wollen, einhalten müssen. »Hurry up« (schnell, schnell) mahnen die sorgfältigen Eltern ihre Kinder, die Kuchen essen und Milch trinken. Die halberwachsenen Roboter sorgen schon selbst für sich. Sie tragen Western-Union-Uniformen oder die von Banken, Kaufhäusern, Hotels. Oft stehen sie lange vor den Automaten. Wozu sollen sie sich entschließen: Milchspeise oder Eiscreme? Meist siegt doch die Liebe über den Verstand. Sie essen Eiscreme.
Automaten, Automaten
Die Automaten sind Glasschränkchen, die prahlerisch ihren Inhalt zeigen. Sie bleiben kühl verschlossen, auch vor dem hungrigsten Magen, lassen sich aber mit einem kleinen, leichten Griff öffnen, wenn man die ihrem Inhalt entsprechende Anzahl von Nickeln entrichtet.
Aber auch hinter den Automaten stehen unsichtbar in dem schmalen, heißen Gang Automaten. Sie legen Sandwiches auf Teller, immer wieder neue, sie verteilen Kuchen und Kompott. Sie füllen die Samoware mit Tee und Kaffee, sie verteilen Suppe, Gemüse und Fleisch.
Wir anderen Automaten tragen die schweren Tablette, räumen immer wieder das schmutzige Geschirr ab, das sich alle fünf Minuten auf jedem Tisch von neuem auftürmt. Automaten stehen ganz unten in der Tiefe, Negerautomaten, und waschen Geschirr, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Automaten sitzen an der Kasse und wechseln Fünfundzwanzig-, Fünfzigcentstücke, Dollars in Nickel um. Sie geben Nickel aus, den ganzen Tag, den ganzen Abend, immer Nickel, Nickel. Und Automaten gehen auf und ab zwischen den Tischen und geben acht, den ganzen Tag, den ganzen Abend, ob die Essautomaten auch ihre Pflicht erfüllen, den ganzen Tag, den ganzen Abend, und essen, schnell essen.
Manchmal bekommen die Automaten so etwas wie ein Gesicht.
Ein besonders fleißiger Automat, er ist eine Frau, fiel mir auf, der immer mit hochgetürmtem Tablett hin- und hergeht. Nicht spricht. Immer nur Geschirr schleppt. Vollkommenster Automat. Und plötzlich erblickt man hinter dem Automaten ein menschliches Gesicht. Ein ganz und gar nicht merkwürdiges, ganz gewöhnliches, sächsisches; das Gesicht einer deutschen Kleinbürgerin. Sie ist seit zwei Jahren in Amerika. Sie hat bisher als Dienstmädchen gearbeitet, wie vier Pferdeknechte, versichert sie. Und sie hat viel geweint in Amerika, wo man nur Arbeit und den Dollar kennt. Aber hier, meint sie, sind wir im Paradies. Sie gibt natürlich zu, dass es nur ein verhältnismäßig schlichtes Paradies sei. Aber wir haben vierzehn Dollar Wochenlohn und können essen, soviel wir wollen und was wir uns aussuchen, meint sie. Und man sagt zu ihr Lady. Und wenn die Uhr geschlagen hat, ist Schluss. Sie ist sehr fleißig, denn sie möchte nicht, dass man sie wegschickt.
Eine Russin ist da, die kein Wort Englisch kann. Sie nimmt immer, wenn sie eine Minute Arbeitspause macht, einen Zeitungsausschnitt hervor. Es ist die Photographie einer Frau. Sie besieht sie immer lange, dann arbeitet sie weiter. Eine kleine Spanierin hat sich von ihrem Wochenlohn lange Ohrgehänge gekauft. Es war eine Sensation. Einmal kam sie fünf Minuten zu spät. Man hat sie mit einem Mann vor dem Geschäft gesehen. Das war eine noch größere Sensation. Später bekommen auch manche Gäste ein Gesicht. Es gibt sogar einige, die sich nicht zu dem üblichen Tempo zwingen lassen. Sie sitzen ruhig zur größten Empörung des Managers stundenlang vor einer Tasse Kaffee, bringen Bücher mit und sprechen über die überflüssigsten Sachen. Nicht über den Wochenlohn und über den »Job«, den sie haben, sondern über Politik und neue Literatur. Aber man sieht ihnen auch an, dass sie zu ihrem eigenen Schaden die amerikanische Lebensweisheit ignorieren. Einmal geschah es, dass die ganze Gesellschaft bei einer einzigen Tasse Kaffee saß.
Der Manager duldete eine Zeitlang, wenn auch mit sichtlich unzufriedener Miene, den Unfug. Endlich konnte er nicht länger an sich halten, er ging zu der Gesellschaft und hielt ihr folgende Rede: »Meine Herren, Sie scheinen den übrigens respektablen und ehrlichen Beruf der Hungerkünstler auszuüben. Es wundert uns nur, warum Sie dann unser Restaurant mit Ihrer werten Gegenwart beehren. Sollten Sie aber das Hungern nicht aus Beruf, sondern aus Notwendigkeit ausüben, befolgen Sie meinen Rat, lassen Sie Ihre Bücher im Stich und suchen Sie sich bessere Arbeit.«
Da ist noch ein junger Mann, der immer liest, während die Kaffeetasse halbvoll vor ihm steht. Bevor er das, was er bezahlte, nicht verzehrt hat, ist es sein gutes Recht, zu sitzen, und kein Manager kann ihn aus dem Paradies vertreiben. Einmal aber passierte es ihm, dass er aus Zerstreutheit den Kaffee austrank bis zum unwiederbringlich letzten Tropfen. Und er musste nun gegen uns alle, die seine Tasse fortnehmen wollten, einen harten Kampf führen. Während er krampfhaft die leere Tasse festhielt, las er mit größtem Eifer den »Bürgerkrieg in Frankreich« von Karl Marx. Manchmal saßen auch Liebespaare da. Sie saßen und sprachen und sprachen und saßen. Sie alle waren mir sympathisch. Ich mochte es gern, wenn sie sich an meine Tische setzten. Sie haben nicht viel Geschirr schmutzig gemacht.
Neger und Negerinnen
Man ist bei Horn & Hardart liberal den Negern gegenüber. Man sieht sich die Nickel, die die Automaten füllen, nicht danach an, ob sie von weißen oder schwarzen Händen entrichtet wurden. Es arbeiten viele Neger hier. Sie sind gute Arbeiter. Es ist vorteilhaft, vorurteilslos zu sein.
Manchmal sieht man reizende Negerinnen. Ich sah hier einmal eine in schreiend buntem Kleid mit einem in allen Farben schillernden Hut. In dieser für eine Europäerin unmöglichen Aufmachung sah sie wie eine richtige Urwaldschönheit aus. Zwischen einer Kreolin und einer schönen Negerin kann man kaum noch Unterschiede entdecken. Aber die Neger haben eine untrügliche Probe dafür, wer Negerblut in den Adern hat. Da hat auch eine kleine Kreolin aus Westindien gearbeitet. Sie war sehr hübsch, aber so dunkel, dass man sie spaßeshalber verdächtigte, nicht rasserein zu sein. Man vollzog an ihr die Negerprobe. Die besteht darin, dass man die Halshaut zu ziehen versucht. Gibt sie nicht nach, ist die der Probe Unterworfene nicht rasserein. Die Negerinnen zeigten dann, wie es bei einer richtigen Negerin sein muss. Sie können die Halshaut wie Gummi ziehen. Die kleine Kreolin, deren Haut fest blieb, sah diesen Kunststücken mit aufrichtigem Neid zu.
Ein Neger, der viele Negerlieder sang, philosophierte auch gerne. Er sprach lange und oft darüber, dass den großen Unterschied zwischen Mensch und Mensch nicht die Hautfarbe, sondern nur das Geld ausmacht. Und er konnte seine Behauptungen immer mit guten, dem Leben entnommenen Beispielen belegen. »Ein Neger kann nicht in ein jedes Restaurant essen gehen, das ist wahr«, sagte er, »aber können Sie vielleicht essen, wo Sie wollen? Versuchen Sie es doch, gehen Sie zu Ritz; oder machen Sie eine Reise, oder setzen Sie sich in eine Theaterloge. Freiheit ist, wo Geld ist. Zwischen denjenigen, die einige Dollars haben, und zwischen mir, der keine hat, ist der Unterschied nur winzig«, sagte er. »Ist vielleicht der Manager ein freier Mann, weil er mir befehlen kann? Er darf mir ja nur das befehlen, was man ihm befiehlt, mir zu befehlen. Ist es nicht so? Und wie klein ist der Unterschied zwischen den Dollars, die er verdient, die ich verdiene, wenn man sie mit dem Dollargewinn der Gesellschaft vergleicht. Ist es nicht so?« Und wir alle mussten zugeben, dass an dem, was er sagte, etwas Wahres sei.
Die Organisation der Massenabfütterungsgesellschaft
Man muss bekennen, sie ist bewunderungswert. Allein in der Filiale der 14. Straße speisen täglich Zehntausende. Man kann jederzeit warm essen. Alles funktioniert auf die Minute. Dabei ist der Raum, wo die Speisen verteilt werden, unglaublich klein. Eine Küche existiert in den Filialen überhaupt nicht. Es wird alles in einer Zentralküche hergestellt, die Suppen und das Gemüse gekocht, das Fleisch zerschnitten und bratfertig hergestellt. Dort werden die verschiedenen Brotsorten und Kuchen gebacken. Dort ist die Zentraleinkaufsstelle, von dort wird der Bedarf aller Filialen, es gibt ihrer in New York zweiundvierzig, gedeckt. Alles, was gebraucht wird, kommt in Kisten an, auch die Suppen in hermetisch verschlossenen Behältern. Die Speisen werden nur aufgewärmt.
Dabei ist der Betrieb denkbar unbürokratisch. Es wird nur wenig gezählt und aufgeschrieben. Es gibt nicht einmal Karten für Arbeitszeitkontrolle, aber man wird »gewatscht«, wie mir die eine deutsche Frau sagte. Eine philologische Erklärung ist hier nötig. »Watschen« stammt vom »watch«, beobachten. Und man wird sehr scharf beobachtet. Ein wahrer Ring von Aufsehern umgibt uns. Es ist unmöglich, auch nur eine Minute die Arbeit stehenzulassen, und ich glaube kaum, dass es jemandem gelingen könnte, etwas wegzutragen.
Die Fünfcentstücke werden von einer Zählmaschine gezählt, die mit einer Fleischhackmaschine Ähnlichkeit hat. Wenn die Automaten geleert werden, erfüllt der Klang der rieselnden Nickel den ganzen Raum. Hier wird erst recht »gewatscht«.
Die endlose Zeit
Wenn man mit einem schweren Tablett auf- und abgeht, immer auf und ab, wie endlos wird dann die Zeit. Die Minuten dehnen sich, das Ende der Stunden ist nicht abzusehen. Teller, Tassen, Schüsseln abräumen, immer von neuem abräumen. Ich nehme mir vor, nicht eher auf die Uhr zu schauen, als bis ich das Tablett zehnmal zum Abwaschen befördert habe. Ich mache meine Arbeit absichtlich langsam, bleibe manchmal träumerisch stehen. Die Füße tun verdammt weh, und erst der linke Arm. Die zehnte Runde. Sicher ist schon mindestens eine halbe Stunde vergangen. Man blickt auf die Uhr und sieht, es sind erst fünf Minuten vorbei. Das ist hoffnungslos.