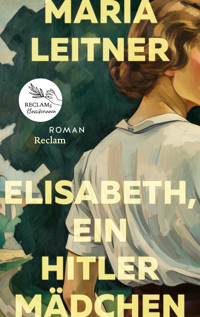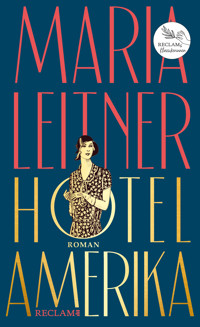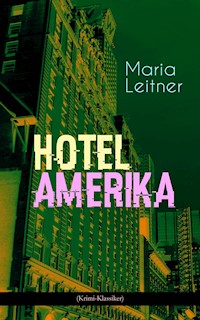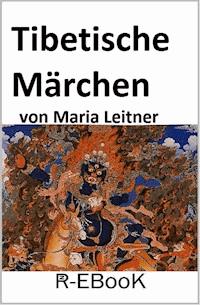0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Verbrannte Bücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Aus der Reihe der "verbrannte Bücher" "Hotel Amerika" war ein früher sozialkritischer Roman. Wahrscheinlich das erste Buch aus europäischer Sicht, dass die Ausbeutung der hoffnungslosen arbeitenden Bevölkerung in den USA thematisierte. Im "Hotel Amerika", das sinnbildlich für den amerikanischen Traum des "Jeder kann es schaffen" steht, aber auch als reales Gebäude der Geschichte seinen Namen gibt. Im "Hotel Amerika" treffen Sie aufeinander: Die Putzfrau Shirley, die sich schwört, eines Tages selbst als Gast im "Hotel Amerika" abzusteigen, ihre Mutter Celestina, die längst schon aufgegeben hat und sich nur durch den Tag und ihr Leben quält. Wir treffen auf den dubiosen Mr Fisher, der im Hotel auf Opfer lauert, oder auf den "schönen Alex", der seinem Traum von der eigenen Bar nachjagt. Als bekennende Marxistin machte sich die Autorin schnell das Dritte Reich zum Feind. Schon früh wurde sie mit Veröffentlichungsverboten belegt. Ihre Lage war exemplarisch für viele der leider vergessenen Autoren nach der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2025
Sammlungen
Ähnliche
Maria Leitner
Hotel Amerika
Roman
Maria Leitner
Hotel Amerika
Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962810-56-6
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Autorin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autorin
Maria Leitner (1892–1942) war eine deutschsprachige ungarische Journalistin und Schriftstellerin. Die Tochter einer deutschsprachigen jüdischen Familie lebte seit 1896 in Budapest, bevor sie 1910-13 in der Schweiz studierte.
Gegen Ende des Ersten Weltkrieges gründete sie den Kommunistischen Jugendverband Ungarns mit und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei.
Zwischen 1925 und 1930 reiste sie mehrmals nach Nord-, Mittel- und Südamerika. Ihre Sozialreportagen aus Amerika hat Maria Leitner in der Reportagesammlung »Eine Frau reist durch die Welt« zusammengefasst.
Als bekennende Marxistin machte sich die Autorin schnell das Dritte Reich zum Feind. Schon früh wurde sie mit Veröffentlichungsverboten belegt. Ihre Lage war exemplarisch für viele der leider vergessenen Autoren nach der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933.
Nach dem Sturz der Räterepublik zog sie über Wien nach Berlin. 1933 floh sie von den Nationalsozialisten über Prag nach Frankreich.
Nachweislich kehrte sie mehrfach illegal nach Deutschland zurück und berichtete u. a. über die geheimen Kriegsvorbereitungen. Durch ihre Publikationen vermittelte sie dem Ausland wesentliche Tatsachen über die Verhältnisse im nationalsozialistischen Deutschland.
Im Mai 1940 wurde Maria Leitner von den französischen Behörden zusammen mit anderen deutschen Exilanten interniert. Ihr gelang die Flucht, doch retten konnte sie sich nicht mehr. Auf der Flucht vor den Nazis wurde sie vor Erschöpfung in den Tod getrieben.
1
Shirleys Kopf hängt schräg aus dem schmalen Bett. Eine unbequeme Lage. Doch ihre schlafenden Züge sind von einem Lächeln belebt. Shirley hat angenehme Träume …
Sie tanzt und schwebt dahin auf einer Spiegelfläche, die tausendfach ihr Bild zurückwirft. Sie sieht sich so, wie sie es sich immer gewünscht hat: schön, strahlend, in einem wundervoll fließenden Kleid, geschmückt mit Steinen, in denen sich das Licht in allen Farben herrlich bricht.
Sie schwebt dahin am Arm eines jungen Mannes, der sie nun behutsam eine breite, glitzernde Marmortreppe hinabführt. Blumen leuchten an ihrem Wege.
Unten erwartet sie ein Auto – so groß, wie sie noch keines gesehen hat. Und Koffer sind hinten im Auto aufgetürmt! Sie haben die merkwürdigsten Formen; alle sind farbig, und Shirley weiß im Traum: sie sind vollgepackt mit den schönsten Sachen, die alle ihr, nur ihr gehören. Sie weiß, sie wird durch die ganze Welt jagen mit diesem Ungeheuer von Auto.
Shirley fühlt – jemand hält ihren Kopf zwischen den Händen und flüstert leise ihren Namen. Sie lächelt. Sie wird geliebt …
Shirleys Kopf ruht wieder auf dem Kissen.
Ihr Name dringt jetzt lauter in sie.
»Shirley, du musst aufstehen, du kommst zu spät zur Arbeit.«
Sie möchte weiterträumen, will nichts hören von der Außenwelt, aber von allen Seiten rütteln die Geräusche an ihr – sie muss die Augen öffnen.
Zuerst sieht Shirley eine große, starke Hand, die sich warm und ein bisschen rau auf ihren Arm gelegt hat, eine Hand mit vielen dicken Adern und einer von Lauge zerfressenen Haut. Die Hand streichelt leicht ihren Arm. Sie muss aufblicken und in das breite, ruhige Gesicht ihrer Mutter sehen.
Celestina trägt ein blauweiß gestreiftes Arbeitskleid, das die Art ihrer Beschäftigung hier im Hotel verrät; sie ist Scheuerfrau. Wieder flüstert sie Shirley aufmunternd zu.
»Komm, du musst machen, dass du aus dem Bett kommst. – So ein Faulpelz!«
Wenn Shirley erwacht, ist das fast immer ihr erster Anblick: die Mutter, die an ihrem Bett sitzt und sie aus dem Bett zu jagen versucht.
Aber sie möchte weiterträumen und nicht dieses Zimmer sehen. Wie gut sie es kennt, wie sie es hasst!
Erst sieht sie die Fahnenstange auf dem flachen Vorsprung des Daches. Bei starkem Wind knarrt die Stange, und Shirley hat dann das Gefühl, als flöge das Zimmer wie der Raum eines Luftschiffes zwischen den Wolkenkratzern. Sie scheinen ganz nahe zu sein. Manche der Gebäude sind wie mächtige Berge, andere, die schmalen weißen Türme, ragen wie übergewaltige Eisblöcke in die Luft.
Das Zimmer ist sehr hell, hier im höchsten Stockwerk des Hotels Amerika. Der Trakt des Personals befindet sich in einem abseits gelegenen Teil des Dachgeschosses, fern vom pompösen Dachgarten.
Shirleys Augen kehren zurück von den Wolkenkratzern. Dicht neben dem Fenster bemerkt sie die alte Nanny, die älteste Scheuerfrau des Hotels. Auch diesen Anblick ist sie gewöhnt. Immer, wenn Shirley erwacht, sitzt Nanny da, aufrecht, mit steifem Rücken, als wäre sie aus Holz geschnitzt, aus einem dunkelbraunen, sehr harten Holz. Sie hält eine Tasse in der Hand und tunkt von Zeit zu Zeit langsam ein Stück Brot in den Tee. Nanny kocht schon um vier Uhr morgens ihren Tee und sitzt nun da, den Teetopf in der Hand, und wartet auf das Klingelzeichen, das sie zur Arbeit ruft. Dann erwacht sie erst wirklich. Nanny ist schon fünfzig Jahre Scheuerfrau, aber immer noch kann sie arbeiten; wie eine Maschine reibt und wischt und wringt und bürstet sie. Nach der Arbeit wird ihr Körper wieder hölzern; dann sitzt sie bewegungslos und starrt auf die Wolkenkratzer.
Shirleys Blicke fallen auf Patrizia. Jeden Morgen bietet auch diese Zimmergenossin den gleichen Anblick. Sie kniet, Gebete flüsternd, vor ihrer Kommode, auf der sich Heiligenbilder und eine Fotografie des Papstes befinden. Shirley kann die großen Füße in den ausgetretenen, schiefen Schuhen sehen und den dünnen, kleinen Haarknoten, der etwas verrutscht auf ihrem Kopf sitzt. Und jeden Morgen dringen die gleichen sägenden Laute aus der Richtung des Bettes, in dem das Nachtstubenmädchen Bessie, erlöst von der Arbeit und von einem alten Panzerkorsett, zufrieden seine Leibesfülle ausbreitet.
Celestina möchte Shirley wieder daran erinnern, dass es Zeit sei, aufzustehen, aber sie wagt es nicht.
So kalt, so voll Hass wandern die Augen Shirleys weiter.
Sie prüfen jetzt das Bett. Die Wäsche ist zerrissen. Das Personal auf der letzten Stufe in der Rangfolge der Angestellten bekommt Bettzeug, das nicht mehr ausgebessert werden kann. Die aufgerissene Matratze zeigt die Seegrasfüllung durch zerrissene Laken. Das Polster, hart wie Stein, blickt gleichfalls neugierig aus dem Überzug. Das Gestell des schmalen Bettes, das auf kleinen Rädern steht, ist verbogen.
Shirley muss lachen, wenn sie dieses Bett sieht, aber es ist ein hartes, ein bitteres Lachen. Im Zimmer hat sie nur auf dieses Bett und auf ein Fach des eisernen Schrankes ein Anrecht. Die Kommode dürfen nur die beiden ältesten Mitbewohnerinnen, Nanny und Patrizia, benutzen. Bessie hat einen Schaukelstuhl, in den sie sich nur mit Schwierigkeiten hineinzwängen kann; Celestina verfügt über einen kleinen Tisch.
Shirley muss sich schütteln. Hier hatte sie nun sechs Jahre lang gelebt!
Unter den Betten lagern dicke Staubflocken. Schaben wandern, trotz der Helligkeit, gemächlich umher. Kein Wunder! Das Personal hat wohl eine eigene Bedienung – jedoch eine Frau reinigt hundert Zimmer in sieben Stunden! Keine der Bewohnerinnen aber hat Lust, wenn sie von der Arbeit kommt, das Zimmer noch selbst in Ordnung zu bringen. Wozu? Und dann muss man noch um Besen betteln und um Scheuerlappen. Wozu? Hier ist ja nur der Trakt des Personals. Hier kann es schmutzig sein, hier darf es dreckig bleiben.
Shirley setzt sich plötzlich auf, verschränkt die Arme über dem Kopf und jauchzt: »Heute der letzte Tag. Gott sei Dank, der letzte Tag!«
Alle blicken sie erstaunt an, sogar Patrizia wendet den Kopf von den Heiligen ihr zu.
Celestina aber ist erst ganz starr, sie begreift nicht, worauf Shirley abzielt. Hat ihre Tochter etwas vor, was sie ihr nicht verraten will, verheimlicht sie etwas vor ihr?
Die Mutter beugt sich über Shirley, sie dringt in sie. »Was willst du denn tun, Shirley? Glaubst du, ich weiß nicht, du hast es schwer hier, dass ich dir nicht etwas Besseres gönne? Du kannst mir doch sagen, was du vorhast!«
Shirley bedauert schon, dass sie gesprochen hat. Sie hatte sich fest vorgenommen zu schweigen; nun, mehr wird man aus ihr nicht herausbekommen.
»Ich habe das nur so ohne Sinn hergesagt.«
Celestinas Misstrauen ist damit nicht beseitigt, doch sie will nicht weiter fragen. Patrizia aber winkt Celestina mit den Augen, während sie weiter ihr Gebet murmelt. Ihre Augen schielen unter Shirleys Bett. Sie scheint mehr zu wissen als die Mutter.
Celestina folgt ihrem Blick und entdeckt nun auch einen Pappkarton.
Sie zieht ihn schnell hervor, bevor noch Shirley sie hindern kann, öffnet ihn und sieht ein mit Flitter dicht besätes Abendkleid, goldfarbene Abendschuhe und eine Fotografie, auf der Shirley lachend, am Arm eines jungen Mannes, in diesem verheimlichten Kostüm abgebildet ist.
Shirley springt blitzschnell aus dem Bett und reißt die Fotografie und das Kleid aus Celestinas Händen.
Dieses Kleid übrigens, das am Abend sie noch entzückt hatte, erscheint ihr hier im hellen Licht recht armselig, ja lächerlich; aber sie wird bald andere haben, die kein Tageslicht zu scheuen brauchen. Oh, man soll nur ruhig über sie lachen.
Celestina denkt angestrengt nach. Der junge Mann auf dem Bild scheint ihr bekannt, sicher ist es ein Gast aus dem Hotel. Was will der von Shirley?
»Kannst du hier nicht genug Männer finden, die deinesgleichen sind?« Celestina versucht, Shirleys Blicke einzufangen.
Aber Shirley schaut in die Luft, während sie in das Zimmer hineinschreit:
»Soll ich vielleicht mit einem Tellerwäscher oder einem Hausmann dasselbe Leben weiterführen, das ich hier genieße? Danke, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen.«
Patrizia hat jetzt ihre Gebete beendet; in einem Ton, als murmele sie sie weiter, wendet sie sich an Celestina: »Du hättest deine Tochter heute früh sehen sollen, wie sie nach Hause kam. War die guter Laune! Ich wette, ihr Galan hat nicht mit Alkohol gespart. Ja, die Mädchen, die nur an ihr leibliches Wohl denken, können sich ein gutes Leben leisten. Aber was geschieht später mit ihrer Seele?«
Shirley hat ihr rosa Arbeitskleid mit dem großen weißen Kragen angezogen, die Uniform der Wäschermädchen. Ihre dunklen Haare fallen weich auf den Kragen, ihre Haut ist straff und jung, ihre Gestalt schlank. So steht sie vor Patrizia, die ein Gesicht wie eine alte gedörrte Pflaume hat, und sieht sie erst wütend aus dunklen Augen an, dann aber muss sie lachen.
»Du hast sicher Augen in deinem Dutt, denn nichts entgeht dir, obgleich du immer nur deine Heiligen anstarrst. Ich wette, ich werde nie soviel Sünden haben, dass ich die ganze Nacht beten muss, um sie abzubitten. Ihr seid ja nur neidisch, weil euch keiner mehr will.«
Celestina versucht, Shirley an sich zu ziehen: »Shirley, du weißt, was ich von dem Geschwätz der Patrizia halte, aber wozu brauchst du mit Gästen auszugehen? Du lernst nichts Gutes von ihnen, sie lachen dich nur aus, ohne dass du was davon merkst. Du hast dir sicher was Dummes in den Kopf gesetzt.«
Shirley verstopft sich mit den Fingern die Ohren. »Alle Mädchen gehen aus, wenn man sie einladet – wir wollen doch auch etwas vom Leben haben. Wie konnte ich es nur so lange zwischen euch vier alten Frauen aushalten? Überlass nur mir, was ich tue! Ich will heraus aus diesem Dreck, ich will, und es wird auch gelingen.«
Celestina ist hartnäckig. »Ich will nur wissen, was du vorhast.«
Aber Shirley bearbeitet schon ihr Gesicht mit Creme, pudert sich und zeichnet ihre Lippen nach, während sie einen halb erblindeten Spiegel vor das Gesicht hält.
Sie ist froh, als Ingrid, das kleine schwedische Stubenmädchen, das mit Celestina auf der gleichen Etage arbeitet, ins Zimmer tritt.
»Heute arbeitest du in meiner Sektion, Celestina.« Ingrid ist noch nicht lange in Amerika. Sie sucht Wärme wie ein kleines verlassenes Tier.
»Komm her, Ingrid, ich zeige dir, wie man sich schminken muss«, ruft Shirley. »Hast du dich noch nie geschminkt? Willst du, dass alle Leute gleich sehen, dass du eine Eingewanderte bist? Ich werde dich hübsch machen. Gleich siehst du besser aus. Wirst du oft eingeladen von den Gästen? Die alten Damen hier ärgern sich, wenn wir Mädchen mal tanzen gehen. Was sagen dir die Herren?«
»Ich verstehe sie oft nicht, sie sprechen so schnell, dann komme ich mir immer sehr dumm vor. Aber jetzt gehe ich in die Abendschule und lerne Englisch.«
Die Glocke in dem Trakt des weiblichen Personals schrillt laut auf. Es ist das Zeichen, dass es an der Zeit sei, jeden Gedanken an das Privatleben auszulöschen.
Shirley zieht Ingrid schnell aus dem Zimmer. Sie will den fragenden Blicken ihrer Mutter entfliehen.
Alle Türen im Trakt des weiblichen Personals sind geöffnet. Man versucht, auf diese Weise Luft in die überfüllten Räume zu bekommen. Die Türen können offenstehen; niemand hat Geheimnisse zu hüten, und es ist auch vollkommen gleichgültig, ob ein halbes Dutzend oder einige tausend Fremde zusehen, wie man sich an- und auskleidet.
In allen Zimmern ist ein abenteuerliches Durcheinander. Alle sind zwar mit den gleichen Betten vollgestopft, in allen stehen die gleichen Blechschränke, doch auf den Kommoden und auf den Betten häuft sich der weggeworfene Tand aus den glänzenden Räumen des Wolkenkratzerhotels. Man sieht großartige, aber schon völlig verwelkte Blumenarrangements, Pfauenfedern, die irgendeiner Modedame als Schreibfeder dienten, zerbrochene Kristallvasen, zerrissene Abendkleider in großartiger Aufmachung, ebenso zerrissene Brokatschuhe mit Strassabsätzen, fantastische Sofakissen mit großen Brandflecken, zerdrückte, zerbrochene Bonbonnieren. Dieses farbige Gerümpel sticht komisch ab von den ärmlichen Habseligkeiten des Personals, den billigen Kleidern, den Heiligenbildern und den alten Postkarten.
Die Korridore sind erfüllt von beängstigendem Lärm, von emsiger Geschäftigkeit, von Schreien und Lachen.
Tausende schwirren herum. Bunte Farben flimmern durcheinander. Die Wäscherinnen tragen blaue, die Laufmädchen aus der Wäscherei rosa, die Scheuerfrauen gestreifte, die Stubenmädchen weiße, die Kellnerinnen in der Sodaquelle ockergelbe, die in dem Teeraum fliederfarbene Arbeitskleider.
Die Frauen und Mädchen kommen aus allen Teilen der Stadt, aus ihren dunklen, trostlosen Quartieren, aus der Negerstadt Harlem, aus Chinatown, aus den italienischen und spanischen, aus den deutschen und irischen Vierteln. Alle Nationen der Welt sind vertreten.
Man hört die gutturalen Laute der Negerinnen, den singenden Tonfall der Italienerinnen, die weichen Zischlaute der Spanierinnen. Ein Sprachforscher könnte hier alle Dialekte der Slawen entdecken, aber auch hindustanische und armenische, griechische und japanische Sprachen vernehmen.
Zwischendurch unterhalten sie sich auch in gebrochenem Englisch und werfen sich gähnend, mit noch schlaftrunkener Stimme, immer die gleichen Sätze zu.
»Ein schöner Morgen heute.«
»Ja, wenn man spazieren gehen könnte …«
»Huch, die verfluchte Arbeit!«
»Ach, ich möchte noch schlafen.«
»Keine Nacht hat man seine richtige Ruhe.«
»Ich wünschte, ich könnte diesem dreckigen Läusenest adieu sagen.«
»Habt ihr euch gut amüsiert gestern Nacht?«
»Oh, ich habe getanzt.«
»Ihr habt es gut, junges Blut, ich bin nach der Arbeit zu müde.«
Shirley zieht Ingrid mit sich. »Kann man das aushalten, ein ganzes Leben lang?«
Celestina hat die beiden eingeholt. »Du musst mir jetzt sagen, was du damit gemeint hast: ›heute der letzte Tag‹.«
Shirley reißt Ingrid mit sich, sie nimmt einfach Reißaus, sie will nicht antworten.
Aber weil sie sich doch aussprechen möchte, flüstert sie geheimnisvoll Ingrid zu: »Ich will heute fort aus dem Hotel, nur als Gast komme ich wieder; pass auf, ich werde reich werden. Du wirst von mir ein extra schönes Geschenk bekommen. In Ordnung?«
Ingrid löst ihre Hand aus Shirleys Arm.
»Ich glaub das nicht, du machst nur Spaß, willst mich nur uzen.«
»Du wirst schon sehen, ich werde wirklich gehen, noch heute, alles dalassen, dies ganze hässliche, schwere Leben. Möchtest du das nicht auch?«
»Ja, ich möchte auch anders leben, aber nicht so wie du sagst, als Gast hier im Hotel.«
Auf dem Wege an dem Barbierladen für das männliche Personal des Hotels vorbei begegnen die beiden Mädchen Salvatore Menelli.
Seine glänzenden schwarzen Haare sind sorgfältig aus der schönen Stirn gekämmt. Die dunklen Augen unter den regelmäßigen Bogen der Brauen lächeln wohlgelaunt. Blitzblank sieht er aus in seiner Pagenuniform.
Salvatore geht zu den Schuhputzern, mit spitzem Mund vor sich hinpfeifend, und legt den Fuß auf eine Messingplatte. Er stemmt die linke Hand gegen seine schlanke Hüfte, während er mit der rechten Geldstücke in die Luft wirft, die er mit großer Geschicklichkeit immer wieder auffängt.
»Er spielt nur Theater«, flüstert Shirley ihrer Kollegin zu. »Er ärgert sich, dass ich mir nichts mehr aus ihm mache.«
Ingrid kann sich nicht enthalten, Salvatore einen bewundernden Blick zuzuwerfen.
»Willst du wirklich fortgehen und auch ihn ganz aufgeben?« Ingrid weiß, dass Salvatore früher Shirleys Freund gewesen ist.
Shirley macht eine wegwerfende Bewegung. »Ich kann mir ganz andere aussuchen als diesen kleinen Zuckerbäckersohn aus dem italienischen Viertel. Aber du kannst ihn ja trösten, er gefällt dir, ich habe das schon bemerkt.«
Ingrid spürt ein Erröten. Diese Shirley ist schrecklich; man weiß nie, ob sie das, was sie sagt, auch ernst meint. Aber sie will hoch hinaus, das ist sicher. Alle im Hotel sagen es von ihr.
Zum zweiten Mal ertönt die Glocke in allen Abteilungen des Personals. In der Luft schwirren Nummern, man hört das Knarren der Kontrolluhren, das Klirren der Schlüssel. Im Wäscheraum beginnen elektrische Nähmaschinen zu surren, die Hausmänner sind schon dabei, die Wäsche für die dreißig Stockwerke in große Rollwagen zu verstauen, die Stubenmädchen binden ihre Schlüssel um die Taille, die Haushälterinnen sehen die Listen mit den Zimmernummern durch. Überall werden Befehle erteilt, das tätige Leben hat schon voll begonnen.
»Wir kommen zu spät zum Frühstück.« Ingrid blickt in den Speisesaal des weiblichen Personals unterster Stufe, der gleichzeitig auch als Küche und Abwaschraum dient. Er ist von fast unübersichtlicher Ausdehnung.
Eingezwängt zwischen Wolkenkratzern, nahe dem Keller, liegt er wie in einem endlos tiefen Schacht und bleibt immer dunkel und luftlos. Man müsste sich platt auf den Boden legen, um ein Stückchen Himmel zu erspähen. Es riecht hier immer unangenehm nach ranzigem Fett und Spülwasser.
Im Saal ist schon allgemeiner Aufbruch; die langen, lehnenlosen, nur gehobelten Bänke sind leer, die Holztische abgeräumt. Es stehen nur noch einige Gruppen zusammen.
»Ich schenke mein Frühstück der Direktion«, sagt Shirley. »Na, ich brauche ja nicht mehr lange diesen Fraß in mich zu zwingen, ich habe ja auch heute Nacht gut gegessen. Aber du, hast du Hunger?«
»Eigentlich nein, ich mache mir nichts daraus, dass ich kein Frühstück habe. Nachts bin ich immer hungrig und kann kaum einschlafen. Aber morgens, wenn ich erwache, dann ist es weg, das Hungergefühl. Ich denke dann gar nicht mehr gern ans Essen.«
Es hat schon zum dritten Mal geläutet. Der Raum vor den für die Angestellten bestimmten Aufzügen ist auch schon entvölkert. Er sieht dunkel und ungepflegt aus. Die Aufzüge funktionieren meist nicht einwandfrei. Jetzt sind die Klingeln nicht in Ordnung, und man muss schreien, um sich den Aufzugführern bemerkbar zu machen.
»Hinauf!« ruft Ingrid.
»Hinab!« schreit Shirley, die in die Wäscherei hinunterfahren muss.
Die Verbindungstüren, die sonst sorgfältig abgeschlossen sind und die zu dem eigentlichen, für die Hotelgäste bestimmten Teil dieses Stockwerkes führen, sind weit aufgeschlagen, und man kann den unteren Ballsaal übersehen, einen prächtigen, durch sinnreich angebrachte Spiegel grenzenlos wirkenden marmornen Saal.
Shirley erinnert sich, dass der im Traum gesehene Saal Ähnlichkeit mit diesem hat.
Ingrid starrt neugierig hinein.
»Was sie hier wohl feiern werden?«
Es werden jetzt prächtige Bäume hineingetragen, exotische, üppige Bäume, überschüttet mit roten Blüten, lilafarbene Sträucher, die betäubend duften, Blumen mit merkwürdigen gelben Dolden. Man sieht, die Vorbereitungen zu der Ausschmückung des Saales haben erst begonnen, aber schon jetzt hat er Ähnlichkeit mit einem unwirklichen, traumhaften Feengarten.
Shirley lacht. Sie könnte der kleinen Ingrid nähere Auskunft geben, wenn sie nur wollte; sie weiß mehr als die anderen. Aber jetzt sagt sie nur:
»Man wird hier eine große Hochzeit feiern. Siehst du, so heiraten die reichen Mädchen. Sie ist die Tochter eines Millionärs, ich weiß einiges über sie – na, aber ich schweige.«
Shirley lacht über die erstaunten Augen Ingrids.
Diese beginnt wieder zu rufen: »Hinauf!«, und Shirley schreit: »Hinab!«
Und in dem Fahrstuhl, der in die Wäscherei fährt, der langsam hinabsinkt in die Tiefe, zu den erstickenden Dämpfen, denkt sie: es ist heute zum letzten Mal, zum letzten Mal hinab – morgen schon wird sie steigen …
2
In der Frühstücksbar des Hotels Amerika sitzt an dem braun polierten Holztisch, der in einem Halbkreis durch den ganzen Raum läuft, Herr Fish, ein junger Mann mit gepflegtem Äußern, und löffelt seine Grapefruit. Die anderen, hohen runden Stühle sind noch leer. Herr Fish ist der erste Gast und genießt demzufolge aufmerksamste Bedienung.
Der Kellner stellt ihm jetzt mit eleganter Handbewegung Haferbrei mit Sahne auf den Tisch und bleibt dann in angemessener Entfernung vor ihm stehen.
Herr Fish ist leutselig und mitteilsam.
»Ein feiner Morgen heute, ein schöner Tag, ganz entschieden.« Er reibt sich die Hände.
Dann entfaltet er die Zeitung und beginnt, die Börsenmitteilungen zu studieren. Während des Lesens redet er fortwährend auf den Kellner ein: »Millionen, wohin man blickt, Milliarden, und was alles hinter diesen Milliarden steckt! In Brasilien sprießen Gummiwälder, echt amerikanische, mein Lieber. Ja, man wird England ein Schnippchen schlagen, Amerika, das mächtigste Land der Welt. Hier sehen Sie: ›Wall Street finanziert Kanalisationsarbeiten im Sudan‹, ›Hungersnot in China‹ soll finanziell ausgebeutet werden. ›Rationalisierung in Deutschland befestigt das dort angelegte amerikanische Kapital‹. Man muss Börsenkurse lesen können, mein Lieber, die sind interessanter als der fantastischste Roman.«
»Hehe«, kichert diskret hinter der hochgehobenen Serviette der Kellner. Er findet den Gast reichlich merkwürdig. Man liest Börsenkurse, spricht aber nicht soviel.
Der Gast redet immer weiter.
»Man muss nur schlau sein, dann kann man auch seinen Teil aus dem trüben fischen.«
Der Kellner, der seinen Spitznamen »der schöne Alex« gerne hört, beginnt aufzuhorchen. Aus dem trüben fischen – hm, das lässt sich hören. Man kann nie wissen, ob man nicht auch einmal brauchbare Tipps bekommt, obgleich es bekannt ist, dass die Kleinen immer über den Kamm geschoren werden. Man kann nie vorsichtig genug sein. Der Kerl ist vielleicht ein Agent, der gern Aktien loswerden möchte.
Von meinen sauer verdienten Dollars bekommst du nichts, denkt der »schöne Alex« und geht in die Küche, um dem gesprächigen Gast seine verlorenen Eier auf Toast und den Kaffee zu bringen. Herr Fish ist anscheinend noch mit seinen hochfliegenden Gedanken beschäftigt.
»Das Ganze durchschauen, das ist alles! Das Chaos analysieren, dann findet sich auch ein Weg, der richtige Weg für den eigenen Gebrauch und zum eigenen Nutzen.«
Der »schöne Alex« denkt wegwerfend: Man muss nur wissen, was man will, das ist die Hauptsache, man muss ein bestimmtes Ziel haben. Das hat er auch. Er will eine Flüsterkneipe in der 81. Straße New York-Ost, das ist sein Traum. Ja, er kennt die 81. Straße im Osten besser als seine Westentasche. Er hat eigentlich eine schöne Karriere gemacht: Kellner sein in dem feinsten Hotel der Stadt ist keine Kleinigkeit. Und trotzdem spürt er Heimweh, wenn er an die alten Zeiten denkt, obgleich man ihm übel mitgespielt hat. Aber er wird Rache nehmen. Er sieht sich wieder in der »Bar Lohengreen« (wirklich mit zwei »ee« geschrieben). Freilich, da stellte er mehr vor als einen Kellner. Er war die rechte Hand der Besitzerin, der Witwe Lohengreen, ja, mehr als die rechte Hand: er war die große Liebe der Witwe, und der »schöne Alex« sah sich schon als Besitzer, als »Lohengreen« selbst, enthoben dem harten Kampf der Abhängigen.
Herr Fish hängt gleichfalls seinen eigenen Gedanken nach und trinkt den Kaffee in ganz kleinen Schlucken.
Der »schöne Alex« durchlebt wieder einmal die demütigenden Minuten seines Sturzes. Die Witwe Lohengreen überraschte ihn bei einem Vergnügen mit einer kleinen hübschen Kellnerin. Statt einzusehen, dass er, der »schöne Alex«, ein Mann sei, den man nicht mit gewöhnlichem Maße messen könne, gab sie ihm noch am selben Abend seinen Lohn mit den dürren Worten: »Morgen brauchen Sie nicht mehr zu kommen.« Das ihm, dem »schönen Alex«! Wenn er an die Flüsterkneipe denkt, die er einmal in der 81. Straße New York-Ost haben wird, träumt er zugleich von Rache.
Herr Fish beginnt jetzt wieder zu reden, der »schöne Alex« kann seinen Gedanken nicht länger nachhängen.
»Haben Sie auch manchmal dieses kitzelnde Gefühl, hineinsehen zu wollen in alle Häuser, in alle Wohnungen, Lokale, Geschäfte, in die Warenhäuser, Fabriken, Wolkenkratzer, Hospitäler, hineinsehen in alles: die Gedärme, das Herz, das Gehirn, das ganze Innere, die Triebfeder, die Hintergründe sehen, entdecken, erkennen können? Überkommt Sie nicht auch manchmal diese Neugierde?«
Der »schöne Alex« murmelt etwas Bejahendes. Er sagt sich, dass im Hotel Amerika die Gäste immer recht haben, aber er ist zufrieden, dass er selbst nie so verstiegene Gedanken wie dieser Herr da hat; er weiß, was er will, und das ist die Hauptsache, wenn man wirklich etwas erreichen will. Wenn er das Geld für seine Flüsterkneipe zusammenhätte, so wüsste er schon, den Betrieb nutzbringend zu führen. Er würde sich gegenüber der »Bar Lohengreen« ansiedeln – sie würde bald pleite gehen, die Witwe. Nun, sie könnte ja zu ihm arbeiten kommen; der »schöne Alex« würde es ihr sogar anbieten. Und dann eines schönen Tages würde er ihr den Lohn auszahlen und sagen: »Morgen brauchen Sie nicht mehr zu kommen.« Ja, sein eigener Herr sein, Leute wegschicken können, das möchte er auch …
»Sie verdienen hier wohl gut«, fragt der neugierige Gast; er macht keine Anstalten, mit seinem Frühstück fertig zu werden.
»Na, es geht so lala; Sie würden staunen, Herr, wie oft die vornehmen Leute Trinkgelder zu geben vergessen.«
Ja, der »schöne Alex« hält nicht viel von feinen Gegenden. Auch wenn er von seinen Racheplänen absieht, möchte er sich nicht in den »tobenden Vierzigern« ansiedeln, in den Straßen zwischen 40 und 50 an beiden Seiten des »Weißen Weges«, wie man den Broadway dort nennt, wo er Vergnügungen bietet. Die dort florierenden Nachtklubs, geheimen Absteigequartiere und Tanzlokale sind nicht das Ziel seiner Sehnsucht; dafür braucht man klotzige Gelder, und im übrigen ist alles in einigen wenigen Händen; der Außenseiter wird schnell zermalmt. Aber in der 81. Straße New York-Ost, da könnte es auch noch der kleine Mann zu etwas bringen. Er sieht die Straße dunkel und schmal im East River verenden. Die Gäste ihrer Kneipen sind armselige Burschen, Leute, denen es schlecht geht, die Heimweh haben, die schon halb verkommen sind, Leute mit geheimem Kummer, Einwanderer, die sich noch nicht richtig verständigen können. Mit einem Wort, lauter Menschen, denen es ganz dreckig geht. Aber gerade an solchen Menschen ist etwas zu verdienen, stellt Alex fest. Die anderen, die fest im Sattel sitzen, die sind so scheußlich wach, sogar dann, wenn sie viel getrunken haben. Sie sind immer nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Ja, so unglaublich es auch scheint, gut verdienen kann man nur an Leuten, die in der Patsche sitzen. Vor Alex’ Augen tauchen die Betrunkenen auf, die das Pflaster der 81. Straße besäen und zwischen denen die Polizisten friedlich daherwandeln.
Herr Fish aber hat sich während dieser Überlegungen des »schönen Alex« in Begeisterung geredet.
»Immerhin, was Sie hier alles sehen können …! Haben Sie schon darüber nachgedacht, was für eine ungeheure Stadt dieses New York ist? Sie können sich große Reisen ersparen, wenn Sie sie nur genau studieren. Ungarn und China, Schweden und Japan, bitte, hier sitzt alles zusammen. Die Ausgestoßenen aus allen Teilen der Welt haben sich in dieser Stadt ein Rendezvous gegeben. Sie können hier im Hotel Amerika glänzende Studien machen. Wie?«
»Nun, man tut seine Arbeit, da hat man keine Zeit zu Studien, mein Herr, und dann hat man auch seine eigenen Sorgen und kümmert sich nicht soviel um die der anderen.«
Aber der »schöne Alex« beginnt doch aufzumerken. Ob er hier Studien macht? Das klingt gut. Aber es scheint, dass dieser merkwürdige Gast etwas Bestimmtes von ihm will. Man wird ja sehen.
»Sie haben hier im Hotel allein ein Dutzend Restaurants, nicht wahr?«
Der »schöne Alex« winkt zum Zeichen der Bejahung mit seiner Serviette.
»Sie bedienen wohl auch abends gelegentlich im großen Ballsaal?«
Der »schöne Alex« beginnt aufzuhorchen. Jetzt kommt’s doch, man wird ja hören, was der gesprächige Mann will.
»Na ja, es kommt schon vor.«
»Heute Abend?«
»Mag schon sein, müsste mal nachsehen.«
Der »schöne Alex« langt nach seinem Notizbuch und überlegt. Man muss schlau sein. Dem jungen Mann da, der gar soviel spricht, geht es wahrscheinlich nicht so gut, wie er den Anschein geben möchte. Menschen, denen es gut geht, reden nicht soviel mit einem Kellner, man hat schon so seine Erfahrungen. Aber mit Menschen, denen es schlecht geht, kann man wiederum gute Geschäfte machen.
Er blättert in seinem Notizbuch.
»Ja, heute Abend ist große Hochzeit.«
»Die Hochzeit Marjorie Strongs mit Edgar Sedwick?«
»Mich interessieren die Namen nicht, aber es wird schon stimmen.«
»So etwas aus der Nähe zu sehen, das würde mich interessieren – ich meine als dienstbarer Geist, nicht als Gast.«
Der »schöne Alex« ist jetzt ganz Ohr.
»Hm, hm, so was lässt sich aber nur schwer durchführen. Und warum gehen Sie nicht als Gast, mein Herr? Lassen Sie sich doch eine Einladung geben. Ich muss schon sagen, ich möchte mir so ein Fest lieber als Gast ansehen, das würde mir mehr Spaß machen.«
»Nun, erstens, sehen Sie, ist das auch mit einer Einladung nicht so einfach, und dann, wie ich Ihnen schon gesagt habe, möchte ich einmal ein solches gesellschaftliches Ereignis aus einer anderen Perspektive, von der anderen Seite ansehen.«
»Was Sie sich wohl denken, Herr? Dabei gibt es doch gar nichts zu sehen. Wenn man arbeitet, hat man keine Zeit zum Sehen und auch kein Interesse dafür. Haben Sie eine Ahnung, mein Herr, wie es bei uns zugeht, wie viel man rennen und wie man aufpassen muss!«
»Na, sehen Sie, deshalb will ich doch eine Ahnung von der ganzen Sache bekommen.«
»Aber warum wenden Sie sich gerade an mich? Wie sollte ich Ihnen denn helfen?«
»Man hat mich zu Ihnen gewiesen, Sie sind als fixer Kerl bekannt, mein Lieber; man hat mir erzählt, dass Sie nicht abgeneigt sind, kleine Nebeneinnahmen zu erzielen, ohne Risiko, versteht sich.«
»Ich möchte wohl wissen, wer Ihnen das von mir erzählt hat; da hat man Sie schön angeführt, Herr.«
»Also, ich könnte auf Sie nicht rechnen, meinen Sie? Ich habe natürlich auch Adressen von anderen Kellnern.«
»Habe ich Ihnen vielleicht ›nein‹ gesagt? Kann man überhaupt ›ja‹ oder ›nein‹ sagen, wenn man nicht weiß, um was es sich handelt?«
»Sie sind zu klug, als dass Sie nicht erraten hätten, was ich will. Leihen Sie mir Ihre Arbeitskarte und Nummer für heute Abend, das ist alles, verstehen Sie jetzt?«
»Verstehen kann ich nicht, wie jemand zu so etwas Lust haben kann. Eine Hochzeit ist kein Spaß, für niemanden, mein Herr, aber für die Kellner schon ganz gewiss nicht. Sie wollen also Kellner spielen, darauf läuft wohl Ihr Vorschlag hinaus?«
»Passen Sie auf, Sie können heute einen freien Abend haben und mich zur Aushilfe schicken – und der Verdienst gehört doch Ihnen.«
»Dass ich nicht lach, mein Herr, meine Stellung soll ich aufs Spiel setzen und nicht mehr haben als das, was Sie verdienen können? Glauben Sie denn, es ist so leicht, Kellner zu werden, dass es nicht auch eine Kunst ist, die gelernt werden muss.«
»Beruhigen Sie sich, ich werde schon meine Sache gut machen, ich war schon Kellner, ich war schon alles. Sie würden schwer einen Beruf ausfindig machen, den ich nicht schon ausgeübt hätte.«
»So, Sie waren früher Kellner? Vorhin erzählten Sie etwas von einer Perspektive, die Sie studieren möchten. Wenn Sie schon Kellner waren, warum wollen Sie jetzt wieder einer sein? Wenn man den Dreh kennt und nicht unbedingt Geld zum Leben braucht, hat man keine Sehnsucht, noch einmal anzufangen.«
»Ich habe Ihnen schon gesagt, ich will dieses bestimmte gesellschaftliche Ereignis von der Hintertreppe aus sehen.«
Alex überlegte schnell. Was will eigentlich der Bursche? Juwelen stehlen? Armer Mensch, der würde seine Enttäuschung erleben. Auf jeden Gast kommt ein Detektiv und auf jeden Kellner zwei. Da könnte er schon leichter Juwelen auf der Fifth Avenue klauen. Andererseits: Unannehmlichkeiten könnte ich ja doch nicht haben, wenn ich ihn auch wirklich einschmuggelte; ich wüsste schon, wie ich mich ausreden würde. Und es würde ihm schon Hören und Sehen vergehen, wenn ihn unsere »Kapitäne« hin und her kommandieren.
Er lässt seine Augen über Herrn Fish auf und ab wandern.
»Mein Herr, Sie glauben, es ist so leicht, im Hotel Amerika als Kellner eingestellt zu werden. Ich bin nicht eingebildet, aber sehen Sie sich mal meine Figur an, sehen Sie sich mein Profil an. Wer Kellner im Hotel Amerika werden will, noch dazu Aushilfskellner bei einer erstklassigen Hochzeit, der muss über ein tadelloses Äußeres verfügen, mein Herr. Ein Tenor kann einen Bauch haben, ein Liebhaber auf der Bühne krumme Beine, aber ein Kellner im Hotel Amerika muss aussehen, dass die Leute Appetit bekommen, wenn sie ihn erblicken. Wenn Sie nur eine Pustel haben, schickt Sie der Ober nach Hause.« Der Kerl ist unverschämt, denkt Herr Fish. Aber er lässt sich auf keine weitere Diskussion mehr ein.
»Also hören Sie, Sie leihen mir heute Abend Ihren Frack, Ihre Nummer und Ihre Arbeitskarte. Ich wette, keiner wird merken, dass ein anderer Kellner zur Arbeit angetreten ist, trotz Ihres vollkommenen Profils. Machen Sie sich also keine Sorgen.«
»Mein Herr, Sie denken, Sie können nur so ohne weiteres über mich verfügen, das Ganze muss noch genau überlegt werden. Wie soll es sich mit meinem entgangenen Verdienst verhalten?«
»Wie viel pflegen Sie an solchem Abend einzunehmen?«