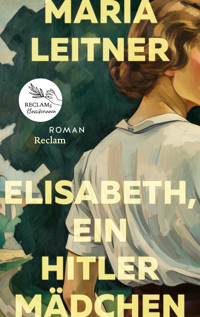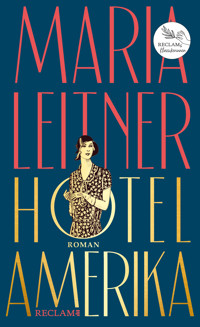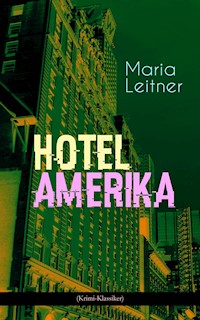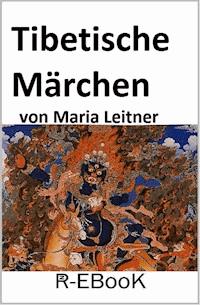Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Verbrannte Bücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die titelgebende junge Berlinerin Elisabeth Weber verliebt sich auf einer Mai-Kundgebung in den ebenso wie sie vom Nationalsozialismus geblendeten SA-Mann Erwin Dobbien. In ihrer Begeisterung verschließen beide die Augen vor dem Terror des Regimes. Nach einer von Erwin gewünschten Abtreibung landet Elisabeth schließlich mit anderen jungen Frauen in einem Arbeitslager. Die angespannte Versorgungslage verlangt nach billigen und willigen Arbeitskräften. Sie soll "zum Dienst am Vaterland im Geiste des Führers" erzogen werden. Erst da erkennt sie das Grauen der Nazis. Sie zettelt einen Aufstand an. "Elisabeth, ein Hitlermädchen" erschien von April bis Juni 1937 in der Exilzeitung Pariser Tagblatt als Fortsetzungsroman. Der Roman ist eine deutliche Replik auf den demagogischen Propaganda-Jugendroman "Ulla, ein Hitlermädel" (1933) der Autorin Helga Knöpke-Joest. In einer bewusst einfachen Sprache, eben der eines Berliner Mädchens, das sich zunächst nur um sich und ihr eigenes Glück sorgt, verfasste Maria Leitner ein stimmiges Sittengemälde der "einfachen" Mitläufer aus der NS-Zeit. Wenn man die Zeilen liest, die Blauäugigkeit und Begeisterung unter den jungen Menschen spürt, so kann man ein Stück besser verstehen, wie die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Leitner
Elisabeth, ein Hitlermädchen
Maria Leitner
Elisabeth, ein Hitlermädchen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Pariser Tageszeitung, 1937 2. Auflage, ISBN 978-3-962815-80-6
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Zur Erstveröffentlichung
Erstes Kapitel. – Begegnung am 1. Mai
Zweites Kapitel. – Warenhaus Alderman, Schuhabteilung
Drittes Kapitel. – Marschmusik unter blühenden Kastanien
Viertes Kapitel. – Junge Liebe im Gelände
Fünftes Kapitel. – Gespensterzug der Gasmasken
Sechstes Kapitel. – Kostenanschlag des Familienglücks
Siebentes Kapitel. – Der Stammbaum
Achtes Kapitel. – Jugend, mach Platz!
Neuntes Kapitel. – Das Reich der Ungeborenen
Zehntes Kapitel. – Muss i denn, muss i denn, zum Städtele hinaus
Elftes Kapitel. – Mädchen mit Pappschachteln
Zwölftes Kapitel. – »Du bist nichts!«
Dreizehntes Kapitel. – Hüterin der Rasse
Vierzehntes Kapitel. – Das Mädchen »Ichweißwas«
Fünfzehntes Kapitel. – Die Schießübung
Sechzehntes Kapitel. – Der Brief
Siebzehntes Kapitel. – Gilda
Achtzehntes Kapitel. – Die Aufrührerischen
Neunzehntes Kapitel. – Ausgestoßen
Zwanzigstes Kapitel. – Schatten preußischer Könige und das Glück
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Zur Erstveröffentlichung
Das vorliegende Werk erschien ursprünglich 1937 über mehrere Ausgaben der Pariser Tageszeitung verteilt.
Das Pariser Tageblatt und seine Nachfolgerin die Pariser Tageszeitung war die einzige bis 1940 erschienene deutschsprachige Tageszeitung im Exil. Die Redakteure und Mitarbeiter versuchten von Frankreich aus, den Nationalsozialismus politisch bekämpfen.
Die Zeitung war eine parteiunabhängige Gründung verschiedener deutscher liberaler und linksgesinnter Journalisten. Mitarbeiter waren größtenteils prominente Berliner Journalisten. Zu den Autoren gehörten unter anderem Henri Barbusse, der tschechoslowakische Außenminister Edvard Beneš, Hellmut von Gerlach, Oskar Maria Graf, Heinrich Mann und der ehemalige Nationalsozialist Otto Strasser.
Erstes Kapitel.
Begegnung am 1. Mai
Sie glich einer Schwimmerin. Mit hastigen Armbewegungen zerteilte sie die Menge, die wie aufspritzend zur Seite wich und eine schmale Rinne frei ließ. Sie schlüpfte durch sie hindurch, während schon im nächsten Augenblick die Menschenwoge wieder über ihr zusammenschlug.
Diese Menge schien wie das Meer ganz ohne Grenzen. Zur Bewegungslosigkeit gebannt, hielt sie doch innerer Aufruhr in ständigem Auf und Ab.
Das Mädchen erreichte eine kleine Erhöhung. Von hier gewann sie einen ganz neuen Blick. Jetzt sah es aus, als wäre auf diesem Feld die ganze Stadt, das Wesentlichste der ganzen Stadt zusammengepresst.
Unzählige Tafeln schwebten über den Köpfen der Menge: »Belegschaft AEG«, »Ullstein«, »Brotfabrik Wittler«, »Aschinger«, »Siemens u. Schuckert«, »Kaufhaus Wertheim«, »Industriewerke Karlsruhe«, »Haus Vaterland«, »Tiefbau-Gesellschaft«. Wie auf dem primitiven Theater beschworen sie stärker als Bilder, die nur den schwachen Abklatsch der Wirklichkeit geben, die Stätten, die sie nur mit einem Wort andeuteten: Maschinenhallen, Kessel, aufglühenden Stahl, Kanonen und Flugzeuge, Wege und Bagger, knetende Eisenfinger der Brotmaschinen, Hochhäuser und Schächte.
In diesem unübersehbaren Tafelwald suchte das Mädchen ihren Platz. Könnte sie ihn doch endlich wiederfinden.
Die Gruppen waren kahl. Die Fahnen mit den Hakenkreuzen, die so weit waren, als wollten sie den Himmel bedecken, umflatterten das Feld, aber sie gehörten nicht zu den Gruppen.
In den Augen des Mädchens sammelte sich gespannte Aufmerksamkeit. Erst flossen die Gesichter gesichtslos ineinander. Nur langsam begannen sich die einzelnen zu unterscheiden, so wie man sich an das Dunkel langsam gewöhnen muss, bevor man allmählich die Umgebung erkennt.
Wie verschieden waren die Gesichter, die sich plötzlich gegen den harten Hintergrund der Masse abzeichneten! Sie zerbrachen die scheinbare Einheit. Es tauchten entschlossene, triumphierende, verzweifelte, aufleuchtende, müde, hasserfüllte, aufrührerische, dumpfe, entschlossene, verängstigte, stolze, stumpfe, vergrämte, kampfbereite Antlitze auf.
Manchmal fühlte das Mädchen, wie Hass auf ihre Person übersprang. Sie wusste, er galt ihrem Kleid. Ihrem Ehrenkleid, auf das sie stolz war. Dem blauen Rock, der weißen Bluse, dem schwarzen Tuch, das von einem braunen geflochtenen Lederschlupf gehalten wurde, der braunen Kletterweste.
Einigemal erreichte sie, zwischen zusammengepressten Zähnen abschätzend geflüstert, das Wort: »Hitlerika.«
Lass sie nur, dachte das Mädchen, lass sie nur. Das wird schon anders werden. Es ist schon jetzt viel besser. Früher waren sie schlimmer. Aber sie alle, auch die erbittertsten Feinde, werden merken, dass sie richtig, dass sie aus dem Elend geführt werden.
Doch es tat jetzt weh, in diesem Menschenlabyrinth allein herumzuirren. Langsam begann sie aus den dichtesten Massen herauszufinden. Die Menge wurde dünner. Man konnte jetzt an manchen Stellen das Feld sehen mit schütterem, krankem Gras. Rostig hatten sich gelbliche Flecke in das armselige Grün eingefressen. Gruppen lagen verstreut auf der mageren Wiese.
Die Stimmen der Verkäufer, die laut ihre Ware anpriesen, konnten sich jetzt ungehindert Gehör verschaffen.
»Warme Würstchen gefällig?« – »Saure Drops, die beste Erfrischung!« – »Die Riesensalzstangen, kauft die Riesensalzstangen!« – »Limonade, wer kauft Limonade?«
Es war wie auf einem Jahrmarkt.
»Hier ist’s richtig«, sagte ein älterer Mann, der mit einer größeren Gesellschaft auf der Wiese lagerte. »Keine Lautsprecheranlagen, diesen Winkel haben sie vergessen. Man braucht nicht zuzuhören und wird doch vom Feuerwerk etwas sehen können.«
Das Mädchen hasste ihn. Warum musste sie gerade hierher geraten, fern von den Kameraden? Vielleicht sprach schon der Führer, und sie war gezwungen, diese Leute zu hören, die ungläubig waren, die immer nur das Schlechte sehen wollten.
Ihre Augen suchten so verzweifelt, so dringlich, dass sie einen SA-Mann,1 einen jungen Menschen, der schlendernd vorbeikam, zum Stehen brachten.
Der Junge streckte ihr den Arm entgegen und sagte: »Heil Hitler!«
Auch sie hob den Arm und rief mit heller, wie befreiter Stimme: »Heil Hitler!«
Der Junge hatte den Arm wieder heruntergelassen und fragte sie: »Suchen Sie etwas, Fräulein?«
Sie antwortete ihm erst nicht; ihr Blick verlor sich an ihm. Jetzt suchte sie nicht mehr, oder doch, sie suchte nur noch dieses Gesicht, diese Gestalt, diese Augen.
So möchte ich aussehen, wenn ich Junge wäre, dachte das Mädchen. Genau so, ein scharfes, vorspringendes Kinn möchte ich haben, eine so gerade Nase, solche blauen Augen und zwei solche goldenen Pfeile im tiefbraunen Gesicht, das brauner ist als seine braune Uniform.
Dann sagte sie ihm: »Ob ich etwas suche? O ja, ich suche das Warenhaus Alderman.«
Beide lachten.
Das Mädchen sprach weiter: »So was Dummes, ich habe meine Kolonne verloren und kann sie nicht wiederfinden. Schon seit einer Stunde irre ich hier herum in der Menge. – Ist das nicht großartig, so viele Menschen? Aber ich hätte zu gern unter meinen Kolleginnen gestanden, ich hätte ihre Gesichter während der Rede des Führers beobachtet; und Sie? Haben Sie auch Ihren Betrieb verloren?«
»Ich muss, offen gestanden, sagen, ich bin einfach ausgerückt. Wenn Sie diese Büromenschen aus dem Bankhaus Wallenberg sehen würden, dort arbeite ich nämlich – unser Prokurist hat einen Regenschirm mit; stellen Sie sich das vor, mit einem Regenschirm vor dem Bauch marschiert er seit acht Stunden.«
»Sie müssten die Parfümerie-Abteilungsleiterin von unserem Warenhaus sehen, mit sooo hohen Absätzen, da kann sie natürlich nicht genug jammern: Sind wir eigentlich Soldaten, und so ähnlich. Von unseren Lehrlingen und Verkäuferinnen sind ja einige ohnmächtig geworden, das ist Unterernährung. Aber das wird anders werden. Und Ihre Kollegen, wie sind die sonst?«
»Ach, ich mag gar nicht ihre Redensarten hören; wissen Sie, wie diese älteren Leute sprechen?«
»Ich kann es mir vorstellen.«
»Das kennen wir, sagen sie. Alles kennen sie, alles haben sie schon erlebt. Diese Begeisterung, kennen sie, die Fahnen, kennen sie, den Krieg, kennen sie. Man kann es ihnen nicht klarmachen, dass sie diese Begeisterung, diese Fahne nicht kennen, dass unser Krieg nicht sein würde, wie der ihre war.«
»Aber wir werden ja gar keinen Krieg haben.«
»Ich meine, wenn wir zu einem gezwungen werden sollten. Sehen Sie, mit Ihnen verstehe ich mich. Sie sind nicht wie diese Ewig-Unzufriedenen.«
»Denken Sie, bei uns gibt es auch solche. Gestern, als ich eine Schuhschachtel öffnete – ich arbeite nämlich in der Schuhabteilung –, fand ich ein Flugblatt darin.«
»Haben Sie es gleich angezeigt?«
»Nein, das konnte ich nicht tun, ich hatte Angst, es hätte ein Mädel aus unserer Abteilung sein können: Tilly, Gilda oder Anna. Wenn ich höre, dass einem Kommunisten, den ich nicht kenne, dies oder jenes geschehen ist, da freue ich mich. Wieder so ein Hetzer unschädlich gemacht worden. Aber wenn ich jemanden kenne, dann ist das doch anders, finden Sie nicht?«
»Ich weiß nicht, ob Sie da recht haben. Was stand denn in dem Flugblatt?«
»So genau habe ich es nicht gelesen, es war ein Aufruf zum Roten Mai.«
»Es gibt keinen Roten Mai mehr, es gibt nur einen deutschen Mai, in dem alle einig sind.«
»Ja, schade nur, dass so viele Menschen nicht verstehen wollen, dass wir jetzt einig sind. Aber wir stehen hier und haben gar nicht die Rede des Führers gehört.«
»Das Feuerwerk dürfen wir nicht auch noch versäumen. Wir wollen einmal das Gelände vom strategischen Standpunkt betrachten, wie unser Sturmbannführer immer sagt. Wir müssen den richtigen Punkt finden, von dem man am besten alles übersehen kann. Geben Sie mir die Hand, sonst könnten wir uns wieder verlieren. Ich wäre dann so allein.«
»Allein unter so vielen Menschen?«
»Wenn wir uns wieder verlieren würden, wäre ich sehr einsam. Und Sie?«
»Also, hier ist meine Hand.«
»Gehen wir hier auf diese Terrasse.«
*
»Schauen Sie, wie schön, wie bunte Sterne für den Weihnachtsbaum.«
»Aber jetzt kommt noch etwas Schöneres, der Niagarafall.«
»Ach, das ist herrlich, dieser unendliche Lichterfall, der den ganzen Himmel überrieselt.«
»Möchten Sie mit mir zu dem Niagarafall?«
»Sie dürfen jetzt nicht sprechen, sonst kann ich nichts sehen.«
»Aber jetzt kommt was ganz Tolles: Trommelfeuer an der Westfront.«
»Aber nein, das ist ja schrecklich, mein Trommelfell! Das hört ja gar nicht auf. Ist es nicht wie Kanonendonner?«
»Lehnen Sie sich doch an mich, dann werden Sie keine Angst haben. Eine Frau ist eben dem Trommelfeuer nicht gewachsen, auch wenn sie ein Hitlermädel ist. Aber einem Mann macht so was Spaß. Was meinen Sie, wenn es wirklich losgehen würde; das hier ist ja ein Kinderspiel. Aber es ist gut, wenn sich die Leute langsam daran gewöhnen.
Hätten Sie Angst um mich, wenn es Ernst würde? Wenn das Feuer kein Feuerwerk mehr wäre?«
»Das dürfen Sie gar nicht sagen.«
»Wir müssen weitergehen, es ist zu Ende.«
Die Massen überfluteten, wie Wasser, das über die Ufer tritt, das Feld. Sie versickerten in tausend Adern, die alle den Lichtern der Stadt zuströmten. Der ganze Raum war von Tönen erfüllt, aber es war wie das sinnlose Rauschen und Raunen des Wassers.
Nur hier und da wurden einzelne Sätze deutlich:
»Nein, so was von Menschenmengen!« – »Das Feuerwerk war wirklich großartig.« – »Viel Gerede, wenig Sinn.« – »Großer Rummel.«
Das Mädchen und der Junge hielten sich wieder an den Händen.
»Haben Sie das gehört?« sagte der Junge, und seine Stimme klirrte vor Empörung. »Überall lauern noch Feinde, man muss wach sein.«
»Ja, das muss man, das glaube ich auch.«
»Wie gut, dass Sie ein Hitlermädel sind, ich glaube, ich hätte Sie sonst gar nicht angesprochen.«
»Und ich hätte Ihnen vielleicht gar nicht geantwortet, wenn Sie nicht ein SA-Mann wären.«
»Wir müssen uns wieder treffen, ja? Am Sonntagnachmittag im Tiergarten bei den Hirschen, sagen Sie: ja.«
»Ja.«
»Aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Gestatten Sie, mein Name ist Erwin Dobbien.«
»Sind Sie aber förmlich! Ich heiße Elisabeth Weber.«
»Elisabeth.«
»Erwin.«
Die Sturmabteilung war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP während der Weimarer Republik und spielte als Ordnertruppe eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten <<<
Zweites Kapitel.
Warenhaus Alderman, Schuhabteilung
In der Kantine schwebte der ranzige Hauch von abgestandenem Fett und zerkochtem Kohl. Auch nach sorgfältigster Lüftung blieben Geruchsfetzen in dem Raum hängen, die sich schnell mit den Dämpfen der neuen, sich immer gleichenden, freudlosen Mahlzeiten vermischten.
Der Tisch der Schuhabteilung stand in der linken Ecke des weiten Saales gegenüber einem der wandlangen Fenster, in die sich wie in Rahmen die Bilder von Häuserriesen, das Grün verkrüppelter Bäume, dunkle Menschenknäuel einhängten.
Ohne Unterlass strömte die Menge durch die einladenden, von goldbetreßten Portiers behüteten Türen.
Das Verpönte gab diesem Palast aus seltenen Hölzern und teuren Steinen nur neue Anziehungskraft. Kein Verbot konnte den Wunsch, in Seide, Spitzen, Stoffen zu wühlen, ersticken, den Wunsch, Neues, Vielfältiges zu sehen.
Die Rosenholzintarsien, die perlmutterfarben schimmernden Porphyrsäulen, das Licht, das hell, doch ohne Grellheit aus blitzenden Röhren strahlte, gab dem billigsten Schund begehrenswerten Schimmer.
Mit glänzenden Augen rechneten die Frauen ersparte Groschen zusammen, um den verführerischen Kram erstehen zu können.
Aber auch, wenn man nicht kaufte, weil das Portemonnaie sich schwindsüchtig in der Tasche barg, oder auch, weil höhere Weltanschauung es verbot, konnte man dem Reiz des Suchens und Wählens nicht entgehen. Hier war im grauen, nüchternen Häusermeer der märchenhafte Basar aus Tausendundeiner Nacht.
Man mochte weniger kaufen, aber umso eifriger beschäftigte man die dienstbaren Geister des Hauses.
Sie stärkten sich jetzt in Etappen zu neuem Dienst.
Die Schuhabteilung wirkte im Saal wie ein großer lila Fleck. Die Mädchen trugen veilchenfarbene Kleiderschürzen. »Sie wirken dekorativ und schmutzen nicht leicht«, hatte der Zeichner, der ihre Tracht entworfen hatte, dem Dekorationschef erklärt. Aus der Ferne glichen sich die Verkäuferinnen, als wären sie standardisierte Blumen, die ein ehrgeiziger Gärtner nach neuesten Methoden züchtete.
Elisabeth war nicht mehr braun, auch sie war veilchenfarben. Jetzt war sie kein Hitlermädchen, jetzt stand sie im Dienste des Hauses Alderman, und das zwischen Martha, Tilly, Emilie und Anna. Sie saß genauso erschöpft da wie alle. Sie tauchten ihre Löffel mit dem gleichen Ausdruck der Müdigkeit in die trübe Brühe, die schon durch ihre graue Schleimigkeit jede Hoffnung auf Freuden des Gaumens erstickte.
Nur ein Mädchen kam erst jetzt mit ihrem Suppenteller, den sie auf der Handfläche balancierte.
Sie mimte eine Frau mit neuen engen Schuhen, die aber ungeheuer stolz auf diese Schuhe ist, das eitle Gesicht schmerzgeplagt, und doch vor Stolz strahlend.
»Gilda, setz dich endlich!«
Gilda tänzelte mit dem Teller zum Tisch, die braunen Locken tänzelten, die langen Wimpern tänzelten.
»Ich verstehe nicht, dass diese Gilda nicht müde ist.« Martha hielt den Suppenlöffel in der Hand, als wäre seine Last zu viel für sie. »Die Pause sollte man wenigstens ausnützen, um sich auszuruhen.«
»Ich kann doch nichts dafür, ich muss doch immerfort an meine letzte Kundin denken.« Gilda lachte und machte große Augen. Die Mädchen sagten, dass sie Gildas wegen lila Schürzen tragen müssten, damit Gildas Augen noch veilchenfarbener wirkten. Der Zeichner hatte sich in sie verguckt.
»Iss doch erst mal.«
»Eidechsenschuhe hat sie gekauft, ihre Hühneraugen tun mir ja so leid; ich habe ihr von den Eidechsen erzählt, was die für eine unverwüstliche Haut haben, weil sie ein so gefährliches Leben in den Urwäldern führen. Eidechsenschuhe zerreißen nie. – Sind das auch echte Eidechsen? hat sie mich gefragt; darauf habe ich ihr gesagt: Aber, gnädige Frau, unser Chef, Mister Elderman, war selbst mit einer Expedition in den südamerikanischen Urwäldern auf der Eidechsenjagd. Und ich habe dazu nicht gelacht! Sie hat’s mir geglaubt. Deshalb musste sie die Schuhe kaufen, auch wenn sie ihr zu eng waren.«
»Du wirst noch wegen deiner Albernheiten herausfliegen; denk daran, dass ich dir das prophezeit habe«, sagte Emilie, die Gilda nicht anders als missbilligend anblicken konnte.
»Mister Elderman auf der Eidechsenjagd, das ist gut; ich möchte nur wissen, woher er wirklich kommt.«
»Aus Amerika jedenfalls.«
»Er ist Amerikaner, ein Mister, da kannst du nichts gegen machen; jetzt gehören die meisten Aktien einem Amerikaner.«
»Nichts gehört ihm, man tut nur so, man muss nur sehen, wie er vor Herrn Direktor Lanz katzbuckelt.«
Tilly spürte gegen diesen neuaufgetauchten Chef Abneigung, weil er einmal missbilligend sich über ihre Art, Schuhe zu präsentieren, geäußert hatte.
Dieser Mister Elderman, der im Hause Alderman plötzlich aufgetaucht war, hatte vor vielen Jahren als ein simpler, sich vor Gläubigern flüchtender Herr mit einer kleinen Abfindung seines reichen Onkels Europa verlassen; er wurde kein Millionär wie in den Märchen, das Schicksal war ihm nicht hold. Er fristete sein Leben aus jämmerlichen Provisionen, die ihm aus kleinen, bunt zusammengewürfelten Geschäften zuflossen. Er hatte sich schon damit abgefunden, dass er als verbrauchter Mann, zermürbt von kleinlichen Sorgen, im Exil sterben würde, als ihn ein Notar im eingeschriebenen Brief zu sich bat. Er hatte zwar keine Erbschaft gemacht, wie er in der ersten freudigen Überraschung erhofft hatte; der Notar wollte von ihm wissen, ob er amerikanischer Staatsangehöriger geworden sei, und prüfte aufmerksam seine Papiere. Als kein Zweifel mehr bestand, dass er Bürger des mächtigsten Staates sei, eröffnete ihm der Notar, dass seiner eine bedeutende und ausgezeichnet bezahlte Stellung im Hause Alderman harrte. Er würde sogar, allerdings mit allen nötigen Rückversicherungen, pro forma Mitbesitzer des Hauses. Mister Elderman konnte sich erst kaum über diese neue Wendung in seinem Schicksal fassen, aber er nahm natürlich die Berufung an. Warum auch nicht? Wenn man ihn in Deutschland brauchte! Er würde seine Verwandten nicht im Stich lassen.
So erhielt das Haus Alderman eine amerikanische Note, und Verordnungen des dahinstürmenden Nationalsozialismus wurden von ihr besänftigt und entgiftet.
»Natürlich ist das Ganze nur eine Schiebung«, sagte Elisabeth. »Die Juden verstehen es zu gut, sich zu drehen und zu wenden.«
»Warum nur die Juden?« fragte Anna und sah dabei Elisabeth so prüfend an, dass diese sich verärgert wieder mit ihrer Suppe zu beschäftigen begann. »Hat sich bei den Großkonzernen irgendwas geändert?«
»Hast du Sorgen, Anna! Großkonzerne! Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, wie schlecht heute wieder die Suppe ist, das ist auch ’ne Schiebung.« Tilly sah unzufrieden um sich.
Auf die Anna muss man aufpassen, ich hätte das Flugblatt doch anzeigen sollen. Elisabeths Gesicht wurde ganz düster.
»Ich verstehe gar nicht, wie ihr euch erlauben könnt, von Schiebung zu sprechen«, sagte Emilie, die, obgleich sie in letzter Zeit glühende Nationalsozialistin geworden war, nie vergaß, dass sie das Brot des Hauses Alderman aß. »Man hat doch keinen Amerikaner nötig; Herr Direktor Lanz ist doch der eigentliche Inhaber, und er ist Arier.«
»Er ist Schwiegersohn und nicht Inhaber.«
»Er hätte’s nicht mal nötig, Arier zu sein, er ist doch Österreicher.«
»Ich kann gar nicht verstehen, wie ihr so viel reden könnt«, sagte Martha. Sie ist eine geschiedene Frau, die noch für zwei Kinder zu sorgen hat. Ihr Mann hat sich einfach aus dem Staube gemacht und ist jetzt irgendwo im Ausland. »Ich habe das Gefühl, ich schaffe es nimmer; mein Rücken – als hätte man ihn in Stücke geschlagen.«
»Das ist auch kein Wunder, wir müssen jetzt viel mehr schaffen. Rechne es dir aus: aus unserer Abteilung sind zwei Mädchen entlassen: die Hirsch, weil sie Jüdin ist, die Mertens wegen marxistischer Umtriebe.«
Anna sprach ruhig, aber Elisabeth betrachtete sie voller Misstrauen: Warte nur, du, ob du nicht auch wegen marxistischer Umtriebe entlassen wirst. Wühlmaus! Immer mit diesen hinterhältigen, aufreizenden Bemerkungen. Sie versucht, die Mädchen aufzuhetzen. Das ist unrecht. Man soll nicht das Aufbauwerk stören. Ich kenne diese Stillen, an die man nicht so leicht heran kann. Aber ich werde aufpassen!
Anna sieht gar nicht wie eine Maus aus. Sie hat große braune Augen und ein so klares Gesicht. Sie ist die beste Verkäuferin in der Abteilung, ruhig und sicher; die Kunden lassen sich gern von ihr beraten, und sie schwätzt ihnen nie etwas aus Spaß auf wie Gilda.
»Ach, ich habe es euch noch gar nicht erzählt«, rief Tilly, »ich habe vor einigen Tagen die Hirsch, das arme Luder, getroffen. Wie die aussieht! Jeden Knochen an ihr kannst du zählen. Fünfzehn Jahre war sie hier angestellt; geschuftet hat sie wie keine, und jetzt kann sie glatt verhungern.«
Die Tilly soll schweigen, dachte Elisabeth. Jetzt bedauern sie natürlich alle die Hirsch, sie kann doch nichts dafür, dass sie Jüdin ist, denken sie, auch wenn sie es nicht sagen. Aber warum sollen die Fremden Brot haben und die Deutschen hungern. Wie viel Millionen Arbeitslose haben kaum zu essen. Sie überlegte das alles schnell, um das Gefühl zu betäuben: die arme Hirsch!
»Weißt du, das ist gar nicht so klug von dir, eine Jüdin zu bedauern«, sagte Emilie und sah kampfbereit auf Tilly.
Elisabeth, die eigentlich auch aussprechen wollte, was Emilie sagte, empfand doch Unwillen, vielleicht nur, weil Emilie erst seit so kurzer Zeit in der Bewegung war.
Gilda schnupperte in der Luft herum und machte dann ein ganz begeistertes Gesicht.
»Ich weiß nicht, hier riecht’s so stark nach Märzveilchen, spürt ihr’s auch?«
Das allgemeine Lachen erboste nur Emilie:
»Ach, Gilda«, sagte sie geringschätzig, »weißt du, deine Mutter hat den richtigen Namen für dich ausgesucht, so ausländisch und komödiantisch.«
Gilda schluckte, das war gemein von der Emilie, ihr ihren Namen vorzuwerfen. Kann sie etwa dafür, dass ihre Mutter eine Opernschwärmerin ist? Eine Opernsängerin, die ihre Stimme verloren hatte und die jetzt armen Mädchen, die genauso hoffnungslos für Opern schwärmten wie sie, Stunden gab?
Die Mädchen hatten ihre Teller gewechselt und stocherten jetzt unlustig im Gemüse und dem hauchdünnen Fleisch herum.
»Ach, Kinder«, sagte Tilly und schob ihren Teller plötzlich weit von sich, »ich hatte heute einen Kunden, der hatte Schweißfüße, ihr könnt euch das nicht vorstellen.«
»Du Schweinigel. Dich hat sicher die Direktion gemietet, uns noch das bisschen Appetit zu verderben, das wir noch haben«, rief Martha.
»Natürlich, wir sollen nicht merken, dass die Portionen immer kleiner werden.«
»Kein Wunder, wird ja alles ständig teuerer.« Das sagte Anna.
Jetzt konnte Elisabeth nicht länger an sich halten. Sie wusste, Anna machte nur ihre Bemerkungen, um Unzufriedenheit zu säen. Es war ihre Mundpropaganda. Sie wollte nur das Schlechte sehen, nie das Gute.
»Wie kannst du immer nur so kleinlich sein.« Sie blickte erst Anna an, als sich aber ihre Augen begegneten, wandte sie sich ab und sah geradeaus vor sich hin. »Du willst nicht das Große sehen, jeder Kampf bringt Schwierigkeiten mit sich, jeder Kampf verlangt Opfer. Wenn man eine neue Welt aufbauen will, muss man von jedem Opfer verlangen.«
»Opfer von wem?« fragte Anna. »Wer bringt die Opfer, Elisabeth? Wer soll die Opfer bringen?«
Natürlich, jetzt denkt sie an die Margarine und an das Fett; die Reichen kaufen keine Margarine, die Reichen verdienen mehr und die Armen weniger, will sie mir sagen. Sie will es nicht sehen, dass sich dahinter noch etwas Großes abspielt. Es ist nur so schwer, das in Worte zu fassen, es zu erklären. Ich könnte ja ein leichtes Spiel mit der Anna haben, aber ich will sie überzeugen, nicht anzeigen.
»Man kann doch die Opfer nicht auf die Waagschale legen, wir wollen eine neue Welt. –«
»Kuckuck, ich kann auf die neue Welt blicken.«
Tilly hatte das Fleisch auf die Gabel gespießt und hielt die dünne Scheibe, als wäre es durchsichtiges Papier, vor ihre Augen.
»Lass doch die dummen Späße, jede Revolution hat Schwierigkeiten mit sich gebracht.«
»Ach was, Revolution, das ist doch gar keine Revolution.«
Emilie wollte dazwischenfahren, aber Gilda ließ sich nicht aufhalten. »Es hat sich doch nichts geändert, es ist alles beim alten geblieben. Wisst ihr, wie eine wirkliche Revolution aussehen würde? Da käme eine Kommission und suchte nach Talenten. Mich würden sie freilich gleich entdecken. Wie, Fräulein Gilda, Sie mit Ihrer Begabung für Tanz und Schauspielerei Schuhverkäuferin? Das ist ja Wahnsinn. Vergeudung der edelsten Menschenkräfte. Sie müssen lernen, sich bilden. Sie müssen eine große Künstlerin werden. – Aber ich habe kein Geld, würde ich sagen. – Kein Geld, was für eine Kleinigkeit, machen Sie sich keine Sorgen! Gibt es denn nicht genug Geld in der Welt? Wie viel Geld brauchen Sie, um sich ausbilden zu lassen? Wie, nicht mehr? Hier haben Sie es, bitte sehr! – Aber meine Mutter braucht auch Geld, um zu leben. – Natürlich, ja, wie viel? Erledigt, bitte sehr! – Aber, ach, mein Großvater braucht auch Geld! – Aber ja, natürlich, bitte sehr! – Das wäre eine Revolution.«
Alle lachen.
»Das könnte dir so passen«, sagte Emilie.
Elisabeth konnte die Augen nicht von Gilda wenden, während sie sprach. Was konnte sich dieses Mädchen alles ausdenken? Wie, wenn eine Kommission zu ihr käme? Was würde sie sich wünschen? Das Glück! – Das Glück? Das ist viel; was für ein Glück? – Nur das einfachste. – Liebe? – Ja, Liebe! – Wen lieben Sie? Wissen Sie es schon? – Ja, sie wusste es schon! – Was möchten Sie, ein Häuschen, ein Gärtchen? – Es genügte mir ein Fleckchen Erde, von dem ich sagen könnte: Hier bin ich zu Hause. – Sie verlangen nicht viel, ja bitte sehr. Sie möchten Kinder? – Ja, Kinder. – Bitte sehr.
Tilly schreit: »Ich würde der Kommission sagen … jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen würde, man hat soviel zu wünschen –«
Emilie schüttelt missbilligend den Kopf. »Gilda, du bist doch das verrückteste Luder hier im ganzen Hause. Ach was, das ist ein Kompliment für dich. Es gibt keine Verrücktere in der ganzen Stadt.«
»Warum müsst ihr euch immer zanken?« fragte Martha.
»Du hast recht, man sollte gar nicht hinhören auf diesen Quatsch«, sagte Emilie. »Gestern war ich im Kino, da habe ich ein wunderbares Stück gesehen. ›Blut und Erde!‹ Was führen die Bauern für ein schönes Leben! In einem Bildstreifen konnte man sehen, wie Adolf zu den Bauern spricht und wie er umjubelt wird. Und wie das fremde Blut den Bauern schadet. – Herrlich war es, sage ich euch!«
»Im Kino finde ich ja das Landleben sehr langweilig«, erklärte Tilly.
»Du verstehst eben nichts Höheres.«
»Gestern war ich mit meinem Freund auch im Kino. Mein Freund hat ein kleines Lichtspieltheater entdeckt, wo sie ganz alte Filme spielen. Da kann man wenigstens lachen. Einen Chaplin habe ich gesehen.«
»Gib mir die Adresse.«
»Ach, du möchtest dir auch so was ansehen!«
»Beruhige dich, ich würde nie etwas sehen wollen, was eigentlich gar nicht erlaubt ist.«
»Ach Gott, wir wissen schon längst, wie tugendhaft du bist, aber da gebe ich dir auch gar nicht die Adresse.«
»Brauche ich nicht, das wird ja sowieso verboten werden.«
»Übrigens haben sie noch einen ollen Film gespielt, wo der Albers als Nationalsozialist auftrat.«
»Das ist doch unmöglich. Früher hat der doch mit einer Jüdin gelebt. Da konnte er doch gar keine Nazis spielen!«
Tilly begann zu trällern: »Das ist die Liebe der Matrooosen!«
»Na, hör mal, so uralte Klamotten singst du – und noch dazu ganz falsch.«
»Das ist doch aus dem Film ›Bomben auf Monte Carlo‹.«
»Na, das ist doch noch lange vor Adolf gewesen, und den Film haben Juden gemacht, der wird doch auch verboten werden.«
»Aber der Albers ist doch darin wie ein Nationalsozialist. – Elegant, sag ich dir, ganz in Weiß und mit Gold. Du, er sieht wirklich dem ›Hermann‹ ähnlich. Ach, ist er schick. Er verliert sein Geld im Kasino, aber das Geld gehört ihm gar nicht. Er verlangt es von der Spielbank zurück, aber die tun, als hätten sie gar nichts gehört. Da bombardiert er Monte Carlo. Tolle Sache, was? Er hat nämlich ein Kriegsschiff; natürlich kriegen die von der Spielbank Angst und rücken das Geld raus. – Warum soll das verboten werden?«
»Der Film ist doch von Juden gemacht, das Lied darfst du gar nicht singen: Das ist die Liebe der Matrosen. Das hat ein Jude komponiert. Mein Freund ist SS-Mann, der weiß das alles.«
»Ach, ist dein Freund SS-Mann?« rief Gilda. »Schwarz muss dir sehr gut zu Gesicht stehen. Erinnert ihr euch noch, als Emiliens Freund Reichsbannermann war? Ein hoher Reichsbanner-Funktionär.«
Die Schuhabteilung lachte so schallend, dass sich die anderen Tische nach den Veilchenfarbenen umsahen, denn es war viel stiller geworden im Saal.
Frau March durchschritt den Raum. Sie ist die Leiterin der Personalabteilung. Die Mädchen erzittern, wenn sie sie mit den Blicken nur streift; sie möchten sich am liebsten unsichtbar machen. Sie könnte vielleicht auf den Einfall kommen, man sei überflüssig. Frau March hat eine besondere Organisationsbegabung. Ihre Chefs erkennen sie dankbar an.
Sie hat die Fähigkeit, zu berechnen, wie eine Arbeit, die früher von zweien gemacht wurde, jetzt eine schaffen könnte. Sie hätte ihre Begabung wahrscheinlich mit demselben Eifer zur Geltung gebracht, wenn sie der Allgemeinheit Nutzen gebracht hätte. So aber erfreute sie nur die Chefs des Hauses Alderman. Wenn sie im Chefzimmer verschwand, zitterten die Mädchen: Jetzt macht sie Abbau-Vorschläge. Wer war überflüssig?
Frau March trug ein schwarzes Seidenkleid, das leise rauschte. Ihren Busen zierte als einziger Schmuck das Doppelkreuz der nationalsozialistischen Frauenschaft.1 Sie übertrieb aber nie die Gesinnung, die sie leicht, ohne besondere Grübeleien, wechselte.
Sie stand jetzt vor dem Tisch der Schuhabteilung und grüßte mit »Heil Hitler«, aber nicht laut und aufdringlich, sondern nur so, wie man guten Tag sagt. Die Hand reckte sie nicht hart in die Luft, sondern hob sie nur, als verscheuchte sie eine Fliege.
Der Veilchentisch merkte erst auf, als sie dicht davor stand und das »Heil Hitler« sich mit dem Mädchenlachen vermischte.
Die Mädchen begannen erschrocken, sich mit ihren Tellern zu beschäftigen. Einige murmelten leise, nur Emilie stand mit erhobenem Arm auf und schmetterte laut den Gruß.
»So ist’s richtig«, sagte Frau March huldvoll. »Zu der Jugend gehört Fröhlichkeit. – Worüber habt ihr euch unterhalten?«
Emilie stand noch immer, ihr halboffener Mund rundete sich, als versuchte er, Worte zu formen, die das Gehirn noch nicht klar vorgezeichnet hatte.
Aber Frau March wandte sich an Elisabeth:
»Nun erzähl, worüber habt ihr gesprochen?«
Elisabeth erhob sich halb von ihrem Sessel, ihre braunen Augen richteten sich in ihrer klaren Offenheit, die ihr die Zuneigung ihrer Vorgesetzten gewann, auf Frau March.
»Über Hans Albers«, sagte sie und lächelte etwas verschämt.
Die Tafelrunde atmete befreit auf.
»Na, ihr seid doch immer die gleichen Dummchen. Wir leben in einer großen Zeit, und ihr merkt nichts davon.«
Frau March ging nachsichtig lächelnd weiter.
Das Rauschen ihres Kleides brachte langsam überall das Lachen und Durcheinander im Saal zum Verstummen.
Erst als sie schon längst fort war, rief Gilda:
»Emilie hätte anders geantwortet.«
»Ach was, Elisabeth gehört doch zu Frau March, die sich mit dem Direktor Lanz zusammen nur darüber den Kopf zerbricht, wen sie von uns fortschicken soll. Ich will überhaupt nichts mehr reden, ich habe ja auch nie was gesagt. Ich habe bemerkt, wie prüfend mich immer die March ansieht, wenn ich müde bin. Sie lauert nur darauf, dass man irgendein Wort sagt, das einem schaden könnte. Man weiß auch nicht, was die Elisabeth spricht, wenn wir nicht dabei sind.«
»Martha, ich glaube wirklich, du bist zu müde, als dass du noch wüsstest, was du daherredest. Das ist eine ganz große Gemeinheit, aber ich kümmere mich nicht mehr darum, was ihr zusammenmeckert. Ich sage euch etwas: Übermorgen ist Sonntag.«
Plötzlich lief über die weiten Flächen der Wangen, der schmalen Gracht zwischen den Augen ein leuchtendes Lächeln.
Noch einmal sagte sie vor sich hin: »Übermorgen ist Sonntag.«
Tilly starrte sie aufmerksam an: »Elisabeth, du bist ja verliebt – hört mal, Elisabeth Weber, das deutsche Heldenmädchen, ist verliebt. Ich sage euch das, ich, Tilly.«
Plötzlich treibt ein langanhaltendes Klingelzeichen die Mädchenschar wie ein Wirbelwind durcheinander. Eine neue Schicht kommt, die alte geht.
»Sechs Stunden noch bis zum Ende«, flüsterte Martha.
»Ach ja, aber übermorgen ist Sonntag.«
»Sechs Stunden noch, wann werden sie ein Ende nehmen?«
»Ach, Sonntag, bald ist wieder Sonntag!«
Die NS-Frauenschaft war die dem Kreisleiter unterstellte Frauenorganisation der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. <<<
Drittes Kapitel.
Marschmusik unter blühenden Kastanien
Der Sonntag kam, ein Sonntag, genau wie ihn sich Elisabeth und Erwin ersehnt und erwünscht haben.
Hoffentlich wird es nicht regnen, dachte Erwin, während er Konten nachschlug, Unterschriften verglich und Zahlenreihen zusammenrechnete. Hoffentlich wird es nicht regnen. Nicht als ob ihn selbst etwas störte, wenn es goss, das Unwetter möchte er sehen, das ihn hindern könnte, eine Verabredung einzuhalten. Aber die Mädchen, und selbst die bei Hitler, sind so zimperlich und haben Angst um ihre Kleider und Hüte. Und wenn es regnet, denken sie gar nicht mehr an den Treff im Tiergarten und gehen einfach ins Kino mit dem ersten besten, der in der Nähe ist.
Der Prokurist Melchior brüllte ihn an: »Was ist endlich mit dem Konto Hauswirt und Haas? Ich möchte nur wissen, Herr Dobbien, wo Sie eigentlich immer Ihren Kopf haben.«
Wenn das endlich ein Ende nehmen würde, die Konten und die Zahlenreihen und der Herr Melchior mit seinem Gebrüll! –
Wenn es nur nicht regnet am Sonntag. Elisabeth kniete vor einer Dame, der sie die Schuhe anpasste, als betete sie. Auch ihr Gesicht drückte inbrünstiges Flehen aus.
Vielleicht hat er die Verabredung schon längst vergessen. Man weiß doch, wie die Männer sind. Aus dem Auge, aus dem Sinn! Ich würde natürlich auch hingehen, wenn es regnete. Aber im Regen vergeblich zu warten, das ist scheußlich. Nicht, als ob ich Angst hätte vor dem Regen, aber es wäre doch so trostlos.
Aber die Befürchtungen waren überflüssig. Der Sonntag im Tiergarten war schön. Blauseiden fiel der Himmel auf den grünsamtenen Rasen. Das war ein gepflegter Rasen, wie geduscht und rasiert. Mit bunten Blumen bestickt. Wie schön ist der Tiergarten, denken beide. Sie haben ein bisschen Angst, sie könnten sich nicht gleich wiedererkennen.
Sie brauchen die bronzenen Hirsche, die die Zeit mit grünen Fingern ganz sachte berührt hatte, nicht wartend zu umkreisen. Beide sind vor der verabredeten Zeit da.
Aber wie sollten sie sich nicht wiedererkennen! Sie kennen sich nicht seit einigen Tagen, sie kennen sich seit ewigen Zeiten.
»Sie sehen heute so mädchenhaft aus«, sagte der Junge und nahm die Hand Elisabeths.
Sie trug ein geblümtes Organdykleid – der Stoff war aus dem Ausverkauf, und beim Zuschneiden hatte ihr Gilda geholfen. Bis jetzt hatte sie sich nicht viel aus Kleidern gemacht, es war ihr gleich, wie sie aussah, aber jetzt war das anders. Doch sie war auch heute ohne Hut. Hüte waren so spießig! So bürgerlich!