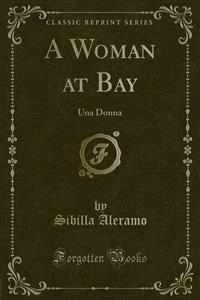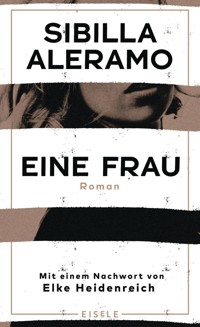
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"Lieben und Opfer bringen! War ihr Schicksal vielleicht das Schicksal aller Frauen?" Der erste feministische Roman Italiens in deutscher Neuübersetzung Die unbeschwerte Kindheit von Sibilla Aleramo findet ein abruptes Ende, als sie sich mit siebzehn Jahren in einen Arbeiter aus der Glasfabrik ihres Vaters verliebt, ungeplant schwanger wird und heiraten muss. Plötzlich Mutter und Ehefrau, sieht sie sich gefangen in den patriarchalen Strukturen der damaligen Zeit – so wie ihre eigene Mutter und alle Frauen, die sie kennt. Doch statt sich den Erwartungen an ihre neue Rolle zu fügen, strebt sie nach Freiheit, Selbstbestimmung und einem Leben voller Bildung und Literatur. Sibilla Aleramo ist "eine Frau" – und doch fängt sie das Schicksal einer ganzen Generation von Frauen ein und beschreibt authentisch und mit außergewöhnlicher Intensität, wie sich ihre Protagonistin aus den Fesseln der Tradition befreit und ihre eigene Identität findet. Eine Frau ist nicht nur das eindringliche Porträt der italienischen Gesellschaft um die Jahrhundertwende, sondern auch ein Manifest für Gleichberechtigung in jedem Sinne – und inspiriert so noch heute, über die Grenzen der eigenen Lebensumstände hinaus zu denken. "Die erste feministische Autorin Italiens!" La Repubblica
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Ähnliche
Das Buch
Als ihre unbeschwerte Kindheit brutal zu Ende geht, entdeckt Sibilla Aleramo die schockierende Realität des Lebens einer Frau in Italien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie beginnt, die Ähnlichkeiten zwischen ihrer eigenen misslichen Lage und der ihrer Mutter und der Frauen um sie herum zu erkennen, und kommt zu der Überzeugung, dass sie ihrem Schicksal entkommen muss.
Die Autorin
SIBILLA ALERAMO, geboren 1876, gilt als eine der Wegbereiterinnen des Feminismus in Italien. Als sie 1906 Eine Frau veröffentlicht, erregt der Roman in ganz Europa Aufsehen. Maxim Gorki, Stefan Zweig, James Joyce und Auguste Rodin wollen die Frau kennenlernen, der es mit ihrer ersten Veröffentlichung gelungen ist, wahre Schockwellen durch die internationale Literaturszene zu schicken. Nach dem Erscheinen ihres Skandalromans schreibt Aleramo jahrelang keine Prosa mehr. Sie konzentriert sich auf ihre Arbeit als Journalistin für soziale Zwecke, begeistert sich für den Kommunismus und schreibt Lyrik. Sibilla Aleramo stirbt 1960 in Rom.
Sibilla Aleramo
Eine Frau
Roman
Aus dem Italienischen von Ingrid Ickler
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Dieses Buch wurde übersetzt dank einer Übersetzungsförderung des italienischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Kooperation.
Die Originalausgabe »Una donna« erschien 1906 bei Feltrinelli, Mailand.
ISBN 978-3-96161-194-2
© Giangacomo Feltrinelli Editore Milano
First published in »Universale Economica«, November 1950
© 2024 der deutschsprachigen Ausgabe
Julia Eisele Verlags GmbH, München
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: © suteishi/getty-images
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Über das Buch / Über die Autorin
Titel
Impressum
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zweiter Teil
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Dritter Teil
20
21
22
Nachwort
Die Furchtlose
EMPFEHLUNGEN
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Textbeginn
Erster Teil
1
Meine Kindheit war heiter und frei. Sie mir ins Gedächtnis zurückzurufen, sie erneut in meinem Bewusstsein erstrahlen zu lassen, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Ich sehe das Mädchen vor mir, das ich mit sechs, mit zehn Jahren war, als hätte ich sie nur geträumt. Ein schöner Traum, der angesichts der Realität der Gegenwart verschwindet. Er wird eingehüllt von einer Melodie oder auch einer ebenso zarten wie pulsierenden Harmonie, einem Licht, und der immer noch großen Freude, wenn ich daran zurückdenke.
In der langen dunklen Phase meines Lebens habe ich diese frühe Zeit als etwas Perfektes, als das wahre Glück angesehen. Jetzt, mit einem weniger von Angst und Sorgen getrübten Blick, erkenne ich, dass auch über meinen ersten Lebensjahren einige diffuse Schatten lagen, und spüre, dass ich mich schon als Kind nicht ganz glücklich gefühlt haben konnte. Aber auch nie unglücklich, sondern frei und stark, ja, das dürften meine Gefühle gewesen sein. Ich war die Älteste, und ich hatte keine Scheu, meine zwei jüngeren Schwestern und meinen Bruder meine Überlegenheit spüren zu lassen. Mein Vater zog mich ihnen offensichtlich vor, und ich verstand nach und nach immer besser, warum er mich so erzog. Ich war – so hieß es jedenfalls – gesund, anmutig, klug, hatte Spielsachen, Süßigkeiten, Bücher und ein Stück Garten ganz für mich allein. Meine Mutter verbot mir nie etwas. Selbst bei meinen Freundinnen gab ich den Ton an.
Die Liebe zu meinem Vater beherrschte mich. Ich mochte meine Mutter, aber für meinen Vater empfand ich grenzenlose Verehrung. Diese Diskrepanz war mir bewusst, aber über die Gründe wagte ich nicht nachzudenken. Er war das leuchtende Vorbild meiner noch jungen Persönlichkeit, das Symbol für die Schönheit des Lebens, und instinktiv glaubte ich, dass seine faszinierende Ausstrahlung gottgewollt war. Niemand war so wie er, er wusste alles und er hatte immer recht. Stundenlang gingen wir Hand in Hand spazieren, durch die Stadt oder vor ihren Toren, ich fühlte mich leicht, wie über allem schwebend. Er erzählte mir von den Großeltern, die kurz vor meiner Geburt gestorben waren, von seiner Kindheit, den wunderbaren Erlebnissen und den französischen Soldaten, die er mit acht Jahren in seiner Heimatstadt Turin hatte einmarschieren sehen, als es »Italien noch nicht gab«. Eine solche Vergangenheit hatte etwas Unwirkliches. Er ging neben mir, ein schlanker hochgewachsener Mann mit schnellen Bewegungen, den Kopf stolz aufgerichtet, auf den Lippen das triumphierende Lächeln der Jugend. In diesen Augenblicken erschien mir die Zukunft voller vielversprechender Abenteuer.
Mein Vater organisierte meinen Unterricht und meine Lektüren, ohne jedoch viel von mir zu verlangen. Die Lehrerinnen hingen an seinen Lippen, wenn sie zu uns nach Hause kamen, manchmal sogar mit einer gewissen Ehrerbietung, so kam es mir zumindest vor. In der Schule gehörte ich immer zu den Besten und hatte oft das Gefühl, privilegiert zu sein. Vom Beginn meiner Schulzeit an bemerkte ich den Unterschied in Kleidung und Mahlzeiten. Ich konnte mir gut vorstellen, wie es in den Familien meiner Mitschülerinnen zuging, Arbeiterfamilien, die schwer schuften mussten, oder Kaufleute, die ein einfaches Leben führten. Wenn ich nach Hause kam, betrachtete ich das glänzende Schild neben dem Eingang, auf dem der Name meines Vaters zusammen mit seinem Titel eingraviert war. Als ich fünf Jahre alt war, hörte mein Vater nach einer Auseinandersetzung auf, in meiner Heimatstadt Naturwissenschaften zu unterrichten, und tat sich mit seinem Schwager aus Mailand zusammen, der ein großes Handelshaus besaß. Ich verstand, dass er sich mit dieser neuen Situation nicht besonders wohlfühlte. Wenn ich ihn an manchen freien Nachmittagen nach Hause kommen und das kleine Zimmer betreten sah, wo seine Gerätschaften für physikalische und chemische Experimente untergebracht waren, wurde mir klar, dass er sich nur dort wirklich an seinem Platz fühlte. Was würde mir mein Vater noch alles beibringen können!
Ich war nicht ungeduldig, aber die Neugier war ein starker Antrieb in meinem Leben. Ich langweilte mich nie. Oft lehnte ich es ab, meine Mutter zu begleiten, wenn sie irgendwelche Besuche machte, sondern blieb zu Hause, kuschelte mich in einen tiefen Sessel und las Bücher zu ganz unterschiedlichen Themen, die ich oft nicht verstand, an deren Fantasien ich mich aber berauschen und in denen ich komplett versinken konnte. Manchmal hielt ich inne, um unklare Gedanken zu formulieren, oft mit halblauter Stimme, als rezitierte ich Verse, die mir von einer inneren Stimme diktiert wurden. Ich empfand häufig Scham, zum Beispiel wenn ich in meinem Sessel schmachtende Positionen einnahm und mich dazu hinreißen ließ, mir vorzustellen, ich sei eine verführerische Schönheit. Konnte ich zwischen Affektiertheit und Natürlichkeit unterscheiden? Mein Vater betrachtete jede Form der Poesie mit einer gewissen Geringschätzung und Gleichgültigkeit, er sagte immer, er verstünde sie nicht. Meine Mutter deklamierte hin und wieder eine zärtliche oder sehnsuchtsvolle Gedichtzeile oder zitierte in leidenschaftlichem Tonfall Auszüge alter Romane, aber nur, wenn mein Vater nicht da war. Und immer war ich nur zu bereit zu glauben, dass mein Vater häufiger im Recht war als sie.
Das galt auch, wenn er einen seiner Wutanfälle bekam, vor denen wir alle zitterten und die mich sofort in einen Zustand unbeschreiblicher Angst versetzten. Meine Mutter unterdrückte die Tränen und floh ins Schlafzimmer. Oft nahm sie meinem Vater gegenüber eine unterwürfige, beinahe schuldbewusste Haltung ein. Und folglich gab es nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Kinder nur eine Person, auf die sich die gesamte Autorität konzentrierte: meinen Vater.
Große Auseinandersetzungen gab es zwischen ihnen jedoch nicht, nur einige scharfe Bemerkungen, Vorwürfe und knappe Ermahnungen, wenn wir in der Nähe waren. Sein aufbrausendes Temperament auszuleben, erlaubte sich mein Vater höchstens bei einem Fehlverhalten der Dienstboten oder vor uns Kindern, aber für all das schien meine Mutter verantwortlich zu sein, die dann immer den Kopf senkte, als ob sie plötzlich eine große Müdigkeit überfallen würde. Oder sie lächelte ein gewisses Lächeln, das ich kaum ertragen konnte, weil es ihrem schönen Mund einen resignierten Ausdruck verlieh.
Ob sie auch so oft an die Vergangenheit dachte?
Sie sprach mit mir fast nie über ihre Kindheit und Jugend, doch von dem wenigen, das ich wusste, konnte ich mir eine ungefähre Vorstellung machen, die allerdings wesentlich weniger spannend war als die von der Kindheit meines Vaters. Sie war in einem bescheidenen Angestelltenhaushalt groß geworden, und genau wie meine Großmutter väterlicherseits hatte auch ihre Mutter viele Kinder gehabt, die inzwischen zumeist überall auf der Welt verstreut lebten. Sie musste in beengten, lieblosen Verhältnissen aufgewachsen sein. Sie war das Aschenbrödel. Mit zwanzig Jahren lernte sie auf einem Ball meinen Vater kennen. Sie zeigte mir ein Bild von ihm als jungem Mann. Damals hatte er noch keinen Bart, er hatte weiche, regelmäßige Gesichtszüge, aber seine Augen verrieten bereits eine eiserne Entschlossenheit. Zu dieser Zeit war er im vorletzten Jahr der Universität. Nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte, bekam er einen Lehrstuhl und sie heirateten.
Als ich geboren wurde, war seit der Hochzeit noch kein Jahr vergangen. Die wenigen Male, wenn sie von der kleinen möblierten Zweizimmerwohnung erzählte, in der sie ihre ersten Monate als Ehefrau verbracht hatte, leuchtete ihr blasses, reines Gesicht auf. Warum war sie nicht immer so lebhaft? Warum weinte sie so schnell, obwohl mein Vater den Anblick von Tränen nicht ertragen konnte, und wann wagte sie mal ihre Meinung zu äußern, die oft ganz anders war als die meines Vaters? Warum hatten wir Kinder so wenig Achtung vor ihr und zeigten kaum Gehorsam? Genau wie mein Vater wurde auch sie hin und wieder von Wut übermannt, aber damals wirkte das immer, als würde sich ein zu lange unterdrückter Schluchzer endlich Bahn brechen … Ich hatte das Gefühl, dass die Ausbrüche meines Vaters, auch wenn sie übertrieben waren, immer etwas Natürliches hatten, sie gehörten zu seinem Wesen. Zeigte jedoch meine Mutter ihren Missmut gegenüber ihren Kindern oder den Dienstmädchen auf diese Weise, so stand das im Widerspruch zu ihrer sanften Natur. Es wirkte dann, als leide sie unter starken Anfällen, derer sie sich bewusst war und für die sie sich schämte.
Wie oft habe ich in den schönen Augen meiner Mutter unterdrückte Tränen glitzern sehen! Dann stieg ein unbeschreibliches Unwohlsein in mir auf, das kein Mitleid und auch kein Schmerz, keine echte Erniedrigung war, sondern eher ein finsterer Groll gegen meine Unfähigkeit zu reagieren, darauf, dass nicht das geschah, was geschehen sollte. Aber was? Das wusste ich selbst nicht genau. Als ich etwa acht Jahre alt war, litt ich unter der seltsamen Befürchtung, keine »echte« Mutter zu haben, eine Mutter, die, wie ich es in meinen Büchern gelesen hatte, ihre Kinder mit ihrer Liebe und einer unsagbaren Freude überschüttet und ihnen die Sicherheit vermittelt, stets von ihr beschützt zu werden. Einige Jahre später wich diese Furcht dem Bewusstsein, dass ich meine Mutter nicht so lieben konnte, wie ich es gerne gewollt hätte. Das war sicherlich der Grund, warum über unserem Haus stets ein unbestimmter Schatten lag, der oft verhinderte, dass man dort frei und spontan lachen konnte. Ach, wenn ich mich nur einmal ohne nachzudenken in ihre Arme hätte werfen können, mich verstanden gefühlt und ihr versichert hätte, dass ich, wenn ich mal groß wäre, an ihrer Seite sein würde. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, auch mit ihr ein zärtliches Band zu knüpfen, wie ich es mit meinem Vater schon seit langer Zeit getan hatte!
In aller Stille bewunderte sie mich und übertrug ein wenig von dem Stolz auf die große Selbstsicherheit ihres Mannes auch auf mich, aber seine Erziehungsmethoden, die er unbeirrt fortführte, gefielen ihr nicht. Sie machte sich Sorgen, war sicher, dass ich in Gefühllosigkeit aufwuchs und für ein Leben bestimmt war, das nur von Verstand geprägt wäre. Aber ihr fehlte der Mut, sich deswegen offen gegen meinen Vater aufzulehnen.
Aber auch mein Vater machte sich keine Mühe herauszufinden, wer ich wirklich war. Manchmal fühlte ich mich mutterseelenallein. Dann hüllte ich mich in die Traumwelten ein, die den geheimen Wert meines Lebens ausmachten.
Mein Schamgefühl erwachte. Neben dem Leben, das ich nach außen führte, entwickelte sich ein verborgenes Leben in mir, das niemand kannte. Diese Dualität spürte ich genau. Mir machten diese beiden Aspekte meines Wesens Sorge, seit ich in die Schule gekommen war. Dort hielten mich alle für eine engelsgleiche Gestalt, ich war brav, eine Musterschülerin, hatte immer ein schüchternes und gleichzeitig lebhaftes Lächeln auf den Lippen. Aber sobald ich wieder draußen auf der Straße war, wollte ich die gesamte Luft um mich herum aufsaugen und rannte und quasselte drauflos. Kaum betrat ich mein Zuhause, brach ein Erdbeben aus, meine Geschwister, die eben noch ruhig und zufrieden gespielt hatten, waren jetzt bereit, sich meiner unbeugsamen Autorität zu beugen.
Nachdem ich die Hausaufgaben gemacht und mich auf den Unterricht vorbereitet hatte, zog ich mich in mein kleines Zimmer oder in eine Ecke des Gartens zurück und existierte für die anderen nicht mehr. Ich wurde wieder von intellektuellem Eifer erfasst, hatte keinerlei Interesse, Freundschaften zu schließen oder mir mit irgendetwas Lorbeeren zu verdienen. Abends, nachdem uns meine Mutter dazu angehalten hatte, ein kurzes Gebet zu sprechen: »Herr, lass mich groß und brav werden, meinen Eltern ein Trost«, blieb ich allein im Dunkeln zurück, sobald meine Schwester eingeschlafen war. Dann breitete sich ein Gefühl der Ruhe und Entspannung in mir aus. Und das nicht nur körperlich. Es war, als ob ich in diesem Moment der erzwungenen Dunkelheit, der Stille und der Reglosigkeit viel freier war als tagsüber.
Ich betrachtete gerne die Schatten an der Wand, sie machten mir keine Angst, denn mein Vater hatte mir immer versichert, dass es die Ungeheuer und Hexen aus den Märchen gar nicht gab, genauso wenig wie »den Teufel«. Ich ließ noch mal die einzelnen Episoden des Tages Revue passieren, sah wieder das verführerische Lächeln meines Vaters vor mir, die verzweifelten Gesten meiner Mutter, ärgerte mich kurz über die Dummheit meiner jüngeren Geschwister und dachte auch an das, was am nächsten Tag auf mich warten würde: Prüfungsergebnisse, kleine Unternehmungen, neue Bücher und Spiele, Freundinnen und Lehrerinnen, die es zu erobern galt …
Jeden Abend ließ mich meine Mutter beten. Zu Gott …
Eines Tages, ich war in der zweiten Klasse, hatte ich gehört, wie man zu einer kleinen, stillen und blassen Klassenkameradin abfällig »Jüdin« gesagt hatte. Sie saß in der Bank neben mir. Sie war in Tränen ausgebrochen, und als die Lehrerin den Grund erfuhr, hatte sie strenge Worte gefunden. Die Angelegenheit hatte mich verwirrt, von Rassen und unterschiedlichen Religionen wusste ich noch nichts. Aber noch mehr hatte mich etwas erstaunt, was die Lehrerin gesagt hatte: Alle Religionen brachten den Menschen vor Gott und alle verdienten Respekt, und abscheulich und gleichzeitig zu bemitleiden war nur Einer: der Atheist. In diesem Moment war vor meinem inneren Auge mein Vater erschienen. Er war Atheist, da war ich sicher, er selbst hatte dieses Wort schon benutzt, er ging nicht in die Kirche … War mein Vater etwa für die Lehrerin, meine Mitschülerinnen, für alle Leute eine verachtenswerte Kreatur?
Einige Jahre später stellte ich mir die gleiche Frage in der Stille meines Zimmers noch einmal. Damals sprach mein Vater öfter über das, was er für eine jahrhundertealte Lüge hielt. Er erzählte, dass es vor uns Menschen Tiere gegeben hatte, die uns ähnlich waren, und dass noch früher, bevor es Pflanzen gab, die Erde eine Wüste war, dass sie nur ein winziger Punkt im Universum war, so wie für uns die Sterne am Himmel, und dass es noch andere Welten gab, in denen vielleicht auch Menschen lebten … Er sagte all diese merkwürdigen Dinge mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass ich sie nicht anzweifeln konnte.
Trotzdem erklärte er mir nicht – und ich traute mich nicht, ihn danach zu fragen –, warum wir auf dieser Welt sind. In dieser Hinsicht gab der Katechismus der Schule vielleicht eine befriedigendere Antwort: Gott hat uns geschaffen, Gott beobachtet uns von oben, Gott wird uns ins Paradies eintreten lassen, wenn wir gute Menschen sind … Das Leben ist nur ein Übergang.
Aber wie wichtig war dieser Übergang für alle! Ich hatte den Eindruck, dass niemand so recht an die Hölle glaubte, aber dass alle Angst hatten, sich zu verletzen, krank zu werden oder zu sterben. Ich war entschlossen, an das zu glauben, was mein Vater gesagt hatte. Es gibt keine Hölle, keine Engel und keine Versuchung, und ich hatte all das auch nie gespürt. Wenn ich gehorchte, dann, weil ich es wollte, wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte, dann weil ich davon überzeugt war, dass ich mir etwas hatte zuschulden kommen lassen. Also …? Tagein, tagaus waren meine Mutter, mein Vater, die Lehrerinnen, die Arbeiter, im Grunde alle, selbst die Reichen, alle, die Geld verdienten, damit beschäftigt, Nahrung zu kaufen, um zu essen und nicht zu sterben. So vergingen die Wochen, die Monate und die Jahre, und irgendwann starb man, auch meinen Geschwister und mir würde es so ergehen …
Das ärgerte mich. Ich spürte, wie mir die Augen zufielen. Morgen würde ich wieder darüber nachdenken und wieder keine Antwort finden. Verstehen, ich wollte es verstehen! Im Halbschlaf schossen mir geheimnisvolle Worte durch den Kopf: »Ewigkeit«, »Fortschritt«, »Universum«, »Bewusstsein« … Sie tanzten vor meinen Augen, und meine Müdigkeit verflog. Und wieder sah ich das zerknirschte Gesicht der Lehrerin vor mir, fragte mich, ob meine Mutter sonntags zur Messe ging, weil sie es wollte oder weil sie Angst vor dem Gerede der Leute hatte. Dabei fiel mir das erste und einzige Mal ein, als ich eine Predigt gehört hatte. Es war an einem Abend im Mai gewesen. Der Altar einer großen Kirche war von Kerzen erhellt und mit Jasmin geschmückt. Auf der Kanzel stand ein Priester, fuchtelte mit dem Arm und sprach mit majestätischer Stimme zu der knienden Menge, er sprach vom Wunder eines Heiligen und offensichtlich glaubten sie ihm. Am Ende begann die Orgel zu spielen, und von oben stimmte ein unsichtbarer Chor Lobpreisungen an, eine reine, silberne Welle … Immer wenn ich daran dachte, erbebte etwas in mir, ich bedauerte, dass ich weder beten noch singen konnte, und das verstärkte meine Einsamkeit noch mehr.
Danach löste sich alles auf. Warum sollte ich traurig sein? Ich war zwar noch klein, wollte aber nicht in die Irre geführt werden, eines Tages, wenn ich groß wäre, würde ich alles wissen.
Meine kleine Schwester neben mir schlief tief und fest. Vielleicht träumte sie von einem Haus aus Kristall für ihre Puppe, das hatte ich ihr irgendwann mal versprochen, damit sie mir mehr Platz in unserem schmalen Bett einräumte. Aber ich war nicht sicher, ob ich mein Versprechen würde halten können. Wenn ich doch nur schon groß wäre! Dann würde ich meine Geschwister auch lieber mögen und sie nicht mehr zum Weinen bringen und meine Mutter wäre endlich glücklich …
Ich musste wirklich schlafen, doch mein Kopf war hellwach. Einen Moment lang hoffte ich, von einem Windstoß zu einem der grünen Hügel auf dem Land geweht zu werden, die ich im Sommer so liebte. Aus der Ferne hörte ich den Ruf der Glocken …
2
Eines Morgens, ich hatte gerade die fünfte Klasse beendet, fragte ich mich, welche Richtung meine Schulbildung wohl nehmen würde. Mein Vater war eine Stunde früher als üblich nach Hause gekommen, in Begleitung des Büroboten, der eine Kiste auf der Schulter trug. Mein Vater verabschiedete ihn, dann hob er mich hoch, hielt mein Gesicht ganz nah vor seines und setzte mich wieder ab. Meiner besorgten Mutter, die ihn fragend ansah, erklärte er: »Es ist vorbei … Ich habe gekündigt. Endlich kann ich wieder frei atmen!«
Die beiden Geschäftspartner verstanden sich schon lange nicht mehr. Ihre unterschiedlichen Temperamente ließen sich nicht mehr unter einen Hut bringen. Der eine machte riskante Vorschläge, der andere versuchte ihn zu bremsen. Mein Vater langweilte das geregelte Büroleben, das ihm nicht mal großen materiellen Nutzen einbrachte. An diesem Morgen hatte eine heftige Szene zum endgültigen Bruch zwischen den beiden Schwagern geführt.
Mit sechsunddreißig Jahren begann mein Vater zum zweiten Mal ein neues Leben, Ursache war sein Hunger nach neuen Erlebnissen und nach Unabhängigkeit.
Am selben Tag machte er mit mir einen langen Spaziergang, ich sehe noch verschwommen die riesige Piazza d’Armi vor mir, die wir im leichten Herbstnebel überquerten, mein Vater sprach wie zu sich selbst. Mein kleines Ich jubelte innerlich. Amerika, Australien … Oh, wenn mein Vater uns tatsächlich mit auf die Reise um die Welt nehmen würde! Er deutete auch weniger abenteuerliche Möglichkeiten an: Er könnte wieder unterrichten, eine Firma gründen, aber in Mailand würde er auf keinen Fall bleiben. Die Stadt, die ich, ohne es mir einzugestehen, bis zu diesem Tag geliebt hatte, erschien mir jetzt unerträglich, wer weiß, welche wunderbaren Erlebnisse mich anderswo erwarteten! Plötzlich kam ich mir älter und sehr wichtig vor. War ich denn nicht die Vertraute meines Vaters? Die Vorstellung, weiter zur Schule zu gehen, löste sich in Luft auf. Vielleicht müsste ich arbeiten, die Familie unterstützen … Ich blickte in die Augen meines Vaters, die voller flammendem Enthusiasmus waren.
Meine Mutter zu Hause war jedoch wie erstarrt. Wovor hatte sie Angst? Sie war doch auch noch jung, jünger als mein Vater, wir Kinder waren gesund und stark … Sicherlich hätte sich auch mein Vater mehr Mut von ihr gewünscht!
Nur ein paar Wochen später, als ein Mann, der in Süditalien eine Chemiefabrik eröffnen wollte, meinem Vater eine Stellung als Direktor anbot, wirkte sie erleichtert. Ein großes Wagnis für meinen Vater, ohne Frage, denn er kannte sich in der Branche überhaupt nicht aus.
Aber das breite, selbstsichere Lächeln meines Vaters überzeugte den Unternehmer. Die Arbeitsbedingungen waren hervorragend, die Region ausgesprochen sonnig. Erst mal nur für ein paar Jahre, mein Vater plante nicht gerne lange im Voraus, und im Augenblick gefiel ihm das Risiko. Die Bedenken meiner Mutter waren ihm egal, und so wurde der Umzug auf das Frühjahr festgesetzt.
Sonne, Sonne, diese gleißende Sonne! Alles in dem Dorf, in dem ich ankam, glitzerte. Das Meer war eine weite, silberne Fläche, der Himmel über meinem Kopf ein unendliches Lächeln, ein unendliches Blau, das ein Genuss für die Augen war. Zum allerersten Mal enthüllte sich mir die Schönheit der Welt. Was waren die grünen Wiesen von Brianza und dem Piemont, die Täler und selbst die Alpen, die ich in meinen ersten Lebensjahren gesehen hatte, die sanften Seen und die prachtvollen Gärten im Vergleich zu dieser lichtdurchfluteten Landschaft, dieser grenzenlosen Weite über mir und vor mir, der wunderbaren Frische von Wasser und Luft? Die frische, salzige Luft strömte in meine gierigen Lungen, ich rannte den sonnendurchfluteten Strand entlang, stürzte mich in die Wellen und hatte das Gefühl, mich jederzeit in einen der großen weißen Vögel verwandeln zu können, die übers Meer flogen und am Horizont verschwanden. War ich nicht genau wie sie?
Ein perfekter Sommer voller Freude! Das war meine wunderbar wilde Jugend!
Ich war zwölf. Im Dorf, das sich mit der Bezeichnung »Stadt« schmückte, gab es keine weiterführenden Schulen. Der Hauslehrer, den man für mich eingestellt hatte, wurde schon bald wieder entlassen, weil er mir nichts beibringen konnte, was ich nicht schon wusste. In den heißen Mittagsstunden saß ich in dem winzigen Raum des großen Hauses, den ich zu meinem Arbeitszimmer auserkoren hatte, und warf ohne große Begeisterung mal einen Blick in ein Lehrbuch der Physik, der Botanik oder der Grammatik einiger Fremdsprachen, die mein Vater mir gegeben hatte. Zwischendurch trat ich auf den Balkon, schaute auf die Piazza hinunter und beobachtete die Müßiggänger nahe der Apotheke oder vor dem Caffè, Bäuerinnen, die unglaublich schwere Lasten trugen, schmutzig aussehende Jungen, die sich in einer unverständlichen, klangvollen Sprache beschimpften. Am Ende der Piazza glänzte das Meer. Zwei Stunden vor Sonnenuntergang konnte man in der Ferne die sich langsam nähernden Segelboote der Fischer beobachten, die eines nach dem anderen vom Fang zurückkehrten und sich auf ihrem Weg im Licht rot und gelb färbten. Das Stimmengewirr der Fischer drang bis zu mir herauf, ich hörte das rhythmische Rufen der Männer, die das Schiff ans Ufer zogen.
Ich ging nach unten und den langen Zaun neben der Eisenbahnstrecke entlang, wo der Bau des Fabrikgebäudes überraschend schnell voranschritt. Mein Vater verbrachte fast seine gesamte Zeit dort. Manchmal gab er mir kleine Aufträge, die ich umgehend und mit großer Sorgfalt ausführte. »Wirst du mir später helfen, wenn alles fertig ist? Du wirst meine Sekretärin, was meinst du?« In mir kämpften meine angeborene Schüchternheit und ein neuer Drang nach Unabhängigkeit und Wagemut. Vielleicht wollte mich mein Vater dafür entschädigen, dass ich nicht weiter zur Schule gehen konnte. Unvermittelt übermannte mich eine Art Stolz, die vage Erkenntnis, in Kontakt mit dem Leben zu kommen, etwas Echtes zu erleben, das vielseitiger und interessanter war als jedes Buch.
Die Arbeiter, Bauern aus den umliegenden Dörfern mit sonnenverbrannter Haut, die kamen, um sich zu bewerben, junge Frauen, die leichtfüßig aufs Baugerüst stiegen und Körbe mit Mörtel auf dem Kopf trugen, alle lächelten mich an, und ich empfand ihnen gegenüber eine von Sympathie geprägte Neugier. Gegenüber meinen Geschwistern wiederholte ich ihre lustigen Nachnamen und fragte mich, ob ich es jemals wagen würde, ihre Vorgesetzte zu sein, wie bei unserem Dienstmädchen.
Mein Vater war es gewöhnt, Anweisungen zu geben, er war unbeugsam und machtbewusst, voller Energie und Unternehmungsgeist. Wenn wir manchmal abends nach dem Essen mit meiner Mutter und meinen Geschwistern die Hauptstraße entlanggingen, betrachteten ihn die Dorfbewohner, die auf den Schwellen der Häuser standen, mit einer Mischung aus Bewunderung und Furcht. Für sie glich das Gesicht meiner Mutter dem der Madonna, die Frauen murmelten ihr Segenswünsche für die Kinder hinterher. Sie dankte ihnen mit einem sanften Lächeln, in ihrem bescheidenen Kleid wirkte sie klein und zierlich. Ich hatte das Gefühl, dass auch sie in solchen Momenten zufrieden war, denn in ihren Augen war das ein Zeichen der Ehrerbietung gegenüber ihrem Mann, der für sie damit wieder an Attraktivität gewann.
Ich erinnere mich an ein Foto von mir, das im darauffolgenden Jahr gemacht wurde. Ich hatte bereits eine Anstellung in der Fabrik und trug ein Kostüm, eine gerade geschnittene Jacke mit vielen Taschen, in denen meine Uhr, der Bleistift und der Notizblock steckten, darunter ein kurzer Rock. Meine kurz geschnittenen Locken kringelten sich über der Stirn, ich ähnelte einem jungen Mann. Meinen langen Zopf mit den goldblonden Strähnen hatte ich auf Anraten meines Vaters abgeschnitten.
Mein merkwürdiges Aussehen spiegelte perfekt meinen damaligen Zustand wider. Ich sah mich nicht mehr als Kind, hielt mich aber auch nicht für eine junge Frau, sondern ich war ein viel beschäftigtes Individuum, das von der Wichtigkeit seiner Aufgabe überzeugt war. Ich hatte das Gefühl, nützlich zu sein, und das gefiel mir wahnsinnig gut. Tatsächlich führte ich die Aufgaben, die mein Vater mir aufgetragen hatte, mit absoluter Loyalität und großer Leidenschaft aus. Genau wie er interessierte ich mich für die großen und kleinen Angelegenheiten der Fabrik. Es langweilte mich nicht, stundenlang Zahlen in Tabellen einzutragen, und mir gefiel es, inmitten der Arbeiter zu stehen, sie bei ihrer schweren Arbeit zu beobachten und mich in den Pausen mit ihnen zu unterhalten. Es waren viele, mehr als zweihundert, ein Teil kam aus dem Piemont und arbeitete im Schichtbetrieb Tag und Nacht an den Öfen, die anderen kamen aus der Umgebung und waren ständig auf den weiträumigen Innenhöfen und unter den Vordächern unterwegs. Geliebt wurde ich von all diesen Menschen wahrscheinlich nicht, aber sie mochten es, wenn ich plötzlich und mit raschem Schritt zwischen ihnen auftauchte, danach war ihre Arbeit sorgfältiger und gewissenhafter, eher so, wie ich es mir vorstellte. In ihren Augen war ich gerechter als mein Vater, und sie versuchten sich mit harmlosen Komplimenten mein Wohlwollen zu sichern, weil ich Einfluss auf den Mann hatte, den sie alle fürchteten. Aber ich wusste, dass ich an der eisernen Disziplin meines Vaters nichts ändern konnte. Außerdem war ich davon überzeugt, dass sie notwendig war. Es war mir wichtig, dass er als Vorgesetzter akzeptiert wurde, und mit meinem Gehorsam gab ich ein Beispiel. Vielleicht war sich mein Vater dessen sogar bewusst. Auf dem kurzen Weg zwischen der Fabrik und unserem Haus sprach er in einem Tonfall mit mir, den nur ich kannte, nicht sanft oder zärtlich, sondern in diesem Moment erholte er sich, er gönnte sich einen Augenblick des Innehaltens und der Entspannung. Er vertraute mir an: »Man müsste dieses oder jenes probieren … Dann könnten wir auch die Gehälter etwas erhöhen …« Er schien mich nach meiner Meinung zu fragen. Und ich dachte an das Glücksgefühl, das ich empfand, wenn mir etwas einfiel, das ich ihm vorschlagen könnte. Die Fabrik wurde für mich, genau wie für ihn, ein riesiges Lebewesen, das uns von allen anderen Sorgen abschirmte, das unsere Fantasie beflügelte und unsere Nerven strapazierfähig hielt. Wir liebten die Fabrik, sie war Teil eines herausfordernden Lebens, dem wir unterworfen waren, während wir uns der Illusion hingaben, sie zu beherrschen.
Kam ich nach Hause, verspürte ich das gleiche Unwohlsein, das ich früher als kleines Kind bei meiner Rückkehr aus der Schule immer gehabt hatte, nur hundertmal stärker. Ich fühlte mich fehl am Platz und verstärkte dieses Gefühl meines moralischen Ausgeschlossenseins durch unangemessenes Verhalten. Ich war wie ein junger Mann, der sich gerade aus den Klauen der Eltern befreit hatte und seine Arroganz an den Dienstboten ausließ. In überheblichem Ton zählte ich die Fehler meiner Schwestern und meines Bruders auf, beschwerte mich über ihren fehlenden Fleiß in der Schule, die mangelnde Disziplinierung durch meine Mutter, ihre fehlende Strenge.
Die Dienstboten mussten im Dorf schreckliche Dinge über mein Verhalten erzählen, nie nahm ich eine Nadel zur Hand, nie kümmerte ich mich um den Haushalt … Und dazu meine grundlosen Wutanfälle! Sie waren nur mit denen meines Vaters zu vergleichen! Vielleicht entlud sich in diesem Moment meine Anspannung, vielleicht waren sie auch Anzeichen einer Adoleszenzkrise. Ich wusste es nicht. Danach musste ich raus, machte ewig lange Spaziergänge am Meer und füllte mich mit der guten frischen Luft, um dann entspannt nach Hause zurückzukehren, wo ich die Erinnerung an meine schlechte Laune zu vertreiben versuchte. Dann vergaß ich auch den Ausdruck tiefen Schmerzes auf dem Gesicht meiner Mutter während dieser Wutanfälle wieder.
Meine Mutter! Wie konnte ich ihr gegenüber nur so gleichgültig sein? Sie war nahezu ganz aus meinem Leben verschwunden. An die Phasen des langsamen Verfalls ihrer Persönlichkeit nach unserer Ankunft im Dorf kann ich mich nicht mehr erinnern. Von Anfang an konnte sie eine gewisse Scheu nicht überwinden, die sie daran hinderte, alleine auszugehen oder mit den Kindern einen Ausflug an den Strand oder in die Umgebung zu machen. Mehr Unterhaltung gab es im Dorf nicht. Die Frauen der Oberschicht verließen nur selten das Haus, sie waren ungebildet, träge und abergläubisch. Die Bauersfrauen hingegen arbeiteten noch härter als die Männer, ein Großteil der Dorfbevölkerung lebte am Meer und vom Meer. Nachts schliefen sie in Bretterbuden, die nur hundert Meter vom Ufer entfernt standen.
Auch für die Fabrik interessierte sich meine Mutter nicht, auch dort fand sie keine Zerstreuung. Ich gebe zu, dass ich ihr dafür dankbar war, denn sie hätte meine Art sicher missbilligt. Stärker noch als in Mailand spürte ich, dass ihre Vorlieben und ihr Temperament so ganz anders waren als die meines Vaters – und damit auch als meine. Und ich ahnte, dass diese Unterschiede der Grund für die Differenzen zwischen meinen Eltern waren, die sie nicht mehr verbergen konnten. Aber ich kümmerte mich nicht darum, oder besser, ich schüttelte unangenehme Gefühle ab, statt sie zu hinterfragen. Vielleicht fürchtete ich instinktiv, ich würde sonst etwas entdecken, was ich in meinem Alter noch nicht bewältigen könnte? Ich weiß es nicht. Ein banaler Vorfall ließ mich vermuten, dass mein Vater meine Mutter nicht so sehr liebte wie mich.
Es war gegen Ende unseres ersten Winters im Süden. Meine Mutter, mein Vater und ich waren auf dem Weg in die nächstgrößere Stadt, weil wir vom Eigentümer der Fabrik und seiner Frau zum Essen und ins Theater eingeladen worden waren. Die Ehefrau hatte uns letzten Sommer sogar die Ehre eines Besuchs erwiesen. Der Abend dämmerte, und es war nicht mehr lange bis zur Abfahrt des Zuges. Als mein Vater nach Hause kam, um sich umzuziehen, war ich bereits fertig, in Windeseile war auch er abfahrtbereit. Doch meine Mutter stand unschlüssig vor dem Spiegel, sie hatte sich schon ewig nicht mehr elegant angezogen und bewegte langsam die Puderquaste übers Gesicht, während mein Vater, der nicht gerne wartete, ungeduldig auf der Schwelle erschien.
Ich sehe die Szene vor mir, den Spiegel, das hohe Fenster, durch das mehr die Reflexion des grauen, aufgewühlten Meeres als der Sonnenuntergang zu dringen schien, und höre noch einmal den beiläufig aufgeschnappten Satz: » … muss ich tatsächlich feststellen, dass du eitel bist?«
Eine halbe Stunde später im Zug zitterte ich innerlich noch immer, unfähig, meinen Vater zu tadeln oder meine Mutter in Schutz zu nehmen. Im Halbdunkel konnte ich in ihren Augen, die fest auf die Tür gerichtet waren, Tränen glänzen sehen. Dachte auch sie wieder an diesen bitteren Moment zurück? Oder an die vielen anderen, die ganz ähnlich gewesen waren? Wusste sie, dass ich Zeugin dieser Beleidigung geworden war? Zum ersten Mal kam sie mir krank vor. Eine Kranke, die nicht geheilt werden, nicht mal über ihre Krankheit sprechen will.
Und danach … Ich hatte Bücher über Liebe und Hass gelesen, die Sympathien und Antipathien zwischen den Dorfbewohnern beobachtet, und dachte, ich wüsste einiges über das Leben. Aber die schmerzhafte Realität meines Zuhauses durchdrang ich nicht. Monat für Monat verstärkte sich die Traurigkeit meiner Mutter, die Aufmerksamkeit meines Vaters wurde geringer, sie gingen nicht mehr gemeinsam spazieren und ich war jetzt kein Kind mehr und lebte mein Leben einfach weiter, als ob ich um mich herum keinerlei Bedrohung wahrnahm. Aus welchem Grund? Sicher, die Bewunderung für meinen Vater füllte mich ganz aus, genau wie in meiner Kindheit, aber das reicht nicht aus, um meine Blindheit zu erklären. Vielleicht vermied es meine Mutter, sich aus Scham für ihre Krankheit einer noch unreifen jungen Frau anzuvertrauen, die ebenjenem Menschen ganz und gar ergeben war, der ihr so viele Schmerzen bereitete. Erschöpft schien sie auf irgendeine Veränderung zu warten.
Im Dorf genoss sie wegen ihrer Freundlichkeit und ihres zarten Aussehens einige Sympathien, obwohl sie unter dem Einfluss meines Vaters nicht mehr zur Kirche ging, was unter den Gottesfürchtigen für Gerede sorgte.
Wer weiß, ob man sie nicht schon von Anfang an für unglücklich gehalten hatte, mit einem Mann und einer Tochter, wie mein Vater und ich es waren? Meinem Vater gegenüber entwickelte sich schon bald eine stumme Feindseligkeit. Im Dorf gab es außer dem Fabrikbesitzer, der fast immer in Mailand lebte, und einem adligen Großgrundbesitzer, dem fast alle umliegenden Felder gehörten, keine wohlhabenden Leute. Der Großgrundbesitzer und seine Frau, eine ausladende und mit Schmuck behängte Person, tauchten nur selten in der Öffentlichkeit auf, und wenn sie vorbeigingen, verneigten sich die Dorfbewohner bis zum Boden. Es gab ein gutes Dutzend Anwälte, die sich hier eingenistet hatten und lang andauernde Konflikte zwischen von Steuern ausgebluteten kleinen Landbesitzern heraufbeschworen und sie dabei über den Tisch zogen, dazu ein halbes Dutzend Carabinieri. Das war die herrschende Klasse im Dorf. Mein Vater hatte sich nicht nur keine Mühe gemacht, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, sondern auch ein festliches Essen abgelehnt, das sie ihm zu Ehren geben wollten, gemeinsam mit den Vorsitzenden irgendwelcher alteingesessenen, aufgeblasenen Institutionen ohne finanzielle Mittel. Ein solches Verhalten war unerhört, genauso unerhört und verletzend wie das Zurückweisen der Geschenke, die sie ihm ständig brachten. Wie oft verließen die Frauen verzweifelt und verwirrt unser Haus, weil mein Vater die Hühner abgelehnt hatte, mit denen sie ihm ihre Söhne ans Herz legen wollten.
Aber in ihrer ausgeprägten Ignoranz und Trägheit waren die einfachen Dorfbewohner noch die besseren Menschen, denn sie hatten eine instinktive Güte. Dem »Direktor« wurde lediglich seine große Strenge gegenüber den Arbeitern zum Vorwurf gemacht, die von Mund zu Mund weitergegeben und dabei immer schlimmer dargestellt wurde.
In der ersten Zeit hatte mein Vater über diese weit verbreitete Ablehnung gelacht. Doch dann, als er die Arbeiter aus der Umgebung besser kennengelernt hatte, begann sich eine zornige Verbitterung in ihm auszubreiten. Vor allem die überall vorherrschende Heuchelei ärgerte ihn. Durch seine Isolation wurde seine Kritik immer harscher, kannte keine Grenzen mehr, und der Gegensatz zwischen der Bevölkerung mit ihren fast orientalischen Zügen und dem Italien seiner Herkunft, dem Norden, wurde immer größer. War das vielleicht eine unbewusste Reaktion des Widerstands dagegen, dass er oder seine Kinder sich den Umständen anpassen könnten? Ohne es zu bemerken, verlor er seine Urteilsfähigkeit, seine Überheblichkeit wuchs, seine Verachtung wurde zur Provokation. Am liebsten hätte er in der Fabrik nur Arbeiter aus dem Piemont beschäftigt, eine Kolonie gegründet, aber der Fabrikbesitzer weigerte sich, zum einen aus Vorsicht, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Arbeiter aus dem Norden bildeten mit ihren Familien ohnehin eine isolierte Gruppe und wurden von den anderen mit Misstrauen betrachtet.
Ich jubelte innerlich über die Distanz zwischen uns und »all den anderen«. Wenn ich mit meiner roten Baskenmütze auf den kurzen Haaren von der Fabrik nach Hause eilte, immerhin war ich vielbeschäftigt, hörte ich sie hinter mir flüstern, beim Kaffee lächelten mich die üblichen Faulenzer freundlich an. Ein Teil von mir hasste ihre Neugier, und ein anderer mochte die Art nicht, wie sie die jungen, schüchternen Mädchen an sich vorbeigehen ließen und sie dabei mit lüsternen Blicken ansahen. Das Dorf machte mich unglücklich, und dass ich es nicht völlig verabscheute, lag nur an der Schönheit der Natur, an der ich mich nicht sattsehen konnte. Langsam sickerte ein merkwürdiges Heimweh in mich ein, merkwürdig deshalb, weil ich Mailand ohne jedes Bedauern verlassen hatte. Nur in den Briefen an meine Freundinnen sprach ich darüber. Mein Norden kam mir durch den Nebel der Erinnerung jetzt begehrenswert vor, voller Zauber, vor allem die Stadt, die riesige Stadt voller Menschen, das pulsierende Leben vermisste ich. Aus meinem Gedächtnis schälten sich Stück für Stück die für sie typischen Charakteristika heraus, die ich deutlich vor mir sah. Manchmal gab ich mich der Illusion hin, immer noch dort zu leben. Dann spazierte ich an der Hand meines Vaters durch den Nebel oder die vom Staub verschleierte Sonne. Die Stadt meiner Kindheit, für die ich eine solche Sehnsucht empfand, dass ich es nicht in Worte fassen konnte, löste in mir leidenschaftliche Gefühle aus …
Als mich mein Vater als Belohnung für meinen ersten Winter »im Dienst« mit nach Rom und Neapel nahm, flammte meine diffuse Sehnsucht nach der »Lebendigkeit« der Stadt wieder auf. Nach zwei Jahren sah ich wieder Menschenmassen, blickte in Gesichter voller Klugheit oder Lebenserfahrung, fühlte mich wieder klein und unbedeutend, verloren und gleichzeitig gierig darauf, alles und jeden kennenzulernen. Dieses Gefühl war wahrscheinlich noch stärker als die Begeisterung für die Sehenswürdigkeiten und die herrliche Umgebung, und es floss in die Briefe an meine Mutter ein und in das Tagebuch, das ich auf Geheiß meines Vaters während der Reise schrieb, zusammen mit harmlosen Beobachtungen, schwärmerischen Notizen und kritischen Bemerkungen.
Diese Reise war die Krönung meiner Jugend voller Selbstsicherheit, Wagemut und Triumphen. Von mir selbst bleibt mir eine verschwommene Erinnerung, die von einem grellen Licht überdeckt wird. Die Eindrücke wurden in meinem Kopf von Silben eines unbekannten Wortes überschrieben, die das Leben zusammenfassten. Mit großer Verwunderung hatte ich diese Veränderung bemerkt. Ich spürte eine unbekannte Sanftheit in mir, eine Sehnsucht, deren Ursprung ich nicht kannte, ein Hauch von Zärtlichkeit, ein Weitwerden … War die Gegenwart nur Lethargie und ich nun auf dem Weg in eine neue Lebensphase?
3
Es war der dritte September, den wir im Dorf verbrachten. Die Badesaison war genauso gewesen wie immer, und nichts davon ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Außer, dass sich in mir das Vergnügen, immer weiter und immer wagemutiger aufs Meer hinauszuschwimmen mit exzessiven Lesephasen abwechselte, aus denen ich mit müdem Kopf wieder auftauchte und mich irgendwie selbst nicht leiden konnte.
Von meiner Mutter, meinen Geschwistern, Bekannten und selbst von meinem Vater erinnere ich aus diesem Sommer nichts mehr. Wie kam es dazu, dass eines Abends einige Dorfbewohner und Familien aus der Umgebung zu einem Empfang zu uns nach Hause eingeladen wurden? Die Initiative war von meinem Vater ausgegangen. Drei Zimmer unseres Hauses waren mit Lichtern und Blumen geschmückt worden, wir empfingen etwa vierzig Personen, Gäste aus Neapel und Rom, aus deren herablassenden Blicken die Verachtung für die Provinzler sprach. Die Männer betrachteten meinen Vater und sein höfliches Auftreten mit ernster und neugieriger Miene. Es waren auch ein paar Angestellte, die Lehrerinnen und Lehrer des Ortes und ihre Familien anwesend. Ein kleines Orchester lud Groß und Klein zum Tanz. Ich konnte als Tochter des Hauses einige Aufforderungen nicht ausschlagen, also ertrug ich es widerwillig, weil ich nicht gerne tanzte und davon Kopfschmerzen bekam. Ich wurde beobachtet, die jungen Männer näherten sich mir mit einer gewissen Schüchternheit, was mich amüsierte. Zwischen einem Tanz und dem nächsten sah ich überrascht zu meinen Eltern. Mein Vater, der hervorragend tanzte, schien sich wieder in einen jungen Mann verwandelt zu haben und hatte durch seine angeborene Natürlichkeit eine unglaubliche Ausstrahlung. Seine große Gestalt, die sich so gekonnt zwischen den anderen Paaren bewegte, bedeutete mir noch mehr als früher Einfachheit, Freude, Lebendigkeit. Ob meine Mutter sich amüsierte? Sie trug ein schwarzes, mit Perlen besticktes Spitzenkleid und weckte in mir weit zurückliegende Erinnerungen an die Abende, als ich sie elegant gekleidet am Arm meines Vaters zu Festen hatte aufbrechen sehen, schüchtern, aber nicht linkisch wirkend. Ihr Gesicht hatte immer noch Anmut, an diesem Abend sah sie nicht älter aus als dreißig.