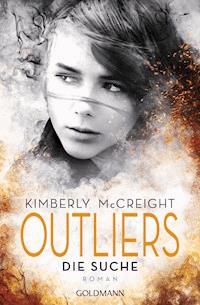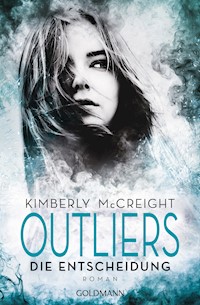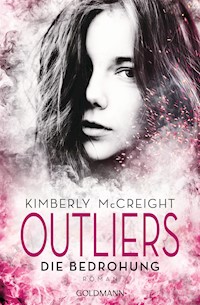9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hochspannend, hochemotional und unvorhersehbar: New York Times-Bestsellerautorin Kimberly McCreight mit ihrem trickreicher Ehe-Thriller um eine New Yorker Anwältin und ihren Freund aus Studientagen, der seine Frau ermordet haben soll Der Hilferuf ihres alten Studienfreundes Zach kommt für die New Yorker Anwältin Lizzie Kitsakis denkbar ungelegen: Eigentlich wollte sie wieder mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen, um die Risse zu kitten, die sich inzwischen unübersehbar in ihrer Ehe auftun. Doch Zach wird verdächtigt, seine Frau Amanda ermordet zu haben, und sitzt bereits in der berüchtigten New Yorker Haftanstalt Rikers Island. Natürlich beteuert Zach seine Unschuld, und Lizzie glaubt ihm. Je mehr sie allerdings über die Ehe von Zach und Amanda erfährt, desto mehr häufen sich die Ungereimtheiten. Was verschweigen Zach und seine Freunde in dem elitären Brooklyner Wohnviertel? Als ein neues Beweismittel auftaucht, wird Lizzies Welt auf den Kopf gestellt: Kann es sein, dass ihr eigener Ehemann Sam in den Fall verwickelt ist? Mit Raffinesse und dem perfekten Gefühl für Timing sorgt die New-York-Times-Bestseller-Autorin Kimberly McCreight in ihrem Thriller »Eine perfekte Ehe« immer wieder für überraschende Wendungen, während sie Stück für Stück den Vorhang beiseite zieht. Was dahinter zum Vorschein kommt, wird zweifellos noch lange im Gedächtnis bleiben! "Was immer Sie über das Geheimnis guter Ehen gehört haben: dieser Beziehungsthriller stellt alle Gewissheiten auf den Kopf. Meisterhaft geschrieben, toll beobachtet. Eine perfekte Ehe ist ein Thriller, den man nicht vergisst. Petra "Justizthriller trifft raffinierte Sozialstudie der gehobenen New Yorker Mittelschicht. Eine Mischung, die Kimberly McCreights neuen Roman zum Page-Turner macht. Eine sehr empfehlenswerte Lektüre." Passauer Neue Presse
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kimberly McCreight
Eine perfekte Ehe
Thriller
Aus dem Englischen von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Hilferuf ihres alten Studienfreundes Zach kommt für die New Yorker Anwältin Lizzie Kitsakis denkbar ungelegen: Eigentlich wollte sie wieder mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen, um die Risse zu kitten, die sich inzwischen unübersehbar in ihrer Ehe auftun.
Doch Zach wird verdächtigt, seine Frau Amanda ermordet zu haben, und sitzt bereits in der berüchtigten New Yorker Haftanstalt Rikers Island. Natürlich beteuert Zach seine Unschuld, und Lizzie glaubt ihm. Je mehr sie allerdings über die Ehe von Zach und Amanda erfährt, desto mehr häufen sich die Ungereimtheiten. Was verschweigen Zach und seine Freunde in dem elitären Brooklyner Wohnviertel?
Als ein neues Beweismittel auftaucht, wird Lizzies Welt auf den Kopf gestellt: Kann es sein, dass ihr eigener Ehemann Sam in den Fall verwickelt ist?
Mit Raffinesse und dem perfekten Gefühl für Timing sorgt die New-York-Times-Bestseller-Autorin Kimberly McCreight in ihrem Thriller »Eine perfekte Ehe« immer wieder für überraschende Wendungen, während sie Stück für Stück den Vorhang beiseite zieht. Was dahinter zum Vorschein kommt, wird zweifellos noch lange im Gedächtnis bleiben!
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Lizzie
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Lizzie
Lizzie
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Amanda
Lizzie
Lizzie
Lizzie
Dank
Für Tony,
den Anfang alles Guten.
Und das einzige Ende, das zählt.
Liebe stirbt nie einen natürlichen Tod.
Anaïs Nin, Djuna oder Das Herz mit den vier Kammern
Prolog
Ich wollte nie, dass irgendetwas von all dem passiert. Das zu sagen, ist blöd. Aber es ist wahr. Und selbstverständlich habe ich niemanden umgebracht. So etwas würde ich niemals tun und könnte ich niemals tun. Du weißt das. Du kennst mich besser als jeder andere.
Ob ich Fehler gemacht habe? Definitiv. Ich habe gelogen, bin selbstsüchtig gewesen. Ich habe dich verletzt. Das bereue ich am meisten. Dass ich dir Schmerz bereitet habe. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt.
Das weißt du auch, oder? Dass ich dich liebe.
Ich hoffe es. Denn das ist alles, woran ich denke. Und Einsamkeit gibt einem viel Zeit zum Nachdenken.
(Keine Sorge – ich habe nur leise vor mich hin gesprochen. Das ist es, was man Einsamkeit nennt. Es ist verdammt noch mal zu laut inmitten all der anderen. Die Leute quasseln die ganze Nacht lang, schreien und streiten und reden Unsinn. Falls man nicht verrückt ist, wenn man herkommt, wird man es hier. Und ich bin nicht verrückt. Ich weiß, dass du auch das weißt.)
Erklärungen. Was machen sie für einen Unterschied? Ich kann zumindest mit dem Warum beginnen. Denn es ist so viel schwieriger, als ich gedacht hatte – die Ehe, das Leben. Alles.
Am Anfang ist es leicht. Man lernt jemanden kennen, jemanden, der einen umwirft, der clever ist und lustig. Einen Menschen, der besser ist als man selbst – das wissen beide, zumindest auf einer bestimmten Ebene. Man verliebt sich in diese Eigenschaften. Aber man verliebt sich noch mehr in die Vorstellung des anderen von einem selbst. Man fühlt sich glücklich. Denn man ist glücklich.
Dann verstreicht die Zeit. Beide verändern sich zu sehr. Beide bleiben zu sehr sie selbst. Die Wahrheit dringt mehr und mehr ans Tageslicht, und der Horizont verdunkelt sich. Schlussendlich steht man mit jemandem da, der einen so sieht, wie man wirklich ist. Und früher oder später bekommt man einen Spiegel vorgehalten und ist gezwungen, sich selbst ins Gesicht zu blicken.
Und wer zum Teufel kann damit leben?
Man tut, was man kann, um durchzuhalten. Man fängt an, sich nach einem neuen, unverbrauchten Augenpaar umzusehen.
Lizzie
Montag, 6. Juli
Die Sonne sank tiefer in den Wolkenkratzerwald vor meinem Fenster in der Kanzlei. Ich stellte mir vor, wie ich an meinem Schreibtisch sitzen bleiben und darauf warten würde, dass sich die Dunkelheit herabsenkte. Ich fragte mich, ob sie mich heute Abend endlich ganz verschlucken würde. Wie ich dieses dämliche Büro hasste!
In dem hohen Gebäude gegenüber ging ein Licht an. Bald schon würden weitere Lichter folgen und die Räume erhellen – für Menschen, die beschäftigt waren mit ihrer Arbeit, mit ihrem Leben. Vielleicht sollte ich einfach akzeptieren, dass ich wieder einmal bis spätabends Überstunden machen musste. Nach einer halben Ewigkeit stand ich auf, streckte die Hand zum Lichtschalter aus und schaltete die Deckenlampe an, dann setzte ich mich wieder.
Der kleine Lichtzirkel fiel von oben auf das nicht angerührte Mittagessen neben meinem Schreibtisch, das Sam mir heute Morgen eingepackt hatte – den ganz besonderen, gepfefferten Thunfisch auf genau dem richtigen Roggenbrot mit Karotten. Mein Ehemann machte sich Sorgen, dass ich an Vitaminmangel leiden könnte. Zu Recht. In den elf Jahren, die wir mittlerweile in New York wohnten – verheiratet waren wir seit acht Jahren –, hatte mir Sam jeden Tag etwas zu Mittag eingepackt. Für sich selbst hatte er das nie getan.
Ich versetzte dem Essen einen halbherzigen Tritt und warf einen Blick auf die Uhr an meinem Computer: 19.17 Uhr. Es war noch nicht mal sonderlich spät, und die Zeit bei der renommierten Kanzlei Young & Crane schien wie immer unendlich langsam zu verstreichen. Meine Schultern sackten herab, als ich versuchte, mich auf das immer noch saftlose Antwortschreiben an das US Department of Justice, das amerikanische Justizministerium, zu konzentrieren, das ich für einen anderen Senior Associate verfasste – einen mit keinerlei Strafrechterfahrung. Der Mandant war ein Handyakkuhersteller, in dessen Unternehmen mehreren Vorstandsmitgliedern Insidergeschäfte vorgeworfen wurden. Es handelte sich um eine der typischen Strafsachen, mit denen sich die Kanzlei befasste: ein unerwartetes Problem für einen Mandanten aus der Wirtschaft zu lösen.
Die Kanzlei Young & Crane hatte keine explizite Abteilung für Wirtschaftskriminalität. Stattdessen hatte sie Paul Hastings, ehemaliger Leiter der DOJ-Abteilung für Gewalt und organisierte Kriminalität des Southern District von New York. Und jetzt hatte sie auch mich. Paul war vor meiner Zeit bei der US-Bundesstaatsanwaltschaft gewesen, aber er kannte – und schätzte – meine damalige Mentorin und Chefin Mary Jo Brown, die vor vier Monaten so lange auf ihn eingewirkt hatte, bis er mir einen Job in der Kanzlei gab. Paul war ein beeindruckender, hoch angesehener Anwalt mit jahrzehntelanger Erfahrung, aber bei Young & Crane kam er mir stets vor wie ein Rennpferd im Ruhestand, das sich verzweifelt danach sehnte, dass die Tore ein letztes Mal aufsprangen.
M&M’s. Das war es, was ich brauchte, um endlich diesen Brief fertig zu bekommen, der trotz all meiner Anstrengungen aus drei Absätzen wenig stichhaltiger Ausweichmanöver bestand. Es gab immer M&M’s an der überquellenden Snackbar bei Young & Crane – eine Sonderzulage für die, die die ganze Nacht durchschuften mussten. Ich wollte mich gerade auf die Suche danach machen, als eine E-Mail-Benachrichtigung auf meinem Handy erschien, das ganz am Rand des Schreibtischs lag, damit es mich nicht von der Arbeit ablenkte.
Die Nachricht an meinen Privat-Account kam von Millie, in der Betreffzeile stand: Ruf mich bitte an. Das war nicht ihre erste E-Mail in den letzten Wochen. So beharrlich war sie für gewöhnlich nicht, aber es kam auch nicht zum ersten Mal vor, was bedeutete, dass es nicht zwingend um Leben und Tod ging. Ohne die Nachricht zu öffnen, wischte ich sie in den Ordner für ältere E-Mails. Ich würde sie irgendwann lesen, zusammen mit den vorherigen – das tat ich letztendlich immer –, aber nicht heute Abend.
Mein Blick haftete noch immer auf dem Handydisplay, als das Bürotelefon klingelte. Ein externer Anruf mit meiner Direktdurchwahl, das hörte ich am Klingelton. Vermutlich Sam. Nicht viele Leute kannten diese Nummer.
»Hier spricht Lizzie«, meldete ich mich.
»Dies ist ein R-Gespräch aus einer New Yorker Justizvollzugsanstalt von …«, verkündete eine männliche Computerstimme, dann folgte eine endlose Pause.
Ich hielt den Atem an.
»Zach Grayson«, sagte eine echte menschliche Stimme, bevor die Nachricht auf die automatische Ansage zurückschaltete. »Drücken Sie die Eins, wenn Sie bereit sind, die Kosten zu übernehmen.«
Erleichtert atmete ich aus. Zach … Das sagte mir gar nichts. Äh, Augenblick – Zach Grayson von der University of Pennsylvania Law School, auch »Penn Law« genannt? Ich hatte schon einige Jahre nicht mehr an ihn gedacht, nicht seit ich in der New York Times den Artikel über die ZAG GmbH gelesen hatte, Zachs wahnsinnig erfolgreiches Logistik-Start-up in Palo Alto. Die ZAG GmbH erstellte eine Art Prime-Mitgliedschaft für die unzähligen kleinen Firmen, die versuchten, mit Amazon zu konkurrieren. Versandhandel klang zwar nicht sonderlich glamourös, war aber ungemein profitabel.
Zach und ich hatten seit unserem Abschluss nicht mehr miteinander gesprochen. Die Computerstimme wiederholte die Anweisungen und warnte mich, dass die Zeit ablaufe. Ich tippte auf die Eins, um den Anruf entgegenzunehmen.
»Hier spricht Lizzie.«
»Oh, Gott sei Dank.« Zach atmete zittrig aus.
»Zach, was ist denn …« Die Frage war ein unprofessioneller Ausrutscher. »Warte, antworte nicht darauf. Die Telefonate werden aufgezeichnet. Das weißt du, oder? Auch wenn du mich als Anwältin anrufst, musst du davon ausgehen, dass das Gespräch nicht vertraulich ist.«
Selbst versierte Anwälte legten mitunter ein absurd albernes Verhalten an den Tag, wenn es um Rechtssachen ging. Bei Strafsachen waren sie oftmals völlig nutzlos.
»Ich habe nichts zu verbergen«, behauptete Zach.
»Geht es dir gut?«, fragte ich. »Fangen wir doch damit an.«
»Nun, ich bin im Rikers«, sagte Zach leise. »Es ist mir schon besser gegangen.«
Ich konnte mir Zach absolut nicht auf Rikers Island vorstellen, der berüchtigten Gefängnisinsel im East River von New York. Es war ein unbarmherziger Ort, wo Latin Kings, sadistische Mörder und Vergewaltiger gefährlich eng mit den Jungs zusammengesperrt waren, die auf ihre Gerichtsverhandlung warteten, weil sie eine Zehndollartüte mit Gras verscherbelt hatten. Zach war kein großer Fisch. Er war immer – nun, wie sollte ich es sagen? – zurückhaltend und bescheiden gewesen. Ihn würde man im Rikers auseinandernehmen.
»Was wirft man dir vor? Und damit meine ich jetzt nur die konkreten Anklagepunkte, nicht das, was passiert ist.«
Es war so wichtig, nichts Belastendes preiszugeben, und so leicht, dies zu vergessen. Einmal hatte meine Kanzlei eine gesamte Klage auf einem einzigen mitgeschnittenen Gefängnistelefonat aufgebaut.
»Ähm, tätlicher Angriff auf einen Polizisten.« Zach klang verlegen. »Es war ein Unfall. Ich war aufgeregt. Jemand hat mich am Arm gefasst, und ich bin zurückgezuckt. Dabei habe ich mit dem Ellbogen einen Officer im Gesicht erwischt und ihm eine blutige Nase verpasst. Ich fühle mich schlecht deswegen, aber selbstverständlich habe ich das nicht absichtlich getan. Ich hatte keine Ahnung, dass er hinter mir stand.«
»War das in einer Bar oder so?«, erkundigte ich mich.
»In einer Bar?« Zach klang verwirrt, und ich spürte, wie meine Wangen rot wurden. Ein seltsamer Gedankensprung. Eine Bar war nicht unbedingt der Ort, wo die Probleme der meisten Menschen begannen. »Nein, nicht in einer Bar. Es war bei uns zu Hause, in Park Slope.«
»Park Slope?« Das war meine Gegend, zumindest nicht weit davon entfernt. Wir lebten in Sunset Park.
»Wir sind vor vier Monaten von Palo Alto nach Brooklyn gezogen«, teilte er mir mit. »Ich habe meine Firma verkauft und mache jetzt etwas ganz anderes. Ich baue hier ein Unternehmen auf – völlig neues Gebiet.« Sein Ton war hölzern geworden.
Zach war immer schon so gewesen, dachte ich – stets ein wenig unbeholfen. Victoria, meine Zimmergenossin auf der Penn Law, hatte ihn in ihren weniger freundlichen Momenten einen Spinner und Schlimmeres genannt. Ich hatte Zach gemocht. Klar, er war ein wenig sonderbar, aber er war zuverlässig, klug, ein guter Zuhörer und erfrischend direkt. Außerdem war er genauso unerbittlich ehrgeizig wie ich, was ich als beruhigend empfunden hatte. Zach und ich hatten auch noch andere Dinge gemeinsam. Als ich mich bei der Penn Law einschrieb, war ich gerade dabei, mich aus der trauergehärteten Hülle herauszuschälen, die mich umgab, seit ich am Ende meiner Highschool-Zeit beide Eltern verloren hatte. Zach wiederum hatte seinen Vater verloren, und er wusste, was es bedeutete, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. An der juristischen Fakultät der University of Pennsylvania wussten das nicht alle.
»Ich wohne ebenfalls in Park Slope«, sagte ich. »In Sunset Park. Ecke Fourth Avenue und Eighteenth Street. Und du?«
»Am Montgomery Place, zwischen Eighth Avenue und Prospect Park West.«
Natürlich. Ich hatte diesen unglaublich teuren Teil von Center Slope nur ein einziges Mal betreten, und zwar, um ein wenig auf dem gleichermaßen überteuerten Bauernmarkt auf der Grand Army Plaza zu stöbern – wohlgemerkt: nur um zu stöbern.
»Warum war die Polizei bei dir zu Hause?«, erkundigte ich mich.
»Meine Frau …« Zach stockte. Er schwieg für einen langen Moment. »Amanda lag, ähm, am Fuß der Treppe, als ich nach Hause kam. Es war schon sehr spät. Wir waren zusammen auf einer Party in der Nachbarschaft, aber wir sind getrennt aufgebrochen. Amanda ist vor mir nach Hause gegangen, und als ich heimkam … Mein Gott. Überall war Blut, Lizzie. Mehr Blut als … Ich hätte mich beinahe übergeben, ehrlich. Ich hab’s kaum geschafft, ihren Puls zu fühlen. Und darauf bin ich nicht stolz. Welcher Mann kriegt so viel Schiss beim Anblick von Blut, dass er seiner eigenen Frau nicht helfen kann?«
Seine Frau war tot? Scheiße.
»Es tut mir sehr leid, Zach«, brachte ich hervor.
»Ich hab’s zum Glück noch geschafft, die Neun-eins-eins zu rufen«, stieß er gepresst hervor. »Anschließend habe ich versucht, Amanda wiederzubeleben. Aber sie war bereits … Sie ist tot, Lizzie, und ich habe keine Ahnung, was ihr zugestoßen ist. Das habe ich der Polizei gesagt, aber man hat mir nicht geglaubt, obwohl ich doch derjenige war, der den Notruf gewählt hat, Herrgott noch mal. Ich denke, das lag an diesem Kerl im Anzug. Er hat in der Ecke gestanden und mich die ganze Zeit über angestarrt. Aber es war der andere Detective, der versucht hat, mich von Amanda wegzuziehen. Sie lag da auf dem Fußboden, und ich konnte mich einfach nicht von ihr losreißen. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, wie zum Teufel soll ich das …« Er stockte erneut, dann: »Es tut mir leid, aber du bist der erste freundliche Mensch, mit dem ich seither geredet habe. Ehrlich, es fällt mir schwer, mich zusammenzureißen.«
»Das ist verständlich«, sagte ich, und ich meinte es so.
»Die müssen doch gesehen haben, wie aufgeregt ich war«, fuhr er fort. »Sie hätten mir ruhig eine Minute Zeit geben können.«
»Allerdings.«
Die Tatsache, dass die Polizei Zach nicht mehr Spielraum zugestanden hatte, war ein deutliches Anzeichen dafür, dass Schlimmes bevorstand. Die Officer schienen bereits davon auszugehen, dass er verantwortlich war für den Tod seiner Frau. Es gab keine bessere Möglichkeit, einen potenziellen Verdächtigen im Blick zu behalten, als ihn wegen eines geringfügigeren Vergehens ins Gefängnis zu werfen.
»Ich brauche dringend deine Hilfe, Lizzie«, sagte Zach. »Ich brauche einen guten – einen herausragenden Anwalt.«
Es war nicht das erste Mal, dass ein ehemaliger Kommilitone von der Penn Law anrief und mich in einer Strafsache um Unterstützung bat. Es war nicht leicht, erstrangige Strafverteidiger zu finden, und nur wenige Absolventen der juristischen Fakultät praktizierten Strafrecht. Für gewöhnlich benötigten die Leute Hilfe in belanglosen Angelegenheiten – wegen Trunkenheit am Steuer, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Wirtschaftsdelikten –, und immer für ein Familienmitglied oder einen Freund. Sie riefen nie um ihrer selbst willen an, und schon gar nicht aus dem Rikers.
»Ich kann dir da bestimmt helfen. Ich habe Beziehungen zu einigen der besten Strafverteidiger in …«
»Beziehungen? Nein, nein. Ich will dich.«
Leg den verfluchten Hörer auf.
»Oh, ich bin ganz sicher nicht die richtige Anwältin für dich.« Gott sei Dank entsprach das der Wahrheit. »Ich habe erst vor ein paar Monaten als Verteidigerin angefangen und ausschließlich Erfahrung in Wirtschaftsdelikten gesammelt …«
»Bitte, Lizzie.« Zachs Stimme klang furchtbar verzweifelt. Allerdings war er Multimillionär, er musste doch locker jede Menge Topanwälte engagieren können. Also, warum ich? Jetzt, wo ich darüber nachdachte, waren Zach und ich schon lange vor dem Abschluss auseinandergedriftet.
»Du und ich wissen doch beide, was hier passiert – ich werde vermutlich mein Leben lang kämpfen müssen. Wird am Ende nicht immer der Ehemann beschuldigt? Ich brauche keinen aalglatten Anzugträger an meiner Seite. Ich brauche jemanden, der es anpackt – jemanden, der weiß, woher ich komme. Jemanden, der tut, was nötig ist, egal, was. Lizzie, ich brauche dich.«
Zugegeben, ich verspürte einen Anflug von Stolz. Mein außerordentlicher Ehrgeiz war stets mein bestimmendster Charakterzug gewesen. Ich war gewiss nicht die klügste Schülerin der Stuyvesant Highschool gewesen, genauso wenig wie die klügste Studentin der Cornell University und der Penn Law. Aber niemand war fokussierter als ich. Meine Eltern hatten mich die Tugend eiserner Entschlossenheit gelehrt. Vor allem mein Dad. Und unser Eifer hatte uns gleichermaßen gedient: Er war das Seil, an dem wir uns nach oben hangelten – und an dem wir uns aufknüpften.
Trotzdem würde ich Zachs Fall nicht übernehmen.
»Ich weiß das Kompliment zu schätzen, Zach, wirklich. Aber du brauchst jemanden mit Erfahrung bei Tötungsdelikten und den richtigen Beziehungen zur Staatsanwaltschaft in Brooklyn. Ich kann dir weder das eine noch das andere bieten.« Das stimmte. »Allerdings kann ich dir jemanden besorgen, der richtig gut ist. Gleich morgen früh wird jemand bei dir sein, noch vor der Anklageerhebung.«
»Zu spät«, entgegnete Zach. »Ich bin bereits angeklagt. Eine Freilassung gegen Kaution wurde abgelehnt.«
»Oh«, sagte ich. Dann war er offenbar früher verhaftet worden, als ich gedacht hatte. »Das ist, nun ja, überraschend bei einer Anklage wegen Körperverletzung.«
»Nicht wenn die Polizei davon ausgeht, ich hätte Amanda umgebracht«, wandte Zach ein. »Das ist es doch, was dahintersteckt, richtig?«
»Klingt plausibel«, pflichtete ich ihm bei.
»Ich hätte dich vor der Anklageerhebung anrufen sollen«, stellte er fest. »Aber ich stand dermaßen unter Schock nach all dem, was passiert war, dass ich wohl nicht richtig reagiert habe. Man hat mir einen Pflichtverteidiger an die Seite gestellt. Ein netter Kerl und halbwegs kompetent. Gewissenhaft. Aber wenn ich ehrlich bin, hab ich mich während des Prozederes irgendwie ausgeklinkt. Fast so, als würde das Ganze gar nicht passieren, als wäre es gar nicht möglich. Das klingt schwachsinnig, ich weiß.«
Jetzt war der Moment, in dem ich nach Details hätte fragen können: Wann war er verhaftet worden? Was war die genaue Ereignisabfolge an jenem Abend? All die Fragen, die Zachs Anwalt stellen würde. Nur dass ich nicht seine Anwältin war, und das Letzte, was ich wollte, war, tiefer in die Sache hineingezogen zu werden.
»Alles um sich herum auszublenden, ist eine absolut menschliche Reaktion«, versicherte ich ihm daher stattdessen. Meiner Erfahrung nach taten das selbst die rationalsten Menschen, wenn man sie eines Verbrechens beschuldigte. Aber wenn man zudem zu Unrecht beschuldigt wurde? Das war noch mal eine ganz andere Nummer.
»Ich muss hier raus, Lizzie.« Zach klang verängstigt. »Und zwar sofort.«
»Keine Sorge. Ganz gleich, welche Strategie die Anklage fährt, man kann dich nicht wegen des Vorwurfs des tätlichen Angriffs auf einen Polizisten im Rikers festhalten, nicht unter diesen Umständen. Wir suchen dir den richtigen Anwalt, und der sorgt dafür, dass du gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt wirst.«
»Lizzie«, flehte Zach. »Du bist die richtige Anwältin.«
War ich nicht. Ich war die falsche, ohne die richtigen Beziehungen. Außerdem war es kein Zufall, dass ich nie einen Mordfall bearbeitet hatte, und das sollte auch so bleiben.
»Zach, es tut mir leid, aber …«
»Lizzie, bitte«, flüsterte er. Seine Stimme klang jetzt panisch. »Ich will ehrlich sein: Ich habe verflucht Schiss. Könntest du vielleicht wenigstens nach Rikers Island kommen und mich besuchen? Damit wir darüber reden?«
Verdammt. Ich würde Zach nicht vertreten, komme, was wolle. Aber seine Frau war tot, und wir waren alte Freunde. Vielleicht sollte ich ihn tatsächlich besuchen. Vielleicht brauchte er tatsächlich jemanden zum Reden. Vielleicht würde er begreifen, warum ich nicht seine Anwältin sein konnte, wenn ich es ihm direkt ins Gesicht sagte.
»Okay«, gab ich schließlich nach.
»Super«, erwiderte Zach, unendlich erleichtert. »Gleich heute Abend noch? Besuchszeit ist bis einundzwanzig Uhr.«
Ich warf einen Blick auf die Computeruhr: 19.24 Uhr. Ich würde mich beeilen müssen. Meine Augen wanderten zu dem Briefentwurf auf dem Bildschirm. Dann dachte ich an Sam, der zu Hause auf mich wartete. Jetzt würde ich doch nicht wie angekündigt bis spätabends in der Kanzlei sein. Vielleicht war allein das Grund genug, Zach auf Rikers Island einen Besuch abzustatten.
»Bin schon unterwegs«, sagte ich.
»Danke, Lizzie«, erwiderte Zach. »Danke.«
AUSSAGE VOR DER GRAND JURY
LUCY DELGADO,
am 6. Juli als Zeugin aufgerufen und vernommen, sagt Folgendes aus:
VERNEHMUNGSPROTOKOLL
VON MS. WALLACE:
F: Ms. Delgado, danke, dass Sie hier vor der Grand Jury als Zeugin erschienen sind.
A: Ich wurde vorgeladen.
F: Danke, dass Sie der Vorladung gefolgt sind. Waren Sie am 2. Juli dieses Jahres bei einer Party in der First Street Nummer 724?
A: Ja.
F: Aus welchem Grund waren Sie bei dieser Party?
A: Ich wurde eingeladen.
F: Von wem wurden Sie eingeladen?
A: Von Maude Lagueux.
F: Woher kennen Sie Maude Lagueux?
A: Unsere Töchter waren vor Jahren in derselben Kindergartengruppe an der Grace Hall School.
F: Ist es richtig, dass die Party jährlich stattfindet?
A: Das weiß ich nicht.
F: Das wissen Sie nicht?
A: Nein.
F: Lassen Sie es uns anders versuchen. Waren Sie in den vorangegangen Jahren auch auf einer solchen Party?
A: Ja.
F: Was passiert bei den Partys?
A: Ähm, man knüpft Kontakte, isst und trinkt miteinander? Es ist eine Party.
F: Eine Erwachsenenparty?
A: Ja. Kinder sind nicht eingeladen. Die meisten Kinder sind um diese Jahreszeit in einem Ferienlager oder Sprachcamp oder sonst wo. Das ist der Clou der Party: ein Abend ohne Kinder, verstehen Sie? Sozusagen eine Ferienlager-Soiree.
F: Ja. Findet bei diesen Partys Geschlechtsverkehr statt?
A: Wie bitte?
F: Findet während einer solchen Party in den oberen Räumlichkeiten Geschlechtsverkehr statt?
A: Ich habe keine Ahnung.
F: Sie stehen unter Eid. Das ist Ihnen bewusst, oder?
A: Ja.
F: Ich stelle Ihnen die Frage noch einmal. Findet während dieser Ferienlager-Soiree in den oberen Räumlichkeiten der First Street 724 Geschlechtsverkehr statt?
A: Manchmal.
F: Hatten Sie selbst während dieser Partys Geschlechtsverkehr?
A: Nein.
F: Haben Sie während dieser Partys irgendwelche sexuellen Handlungen vorgenommen?
A: Ja.
F: Mit Ihrem Ehemann?
A: Nein.
F: Mit dem Ehemann von jemand anderem?
A: Ja.
F: Haben andere Partygäste ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt?
A: Manchmal. Nicht alle und nicht immer. Das ist keine besonders große Sache.
F: Partnertausch war keine besonders große Sache für die Partygäste?
A: Partnertausch klingt so … ich weiß nicht … vorsätzlich. Es ging lediglich um Spaß. Ja, ums Spaßhaben und vielleicht auch darum, ein bisschen Dampf abzulassen.
F: Haben Sie Amanda Grayson bei der Party am 2. Juli gesehen?
A: Ja. Aber da wusste ich nicht, wer sie war.
F: Wann wussten Sie, dass sie es war?
A: Als mir die Polizei ein Foto von ihr gezeigt hat.
F: Die Polizei hat Ihnen ein Foto von Amanda Grayson gezeigt und Sie gefragt, ob Sie sie bei der Party gesehen haben?
A: Ja.
F: Und wo haben Sie sie gesehen?
A: Im Wohnzimmer. Sie hat mich angerempelt und mir Wein auf die Bluse geschüttet.
F: Wann war das?
A: Ich denke gegen 21.30 oder 22.00 Uhr. Ich weiß es nicht genau. Aber da ich bloß bis 23.00 Uhr bei der Party war, muss es irgendwann davor gewesen sein.
F: Haben Sie sie danach noch einmal gesehen?
A: Nein.
F: Wie wirkte sie auf Sie, als Sie sie gesehen haben?
A: Aufgeregt. Sie wirkte aufgeregt.
F: Aufgeregt. Hat sie geweint? Oder war sie verärgert?
A: Sie wirkte verängstigt. Zutiefst verängstigt.
F: Haben Sie an jenem Abend mit Maude Lagueux gesprochen?
A: Ich wollte mit ihr reden, aber als ich zu ihr hingegangen bin, hatte es den Anschein, als würde sie mit ihrem Ehemann wegen einer anderen Frau streiten.
F: Warum hatte es den Anschein?
A: Ich habe gehört, wie Maude etwas über Nacktfotos sagte. Sie war sehr, sehr wütend. Ich meine, so hatte ich sie noch nie gesehen.
F: Vielen Dank, Ms. Delgado. Sie dürfen den Zeugenstand verlassen.
Amanda
Sechs Tage vor der Party
Was denken Sie?«, fragte die Raumgestalterin, die in Amandas Büro bei der Hope-First-Stiftung stand, und deutete mit ihrer manikürten Hand auf die brandneue, maßgefertigte Couch, den grauen Wollteppich mit breiten, weißen Streifen und die wahnsinnig teuren Beistelltische, »handgefertigt« von irgendeinem Schreiner aus Williamsburg.
Als Amanda aufschaute, stellte sie fest, dass die Raumgestalterin – eine große, entschlossene Frau mit harten Gesichtszügen, die ausschließlich drapierte Kleidungsstücke in verschiedenen Grautönen trug – den Blick auf sie gerichtet hatte. Offenbar wartete sie auf eine Antwort. Bestimmt gab es eine Antwort, die richtige Antwort, aber Amanda hatte keinen blassen Schimmer, was sie sagen sollte. Und für den Fall, dass sie nicht genau wusste, was sie sagen sollte – was häufig vorkam –, hatte sie sich ein paar nette Worte zurechtgelegt, Floskeln, die für vieles herhalten konnten.
Zum Glück hatte Amanda nette Worte gesammelt, seit sie und ihre Mom eng zusammengekuschelt in einem der überdimensionierten Sitzsäcke in der Kinderabteilung der St. Colomb Falls Library gesessen und gelesen hatten. Doch kurz nach Amandas elftem Geburtstag hatten diese gemütlichen Stunden ein abruptes Ende gefunden. Ihre Mom war krank geworden und binnen weniger Wochen gestorben – Lungenkrebs, obwohl sie nie im Leben auch nur eine einzige Zigarette geraucht hatte. Danach war sich Amanda nicht sicher gewesen, ob sie die Bibliothek jemals wieder würde betreten können, doch nur wenige Tage später hatte sie es getan. Sie brauchte dringend einen sicheren Ort.
Die griesgrämige Bibliothekarin war wie aus dem Nichts mit einem Stapel Bücher für Amanda erschienen, als diese zum zweiten oder dritten Mal allein dort auftauchte. Sie fragte nicht nach Amandas Mom. Stattdessen sagte sie mit in Falten gelegter Stirn: »Da hast du Bücher.« Sie legte den dicken Stapel vor sie hin – Herr der Fliegen, Der Fänger im Roggen, Betty und ihre Schwestern. Danach wurden ihre Sonderlieferungen Routine. Und am Ende bezog Amanda ihre besten Formulierungen aus diesen Büchern. Sie wurden zu ihren Worten, daran musste sie sich von Zeit zu Zeit erinnern.Sie hatte diese Bücher gelesen. Dieser Teil von ihr war echt.
Doch im Augenblick wartete die Raumgestalterin noch immer auf eine Antwort.
»Es ist grandios«, äußerte sie sich schließlich.
Die Raumgestalterin warf strahlend einen Blick auf ihr eigenes Werk. »Oh, Amanda, was für eine nette Formulierung! Ich schwöre Ihnen, Sie sind meine angenehmste Kundin.«
»Grandios?« Sarah war in Amandas Bürotür erschienen, die Arme verschränkt, so attraktiv wie immer mit ihrer glatten, olivfarbenen Haut, dem akkurat geschnittenen dunkelbraunen Bob und den riesigen blauen Augen. »Mach mal halblang, Jane Austen. Es ist nur eine Couch.«
Sarah kam herein, ließ sich auf besagtes Möbelstück fallen und klopfte auf die Sitzfläche neben sich. »Komm, Amanda. Setz dich. Es ist deine Couch, nicht ihre. Du solltest sie zumindest mal ausprobieren.«
Amanda lächelte und setzte sich neben Sarah. Trotz ihrer zierlichen Figur war Sarah eine beeindruckende Persönlichkeit. In ihrer Gesellschaft fühlte sich Amanda stets um einiges stärker.
»Vielen Dank für Ihre Hilfe«, sagte sie zu der Raumgestalterin.
»Ja. Und tschüss!« Sarah wedelte die Frau mit der Hand fort.
Die Raumgestalterin blickte Sarah mit verkniffenen Lippen an, doch als sie auf Amanda zutrat, lächelte sie breit und küsste sie auf beide Wangen. »Rufen Sie mich an, sollten Sie noch irgendetwas brauchen.«
»Tschü-hüss!«, sagte Sarah noch einmal.
Die Raumgestalterin schnaubte, dann machte sie auf ihren hohen, dünnen Absätzen kehrt und hielt mit großen Schritten auf die Tür zu.
»Die Tussi ist total nervend – geht davon aus, dass du vierzehntausend Dollar für eine alberne Couch ausgibst, die sie sich selbst nie leisten könnte«, sagte Sarah, als die Raumgestalterin weg war, den Blick auf ihr Handy gerichtet. Vermutlich schrieb sie eine Nachricht an Kerry, ihren Ehemann. Die beiden texteten unaufhörlich, wie Teenager. »Dieses breite Grinsen! Die muss doch eine Kiefersperre kriegen! Leute, die wirklich angesagt sind, schleimen sich nie so ein. Das weißt du, oder?«
Sarah war bei ihrer alleinerziehenden Mutter außerhalb von Tulsa aufgewachsen. Während sie stets jeden Cent hatten umdrehen müssen, hatten Kerrys Vorfahren ein dickes Vermögen angehäuft. Im Lauf der letzten Generationen war es allerdings rapide geschmolzen, sodass Kerry nicht mehr viel davon abbekommen hatte, aber Sarah hatte viel Zeit mit seiner betuchten älteren Verwandtschaft verbracht und wusste daher, wovon sie sprach.
»Zach hat sie engagiert. Sie ist angeblich sehr bekannt«, sagte Amanda und schaute sich um. »Ich mag die Sachen, die sie ausgewählt hat.«
»Oh, Amanda. Die ewige Diplomatin.« Sarah tätschelte ihr Knie. »Du würdest nie etwas Negatives über irgendwen sagen, hab ich recht?«
»Ich sage ohnehin nie Negatives«, protestierte Amanda schwach.
»Und wenn doch, dann nur sehr, sehr leise«, flüsterte Sarah. Sie zuckte mit den Achseln. »He, ich sollte vermutlich lernen, meine Zunge zu zügeln. Du hättest mal hören sollen, wie ich Kerry heute Morgen zerlegt habe.« Ihr Blick schweifte ins Leere. Sie dachte kurz nach, dann fügte sie hinzu: »Nur zu meiner Verteidigung: Er ist definitiv zu alt und dickplauzig für knallrote Air Jordans. Er sieht damit einfach nur lächerlich aus. Ich hab ein paar von den Jungs kennengelernt, mit denen er Körbe wirft. Sie sind jung, in Form und attraktiv und alles andere als lächerlich. Wo wir schon dabei sind … Hast du Lust, mal mitzukommen? Da war ein Typ mit blauen Augen und leichtem Bartschatten …«
Amanda lachte. »Nein, danke.«
Sarah liebte es, über attraktive Männer zu scherzen, dabei waren sie und Kerry absolut unzertrennlich. Sie hatten drei wundervolle Söhne und waren seit Ewigkeiten verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich in der Highschool – Kerry, der Footballstar, und Sarah, die Cheerleaderin. Sie waren sogar Ballkönig und Ballkönigin gewesen, was ihr ein bisschen peinlich zu sein schien, aber gleichzeitig war sie wahnsinnig stolz darauf.
Sarah seufzte. »Wie dem auch sei, ich denke, Kerry war wirklich verletzt, als ich nicht lockerließ wegen der Schuhe. Es gibt eine Grenze, auch wenn alles nur Spaß ist. Leider vergesse ich manchmal, wo diese Grenze liegt.«
Sarah war forsch, das stimmte. Ständig trug sie Kerry auf, dieses oder jenes zu tun: die Söhne abzuholen; die Blätter aus dem Gully zu fischen, damit der nicht überlief; Amanda zu helfen, die Glühbirne in der Lampe über der Eingangstür zu wechseln. Manchmal murrte Kerry deswegen – vor allem, wenn es um die Blätter im Gully ging, der seiner Meinung nach von der Stadt gereinigt werden musste –, aber er war immer voller Zuneigung für seine Frau. Als würde er ihre Kabbeleien genießen. Für Amanda war das ein Rätsel.
»Ich glaube, Kerry mag dich genau so, wie du bist«, sagte sie. »Außerdem bin ich mir sicher, Zach fände es gut, wenn ich genauso durchsetzungsfähig wäre wie du. Dann hätte ich hier in der Stiftung mit Sicherheit alles sehr viel besser im Griff.«
»Ja, aber würde Zach es auch gut finden, wenn du meine scharfe Zunge hättest? Seien wir ehrlich – weder dein Ehemann noch ich würden auch nur eine einzige Nacht überleben.«
Bei der Vorstellung brachen sie beide in Gelächter aus, Amanda atemlos und errötend.
Sie liebte Sarah. Wirklich. Obwohl sie erst vier Monate in Park Slope lebte, war sie ihr schon viel mehr ans Herz gewachsen als die Frauen in Palo Alto, die ihren eigenen Perfektionismus so gnadenlos verteidigten wie ausgehungerte Hunde einen Knochen. Sarah war natürlich keine Carolyn – einen Vergleich zwischen den beiden Frauen zu ziehen, war bei der Vorgeschichte absolut unmöglich. Aber Sarah musste sich ja gar nicht mit Carolyn vergleichen. In Amandas Leben gab es genug Raum für beide Freundinnen.
Außerdem war ihr Sarah eine unschätzbare Hilfe bei der Stiftung. Als ehemalige Erzieherin, die ihre Sprösslinge ebenfalls in Grace Hall untergebracht hatte, sowie als Vorsitzende des Elternbeirats kannte Sarah sämtliche Einzelheiten des verworrenen New Yorker Bildungssystems. Noch vor der Geburt ihrer Kinder hatte Sarah aufgehört zu arbeiten, aber jetzt hatte sie sich bereit erklärt, einen Job als stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung anzunehmen, weil sie sich nützlich machen wollte. Entgegen Sarahs Einwänden hatte Amanda darauf bestanden, sie großzügig zu entlohnen.
Sie hätte alles Geld der Welt bezahlt, wenn sie sich nur nicht allein um die Stiftung kümmern musste. Amanda, die selbst sozial benachteiligt aufgewachsen war, glaubte tief und fest an die Aufgabe von Hope First: Stipendien an bedürftige Schüler und Schülerinnen der Middle School zu vergeben, damit diese einige der besten New Yorker Privatschulen besuchen konnten. Die Hope-First-Stiftung zu leiten, war zwar ausgesprochen nervenaufreibend, aber Amanda musste es hinbekommen. Immerhin war Zach der geistige Vater der Stiftung.
Zachs Eltern – zwei Cracksüchtige aus Poughkeepsie – hatten ihn im Stich gelassen, als er neun war. Anschließend war er von Pflegestelle zu Pflegestelle weitergereicht worden. Das hatte Zach Amanda erzählt, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Er hatte ihr berichtet, wie er im Schatten des piekfeinen Vassar College aufgewachsen war und immer gewusst hatte, dass es mehr im Leben geben musste. Und genau das hatte er gewollt. Mehr. Alles.
Also war Zach losgezogen und hatte es sich genommen. Mit vierzehn hatte er begonnen, während der Nacht Supermarktregale aufzufüllen – obwohl das in diesem Alter noch gar nicht erlaubt war –, um Geld zu verdienen für die erforderlichen Aufnahmeprüfungen bei diversen Internaten. Drei davon nahmen ihn an, darunter auch die Deerfield Academy, die ihm ein Vollstipendium anbot. Von dort aus war er an die Dartmouth Academy gelangt, dann hatte er an der Penn Law ein Doppelstudium zum Doktor der Rechtswissenschaften sowie zum Master of Business Administration absolviert. Amanda hatte das schwer beeindruckt. Ein Dr. jur. und graduierter Betriebswirt in einem – das war tatsächlich imponierend.
Nachdem sie sich zusammengetan hatten, war Zach die Karriereleiter hinaufgeschossen und hatte in Kalifornien bei einem Start-up-Unternehmen nach dem anderen gearbeitet, in Davis, Sunnydale, Sacramento, Pasadena und Palo Alto. Amanda hatte Case in Davis zur Welt gebracht, und als er vier war, hatte Zach erkannt, dass er selbst etwas auf die Beine stellen musste, wenn er wirklich etwas erreichen wollte. Das war der Zeitpunkt, zu dem die ZAG GmbH ins Leben gerufen wurde. (ZAG, das waren Zachs Initialen plus ein A, weil Zach keinen zweiten Vornamen hatte.) Binnen fünf Jahren war die ZAG GmbH Hunderte Millionen Dollar wert. Dennoch war Amanda nicht überrascht, als Zach abdankte und sich zurückzog, weil er »bereit für etwas Neues« sei. Er hatte sich von jeher gern neuen Herausforderungen gestellt. Wie immer seine nächste Firma in New York im Detail auch aussehen mochte – Zach ging nie ins Detail, wenn er denn mal mit ihr über seine Arbeit sprach –, Amanda war sich sicher, dass er damit ebenfalls einen großen Erfolg landen würde.
»Warum muss sich mein Mann per Textnachricht mitten am Tag danach erkundigen, was es heute zum Abendessen gibt?«, regte sich Sarah auf und tippte eine weitere Nachricht in ihr Smartphone. »Es ist doch noch nicht mal Zeit zum Mittagessen! Man sollte vermuten, er hätte Besseres zu tun.«
Amandas Bürotelefon klingelte. Sie zuckte zusammen, machte jedoch keinerlei Anstalten, den Hörer abzunehmen, auch nicht, als es ein zweites Mal klingelte.
»Ähm, du weißt schon, dass wir noch keine Empfangsdame haben, oder?«, fragte Sarah. »Das Telefonat wird sich nicht von allein führen.«
»Oh, richtig.« Zögernd stand Amanda beim dritten Klingeln auf und ging zu ihrem Schreibtisch. Sie nahm den Hörer ab. »Amanda Grayson?«
Keine Antwort.
»Hallo?«
Immer noch keine Antwort. Schlagartig wurde sie von Angst überwältigt.
»Hallo?«, fragte sie noch einmal. Immer noch nichts, abgesehen von dem vertrauten Geräusch im Hintergrund. Keuchendem, ekelhaftem Atmen. Ihr drehte sich der Magen um.
»Wer ist denn dran?«, fragte Sarah von der Couch aus.
Die Anruferkennung zeigte eine Reihe von Nullen. Anonym. Amanda knallte den Hörer auf.
»Hoppla! Was ist denn los?«, wollte Sarah wissen. »Was hat der Anrufer gesagt?«
»Nichts. Gar nichts. Entschuldige, ich weiß nicht, warum ich den Hörer so aufgeknallt habe. Es war niemand dran.« Amanda lächelte, aber es war kein aufrichtiges Lächeln. Sie musste das Thema wechseln. »Es ist bloß … Case ist so weit weg, und das macht mich nervös. Ich hatte gestern Nacht wieder diesen schrecklichen Traum – einfach grauenvoll. Ich bin durch den Wald gerannt, barfuß, und habe mir die Füße an Zweigen und Steinen aufgeschnitten. Ich denke, ich wollte Case vor irgendetwas retten – Gott weiß, was.« Als Amanda Sarah ansah, stellte sie fest, dass diese sie mit weit aufgerissenen Augen anstarrte, dabei hatte sie noch nicht einmal das Verstörendste an ihrem Traum erzählt – dass sie voller Blut gewesen war und dass sie irgendein ausgefallenes Kleid getragen hatte, ein Ballkleid oder ein Hochzeitskleid, nein, es sah aus wie das einer Brautjungfer. Dann war sie plötzlich in ihrer Heimatstadt bei Norma’s Diner gewesen, das einfach so, mitten aus dem Nichts aufgetaucht war, wie ein Spukhaus im Wald. Wer träumte denn solche seltsamen, grässlichen Dinge? Sarah ganz bestimmt nicht. »Egal, es war ja bloß ein Albtraum. Aber jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, mache ich mir Sorgen, dass Case’ Camp-Leiter dran sein könnte.«
Amanda wusste, dass Case im Ferienlager gut aufgehoben war. Sie fühlte sich lediglich so verloren ohne ihn, als hätte sie plötzlich keinen Anker mehr.
Er war erst einmal länger fort gewesen, damals, als Kleinkind, als er mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus gelegen hatte, und selbst da hatte sie bei ihm übernachtet.
Sarahs Gesicht wurde weicher. »Nun, das verstehe ich.« Sie stand auf und lehnte sich neben Amanda an den Schreibtisch. »Jedes Jahr, wenn die Kinder im Ferienlager sind, kaue ich mir in der ersten Woche die Fingernägel ab. Genauer gesagt, so lange, bis der erste Brief eintrifft. Dabei fahren meine Jungs jeden Sommer an denselben Ort.«
»Dann machst du dir also auch Sorgen?«, fragte Amanda.
Sarahs jüngster Sohn Henry ging mit Case in eine Klasse. So hatten Amanda und sie sich kennengelernt. Aber Sarah war keine von den blasierten, hyperperfekten Müttern, die meinten, stets alles unter Kontrolle zu haben, ganz gleich, in welche Katastrophen ihre Sprösslinge hineinschlitterten. Und Katastrophen gab es jede Menge.
»Lass dich nicht von meiner toughen Fassade täuschen!«, sagte Sarah. »Es ist bloß leichter für mich, wenn ich nicht daran denke – aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist wie bei dieser ›Wir möchten Sie wegen Ihres Sohnes Henry sprechen‹-Nachricht, die ich kurz vor Schuljahresende bekommen habe. Willst du wissen, wie ich darauf reagiert habe?«
»Wie denn?«, fragte Amanda und setzte sich auf die Kante ihres Schreibtischstuhls. Was hätte sie dafür gegeben, wenigstens ansatzweise so forsch zu sein wie Sarah!
»Ich habe die Nachricht ignoriert. Habe nicht einmal darauf geantwortet. Kannst du dir das vorstellen?« Sarah schüttelte den Kopf, als wäre sie über sich selbst schockiert, doch in Wirklichkeit wirkte sie ziemlich zufrieden. »Ganz ehrlich, ich bin damit nicht klargekommen. Ich brauchte eine Pause von dem ganzen Kinderkram. Aber prompt haben wir heute Abend beim Elternbeirat eine Krisensitzung, und ich hänge mittendrin.«
»Was für eine Krisensitzung?«, wollte Amanda wissen.
»Ach komm schon, das habe ich dir doch erzählt! Erinnerst du dich nicht? Die Kontaktliste des Elternbeirats! Geklaut vom Schulcomputer!« Sie drückte die Handflächen gegen die Wangen und riss die Augen weit auf vor Entsetzen, dann grinste sie breit. »Also echt, man könnte meinen, die Grace-Hall-Eltern wären alle in einem Zeugenschutzprogramm der CIA oder sonst was. Die flippen total aus.«
O ja, Sarah hatte ihr davon erzählt, und Amanda hatte es sofort verdrängt. Zach würde ebenfalls ausflippen, wenn er erfuhr, dass jemand die Liste gehackt hatte. Er war nahezu besessen, wenn es um ihre Privatsphäre ging. Wenn ihre Daten in die falschen Hände gerieten, würde er definitiv die Schule verklagen. Vielleicht würde er Case sogar von der Grace Hall School nehmen wollen, und das durfte auf keinen Fall passieren. Grace Hall war nach dem rauen Einschnitt des Schulwechsels der einzige Lichtblick für den zehnjährigen Case.
Amanda hatte gehofft, mit dem Umzug nach New York bis zum Schuljahresende warten zu können, aber es war nicht möglich gewesen. Zumindest hatte Case schnell Freunde gefunden. Es war von Vorteil, dass er sich überall scheinbar mühelos einfügen konnte. Auf der einen Seite war Case ein kontaktfreudiger, sportlicher Baseballfanatiker, auf der anderen ein in sich gekehrter Künstler, der glücklich war, wenn er stundenlang allein dasitzen und sein Lieblingstier – den Jaguar – zeichnen konnte. Trotzdem war es viel verlangt von einem Kind, gegen Ende der fünften Klasse in eine neue Schule zu wechseln, selbst von einem flexiblen.
Es hatte Tränen und so manchen Albtraum gegeben. Einmal hatte Case sogar das Bett eingenässt. Amanda, die selbst häufig von Furcht einflößenden Träumen geplagt wurde, hatte den tiefen Schlaf ihres Sohnes stets für ein Zeichen gehalten, dass sie etwas richtig machte. Jetzt war es damit vorbei. Wenigstens hatte sich Case’ Laune gehoben, als Amanda ihm erlaubte, ins Ferienlager zu fahren: acht Wochen in Kalifornien mit Ashe, seinem besten Freund aus Palo Alto. Doch was, wenn die Traurigkeit ihres Sohnes zurückkehrte, sobald er die Heimreise nach Park Slope antreten musste? Amanda wollte lieber nicht darüber nachdenken. Sie hatte sich stets auf Kompromisse eingelassen, wenn es um Zachs Karriere ging, aber niemals auf Case’ Kosten. Ihre wichtigste Aufgabe war es, ihren Sohn zu beschützen, doch der Balanceakt zwischen Zach und Case war nicht immer leicht.
»Oh, nicht, dass du jetzt auch noch ausflippst«, sagte Sarah. »Ich sehe doch deinen Gesichtsausdruck.«
»Ich flippe nicht aus«, log Amanda.
»Das liegt daran, dass die Schulleitung so verschwiegen ist. Das sage ich denen immer wieder«, schimpfte Sarah. »Es sieht dann so aus, als wollte sie etwas vertuschen. Kommst du jetzt zu der Sitzung oder nicht?«
»Oh, ich weiß nicht, ob ich kann …«
»Klar kannst du. Wie dem auch sei – ich brauche deine moralische Unterstützung. Die Eltern sind auf der Suche nach jemandem, auf den sie losgehen können«, fuhr Sarah fort, doch Amanda nahm eher an, dass Sarah sie allesamt zur Schnecke machen würde. »Um zwanzig Uhr. Bei mir zu Hause. Ein Nein wird nicht akzeptiert.«
Sarah brauchte Amanda nicht, aber sie wollte, dass sie dabei war. Und das genügte.
»Ich werde da sein«, versprach Amanda ihrer Freundin. »Du kannst dich auf mich verlassen.«
Lizzie
Montag, 6. Juli
Die Gefängnisinsel sah schlimmer aus, als ich sie in Erinnerung hatte, sogar im Dunkeln.
Die größeren Gefängnisgebäude schienen bewusst disharmonisch angelegt zu sein, die kleineren, umgeben von bunt gemischten Trailern – Verwaltungsbüros, Unterkünfte für das Wachpersonal oder Waffenlager –, waren nicht näher gekennzeichnet und in einem ziemlich schlechten Zustand. Ein Gefängnisschiff aus massivem Beton, das ein paar Hundert weitere Insassen beherbergte, lag auf dem Wasser. Kürzlich – so hatte ich gelesen – war es den Häftlingen gelungen, das Schiff vom Ufer zu lösen. Sie hatten sich einfach davontreiben lassen und konnten tatsächlich beinahe entkommen.
Überall waren Stacheldrahtzäune zu sehen. Fleckig vor Rost, verliefen sie in schnurgeraden Linien und bildeten Quadrate. Das oberste Viertel war schräg nach innen gebogen, was einem das unbehagliche Gefühl vermittelte, gleichzeitig ein- und ausgesperrt zu sein. Doch wovor ich nach meinem letzten Besuch im Rikers am meisten Angst hatte – ich hatte vor einigen Jahren wegen einer Zeugenbefragung dorthin fahren müssen –, waren der ätzende Gestank nach Abwasser und die Ratten. Anders als andere nachtaktive Schädlinge spazierten die Ratten von Rikers Island bei hellem Tageslicht durch die Gegend und verteidigten aggressiv ihr Revier. Ein weiterer Grund, für die Dunkelheit dankbar zu sein.
Im Bantum angekommen – dem Gebäude, in dem Zach untergebracht war –, dauerte es weitere fünfzehn Minuten, bis die Besuchserlaubnis erteilt und die Sicherheitskontrollen passiert waren, dann saß ich endlich in einer Schuhschachtel von Anwaltszimmer, die nach Urin, Zwiebeln und saurem Atem stank. Vor mir stand ein schmaler Tisch. Flach atmend starrte ich durch eine trübe Plexiglastrennscheibe und wartete darauf, dass Zach aus seiner Zelle geholt wurde.
Auf der Fahrt hierher war mir meine Freundschaft mit ihm stückweise ins Gedächtnis zurückgekehrt. Sie war nicht von langer Dauer gewesen, aber wir hatten im ersten Studienjahr ziemlich viel Zeit miteinander verbracht – hatten zusammen gelernt, gegessen und Filme geschaut. Dass ich unser gemeinsames Semester weitestgehend aus meinen Erinnerungen verbannt hatte, gab nicht unbedingt Aufschluss über Zach als Person – nein, ich hatte schon immer ein ausgesprochen selektives Gedächtnis. Aber jetzt fiel es mir wieder ein: Ich hatte Zach gemocht, weil er mir so vertraut erschienen war – im Guten und im Schlechten. Wie zum Beispiel an dem Tag, an dem unser geliebter Vertragsprofessor uns spontan einen leidenschaftlichen »Berufsberatungsvortrag« gehalten hatte. Als Zach und ich uns an jenem Abend bei Mahoney, dem Pub am Rittenhouse Square, zum Essen trafen, war er völlig aus dem Häuschen.
»Glaubst du den Schwachsinn, den Professor Schmitt da erzählt hat?«, fragte er und drückte Ketchup auf seinen Burger. Eine Gruppe pöbelnder Penn-Footballfans kam ins Lokal getaumelt.
»Du meinst das, was er über seelenlose Anwaltssozietäten gesagt hat?«
Zach nickte, den Blick fest auf seinen Burger geheftet, vermutlich, damit er keinem der sehr großen, sehr betrunkenen Footballfans, die sich um uns herum drängten, in die Augen sehen musste. »Das ist echt schade. Ich mochte den Kerl bisher wirklich. Aber jetzt kann er sich, was mich anbelangt, zum Teufel scheren.«
»Dann hältst du Anwaltssozietäten demnach für beseelt?«, neckte ich ihn und drehte mich zu dem Riesen neben mir um, der unheilverkündend schwankte.
»Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine. Du bist die größte Streberin, die ich kenne.« Zachs Bein zappelte auf und ab, so wie immer, wenn er nervös wurde, und er wurde oft nervös. »Die Leute behaupten gern, der Ehrgeiz würde einen zum Monster machen. Aber ich weigere mich einfach, etwas zu vermasseln, und ich schäme mich nicht, das zuzugeben.«
Er meinte das nicht so, aber manchmal klang Zach wie der negative Teil meines Vaters, der Teil, den die Kunden und Angestellten und Nachbarn, die ihn liebten, nicht kannten. Ihnen gegenüber zeigte sich mein Dad stets liebenswürdig und zu Scherzen aufgelegt. Und das war er ja auch. Doch gleichzeitig war er absolut statusbesessen, nahezu krankhaft auf Erfolg bedacht, nur um des Erfolges willen, worüber er das vergaß, was wirklich zählte – zum Beispiel die Menschen. Wie meine Mom und mich. Sein wahres Ich war stets unzufrieden. Was meine Eltern sich aufgebaut hatten – das Restaurant, unser »gemütliches« Dreizimmerapartment in der West Twenty-Sixth Street in Chelsea, das stets überquoll von den hausgemachten Leckereien meiner Mutter und ihrer unbegrenzten Liebe –, war großartig und in meinen Augen absolut idyllisch. Aber es genügte meinem Dad nie, nicht einmal, bevor wir alles verloren.
»Willst du damit andeuten, dass die Studenten an der Penn Law nicht genügend wettbewerbsorientiert sind?« Ich lachte. »Ist das nicht genauso, als würde man behaupten, das Problem mit einem Löwenrudel bestehe darin, dass Löwen keine Vegetarier sind?«
»Die Studenten tun so, als würden sie nicht miteinander konkurrieren. Das ist scheinheilig.« Zach musterte mich unverblümt. Das war typisch für ihn: entweder zu viel Augenkontakt oder nicht genug. Mäßigkeit war nicht seine Stärke. Meine aber auch nicht. Und wenigstens versuchte Zach nicht, sich jovial zu geben wie mein Dad. Zach war so, wie er war, und er war ehrlich dabei. Genau das schätzte ich an ihm. »Meine Mutter war Kellnerin und Putzfrau, mein Vater arbeitete in einem Stahlwerk. Ein einfacher Fabrikarbeiter, ungebildet. Aber eins muss man ihm und meiner Mutter lassen: Die zwei haben sich den Arsch aufgerissen. Sieh dir deine Eltern an – sie haben genauso hart gearbeitet, und das hat sie ins Grab gebracht.« Er deutete mit dem Zeigefinger auf mich. »Erfolg ist nur für reiche Leute ein Abstraktum.«
Ich zuckte die Achseln. »Mir geht es eher um das Allgemeinwohl.«
Zach zog die Augenbrauen in die Höhe. »Das Allgemeinwohl? Das ist durchaus nobel, aber Menschen wie du und ich können uns derart hehre Ziele doch gar nicht leisten.«
»Sprich bitte nur für dich selbst«, blaffte ich. »Ich bin bereit, alles dafür zu tun, um nach dem Studium bei der US-Bundesstaatsanwaltschaft zu arbeiten – Geld ist mir dabei scheißegal.«
Ich mochte es nicht, wenn ich unterschätzt wurde. Ich würde mein Leben dem Ziel widmen, Menschen wie meine Eltern zu beschützen – hart arbeitende Immigranten, die von einem freundlich wirkenden Stammgast dazu überredet worden waren, ihr brummendes Diner in Chelsea mit hunderttausend Dollar zu beleihen, um in einen »Geheimtipp« in Hudson Yards zu investieren. In Wahrheit war es nur mein Dad, den der Stammgast überredet hatte, und er hatte investiert, ohne sich zuvor mit meiner Mutter abzusprechen. Und dann: Puff! Das Geld war weg und der Stammgast ebenfalls. Mit aberwitziger Geschwindigkeit brachte die Bank das Restaurant unter den Hammer. Millie, ebenfalls ein Stammgast und Freundin der Familie, die als Sergeant im Zehnten Bezirk arbeitete, war aktiv geworden und hatte dem FBI Druck gemacht, den Kerl aufzuspüren. Am Ende war es ihr zu verdanken, dass er gefunden wurde. Doch das änderte nichts. Alles, wofür meine Eltern gearbeitet hatten, war zerstört. Genau wie meine Familie. Ich war damals sechzehn; und sie beide starben, noch bevor ich siebzehn wurde.
Ich stolperte durch den Rest meiner Highschool-Zeit, gebrochen. Wohnen durfte ich bei der Schwester meiner Mutter, die die Minuten zählte, bis sie endlich nach Griechenland zurückkehren konnte. Meine Welt hatte sich urplötzlich in eine undurchdringliche, feindselige Dunkelheit verwandelt. Monatelang war ich gefährlich deprimiert. Ich stürzte mich in die Lernerei, und das holte mich irgendwann zumindest teilweise ins Leben zurück.
Immerhin bescherte mir das zwanghafte Lernen einen Freifahrtschein zur Cornell University, und in meinem letzten Jahr dort fing ich an, über ein Jurastudium und einen Job als Staatsanwältin für Wirtschaftskriminalität nachzudenken. Die Vorstellung, einen Beruf auszuüben, bei dem es galt, Menschen zu schützen, die genauso übervorteilt worden waren wie meine Eltern, kam mir vor wie ein Rettungsanker. Ganz zu schweigen von all dem anderen, was passiert war, gab er mir die Kraft, mich von hoher See ans rettende Ufer zu flüchten.
»He, nichts für ungut!« Zach starrte auf seinen Burger und hob beschwichtigend die Hände. »Du wirst eine großartige Staatsanwältin abgeben. Ich sage doch nur, dass du zehnmal härter arbeitest und sehr viel ehrgeiziger bist als alle anderen an dieser verdammten Fakultät, mich eingeschlossen. Vielleicht solltest du auch die Ernte dafür einfahren.«
»Keine Sorge, das werde ich. Ich will bloß, dass die Ernte so aussieht, wie ich sie mir vorstelle.«
»Das glaube ich gern.« Zach hatte gelächelt. »Und ich habe keinen Zweifel daran, dass dir das gelingen wird.«
Ganz gleich, wie eng Zach und ich eine Zeit lang gewesen sein mochten – nichts, was er sagte, würde mich umstimmen können. Ich würde ihn nicht vertreten. Ich würde ihm zuhören, ihm das Gefühl vermitteln, Gehör zu finden, und dann würde ich wie versprochen einen wirklich exzellenten Anwalt für ihn auftreiben. Mehr würde ich nicht tun.
Endlich hörte ich ein Summen auf der anderen Seite der Plexiglasscheibe. Die Tür gegenüber öffnete sich, und dann sah ich ihn wieder, nach all der Zeit: Zach. Oder vielmehr, ich sah sein rechtes Auge. Zumindest als Erstes. Es war zugeschwollen, und darüber entdeckte ich einen tiefen Schnitt. Die ganze Gesichtshälfte leuchtete in einem spektakulären Rot-Lila. Ein schmerzhafter Anblick.
»O mein Gott, Zach!«, stieß ich atemlos hervor. »Alles okay?«
Er lächelte schwach und setzte sich nickend. »Ich habe in der Schlange am Platz von jemand anderem gestanden. Es gibt hier Regeln. Ich lerne, aber es dauert. Ist nicht so schlimm, wie es wirkt.«
Obwohl er verletzt war, sah Zach besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte – im Lauf der Jahre waren seine Gesichtszüge, abgesehen von der Schwellung, ausgeprägter geworden, markanter.
»Es tut mir leid, dass das passiert ist«, sagte ich und deutete auf sein Auge. »Es hat den Anschein, als würde es ganz schön wehtun.«
»Das ist definitiv nicht deine Schuld«, sagte er und senkte hastig den Blick, so wie er es früher immer getan hatte. »Danke, dass du gekommen bist. Ist ziemlich lange her.« Er schwieg für einen Moment. »Zum Glück verdiene ich meinen Lebensunterhalt nicht als Model. Trotzdem würde ich wirklich gern hier rauskommen, damit ich den Rest meines Gesichts behalten kann.«
»Nur zur Erinnerung: Diese Gespräche dürfen nicht aufgezeichnet werden, aber …«
»… wer weiß?«, vollendete Zach den Satz für mich. »Ich habe nichts zu verbergen, aber ich verstehe, was du meinst – es ist Vorsicht geboten. Ich habe dir zugehört, ehrlich.«
Er schaute auf und begegnete meinem Blick. Sein Körper fing leicht an zu zittern – sein Bein, das ich nicht sehen konnte, verselbstständigte sich mal wieder. Armer Zach. Er steckte wirklich tief in der Patsche. Seine Lippen verzogen sich zu einem neuerlichen Lächeln, traurig und erwartungsvoll. Ich spürte, wie sich ein mulmiges Gefühl in meinem Magen breitmachte.
»Ich bin hier, um dir zu helfen, Zach, und zwar auf jede erdenkliche Art und Weise«, begann ich. »Doch wie ich schon sagte: Ich werde dich nicht selbst vertreten.«
Zach musterte mich mit seinem unverletzten Auge und machte eine hilflose Geste. »Also gut. Das ist nicht das, was ich hören wollte, aber du kannst vermutlich nicht mehr tun.«
Ich entspannte mich ein wenig. Es war mir nicht bewusst gewesen, wie sehr es mir davor graute, dass Zach sauer werden könnte.
»Um ehrlich zu sein, hängt das mit meinem neuen Job zusammen«, sagte ich und trommelte mit den Fingern auf den Notizblock, den ich vor mich gelegt hatte – eine ausgesprochen zutreffende, ausgesprochen legitime Ausrede, die ich mir auf der Busfahrt nach Rikers Island zurechtgelegt hatte. »Ich bin Senior Associate bei Young & Crane. Dort übernehmen nur die Partner eigenständige Mandate. Ich bin für die internen Abläufe zuständig.«
»Wie ist es eigentlich zu dieser Kanzleigeschichte gekommen?«, wollte Zach wissen. »Wolltest du nicht immer Staatsanwältin werden? Ohne mir ein Urteil bilden zu wollen – ich war überrascht, als ich gesehen habe, dass du gegangen bist.«
»Gesehen?«, fragte ich.
Dann fiel es mir ein: die Absolventenprofile im Jahrbuch der Penn Law. Unsere Kommilitonin Victoria hatte einen überzogenen Hang zur Studentenverbindung und sah sich offenbar genötigt, an jedem Wiedersehenstreffen teilzunehmen und vierteljährlich ein Update zu allen ehemaligen Absolventen zu veröffentlichen. Ich hegte keinen Zweifel daran, dass sie es gut gemeint hatte – eine Position als Senior Associate bei Young & Crane war ein angesehener und extrem lukrativer Job; die komplexen Fälle, der exzellente Leumund, die Vergütung. Ich war sogar auf dem besten Wege, Partner zu werden. Allerdings war die Änderung meines ursprünglichen Plans – mein Berufsleben in den Dienst des Allgemeinwohls zu stellen und als Staatsanwältin für Wirtschaftskriminalität bei der US-Bundesstaatsanwaltschaft gute Arbeit für wenig Geld zu leisten – nicht freiwillig erfolgt.
»Ich wäre weniger überrascht gewesen, wenn ich gelesen hätte, dass du die Juristerei komplett an den Nagel gehängt hast. Aber Anwältin für Unternehmensrecht …«
Ich zuckte zusammen, doch ich versuchte, es mit einem Lächeln zu überspielen. »So ist das Leben nun einmal. Die Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie man erwartet.«
»Was willst du damit sagen?«, erkundigte sich Zach. »Ich glaube kaum, dass man dich gefeuert hat. Dafür bist du viel zu gut.«
»Es ergab keinen Sinn, dass ich dort bleibe.«
Das stimmte, wenngleich es weit entfernt war von der ganzen Wahrheit: Mein Mann hatte unser Leben gegen die Wand gefahren, und mein Job bei Young & Crane sollte uns finanziell aus der Patsche helfen.
Vor ungefähr einem Jahr hatte sich Sam bei einem Arbeitslunch so betrunken, dass er seinem Redakteur bei der Men’s Health mitteilte, er solle sich verpissen. Anschließend war er auf der Herrentoilette eingeschlafen. Unter einem Urinal, das Gesicht nach unten. Die Men’s Health war bereits der letzte von vielen Stopps auf der steilen Rutschbahn einer Karriere, die einst bei der New York Times begonnen hatte. Sam hatte die Jobs wegen seiner Trinkerei verloren, wegen sachlicher Fehler, versäumter Deadlines. Wegen seiner Streitbarkeit.
Glücklicherweise hatte er, als er bei der Men’s Health rausflog, den Vertrag für ein Buch in der Tasche, basierend auf seiner beliebten Ratgeberspalte. Unglücklicherweise hatten wir den bescheidenen Vorschuss längst ausgegeben, und Sam war noch meilenweit von der Fertigstellung des Buches entfernt. Zu der Zeit schrieb er kaum noch etwas. Trotzdem wären wir halbwegs mit meinem läppischen Regierungsgehalt über die Runden gekommen, wäre nicht dieser Unfall passiert.
An dem Wochenende nach Sams Entlassung fuhren wir mit dem Bus zu einem Freund in Montauk. Wir wollten versuchen, die ganze Sache bei einem guten Essen und einem Glas Wein zu verdauen. Nachdem ich bereits zu Bett gegangen war, hatte Sam anscheinend angenommen, noch »wunderbar« fahren zu können, und sich den restaurierten Oldtimer unseres Freundes, ein Cabriolet, »geborgt«, um noch mehr Bier zu besorgen. Er hatte den Wagen vor die Wand des Angler’s gesetzt, eines historischen Pubs in der Innenstadt. Wand und Fahrzeug erlitten Totalschaden. Sam überstand den Unfall Gott sei Dank völlig unversehrt – ein erstaunlicher Umstand –, doch der Besitzer des Angler’s verklagte uns auf Schadensersatz für das historische Erbe von unschätzbarem Wert, weil grobe Fahrlässigkeit nicht von der Versicherung abgedeckt war. Mit anderen Worten: weil Sam betrunken gewesen war. Der Vergleich lief auf eine Zahlung von zweihunderttausend Dollar aus eigener Tasche binnen der nächsten zwei Jahre hinaus.
Diese Tatsache hatte ich bei der Offenlegung meiner finanziellen Verhältnisse im Rahmen der Einstellungsverhandlungen bei Young & Crane, die von jedem Bewerber eine Selbstauskunft verlangten, bewusst verschwiegen. Die Klage betraf zwar Sam, aber infolgedessen indirekt auch mich. Mir war bewusst, dass Anwaltskanzleien keine verschuldeten Associates einstellen würden, weil sie gegebenenfalls angreifbar oder leichter zu beeinflussen waren, und unsere Schulden waren beträchtlich. Selbst mit meinem Gehalt von Young & Crane waren sie nicht leicht abzutragen. Doch mit der Zeit würden wir es schaffen, ohne Privatinsolvenz anmelden zu müssen, vorausgesetzt, wir verzichteten auf »Nichtlebensnotwendiges« wie die In-vitro-Fertilisation, die uns der Fruchtbarkeitsspezialist als nächsten Schritt empfohlen hatte. Doch genau das vereinfachte die Dinge enorm: Das Letzte, was Sam und ich jetzt gebrauchen konnten, war ein Baby.
Ob ich deswegen sauer war? Natürlich. Manchmal schäumte ich förmlich vor Zorn, aber am Ende des Tages siegte immer die Hoffnung. Wenn ich stattdessen aufhören würde, daran zu glauben, dass sich alles irgendwann fügte, wenn ich aufhörte, durch Sams rosa Brille zu schauen, wäre ich mit der nackten Realität konfrontiert. Und das war mir eine unerträgliche Vorstellung.
»Es hat für dich keinen ›Sinn‹ ergeben, bei der Bundesstaatsanwaltschaft zu bleiben?«, hakte Zach nach. »Was meinst du denn damit?«
Das war seine Direktheit, die mir schon immer gefallen hatte.
»Wir mussten uns einigen unerwarteten finanziellen Herausforderungen stellen – eine lange, komplizierte Geschichte. Wie dem auch sei, für die Bundesstaatsanwaltschaft zu arbeiten, ist nicht unbedingt der beste Weg, um Geld zu verdienen.«
»Tja, die Ehe«, seufzte Zach und schüttelte betrübt den Kopf.
»Es ist ja nicht das Ende der Welt«, sagte ich. »Ich arbeite bei einer der besten Kanzleien im Land, nicht in einer Salzmine.«
Zachs unversehrtes Auge sah mich traurig an. »Trotzdem«, sagte er. »Ich weiß, wie viel dir der Job bedeutet hat. Es tut mir leid.«
Meine Kehle fing an zu brennen. Ich wandte den Blick ab.
»Das ist das Schwierigste bei einer Ehe, stimmt’s?«, fuhr Zach fort. »Dass die Probleme des anderen zu deinen eigenen werden. Das kommt einem nicht immer fair vor.«
»Das ist richtig«, pflichtete ich ihm bei. Dass Zach genau das Richtige sagte, tat mir weitaus mehr gut, als ich zugeben wollte.
»Soso, dein Ehemann. Richard, nicht wahr?«
»Er heißt Sam.«
»Ich nehme an, er ist kein Anwalt …«
»Ein Schriftsteller.«
Zach hielt meinen Blick für eine Sekunde fest.
»Ein Schriftsteller … Das klingt, ähm, sehr kreativ.« Er lächelte. »Ich bin froh, dass du glücklich bist. Ich habe die Jahre über immer wieder an dich gedacht und mich gefragt, wie es dir wohl so ergangen ist. Es ist schön zu sehen, dass alles geklappt hat.«
Hatte es gar nicht. Nichts hatte »geklappt«.
Schweigend blickte ich auf den Tisch zwischen uns. Wir mussten dringend zur Sache kommen.
»Wo ist dein Sohn?«
»In einem Ferienlager in Kalifornien, zusammen mit seinem besten Freund.« Zach lächelte zaghaft. »Amanda wollte ihn nicht gehen lassen, aber wir sind mitten im Schuljahr hierhergezogen, und er hat seine Freunde vermisst. Amanda war gut in solchen Dingen. Sie hat immer die besten Entscheidungen für Case getroffen, selbst wenn sie ihr schwerfielen. Ich kann Case unmöglich am Telefon sagen, was passiert ist – das wäre einfach zu … Trotzdem. Er muss wissen, dass Amanda tot ist.«
»Was ist mit deiner Mom?«
Er wirkte für einen Augenblick verwirrt. »Oh, sie ist verstorben.«
»Das tut mir leid. Vielleicht könnten die Eltern von Case’ Freund das übernehmen?«, schlug ich vor. »Glaubst du, sie würden ihn abholen?«
»Ja, vielleicht«, erwiderte Zach leise. »Um ehrlich zu sein, kenne ich sie gar nicht richtig. Case’ Freund heißt Billy, glaube ich.«
»Ich könnte im Ferienlager anrufen und mich erkundigen«, bot ich an. »Ich bin mir sicher, sie wissen, wie wir Billys Familie erreichen.«
»Das wäre großartig, danke«, sagte Zach. »Leider kenne ich nicht mal den Namen des Camps. Amanda hat sich um alles gekümmert.« Er zögerte, dann fügte er hinzu: »Das klingt, als wäre ich ein echtes Arschloch, oder? Allerdings wette ich, dass auch du nicht Abend für Abend nach Hause hastest und ein warmes Essen für Sam auf den Tisch stellst.«
Ich lachte ein bisschen zu laut.