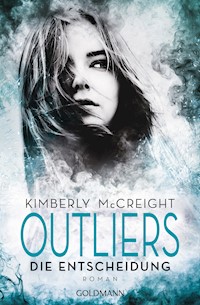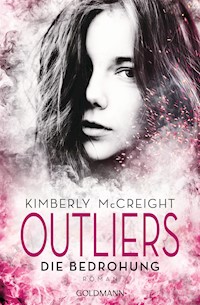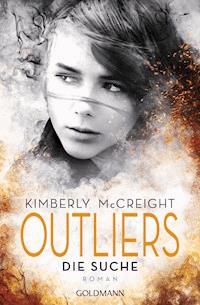
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Outliers-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Stell dir vor, du könntest Gefühle lesen. Stell dir vor, durch deine Gabe würdest du zur Zielscheibe. Stell dir vor, du wärst ein Outlier …
Seit dem Tod ihrer Mutter zieht die 16-jährige Wylie sich immer mehr zurück. Erst ein Hilferuf ihrer verschwundenen Freundin Cassie lockt die menschenscheue Teenagerin aus der Reserve, denn sie spürt, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Und es folgen weitere rätselhafte Nachrichten. Was steckt hinter Cassies Verschwinden? Warum befindet sie sich irgendwo in den Wäldern Maines? Wylie nimmt all ihren Mut zusammen und begibt sich mit Cassies Freund, dem umschwärmten Bad Boy Jasper, auf die Suche. Doch damit geraten auch sie beide in größte Gefahr – vor allem, als Wylie eine Seite an sich entdeckt, von der sie bisher nichts geahnt hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Ähnliche
Buch
Stell dir vor, du könntest die Gefühle deiner Mitmenschen lesen. Stell dir vor, durch deine Gabe würdest du zur Zielscheibe. Stell dir vor, du wärst ein Outlier …
Seit dem Unfalltod ihrer Mutter plagen die empfindsame Wylie große Ängste, die Sechzehnjährige verlässt das Haus nicht und zieht sich auch immer mehr vor ihrem Vater und Zwillingsbruder zurück. Erst eine SMS ihrer besten Freundin Cassie lockt Wylie aus der Reserve: »Wylie, bitte, ich brauche deine Hilfe.« Und es folgen weitere rätselhafte Nachrichten, die Wylie Schlimmes befürchten lassen. Was verbirgt Cassie? Warum befindet sie sich irgendwo in den Wäldern Maines? Wylie nimmt all ihren Mut zusammen und begibt sich mit Cassies Freund, dem umschwärmten Bad Boy Jasper, auf die Suche. Schon bald muss sie erkennen, dass das Rätsel um Cassies Verschwinden mehr mit ihr selbst zu tun hat, als sie jemals ahnen konnte – und sie in größter Gefahr schwebt …
Weitere Informationen zu Kimberly McCreight sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Kimberly McCreight
OUTLIERS
Gefährliche Bestimmung
DIESUCHE
Band 1
Roman
Deutsch von Karen Gerwig
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Outliers« bei Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2018
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Kimberly McCreight
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Catherine Beck
KS · Herstellung: kw
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-22166-9V002www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Harper und Emerson, die Tapfersten der Tapferen.
Alles, was in diesem Roman passiert, ist Fiktion.
Die Dinge, die ihr hier lest, sind nicht passiert.
Zumindest noch nicht.
KM
Wir müssen an unsere Berufung glauben und alles daransetzen, unser Ziel zu erreichen.
MARIECURIE
Prolog
Warum sind die schlimmen Dinge immer so viel leichter zu glauben? So sollte es nicht sein. Aber es ist so, jedes Mal. Du bist zu sensibel und machst dir zu viele Sorgen, sagen sie. Du machst dir zu viele Gedanken über die falschen Dinge. Ein Flüstern in deinem Ohr, und die Worte purzeln in deinem Kopf herum, als hättest du sie selbst als Erste gedacht. Wenn du sie oft genug hörst, sind sie ziemlich schnell in dein Herz eingraviert.
Ich weiß, dass mit mir etwas nicht stimmt, aber das muss ich jetzt vergessen. Während ich hier in diesem kalten, dunklen Raum sitze, tief im pechschwarzen Wald, und dieser Fremden in die Augen blicke, die mich belügt, muss ich das Gegenteil von mir denken. Ich muss glauben, dass ich ein Mensch bin, von dem ich selbst nie geglaubt habe, es zu sein. Dass in meinen tiefsten, dunkelsten, nutzlosesten Ecken ein Geheimnis verborgen liegt. Ein Geheimnis, das mich vielleicht am Ende retten kann. Uns retten kann.
Denn ich verstehe immer noch wenig von dem, was hier passiert. Um ehrlich zu sein, sogar ziemlich wenig. Aber eines weiß ich: Trotz der Furcht im Blick dieser Frau müssen wir sie überreden, uns zu helfen. Denn unser Leben hängt davon ab. Und davon, dass wir hier rauskommen.
1
Das Handy meines Vaters vibriert laut und rutscht dabei über unseren abgenutzten Esszimmertisch. Er streckt die Hand danach aus und schaltet es aus.
»Tut mir leid.« Er lächelt, während er sich über seine dichten grau melierten Haare fährt und die eckige schwarze Brille hochschiebt.
Es ist eine Hipsterbrille, aber deshalb hat er sie nicht gekauft. Bei meinem Dad ist jede Hipness vollkommen zufällig. »Ich dachte, es sei aus. Es hätte nicht einmal auf dem Tisch liegen dürfen.«
Das ist eine Regel: keine Handys im Esszimmer. Die Regel gab es schon immer, auch wenn sie eigentlich keiner je befolgt hat – Mom nicht, nicht mein Zwillingsbruder Gideon, und ich auch nicht. Aber das war davor. Jetzt ist alles aufgeteilt in das Davor und das Danach. Und in der dunklen und schrecklichen Mitte liegt Moms Unfall vor vier Monaten. Im Danach ist Dad die Handyregel viel wichtiger. Vieles ist ihm jetzt wichtiger. Manchmal habe ich das Gefühl, er versucht, unser Leben aus Streichhölzern wieder aufzubauen, und dafür liebe ich ihn. Aber jemanden zu lieben ist nicht dasselbe wie ihn zu verstehen. Das ist schon okay, glaube ich, denn Dad versteht mich auch nicht. Eigentlich hat er das nie. Jetzt, da meine Mom fort ist, denke ich manchmal, niemand wird mich je wieder verstehen.
Dad kann sein Wesen nicht ändern – er ist ein Hardcore-Nerdwissenschaftler, der nur in seinem eigenen Kopf lebt. Seit dem Unfall sagt er zwar viel öfter als früher »Ich hab dich lieb« und tätschelt mir und Gideon ständig den Rücken, als wären wir Soldaten, die in den Krieg ziehen. Aber es ist komisch und unbeholfen. Und es macht alles nur noch schlimmer. Nicht nur für mich, sondern für uns alle.
Das eigentliche Problem ist, dass er nicht viel Übung in Herzenswärme und Kuscheligkeit hat. Das Herz meiner Mom war immer groß genug für sie beide. Nicht dass sie weich war. Sie hätte nicht so eine gute Fotografin sein können – die ganzen Länder, die ganzen Kriege – , wenn sie nicht höllisch zäh gewesen wäre. Aber für Mom gab es Gefühle nur in einer Form: vergrößert. Und das galt auch für ihre eigenen: Sie heulte jedes Mal, wenn sie eines von meinen oder Gideons selbst gemachten Willkommen-zu-Hause-Schildern las. Und wie sie die Gefühle der anderen spürte – sie schien immer zu wissen, wann es Gideon oder mir nicht gut ging, und das noch, bevor wir zur Tür hereinkamen.
Wegen dieses seltsamen sechsten Sinns hat mein Dad so großes Interesse an emotionaler Intelligenz, abgekürzt EI. Er ist Forscher und Professor an der Universität, und so ungefähr alles, was er je studiert hat, ist ein winziger Teil von EI. Reich wird er mit so was nie. Aber Dr. Benjamin Lang interessiert sich für Forschung, nicht für Geld.
Und es hat auch sein Gutes, dass Dad wie der Blechmann aus dem Zauberer von Oz ist: Er ist nach dem Unfall nicht zusammengebrochen. Nur ein einziges Mal hat er ansatzweise die Beherrschung verloren – am Telefon mit Dr. Simons, seinem besten Freund/einzigen Freund/Mentor/Ersatzvater. Und selbst da riss er sich ziemlich schnell wieder zusammen. Trotzdem frage ich mich, ob es mir nicht lieber wäre, dass er total durchdreht, wenn ich dafür eine so feste Umarmung bekäme, dass mir die Luft wegbleibt. Oder einen Blick, der mir sagt, dass er versteht, dass ich am Ende bin, weil er es auch ist.
»Du kannst an dein Handy gehen«, sage ich. »Es macht mir nichts aus.«
»Dir vielleicht nicht, aber mir.« Dad nimmt seine Brille ab und reibt sich die Augen auf so eine Art, dass er ganz alt aussieht. Das reißt das Loch in mir noch ein bisschen weiter auf. »Irgendwas muss von Bedeutung sein, Wylie, sonst bleibt gar nichts mehr.«
Das sagt er oft.
Ich zucke die Achseln. »Okay, wenn du meinst.«
»Hast du noch mal darüber nachgedacht, was Dr. Shepard heute während eurer Telefonsitzung gesagt hat?« Er versucht, beiläufig zu klingen. »Dass du wieder halbtags anfangen könntest?«
Sicher wartet er schon seit wir uns hingesetzt haben auf den richtigen Moment, das anzusprechen. Dass ich dem Hauslehrer abgesagt habe und ob ich die elfte Klasse an der Newton Regional High School fertig mache, sind die Lieblingsthemen meines Vaters. Wenn wir mal nicht darüber reden, dann nur, weil er sich auf die Zunge beißt, um nicht wieder davon anzufangen.
Dad hat Angst, wenn ich nicht bald wieder normal zur Schule gehe, mache ich es vielleicht nie. Meine Therapeutin Dr. Shepard und er sind sich bei dem Thema vollkommen einig. Das sind sie bei den meisten Dingen, wahrscheinlich, weil sich die beiden E-Mails schreiben. Nach dem Unfall habe ich es ihnen erlaubt. Dad hat sich wirklich Sorgen um mich gemacht, und ich wollte total cool und kooperativ wirken und außerdem besonders zurechnungsfähig. Aber ihr privater Plausch war eigentlich nie wirklich in Ordnung für mich, vor allem nicht jetzt, wo sie beide im Team »Wylie muss wieder normal zur Schule gehen« sind. Ich glaube, es war auch nicht gerade hilfreich, dass Dr. Shepard und ich vor drei Wochen zu Telefonsitzungen übergehen mussten, weil ich es nicht mehr schaffe, das Haus zu verlassen. Das bestätigt schon irgendwie ihr Argument, dass es nur die Spitze eines sehr dunklen Eisbergs ist, wenn ich nicht in die Schule gehe.
Dr. Shepard war anfangs gar nicht mit dem Hauslehrer einverstanden. Sie weiß nämlich, dass meine Probleme mit der Schule nicht an dem Tag vor vier Monaten angefangen haben, als Moms Wagen auf einer Eisplatte zum Rutschen kam und aufgeschlitzt wurde.
»Ich mache mir Sorgen, wohin das führen könnte, Wylie«, sagte Dr. Shepard in unserer letzten persönlichen Sitzung. »Die Schule abbrechen ist kontraproduktiv. Wenn du deiner Angst nachgibst, machst du es nur schlimmer. Das gilt auch jetzt in deiner sehr legitimen Trauer.«
Dr. Shepard setzte sich anders in ihrem großen roten Ohrensessel zurecht, in dem sie immer so makellos und zierlich aussah wie die geschrumpfte Alice im Wunderland. Ich war schon seit fast sechs Jahren, seit der Mittelstufe, immer mal wieder bei ihr in Behandlung. Meistens schon. Manchmal fragte ich mich immer noch, ob sie überhaupt wirklich Therapeutin war, so klein, jung und hübsch, wie sie war. Aber sie hatte es mit ihrem speziellen Therapiecocktail geschafft, dass es mir besser ging – Atemübungen, Gedankenspiele und sehr viele Gespräche. Als die High School losging, war ich ein normales Mädchen, nur ein bisschen nervöser. Das heißt, bis mich der Unfall meiner Mutter aufbrach und mein ganzes scheußliches Innere herausquoll.
»Genau genommen breche ich die Schule gar nicht ab, ich gehe nur nicht mehr ins Gebäude.« Ich lächelte gezwungen, woraufhin Dr. Shepard die perfekt gezupften Augenbrauen zusammenzog. »Außerdem ist es ja nicht so, als hätte ich es nicht versucht.«
Tatsächlich hatte ich nur an zwei Schultagen gefehlt – am Tag nach dem Unfall meiner Mutter und am Tag ihrer Beerdigung. Ich ließ meinen Vater sogar vorher anrufen, um sicherzugehen, dass mich niemand komisch behandelte, als ich gleich wieder hinging. Denn das war mein Plan: so zu tun, als wäre nichts passiert. Und eine Weile – eine ganze Woche, glaube ich – funktionierte es. Dann kam dieser Montagmorgen – eine Woche, einen Tag und vierzehn Stunden nach der Beerdigung – , da wurde mir schlecht, und ich konnte gar nicht mehr aufhören, mich zu übergeben. Das ging stundenlang. Ich hörte nicht auf, bis sie mir in der Notaufnahme ein Mittel gegen die Übelkeit gaben. Dad hatte solche Angst, dass er, als wir endlich aus dem Krankenhaus kamen, einem Hauslehrer zustimmte. Ich glaube, er hätte allem zugestimmt, wenn es mir davon nur wieder besser ginge.
Aber wie könnte es mir besser gehen, ohne Mom, die mir half, die guten Seiten zu sehen? Meine guten Seiten. »Du bist nur sensibel, Wylie«, hatte sie immer gesagt. »Die Welt braucht sensible Menschen.« Und irgendwie hatte ich ihr geglaubt.
Vielleicht hatte Mom auch nur die Wahrheit nicht sehen wollen. Schließlich war ihre Mom – meine Großmutter – traurig und allein in einer Psychiatrie gestorben. Vielleicht wollte meine Mutter nicht glauben, dass sich die Geschichte wiederholte. Vielleicht dachte sie auch wirklich, mit mir sei alles in Ordnung. Eines Tages hätte sie es mir vielleicht gesagt. Jetzt werde ich es nie erfahren.
Ich sehe auf meinen Teller und schiebe perfekt gegarten Spargel in einen Couscoushügel, um dem Blick meines Dads auszuweichen. In schwierigen Zeiten verschwindet mein Appetit immer als Erstes. Und seit dem Unfall ist mein Leben im Grunde eine einzige schwierige Zeit. Aber es ist wirklich schade, dass ich keinen Hunger habe. Die Kochkünste meines Dads sind eines der wenigen Dinge, die noch funktionieren – er war immer der Koch in der Familie.
»Du hast gesagt, ich kann selbst entscheiden, wann ich bereit bin, wieder zur Schule zu gehen«, sage ich schließlich, auch wenn ich mir schon sicher bin, dass ich nie bereit, willens und in der Lage sein werde, an die Newton Regional High School zurückzukehren. Aber es gibt keinen Grund, Dad das zu sagen, zumindest jetzt noch nicht.
»Wann du wieder zur Schule gehst, ist deine Sache.« Er versucht, entspannt zu klingen, aber er hat sein Essen auch nicht angerührt. Und die kleine Ader auf seiner Stirn steht vor. »Aber ich finde es nicht gut, wenn du Tag für Tag allein hier im Haus herumhängst. Da fühle ich mich … es ist nicht gut für dich, so oft allein zu sein.«
»Ich bin gern allein.« Ich zucke die Achseln. »Das ist gesund, oder nicht? Komm schon, du bist der Psychologe. Gutes Selbstbewusstsein und so.«
Verrückt, wie viel weniger überzeugend sich mein Lächeln immer anfühlt, wenn ich es erzwinge. Vermutlich, weil ein Teil von mir weiß, es wäre besser, wenn ich diese Diskussion endlich verlöre. Wenn ich zappelnd und schreiend wieder in die Schule gezwungen würde.
»Komm schon, Wylie.« Dad mustert mich mit verschränkten Armen. »Nur weil du dich selbst magst, heißt das nicht, dass …«
Da klopft es laut an der Haustür. Wir zucken beide zusammen. Bitte nicht Gideon – das denke ich sofort. Das letzte Mal, als es unerwartet klopfte, wurde uns jemand entrissen. Und Gideon – mein entgegengesetzter Zwilling, wie Mom immer scherzte, weil wir so unglaublich unterschiedlich sind – ist als Einziger von uns nicht zu Hause.
»Wer ist das?«, frage ich, während ich versuche, das wilde Hämmern meines Herzens zu ignorieren.
»Sicher kein Grund zur Sorge«, sagt Dad. Aber er hat keine Ahnung, wer an der Tür ist oder ob es einen Grund zur Sorge gäbe. Das ist offensichtlich. »Wahrscheinlich will jemand was verkaufen.«
»Heutzutage verkauft keiner mehr was an der Tür, Dad.« Aber er hat schon seine Serviette auf den Tisch geworfen und geht durchs Wohnzimmer.
Als ich um die Ecke komme, hat er gerade die Tür geöffnet.
»Karen.« Er klingt erleichtert. Aber nur ganz kurz. »Was hast du … was ist los?«
Als ich schließlich an ihm vorbeiblicken kann, sehe ich Cassies Mom Karen auf unserer Eingangsterrasse stehen. Trotz des kränklich-gelben Lichts der Energiespar-Außenbeleuchtung sieht Karen perfekt aus wie immer: Ihre schulterlangen braunen Haare sind makellos glatt, ein leuchtend grüner Schal ist ordentlich über ihrem maßgeschneiderten weißen Wollmantel geknotet. Es ist Anfang Mai, aber wir stecken tief in einer dieser fiesen Bostoner Kältewellen.
»Es tut mir leid, dass ich einfach so auftauche.« Karens Stimme ist hoch und quietschig. Und sie keucht ein bisschen, ihr Atem bildet eine Wolke. »Aber ich habe ein paarmal angerufen, und niemand ist rangegangen, und dann bin ich herumgefahren und habe nach ihr gesucht, als ich bei euch das Licht brennen sah, und ich dachte … O Gott, ich habe überall gesucht!« Als sie die Arme verschränkt und einen Schritt näher kommt, bemerke ich ihre Füße. Sie sind nackt.
»Wen hast du überall gesucht …?« Dad hat ihre Füße auch bemerkt. »Karen, was ist mit deinen Schuhen passiert? Komm rein.«
Als sie sich nicht rührt, zieht er sie sanft herein. »Dir muss doch eiskalt sein! Komm, komm!«
»Ich finde Cassie nicht.« Karens Stimme bricht, und sie tritt über die Schwelle. »Kannst du – ich bitte dich wirklich ungern, Ben. Aber kannst du mir helfen?«
2
Im Wohnzimmer führt Dad Karen zu einem Sessel. Sie lässt sich fallen, mit starrem Körper und eingefrorenen Gesichtszügen. So habe ich sie noch nie gesehen. Denn nicht nur Karens Kleidung ist immer perfekt. Sie selbst auch. »Die perfekte Plage«, so nennt Cassie sie tatsächlich – so dünn und hübsch, immer mit einem Lächeln, und nie liegt ein Haar nicht so, wie es soll. Und dünn. Das muss man zweimal sagen. Denn laut Cassie ist für Karen das Gewicht der Leute doppelt so wichtig wie alles andere. Und das könnte stimmen. Karen war immer nett zu mir, aber da ist irgendwas an der Art, wie sie mit Cassie spricht, ein scharfer Unterton in ihrer sanften Stimme. Als würde sie ihre Tochter lieben, aber vielleicht nicht besonders mögen.
»Wylie, holst du Karen bitte ein Glas Wasser?« Dad sieht mich an. Er macht sich Sorgen, dass mich das hier – was es auch ist – noch mehr aus dem Tritt bringen könnte. Und das wäre das Letzte, was ich brauche, damit hat er nicht völlig unrecht. Also schickt er mich zu meinem eigenen Besten weg. Als würde ich mir weniger Sorgen um Cassie machen, wenn ich nicht im selben Raum bin. Ich habe schon zu viel gehört.
»Wasser wäre toll«, sagt Karen, aber so, als bräuchte sie alles, nur das nicht. Sie schließt sich nur meinem Dad an. »Danke.«
»Wylie«, drängt mein Vater, als ich bleibe, wo ich bin, und auf den Teppich starre. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich den Eindruck erwecke, dass ich durchdrehe, schickt er mich ganz nach oben. Vielleicht schickt er dann sogar Karen weg, bevor ich herausfinde, was los ist. Und ich muss es wissen. Trotz allem, was zwischen Cassie und mir passiert ist, auch wenn das nicht unbedingt meine erste Ausnahmesituation im Zusammenhang mit ihr ist, ist mir wichtig, was ihr geschieht. Das wird immer so sein.
Aber ich sehe es im Gesicht meines Vaters: Er will das hier so schnell wie möglich hinter sich bringen und Karen wegschicken. Und das wird er tun, egal, wie gern er Karen und Cassie hat. Seit dem Unfall hat er viele neue Grenzen gezogen – bei meinen Großeltern, Lehrern, Ärzten, Nachbarn. Alles, um uns zu schützen. Mehr noch mich, das stimmt. Gideon und ich sind wirklich sehr unterschiedlich, er ist ein Crack in Naturwissenschaften und Geschichte, ich mag vor allem Mathe und Englisch. Und Gideon war schon immer »der Robustere«. Das sagen die Leute, wenn sie glauben, ich höre nicht zu. Und wenn sie meine Großmutter sind – die Mutter meines Dads – , dann sagen sie es mir ins Gesicht. Sie trieb mich direkt nach der Beerdigung meiner Mutter in die Enge und erzählte mir, ich solle wirklich versuchen, mehr wie Gideon zu sein. Gleich danach bat Dad sie, nie wieder zu Besuch zu kommen.
Die Wahrheit ist, dass meine Großmutter mich noch nie mochte. Ich erinnere sie zu sehr an meine Mom, die sie auch nie mochte. Aber was Gideon angeht, hatte sie recht. Er fängt sich wirklich sehr viel leichter wieder als ich. Das war schon immer so. Gefühle, vor allem die schlechten, prallen einfach an ihm ab – vermutlich hat das mit seinem riesigen Computerhirn zu tun – , während sich meine festsetzen, auf ewig gefangen in einem klebrigen, unentrinnbaren Durcheinander. Natürlich ist Gideon traurig. Er vermisst Mom, aber er ist eher stoisch wie mein Dad.
Ich war immer eher wie unsere Mom. Allerdings: Wenn ihre Gefühle auf volle Lautstärke hochgedreht waren, hatten meine schon lange die Lautsprecher zerfetzt.
»Okay, Wasser, mach ich«, sage ich zu Dad, der mich immer noch anstarrt. »Ich gehe.«
Cassie und ich haben uns in einer Toilette angefreundet. Während wir uns in der Toilette der Samuel F. Smith Memorial Middle School versteckten, um genau zu sein. Es war der Dezember in der sechsten Klasse, und ich war gerade zur Toilette gegangen und hatte vor, mich zur Not die ganze erste Stunde in einer Kabine einzuschließen. Mir war nicht in den Sinn gekommen, dass jemand anders dieselbe Idee gehabt haben könnte, als ich laut an die Tür der hintersten Kabine hämmerte.
»Au!«, schrie jemand auf, als die unverschlossene Tür aufschwang und jemanden traf. »Was soll das denn?«
»Oh, Entschuldigung.« Ich wurde rot. »Ich habe keine Füße gesehen.«
»Ja, das war ja auch der Sinn der Sache.« Das Mädchen klang sauer. Als sie die Tür endlich öffnete, sah sie auch so aus. Cassie – die Neue, oder einigermaßen Neue – kauerte komplett angezogen auf der Toilette, genau wie ich es auch vorgehabt hatte. Sie starrte mich eine Weile an, dann verdrehte sie die Augen, rückte zur Seite und machte mir Platz auf der Klobrille. »Jetzt steh nicht so rum! Komm schon, bevor dich jemand sieht!«
Cassie und ich kannten uns aus der Ferne – unsere Schule war nicht so groß – , aber wir waren keine Freundinnen. Cassie hatte eigentlich immer noch keine Freunde. Und mir war nicht wohl dabei, wie einige der anderen auf ihr herumhackten. Es lag an ihren gemütlichen Trainingshosen oder ihren kurzen, verknoteten Locken oder daran, dass sie dicker war als die anderen Mädchen – sowohl ihre Brüste als auch ihr Bauch. Nicht mal, dass sie eine Supersportlerin war, verschaffte ihr Ruhe vor den anderen. Sie hätte diesen Herbst unsere Fußballmannschaft zu einem brauchbaren Team machen können, zum ersten Mal und im Alleingang, aber sie interessierten sich nur dafür, dass sie nicht danach aussah. Allerdings konnte ich auch nicht Cassies Verteidigerin sein oder so was. Vor allem jetzt nicht mehr. Ich hielt kaum selbst durch.
»Und was führt dich auf den Topf der Schande?«, fragte Cassie, als sich unsere Knie über dem offenen Wasser der Toilette berührten.
Auf keinen Fall würde ich ihr irgendwas erzählen. Nur dass ich ihr dann plötzlich doch alles erzählen wollte.
»Alle meine Freundinnen hassen mich«, begann ich, »und sie sitzen alle mit mir in der ersten Stunde.«
»Warum hassen sie dich?«, fragte Cassie.
Ich war froh, dass sie es mir nicht sofort ausreden wollte. Die Leute reden einem negative Gefühle nur zu gern aus. (Glaubt mir, ich bin Expertin auf diesem Gebiet.) Stattdessen wirkte sie einfach neugierig. »Was ist passiert?«
Und so erzählte ich ihr alles. Wie Maia, Stephanie, Brooke und ich ein Quartett gewesen waren, seit wir acht waren, ich aber das Gefühl hatte, die anderen machten sich einen Spaß, der meistens gegen mich ging. Ich hatte immer noch gehofft, ich bildete es mir nur ein, bis zu dem Samstagabend bei der Übernachtungsparty, als sie anfingen, mich über meine Therapeutin auszufragen. Maias Mom arbeitete ehrenamtlich im Schulbüro und hatte wohl die Notiz gesehen, dass ich wegen meines ersten Termins bei Dr. Shepard früher gehen musste. Und dann hatte sie anscheinend beschlossen, es Maia zu erzählen, was ich immer noch nicht fassen konnte.
»Komm schon, Wylie. Erzähl es uns!«, hatten sie im Singsangchor gerufen.
Ich schwitzte schon, als der Raum anfing, sich zu drehen. Und dann war es passiert.
»Mir war gar nicht klar, dass ich mich übergeben hatte, bis ich ihr Geschrei hörte«, sagte ich zu Cassie. Und es klang mir immer noch in den Ohren: »O mein Gott!« »Iiiieh!«
»Oh, das ist scheiße«, sagte Cassie. Als wäre das, was ich ihr erzählt hatte, zwar wichtig, aber nicht allzu beunruhigend. »Mein Basketballcoach hat mir gestern sein Ding gezeigt. Du weißt schon, Mr Pritzer. Er hat mich nach dem Training nach Hause gefahren und ihn einfach rausgezogen. Und er ist leider auch mein Klassenlehrer.«
Sie sagte das, als wäre die Tatsache, dass sich jemand vor ihr entblößt hat, auch nicht so schrecklich, nur irgendwie ungünstig.
»Oh«, sagte ich, denn mir fiel sonst nichts ein. Allein die Vorstellung, wie Mr Pritzer so etwas tat, war mir schon furchtbar peinlich. »Iih.«
»Ja, iih.« Cassie zog ein finsteres Gesicht und nickte. Jetzt sah sie traurig aus.
»Hast du es deinen Eltern erzählt?«
»Meine Mom würde mir nicht glauben.« Cassie zuckte mit den Schultern. »Das passiert, wenn man oft lügt.«
»Ich glaube dir«, sagte ich. Und es stimmte.
»Danke.« Cassie lächelte. »Und es tut mir leid, dass du alle deine Freundinnen verloren hast.« Sie nickte wieder und presste die Lippen aufeinander. »Gut, dass du jetzt eine neue hast.«
Draußen in der Küche beeile ich mich, warte nicht, bis das Wasser richtig kalt ist, bevor ich nachlässig ein Glas für Karen fülle. In Wahrheit warte ich schon lange darauf, dass mit Cassie »etwas Großes« passiert. Sie zu retten war fast normal – menschlichen Schutzschild spielen, damit sie nicht verprügelt wurde, weil sie Mist über einen riesenhaften Achtklässler erzählt hatte, Geld zu Rite Aid bringen, damit sie keine Diebstahlsanzeige wegen eines Lippenstifts bekam (Cassie trägt nicht mal Lippenstift). Harmloser dummer Kinderkram.
Diesen Herbst nahm das Ganze aber eine düstere Wendung. Cassies Trinkerei war das größte Problem. Und mich beunruhigte nicht nur, wie viel (fünf oder sechs Bier in einer Nacht?) oder wie oft (zwei- oder dreimal die Woche?). Das wäre für jeden ziemlich exzessiv gewesen, aber für jemanden mit Cassies Genen war es eine Katastrophe. Irgendwann hatte sie selbst mal gesagt, sie sollte niemals trinken. Sie liebte ihren Dad, aber das Letzte, was sie wollte, war, wie er zu enden.
Doch dann war es, als hätte Cassie beschlossen, alle Versprechen zu vergessen, die sie sich selbst gegeben hatte. Und Mann, was ging es ihr gegen den Strich, wenn ich sie daran erinnerte. Nach den ersten paar Monaten der elften Klasse ging es so schnell abwärts mit ihr, dass mir schwindlig wurde. Aber je besorgter ich wurde, desto wütender wurde sie.
Zum Glück redet Karen immer noch, als ich endlich wieder ins Wohnzimmer komme. Vielleicht bekomme ich doch noch die wichtigen Einzelheiten mit.
»Ja, also …« Sie wirft einen Blick zu mir herüber, dann räuspert sie sich, bevor sie weiterspricht. »Ich kam nach Hause, um Cassie nach der Schule zu sehen, und sie war nicht da.«
Das Glas ist eindeutig warm, als ich es Karen gebe. Sie scheint es nicht zu bemerken. Aber sie bemerkt schließlich doch meine Haare. Ich erkenne den Sekundenbruchteil, in dem es passiert. Zu ihrer Verteidigung muss ich sagen, dass sie sich ziemlich gut fängt und ihre Augen zur Ruhe bringt, bevor sie richtig entsetzt aussieht. Stattdessen trinkt sie einen Schluck von ihrem Badewannenwasser und lächelt mich an.
»Könnte es dann nicht einfach sein, dass Cassie noch unterwegs ist?«, fragt Dad. »Es ist erst Abendessenszeit.«
»Sie sollte zu Hause sein«, erwidert Karen fest. »Sie hatte die ganze Woche Hausarrest. Weil sie – na ja, ich möchte euch lieber nicht sagen, wie sie mich genannt hat.« Und da ist er. Der Ton. Dieses Ich hasse Cassie ein kleines bisschen, vielleicht sogar mehr, als sie mich hasst. »Ich habe ihr gesagt, wenn sie nicht zu Hause sei, würde ich wirklich dieses Internat anrufen, das ich mir angesehen hatte – du weißt schon, eines von diesen therapeutischen. Und nein, ich bin nicht stolz auf diese Drohung. Dass wir so tief gesunken sind, dass ich sie wegschicke. Aber wir sind es; das ist die Realität. Jedenfalls habe ich auch noch das hier gefunden.«
Karen angelt etwas aus ihrer Tasche und gibt es meinem Dad. Es ist Cassies Notfallarmband.
»Sie hat das Armband seit dem Tag vor drei Jahren, als ich es ihr geschenkt habe, nicht abgenommen.« Karens Augen füllen sich mit Tränen. »Ich habe das mit dem dummen Internat nicht mal richtig ernst gemeint. Ich habe mir nur solche Sorgen gemacht. Und ich war wütend. Das ist die Wahrheit. Ich war auch wütend.«
Fragend blickt Dad auf das Armband hinab, das über seinen Fingern hängt, dann wieder zu Karen. »Vielleicht ist es abgefallen«, sagt er; seine Stimme hebt sich, als wäre es eine Frage.
»Ich habe es auf meinem Kissen gefunden, Ben«, antwortet Karen. »Und heute Morgen war es noch nicht da. Also muss Cassie irgendwann nach Hause gekommen und dann wieder gegangen sein. Es war als Zeichen gemeint – wie ein ›Scheiß auf dich, ich bin weg‹. Ich weiß es.« Da wendet sich Karen mir zu. »Du hast nichts von ihr gehört, oder, Wylie?«
Damals, als alles noch okay zwischen uns war, wäre nicht mehr als eine Stunde vergangen, in der wir uns nicht zumindest geschrieben hätten. Aber das ist jetzt anders. Ich schüttle den Kopf. »Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr mit ihr gesprochen.«
Es ist mindestens eine Woche her, vielleicht länger. Wenn man zu Hause bleibt, verliert man leicht das Zeitgefühl. Aber es ist der längste Zeitraum seit dem Unfall, in dem wir nicht miteinander gesprochen haben. Irgendwann musste es passieren: Wir konnten nicht ewig weiter Freundschaft heucheln. Denn das war eigentlich alles, was wir taten, als Cassie nach dem Unfall wiederkam: so tun, als ob.
Der Unfall passierte im Januar, aber Cassie und ich hatten zum ersten Mal direkt nach Thanksgiving aufgehört, miteinander zu reden. Fast zwei lange Monate, die sich, wenn man sechzehn ist, hinziehen, als wäre es das ganze Leben. Aber am Morgen nach dem Unfall war Cassie einfach auf unserer Schwelle aufgetaucht. Meine Augen hatten vom Weinen so gebrannt, dass ich dachte, ich hätte Halluzinationen. Erst als Cassie mir half, die Kleider zu wechseln, die ich schon seit zwei Tagen trug, fing ich an zu glauben, dass es echt war. Und erst nachdem sie mir die Haare aus dem zerzausten, verdrehten Dutt gelöst hatte, sie weichgekämmt und eng geflochten hatte, als rüste sie mich für den Kampf aus, da wusste ich, wie sehr ich sie brauchte.
Ich weiß nicht, was Cassie Karen über das Ende unserer besten Freundschaft und unsere vorübergehende Wiedervereinigung erzählt hat. Und es war sowieso vor ein paar Wochen vorbei. Aber ich wette, es war nicht viel. Die zwei stehen sich nicht gerade nahe. Und die Gründe, warum wir nicht mehr miteinander reden, werfen auch nicht unbedingt ein gutes Licht auf Cassie.
»Du hast seit einer Weile nicht mit Cassie geredet?«, fragt Dad überrascht.
Mom wusste von meinem Krach mit Cassie, damals, als es zum ersten Mal passierte. Anscheinend hat sie es Dad nie erzählt. Es kann sein, dass ich sie gebeten habe, es nicht zu tun – ich weiß es nicht mehr. Aber ich erinnere mich, was Mom sagte, als ich ihr erzählte, dass Cassie und ich keine Freundinnen mehr seien. Wir lagen nebeneinander auf ihrem Bett, und als ich fertig erzählt hatte, sagte sie: »Ich würde immer deine Freundin sein wollen.«
Ich zucke die Achseln. »Ich glaube, die letzte Nachricht von Cassie habe ich letzte Woche bekommen? Vielleicht am Dienstag.«
»Letzte Woche?«, fragt Dad, die Augenbrauen ganz tief gezogen.
Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht sicher. Aber heute war Donnerstag. Und es ist auf jeden Fall mindestens eine Woche her, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
»Oh, so lange.« Karen ist eher enttäuscht als überrascht. »Ich habe bemerkt, dass ihr beide nicht mehr so viel geredet habt, mir war nur nicht klar …« Sie schüttelt den Kopf. »Ich habe die Polizei angerufen, aber weil Cassie sechzehn ist und wir gestritten haben, scheinen sie es natürlich nicht eilig zu haben, sie zu suchen. Sie haben es aufgenommen und fragen in den Krankenhäusern der Umgebung nach, aber sie durchkämmen nicht die Wälder oder so. Sie schicken einen Wagen los, der nach ihr Ausschau hält, aber nicht vor morgen früh.« Karen drückt die Fingerspitzen an die Schläfen und lässt den Kopf vor und zurück wippen. »Morgen früh. Das sind von jetzt an zwölf Stunden! Wer weiß, wo Cassie bis dahin ist und in welchem Zustand? Wenn ich an all die schrecklichen … Ben, ich kann nicht bis morgen warten. Nicht bei der Art, wie wir auseinandergegangen sind.«
Mich überrascht, dass Karen zumindest teilweise zu wissen scheint, wie durchgedreht Cassie in letzter Zeit war. Andererseits war klar, dass sie irgendwann auffliegen würde, wenn ich nicht mehr ihr Alibi spiele. Und dieses Szenario, das Karen im Kopf hat – dass Cassie irgendwo bewusstlos herumliegen könnte – , ist nicht komplett verrückt. Selbst um diese Uhrzeit, kurz vor sieben Uhr am Abend, ist das möglich.
»Nooners« nennen es die Jugendlichen am Newton Regional. Anscheinend muss man sich neuerdings, wenn man richtig cool ist, mitten am Tag total abschießen. Das letzte Mal, als ich Cassie zu Hilfe geeilt bin, war im November, und es war erst vier oder fünf Uhr am Nachmittag. Ich fuhr mit dem Taxi, um sie von einer Party bei Max Russel zu Hause abzuholen, weil sie viel zu betrunken war, um allein nach Hause zu kommen. Zu ihrem Glück war meine Mom gerade auf Reisen, mein Dad wie immer im Unilabor und Gideon noch in der Schule, weil er länger an seiner Bewerbung für die Intel Science Competition arbeitete. Ich stahl mich davon, und wir schlichen wieder hinein, ohne dass es jemand merkte. Cassie schwankte so stark, dass sie gegen Wände stieß. Danach hielt ich ihr über der Toilette die Haare, als sie sich wieder und wieder übergab. Und später rief ich Karen an, um ihr zu erzählen, sie habe Migräne und wolle über Nacht hierbleiben.
Am nächsten Morgen sagte ich Cassie, sie müsse mit dem Trinken aufhören, sonst werde noch etwas Schlimmes passieren. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich schon nicht mehr ihre einzige Freundin. Ich war nur diejenige, die ihr sagte, was sie nicht hören wollte.
3
»Geht es dir gut, Wylie?« Dad starrt mich an, und das schon wer weiß wie lange. Jetzt wird mir klar, warum. Ich habe mich an die Wohnzimmerwand gedrückt, als versuchte ich, durch die Mauer zu entkommen. »Möchtest du dich nicht hinsetzen?«
»Alles okay«, sage ich. Aber ich klinge nicht so.
»Ach, Schätzchen, das tut mir leid.« Karen schaut mich an und sieht wieder aus, als würde sie gleich weinen. »Das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst, ist mein, ist unser …« Sie zwingt sich zu einem wackligen Lächeln, sieht jetzt noch mehr so aus, als würde sie gleich zerfallen.
Ich senke den Blick. Wenn ich sehe, wie sie wirklich die Fassung verliert, tue ich es auch.
»Cassie kommt schon zurecht, Wylie, da bin ich mir sicher. Die Polizei hat wahrscheinlich recht, ich mache mir zu viele Sorgen. Bei mir brennt manchmal ein bisschen schnell die Sicherung durch bei solchen …«
Sie beendet den Satz nicht. Wegen Cassies Dad, das meint sie eigentlich. Cassies Eltern waren schon geschieden, als wir uns kennenlernten, aber Cassie hat mir alles über das Leben mit Vince erzählt. Er war nie ein stiller Trinker. Streits mit Nachbarn bei Grillfesten im Sommer, zu Hause anrufen, damit man ihn abholte, weil er mal wieder aus einer Kneipe geworfen wurde. Aber was Karen vollends den Rest gab, war seine zweite Alkoholfahrt, bei der er sein Auto in der Stadt gegen einen Briefkasten setzte. Und jetzt hat sie genauso Angst, Vinces Geschichte könnte sich bei ihr wiederholen, wie ich. Als ich den Blick vom Teppich hebe, sieht mich Dad immer noch an.
»Mir geht’s gut«, sage ich noch mal, aber zu laut. »Ich will nur helfen, Cassie zu finden.«
»Wylie, natürlich möchtest du helfen«, fängt mein Dad an. »Aber im Moment glaube ich nicht, dass du …«
»Bitte«, sage ich und bemühe mich, meine Stimme entschlossen klingen zu lassen, nicht verzweifelt. Verzweiflung ist nicht gut. »Ich muss das tun.«
Das stimmt. Erst als die Worte meinen Mund verlassen haben, wird mir klar, wie wichtig es mir ist. Teilweise, weil ich mir selbst beweisen will, dass ich es kann. Aber ich fühle mich auch schuldig. Ich war nicht einverstanden mit dem, was Cassie tat, hatte Angst, was ihr passieren könnte, wenn sie nicht aufhört. Aber vielleicht hätte ich ihr deutlicher sagen sollen, dass ich sie immer lieben würde, egal, welche Fehler sie machte.
»Es war so egoistisch von mir herzukommen.« Karen legt die Stirn in die Hand. »Nach allem, was ihr durchgemacht habt … Ich habe nicht richtig nachgedacht.«
Dad sieht mir in die Augen. Seine sind zu Schlitzen verengt, als berechne er irgendeine komplizierte quadratische Gleichung. Schließlich holt er tief Luft.
»Nein, Wylie hat recht. Wir möchten helfen. Wir müssen«, sagt er, und mein Herz wird leicht. Vielleicht kann er mich ja doch hören. Vielleicht versteht er ein kleines bisschen. Er wendet sich wieder an Karen. »Gehen wir es mal durch: Was genau ist heute Morgen zwischen dir und Cassie passiert?«
Karen verschränkt die Arme und wendet den Blick ab. »Na ja, wir hatten es eilig wie jeden Morgen, schnauzten uns wie üblich an, weil sie nicht aus dem Bett kam. Sie hat in den letzten zwei Wochen fünfmal den Bus verpasst. Und ich hatte heute Morgen einen Termin und konnte nicht …« Ihr versagt die Stimme, während sie ein zerknülltes Papiertaschentuch herauszieht. »Jedenfalls habe ich total die Geduld verloren. Ich … ich habe sie angeschrien, Ben. Ich habe es ihr richtig gegeben. Und sie hat ein ganz schreckliches Wort zu mir gesagt. Eines, das ich nicht wiederholen möchte. So ein Wort habe ich in meinem ganzen Leben nie laut gesagt. Aber Cassie sagte es zu mir.« Ihre Stimme stockt wieder, und sie schaut auf ihre Finger, die das Taschentuch kneten. »Also sagte ich ihr, ich würde jetzt wirklich in diesem Internat anrufen und sie abtransportieren lassen. Damit sie ihr Verstand einbläuen. So habe ich es auch ausgedrückt: ›abtransportieren lassen‹ und ›einbläuen‹.«
Mein Dad nickt, als wüsste er genau, was Karen meint. Als hätte er mich unzählige Male selbst so angeschrien. Aber ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, als er mich wegen etwas angeschrien hat, das war an einem 4. Juli auf dem Albermarle Field, als ich während des Feuerwerks barfuß herumlief und fast auf eine zerbrochene Flasche getreten wäre.
»Das Schlimmste ist der Grund, warum es anfing … meine Hektik. Es ging nicht mal um eine Sitzung bei der Arbeit oder einen Tag der offenen Tür oder einen potenziellen Kunden. Nichts, was ich tun musste, um für Essen auf dem Tisch zu sorgen. Nichts wirklich Wichtiges.« Karen blickt zur Decke auf, als suche sie da oben eine Antwort. »Es war ein Yoga-Kurs. Deshalb habe ich die Beherrschung verloren.« Sie sieht meinen Dad an, als könne er erklären, warum sie so schrecklich ist. »Ich habe die ganze Scheidung über mit Vince darum gekämpft, dass Cassie bei mir wohnt, damit ich für sie da sein kann, und jetzt … Ich bin so selbstsüchtig.«
Karen lässt das Gesicht in die Hände sinken und wiegt sich vor und zurück. Ich weiß nicht, ob sie weint, aber ich wünsche mir sehr, sie täte es nicht, denn ich mache mir Sorgen um Cassie. Aber nicht solche. Lustig, dass ausgerechnet ich jemals weniger besorgt sein könnte als alle anderen. Kommt mir vor, als wäre ich in der Leugnungsphase. Egal, was es ist, es könnte auf jeden Fall böse sein. Und würde irgendeiner von den Leuten, mit denen Cassie in letzter Zeit abhängt, wirklich Hilfe rufen, wenn sie welche bräuchte? Würden sie bleiben, um sicherzugehen, dass sie sich nicht im Schlaf erbricht, dass niemand sie missbraucht, während sie ohnmächtig ist? Nein. Die Antwort auf alles ist nein. Sie würden in jeder Lage als Allererstes ihre eigene Haut retten.
»Karen, das darfst du dir nicht antun. Niemand ist perfekt.« Mein Dad macht einen Schritt auf sie zu und beugt sich vor, als würde er ihr tatsächlich die Hand auf den Rücken legen. Stattdessen verschränkt er die Arme. »Hat Cassie in der Schule gefehlt?«
»Es gab keine Nachricht von ihnen auf dem Anrufbeantworter. Aber ich gehe davon aus …« Karen verdreht ihr Taschentuch noch mehr. »Cassie könnte sie gelöscht haben, als sie wiederkam, um das Armband dazulassen. Das hat sie auch schon vor ein paar Wochen gemacht, als sie geschwänzt hatte. Ich wollte der Schule stattdessen meine Handynummer geben, aber ich habe es vergessen.«
Cassie schwänzt die Schule auch? In letzter Zeit weiß ich so vieles von ihr nicht.
»Was hältst du davon, wenn du jetzt versuchst, ihr zu schreiben, Wylie?«, schlägt Dad vor. »Wenn sie was von dir hört, vielleicht … man weiß nie.«
Vielleicht antwortet sie nur Karen nicht. Das sagt er nicht, aber er denkt es. Und nachdem Karen ihr mit diesem Internats-Bootcamp gedroht hat, spricht Cassie vielleicht nie wieder mit ihr. Aber wenn sie ihrer Mutter aus dem Weg geht, tut sie es mit mir vielleicht auch, aus genau demselben Grund: Wir machen ihr beide Vorwürfe.
»Okay, aber ich weiß nicht …« Ich ziehe mein Handy aus der Sweatshirttasche und tippe: Cassie, wo bist du? Deine Mom flippt aus. Ich warte und warte, aber sie schreibt nicht zurück. Schließlich halte ich das Gerät hoch. »Manchmal dauert es kurz, bis sie antwortet.«
In Wirklichkeit ist das nie so. Oder war es nie. Die Cassie, die ich kannte, lebte mit ihrem Smartphone in der Hand. Als wäre es eine Frage der Ehre, auf jeden Tweet, jede Nachricht, jedes Foto innerhalb von Sekunden zu antworten. Oder vielleicht war es eher eine Rettungsweste. Denn je dünner und betrunkener und beliebter Cassie wurde, desto verzweifelter schien sie sich über Wasser zu halten.
»Kannst du dir vorstellen, wo Cassie sein könnte, Wylie?«, fragt Karen. »Oder mit wem?«
»Hast du es schon bei Maia und den anderen versucht?«, frage ich. Der Name fühlt sich eklig in meinem Mund an.
Die Regenbogenkoalition: Stephanie, Brooke und Maia – nach all den Jahren immer noch beste Freundinnen. Alle außer mir. Sie haben im ersten Studienjahr angefangen, sich die Regenbogenkoalition zu nennen. Wegen ihrer Haarfarbenpalette. (Und es schien ihnen egal zu sein, dass dieser Spitzname dadurch, dass sie alle weiß sind, total beleidigend ist.) Sie waren schöner als je zuvor und inzwischen auch viel cooler. Bis zum dritten Studienjahr hatten sie sich auf der Beliebtheitsleiter der Newton Regional High School ganz nach oben geboxt. Cassie hatte die Regenbogenkoalition immer dafür gehasst, was sie mir angetan hatten, bis sie die Hand herabstreckten und sie einluden, auf der Leiter nach oben zu kommen.
»Maia und diese Mädchen.« Karen verdreht die Augen. »Ich weiß ehrlich nicht, was Cassie an ihnen findet.«
Mit ihnen fühlt sie sich wichtig, möchte ich sagen. Auf eine Art, wie du es ihr nie vermittelt hast. Andererseits muss ich das gerade sagen. Am Anfang versuchte Cassie zu verbergen, wie stolz sie war, dass sie zu einem der »Hangouts« der Regenbogenkoalition eingeladen worden war. Keine »Party«, denn das wäre »so lame« gewesen. (Und ja, sie reden immer so.) Sie tat so, als ginge sie nur zu Recherchezwecken hin. Auf dem allerersten »Hangout« traf Cassie dann Jasper. Und danach war es ihr schon nicht mehr so wichtig, irgendwas vorzutäuschen.
Es war aufregend für sie. Das konnte ich schon verstehen. Aber ich dachte auch, Cassie würde schnell drüber wegkommen – dass sie wieder zu Vernunft kommen würde. Stattdessen betrank sie sich mehr und mehr auf mehr und mehr Partys. Mehr als einmal spiegelte ich ihr, was sie mir immer über ihren Dad gesagt hatte: dass sie nie so enden wolle wie er. Ich sagte ihr wieder und wieder, dass ich als ihre Freundin mir Sorgen machte. Aber wozu brauchte sie mich noch, wenn ich ihr nur ein schlechtes Gewissen machte? Sie hatte die Regenbogenkoalition für die Tage, und nachts verliebte sie sich. Ich sah es, aber ich versuchte mit aller Macht, so zu tun, als sei nichts.
Denn ich wusste schon, dass Jasper Salt keine Lösung für Cassie war. Er war nur noch ein Problem mehr. Und natürlich dauerte es nicht lange, bis er Cassie bei der Hand nahm und mit ihr den Bach runterging.
»Weißt du, Jasper ist wirklich ein guter Mensch, Wylie«, hatte Cassie am Montag nach Thanksgiving angefangen. »Du musst ihn kennenlernen.«
Wir aßen bei Naidre’s zu Mittag, im einzigen Café in der Nähe der Schule, wo die Schüler der letzten beiden Jahrgänge auch außerhalb des Campus hindurften. Suppe und Sandwich für mich, ein trockener Bagel für Cassie, den sie zielstrebig in kleine Stücke rupfte und auf ihrem Teller umarrangierte, damit es aussah, als äße sie.
Wir waren erst fünf Minuten zusammen – nachdem wir einander vier Tage nicht gesehen hatten – und stritten schon wieder.
Aber wenn ich ehrlich war, stimmte es bei uns schon nicht mehr so recht, seit Cassie Ende August vom Fitness-Sommercamp zurückgekommen war. »Fettcamp«, hatte Cassie es genannt, als ihre Mutter sie in den Sommerferien vor der achten Klasse dazu gezwungen hatte. Aber diesmal war es Cassies Idee gewesen. Auch wenn schwer erkennbar war, wo sie noch mehr hätte abnehmen sollen. Als sie nach Hause kam, sah sie aus wie ein Skelett, ein Vergleich, der sie entzückte.
Es war nicht nur der Gewichtsverlust. Cassie hatte auch andere Haare: länger und glatt geföhnt, und stylische Klamotten. Schwer zu glauben, dass das dieselbe Person war, die vor all den Jahren mit mir auf der Klobrille gekauert hatte. Ein paar Wochen später war ich nicht überrascht, als die Regenbogenkoalition anklopfte, und auch nicht, dass jemand wie Jasper – beliebt, gut aussehend, Sportler (und Arschloch) – Cassie bemerkt hatte. Ich konnte nur nicht fassen, wie glücklich sie gewesen war, als sie es taten.
»Über Jasper weiß ich alles, was ich wissen muss«, sagte ich, dann verbrannte ich mir den Mund an meiner Tomatensuppe.
Es gab Gerüchte, er hätte in seinem ersten Studienjahr einen aus dem Abschlussjahrgang mit einem einzigen Schlag umgehauen. In einer Version hatte Jasper dem Jungen die Nase gebrochen. Mir war immer noch nicht klar, warum er nicht im Gefängnis saß und vor allem immer noch an der Schule war. Aber ich hatte Jasper auch schon nicht gemocht, bevor ich die Geschichte hörte, und vielleicht waren ein paar der Gründe oberflächlich – seine enganliegenden T-Shirts, seine Angeberei und der dumme, aufgesetzte Surferslang. Aber ich hatte auch Beweise, dass er ein echtes Arschloch war. Ich hatte Tasha.
Tasha war in unserem Alter, wirkte aber viel jünger. Sie umarmte Leute ohne Vorwarnung und lachte viel zu laut, außerdem trug sie immer Pink oder Rot mit einem passenden Haarreif. Wie eine riesige Valentinskarte. Aber niemand war jemals gemein zu Tasha; das wäre grausam gewesen. Niemand außer Jasper. Ein paar Wochen, nachdem er und Cassie angefangen hatten, gemeinsam abzuhängen – Anfang Oktober – , sah ich Jasper am Ende eines leeren Flurs mit Tasha reden. Sie waren zu weit weg, um etwas zu verstehen, aber es war unübersehbar, dass Tasha weinte, als sie auf mich zurannte. Als ich Cassie davon erzählte, sagte sie nur, Jasper wäre nie gemein zu Tasha. Was wohl heißen sollte, dass ich lüge.
»Jasper mag nicht perfekt sein, aber er hatte ein echt schweres Leben. Lass ihn doch mal in Ruhe«, sprach Cassie jetzt weiter und sortierte ihre Bagelfetzen um. »Er wohnt allein mit seiner Mom, die total egoistisch ist, und mit seinem großen Bruder, ein Riesenarschloch. Und sein Dad ist im Gefängnis«, fügte sie defensiv hinzu, aber auch irgendwie selbstgefällig. Als wäre die Tatsache, dass sein Dad ein Krimineller war, irgendwie ein Beweis dafür, dass Jasper ein guter Mensch sei.
»Im Gefängnis? Weshalb?«
»Ich weiß nicht«, schnauzte sie.
»Cassie, was ist, wenn es etwas echt Schlimmes war?«
»Nur weil Jaspers Vater was gemacht hat, heißt das doch nicht, dass mit ihm was nicht stimmt. Es ist sogar ziemlich krank, dass du so etwas überhaupt denkst.« Cassie schüttelte den Kopf und verschränkte die Arme.
Das Schlimmste war, sie hatte recht: Es war ziemlich scheußlich von mir, dass meine Gedanken einfach dorthin gesprungen waren.
»Abgesehen davon versteht Jasper mich. Das zählt mehr als sein blöder Dad.«
Mir schoss es heiß durch die Brust. Das war sie also, die ehrliche Wahrheit: Jasper verstand sie und ich nicht. Nicht mehr.
»Aber welchen Teil von dir, Cassie?«, schnauzte ich. »Du hast in letzter Zeit so viele Gesichter, wie kommt er da nicht durcheinander?«
Cassie starrte mich mit offenem Mund an. Und dann begann sie, ihre Sachen zusammenzusuchen.
»Was tust du?«, fragte ich mit hämmerndem Herzen. Sie sollte wütend sein. Wir sollten uns streiten. Sie sollte nicht verschwinden.
»Ich gehe«, sagte Cassie ruhig. »Das tun normale Leute, wenn jemand scheußlich zu ihnen ist. Und falls du verwirrt bist, Wylie« – sie deutete auf sich –, »ich bin normal. Und du bist scheußlich.«
»Jedenfalls habe ich Maia und die anderen Mädchen angerufen«, spricht Karen weiter. »Sie sagten, sie hätten Cassie heute in der Schule das letzte Mal gesehen, nur konnte sich anscheinend keine genau erinnern, wann.«
»Hast du mit Jasper gesprochen?«, frage ich und versuche dabei nicht zu klingen, als hätte ich schon beschlossen, dass er – im Geist, nicht tatsächlich – zu hundert Prozent für alles Schlechte verantwortlich ist, das Cassie je zugestoßen ist.
Karen nickt. »Er hat mit Cassie geschrieben, als sie auf dem Weg zur Schule im Bus saß, aber seitdem hat er nichts mehr von ihr gehört. Angeblich zumindest.« Sie blinzelt mich an. »Du magst Jasper nicht, oder?«
»Ich kenne ihn eigentlich nicht, deshalb weiß ich nicht, ob meine Meinung zählt«, sage ich, obwohl ich genau das Gegenteil denke.
»Du bist Cassies älteste Freundin«, sagt Karen. »Ihre einzige echte Freundin, soweit ich das beurteilen kann. Deine Meinung zählt immer. Du glaubst doch nicht, dass er ihr wehtun würde, oder?«
Glaube ich, Jasper würde Cassie tatsächlich etwas antun? Nein. Ich denke viele schlechte Dinge über Jasper, aber dafür habe ich keinen Grund. Das glaube ich nicht.
»Ich weiß nicht«, sage ich absichtlich vage. Aber ich darf Jasper nicht mal halb wegen so etwas Ernstem anklagen, nur weil ich ihn nicht mag. »Nein, meine ich. Ich glaube nicht.«
»Und Vince hat auch nichts von ihr gehört?«, fragt mein Dad.
»Vince«, schnaubt Karen. »Er hängt mit seiner neuen ›Freundin‹ auf den Florida Keys herum. Als Letztes habe ich von ihm gehört, dass er versucht, eine Privatdetektivlizenz zu bekommen. Lächerlich.«
Cassie könnte ihren Dad sogar wirklich anrufen. Sie ist verrückt nach Vince, trotz allem. Sie schreiben sich die ganze Zeit E-Mails und SMS. Ihre Abneigung gegen Karen schweißt sie zusammen.
»Du solltest versuchen, ihn zu erreichen, nur zur Sicherheit«, schlägt Dad vorsichtig vor. Dann geht er zur Ablage hinüber, holt seine Brieftasche und späht zu den kleinen Haken an der Wand, wo wir unsere Schlüssel aufhängen. »Und du und ich können selbst losgehen und nach ihr suchen.«
Karen nickt, ohne den Blick von ihren Fingern zu heben, die sich immer noch um das inzwischen ziemlich zerfetzte Taschentuch öffnen und schließen.
»Vince wird mir die Schuld geben, wisst ihr? Von wegen wenn ich nicht so eine hassenswerte Korinthenkackerin wäre, dann wäre Cassie noch …« Karen hält sich den Mund zu, als ihre Stimme bricht. »Und er hat recht. Das ist das Schlimmste. Vince hat Probleme, aber er und Cassie …« Sie schüttelt den Kopf. »Sie hatten immer eine Verbindung. Wenn ich vielleicht …«
»Nichts ist so einfach. Nicht bei Kindern und auch sonst nicht«, sagt mein Dad, als er endlich seine Schlüssel in einer Schublade findet. »Komm, wir gehen zuerst bei euch zu Hause vorbei. Um sicherzugehen, dass Cassie wirklich nicht dort ist. Vince rufen wir von unterwegs an. Wenn du möchtest, kann ich auch mit ihm sprechen.« Mein Dad geht in Richtung Haustür, bleibt aber stehen, als er Karens Füße bemerkt. »Ach, warte, deine Schuhe.«
»Das macht nichts.« Sie winkt beschämt ab. Selbst jetzt versucht sie noch den letzten Rest ihrer Perfektion zurückzuerobern. »Das geht schon. Ich bin so lächerlich hierhergefahren, dann komme ich auch wieder nach Hause.«
»Was, wenn wir dann doch noch irgendwo anders anhalten müssen? Nein, nein, du brauchst Schuhe. Du kannst ein Paar von Hope leihen.«
Von Hope? Und dann noch so beiläufig, als hätte er Karen nicht gerade ein Stück meiner Haut angeboten. Klar, wir können Karen schließlich kein überzähliges Paar Schuhe von mir anbieten. Nach einer panischen Anti-Hoarding-Episode neulich nach der Beerdigung besitze ich nur noch ein Paar Schuhe. Die, die ich trage. Aber es ist die Art, wie mein Dad es sagt: Als wäre es gar nichts, alle Sachen von Mom wegzugeben.
Manchmal frage ich mich, ob mein Dad meine Mom schon nicht mehr liebte, bevor sie starb. Ich habe noch andere Beweise für diese Theorie, und zwar ihre Streits. Nach einem ganzen Leben, in dem es praktisch nie ein böses Wort zwischen ihnen gab, waren sie in den Wochen vor dem Unfall plötzlich ständig aufeinander losgegangen. Und wenn er sie nicht mehr richtig liebte, würde das auf jeden Fall erklären, warum er nicht halb so am Boden zerstört zu sein scheint wie ich.
Tu das nicht, denke ich, als er in Richtung Treppe zu ihren Schuhen geht. Sonst werde ich dir das nie verzeihen. Zum Glück bleibt er stehen, als sein Handy in seiner Hand vibriert.
Er schaut drauf. »Entschuldige, aber das ist Dr. Simons.« Gerettet vom einzigen Freund meines Vaters: Dr. Simons. Der einzige Mensch, für den er jederzeit alles stehen und liegen lassen würde. Vorher hat mich das nie gestört. Aber jetzt kotzt es mich ernsthaft an. »Kannst du mit Karen nach oben gehen, Wylie? Sehen, ob ihr irgendetwas von deiner Mom passt?«
Ich sehe ihn nur böse an.
»Alles in Ordnung?«, fragt er, als ich mich immer noch nicht rühre. Sein Gesicht ist angespannt.
»Ja«, sage ich schließlich, weil er sonst wahrscheinlich meine Wut als weiteren Beweis dafür nehmen würde, dass wir Karen nicht helfen sollten. »Ganz hervorragend.«
Den ganzen Weg nach oben grüble ich über eine Ausrede nach, um Karen die Schuhe nicht geben zu müssen. Eine, die nicht verrückt wirkt. Eine, die meine Mom okay gefunden hätte. Denn meine Mom würde wollen, dass ich Karen gebe, was auch immer sie braucht. Du kannst das, würde sie sagen, wenn sie hier wäre. Ich weiß, dass du es kannst.
Viel zu schnell steht Karen hinter mir im Schlafzimmer meiner Eltern, während ich erstarrt vor ihrem Kleiderschrank verharre. Wir leihen sie ihr nur, ermahne ich mich, während ich die Tür öffne und mich vor die Seite meiner Mom kauere. Ich schließe die Augen und versuche, nicht ihren Duft einzuatmen, während ich blind nach ihren Schuhen taste. Schließlich landen meine Hände auf etwas, das ich für ein Paar flache Businessschuhe halte, die Mom nur ein- oder zweimal getragen hat. Aber als ich die Augen öffne und sehe, was ich stattdessen herausgezogen habe, wird mir schlecht. Die alten Doc Martens meiner Mom, die sie so liebte, dass sie sie zweimal neu besohlen ließ.
»Ich weiß, Cassie vermisst dich«, sagt Karen, während ich immer noch über die Doc Martens gebeugt kauere wie ein Tier, das seine letzte Mahlzeit verteidigt. »Denn ich weiß immer noch, was sie wirklich fühlt. Selbst wenn sie glaubt, es sei nicht so. Und ich weiß, dass Cassie im Moment völlig verloren ist und eine gute Freundin braucht. Eine Freundin wie dich.«
Karen kommt herüber und kniet sich neben mich. Ich spüre ihren Blick, der von mir zu den Stiefeln geht und wieder zurück. Dann beugt sie sich vor und greift selbst in den Schrank. Kurz darauf zieht sie ein Paar strahlend weiße, brandneue Tennisschuhe heraus. Meine Großmutter – die Mutter meines Dads – hat sie meiner Mom vor Jahren geschenkt, wahrscheinlich gerade