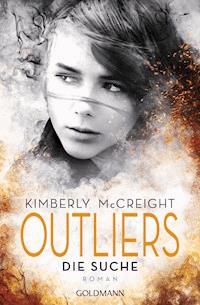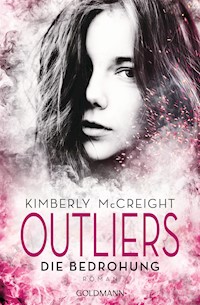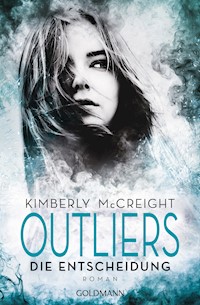
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Outliers-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die sensible Wylie kann der Internierungsanstalt, in der Mädchen wie sie wegen ihrer besonderen Fähigkeit festgehalten werden, entkommen. Sosehr sie auch die dramatischen Ereignisse vergessen will – sie wird erst wirklich in Sicherheit sein, wenn sie herausgefunden hat, wer sie jagt und warum. Mit ihrem Freund Jasper begibt sich Wylie auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit. Dabei wird sie vor eine harte Entscheidung gestellt: Ihre Bestimmung könnte den Tod bedeuten – doch sie ist auch der Schlüssel zur Rettung. Nur Wylie kann die anderen Mädchen vor einem schrecklichen Schicksal bewahren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
Buch
Die sensible Wylie konnte der Internierungsanstalt, in der sie wegen ihrer besonderen Fähigkeit festgehalten wurde, entkommen. Sosehr sie auch die dramatischen Ereignisse der letzten Wochen vergessen will – sie weiß jetzt, dass es noch andere Mädchen gibt, die so sind wie sie. Mädchen, die die Gefühle anderer Menschen lesen können. Mädchen, die Wylie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen kann. Sie muss herausfinden, wer sie jagt und warum. Nur wem kann sie vertrauen? Ihr Vater ist spurlos verschwunden, ihre tot geglaubte Mutter ist wieder aufgetaucht, und von ihrer großen Liebe Jasper muss sie sich fernhalten. Mit ihrem Zwillingsbruder Gideon begibt sich Wylie schließlich auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit. Dabei wird sie vor eine harte Entscheidung gestellt: Ihre Bestimmung könnte den Tod bedeuten – doch sie ist auch der Schlüssel zur Rettung …
Weitere Informationen zu Kimberly McCreight sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Kimberly McCreight
OUTLIERS
Gefährliche Bestimmung
DIEENTSCHEIDUNG
Band 3
Roman
Deutsch von Karen Gerwig
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Collide« bei Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Februar 2019
Copyright © 2018 by Kimberly McCreight
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Catherine Beck
KS · Herstellung: kw
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN: 978-3-641-22168-3V001www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für uns alle, mögen wir mit aller Macht gegen das Erlöschen der Flamme kämpfen.#resist
Widersteht dem Bösen, unterstützt das Gute, investiert in die Zukunft: Dem widmet euch.
CARRIECHAPMANCATT (1859 –1947)
Frauenrechtlerin und Präsidentin der National American Woman Suffrage Association
Dieser Roman ist Fiktion. Was ihr hier lest, ist nie passiert. Zumindest noch nicht.
KIMBERLYMCCREIGHT
Liebe Rachel,
glaub bitte nicht, dass ich Dir nicht dankbar bin für alles, was du getan hast. Man kann einem anderen Menschen wahrscheinlich gar nicht dankbarer sein. Du hast mir das Leben gerettet. Und bis jetzt hattest Du recht damit, dass ich im Untergrund bleiben sollte. Du hattest mit allem recht.
Ich weiß, Du hältst es für eine dumme Idee, Wylie im Jugendgefängnis zu besuchen. In unserem Gespräch hast Du mir alle logischen und vollkommen vernünftigen Gründe dargelegt, warum es gefährlich wäre. Für sie und für mich.
Es ist ein Gefängnis voller Kameras: Das war’s mit dem Totstellen.Ben ist schon verschwunden. Soll ich meine Kinder wirklich als Waisen zurücklassen?Es könnte sein, dass ich Wylie damit noch mehr in Gefahr bringe. Vielleicht versuchen sie, mich als Druckmittel gegen sie zu benutzen.Siehst Du, ich habe sehr wohl zugehört, Rachel. Und ich vertraue Dir wirklich.
Aber ich muss auch meinem eigenen Instinkt vertrauen. Und so gefährlich es ist, mich im Gefängnis blicken zu lassen, ist es noch gefährlicher, es nicht zu tun. Vielleicht bringe ich Wylie und mich damit nicht körperlich in Gefahr. Aber es gibt andere Arten von Schmerz, Rachel. Es gibt noch andere Verletzungen, die man nicht vergessen darf.
Ich war der einzige Mensch, auf den sich Wylie immer verlassen hat. Und ich habe auf die schlimmstmögliche Art gelogen. Wie soll sie mir je wieder vertrauen können? Ich habe solche Angst, dass ich sie jetzt schon für immer verloren habe. So sehr, dass ich manchmal glaube, mir bleibt das Herz stehen. Wenn ich nicht sofort anfange, mich wieder zu ihr durchzukämpfen, glaube ich nicht, dass sie mir je vergeben wird.
Und ich habe hier draußen schon viel verändert. Diese Leute, die Du mir genannt hast, diese Senatorin und diese Freundin von Dir aus der American Civil Liberties Union – sie hatten so gute Vorstellungen davon, was dieser Kampf mit sich bringen wird. Wir müssen vorbereitet sein, daran besteht kein Zweifel.
Aber im Moment muss ich als Allererstes Wylies Mom sein. Das ist das Wichtigste, und sie muss sicher wissen, dass ich lebe. Dafür muss sie mich mit eigenen Augen sehen. Nach allem, was sie durchgemacht hat, ist das die einzige Option. Ich kann sie nicht eine Sekunde länger diesem Schmerz aussetzen. Und nur, damit wir uns auch richtig verstehen: Ich werde auf jeden Fall zu Wylie gehen, mit Deiner Hilfe oder ohne sie. Aber egal, was passiert: Du sollst wissen, wie dankbar ich Dir bin. Und ich bin so froh, dass ich Dich wiederhabe. Ich habe Dich mehr vermisst als Du ahnst.
XX
Hope
Wylie
Ich stehe vor der grauen Tür der Jugendstrafanstalt und warte auf das Summen, wenn sie sich öffnet. In der Hand halte ich eine Plastiktüte mit dem modrigen Cape-Cod-T-Shirt und den Shorts, die ich getragen habe, als ich verhaftet wurde.
In den letzten zwei Wochen habe ich Tag und Nacht den Standardanzug getragen, eine pyjamaartige Kombination aus Shirt und Hose. So steif, dass man meinen könnte, sie wäre absichtlich so gemacht, damit man nie wieder schläft. Was ich jetzt trage, ist das totale Gegenteil. Teure Jeansshorts, an genau den richtigen Stellen abgewetzt, und ein unbeschreiblich weiches, schlichtes graues T-Shirt. Die Kleider hat mir Rachel für den Heimweg gebracht, ohne dass ich danach fragen musste. Und dafür bin ich dankbar. Ich bin Rachel für vieles dankbar.
Angefangen damit, dass sie mich auf Kaution herausgeholt hat. So schwierig war das gar nicht, sagt sie. Trotzdem, sie haben sich solche Mühe gemacht, um mich da reinzubringen – ich hätte nicht gedacht, dass sie mich gehen lassen, nur weil Rachel einen Kautionsantrag stellt. Aber ich habe mich geirrt. Rachel hat sich wieder einmal für mich eingesetzt. Sie sagt aber, es ginge nicht nur um die Papiere, die sie eingereicht hat. Es komme darauf an, wen man anruft, nachdem man sie eingereicht hat, was für mich gleichzeitig total wahr und komplett zwielichtig klingt.
Und ich schreibe es allein Rachel zu, nicht Mom. Ich hole dich hier raus. Versprochen. Xoxo. Das stand auf dem Zettel von meiner Mom. Und auf der anderen Seite: Vertrau Rachel. Sie wird dir helfen. Sie hat mir das Leben gerettet.
Aber das waren nur Worte. Versprechungen machen und dann verschwinden ist leicht. Das Schwierige ist, zu bleiben und sich dem zu stellen, was man getan hat.
Als Rachel mich an dem Morgen besuchte, nachdem Mom wie ein Geist mit dem quietschenden Büchereikarren des Gefängnisses vor mir erschienen war, sah sie verlegen aus. Sie fühlte sich auch schuldig, das konnte ich laut und deutlich lesen. Wir saßen in einem der kleinen Räume für die Treffen mit den Anwälten. Die Räume, die immer nach Zwiebeln rochen und in denen es eiskalt war. Die Räume, in denen man in Wirklichkeit gar nicht unter sich war, wie Rachel mich gewarnt hatte.
Rachels Schuldgefühle löschten alle Zweifel aus. Sie hatte nicht nur gewusst, dass Mom zu mir ins Gefängnis gekommen war – sie hatte auch die ganze Zeit gewusst, dass Mom noch lebte.
Es gab außerdem keine Entschuldigung dafür, dass ich Rachels Täuschung nicht bemerkt hatte. Aber sie war normalerweise wirklich schwer zu lesen; die Schuldgefühle heute waren eine echte Ausnahme. Vielleicht lag es daran, dass sie schon seit vielen Jahren für ihre Mandanten sagen musste, was nötig war. Die einzige echte Konstante bestand darin, dass Rachel nie die ganze Wahrheit sagte. Als wäre es ein Reflex. Ihre wahren Gefühle zu verstehen, das war, als wollte man mit bloßen Händen einen Blitz fangen. Und das machte sie wahrscheinlich zu so einer guten Anwältin. Nur war es dadurch als einfacher Mensch nicht leicht, ihr zu vertrauen. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich ihr auch nie ganz vertraut hatte. Ich hatte nur akzeptiert, es nicht zu tun.
Während ich Rachel also gegenübersaß, wünschte ich mir glühend, sie wäre eine der Outliers, damit sie die volle Wucht meiner Wut spüren konnte. Rachel hatte mich immer wieder angelogen.
Ja, natürlich hatte ich mich gefreut, als ich aufblickte und Mom – meine echte Mom, von den Toten auferstanden – mit so viel Liebe auf mich herabblickte. Auf jeden Fall. Aber einen Tag später mischte sich das mit einem Durcheinander aus anderen Gefühlen: Wut, Traurigkeit, Verwirrung, Verrat.
Aber Mom war nicht hier, ich konnte es nicht an ihr auslassen. Rachel schon. Also musste es genügen, ihr die Hölle heißzumachen.
»Als Erstes muss ich dich daran erinnern aufzupassen, was du hier drin besprichst.« Bevor ich ein Wort sagen konnte, deutete Rachel nach oben zu den unsichtbaren, neugierigen Augen in unserem stinkenden »Privatraum«. »Aber du bist sicher verwirrt.«
»Verwirrt?«, fuhr ich sie an. »Wie wäre es mit echt angepisst?«
Sie nickte erleichtert. Vielleicht war sie froh, dass sie das Geheimnis meiner Mom nicht mehr hüten musste. »Das ist auch berechtigt.«
»Erklär es mir!«, schoss ich zurück und beugte mich vor. Ich drückte mit dem Finger fest auf die Tischplatte. »Sofort!«
Rachel wandte den Blick ab. »Herzukommen war ein echtes Risiko für sie, weißt du? Gefährlich. Aber sie hat es trotzdem getan, denn sie wollte sichergehen, dass du es glaubst. Sie weiß, wie viel du durchgemacht hast, und sie wollte nicht, dass du denkst, ich würde mir das ausdenken oder mir einen Spaß mit dir machen oder so.«
Sorge. Nur ein Blitz, der von Rachel ausgeht. Aber keine Spur von Reue. »Wir haben Glück, dass ich die Freiwilligenbetreuerin hier kenne. Sie hat mir einen Gefallen getan und unsere spezielle Besucherin ehrenamtlich hier arbeiten lassen.«
»Klar.« Meine Wut schwand wie Wasser, das einem durch die Finger rinnt, obwohl ich versuchte, sie festzuhalten. »Was für ein Glück.«
»Pass auf, wenn es dir hilft: Sie wusste nicht, dass es so laufen würde«, erklärte Rachel. Und so weit stimmte es, da war ich mir ziemlich sicher. »Deine …« Sie unterbrach sich, ihr Blick irrte durch den Raum. »Sie ist am Abend des Unfalls aus dem Nichts bei mir zu Hause aufgetaucht. Ich hatte nicht mehr mit ihr gesprochen seit wann – zehn Jahren? Aber sie hatte das Gefühl, verfolgt zu werden, und kam irgendwann in meiner Gegend vorbei. Sie hatte Glück, dass ich nach all der Zeit überhaupt noch dort wohnte. Um ehrlich zu sein, dachte ich erst, sie sei betrunken oder hätte einen psychotischen Schub oder so was. Sie klang so paranoid, fast schon wahnhaft. Aber sie hatte einfach solche Angst. Wie konnte ich das Risiko eingehen, ihr nicht zu helfen? Ich weiß nicht, vielleicht war auch noch ein bisschen Egoismus dabei. Wir haben uns nicht im Guten getrennt, deine Mom und ich. Vielleicht dachte ich, es sei eine Chance zu beweisen, dass sie sich geirrt hatte, was mich anging.«
»Geirrt? Wobei?« Diese Frage schien mir seltsam wichtig zu sein.
»Du weißt, deine … Sie ist ein Racheengel. Und ich habe den Edelmut schon vor Langem aufgegeben.« Rachel zuckte die Achseln.
Noch eine kalte, harte Wahrheit. Rachel schämte sich vielleicht nicht, aber sie war auch nicht stolz darauf.
»Jedenfalls dachte ich, es wäre keine große Sache, jemanden zu bitten, ihr Auto von dort wegzufahren. Das Mädchen in dem Auto war die Freundin eines Mandanten von mir. Ich hatte sie eingestellt, damit sie mein Haus putzte und Besorgungen machte. Ich wusste, dass sie Geld brauchte. Sie war damals seit zwei Monaten trocken und versuchte, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Also brauchte sie Geld, und wir brauchten jemanden, der das Auto wegfährt. Ich dachte, so hätte jeder was davon.«
»Das Mädchen nicht so sehr«, sagte ich und beschloss, die Wodkaflasche nicht zu erwähnen. Vielleicht war das Mädchen doch nicht trocken, aber es kam mir falsch vor, sie jetzt bloßzustellen.
»Ja, nicht besonders«, sagte Rachel. Sie wusste, sie sollte sich schuldig fühlen, schaffte es aber nicht ganz.
»Und nach dem Unfall war es so was wie die einzige logische Alternative, dass sie verschwand und vorgab, tot zu sein?« Ich klang sauer, aber die Trauer folgte sofort. »Zur Polizei zu gehen oder irgendetwas anderes Normales stand gar nicht zur Debatte?«
»Du weißt besser als alle anderen, dass der Polizei zu vertrauen nicht so leicht ist, Wylie. Abgesehen davon hat sie sich große Sorgen um euch gemacht. Da war irgendwas mit Babypuppen. Sie dachte, sie wären als Drohung für euch gemeint, vor allem für ihre Babys.«
»Sie waren nicht mal für sie bestimmt«, sagte ich, obwohl Mom das damals nicht wissen konnte. »Wir haben, nachdem sie fort war, weiter welche bekommen. Ich habe sogar im Krankenhaus eine bekommen. So oder so hat sie aber behauptet, es gäbe wegen der Puppen keinen Grund zur Sorge.«
»Was sollte sie auch sagen? Sollte sie euch allen Todesangst einjagen? Jedenfalls gab es anscheinend auch noch andere Dinge. E-Mails. Anonyme. Darin wurdet ihr ausdrücklich erwähnt. Vor der Polizei gewarnt. Nach dem Unfall waren wir beide überzeugt, die einzige Möglichkeit, euch in Sicherheit zu bringen, sei, die Leute, die hinter ihr her waren, glauben zu lassen, sie sei tot.«
»Toller Plan«, sagte ich besonders abfällig.
»Na ja, jetzt ist klar, dass alles mit der Forschung deines Dads zu tun hatte. Aber erst nachdem dein Dad ihr erzählt hat, was in diesem Camp in Maine mit seinem Assistenten los war …«
»Warte, was?« Meine Brust wurde eng. »Dad wusste, dass sie lebt?« Dieses Gespräch konnte nur im Mai stattgefunden haben, als wir schon lange glaubten, sie sei tot.
»Erst nach der Sache im Camp.« Rachel mied meinen Blick. »Nachdem deine … Nachdem ihr klar wurde, dass ihr Unfall … dass die Drohungen mit seiner Arbeit zusammenhingen, musste sie ihm sagen, dass sie lebte. Dein Dad war nicht glücklich darüber, aber er verstand es dann doch. Sie beschlossen gemeinsam, es sei sicherer, es dir und Gideon nicht zu sagen. Dass sie eine bessere Chance hatte, hinter den Kulissen zu helfen, wenn niemand wusste, dass sie lebte.«
Rachel beugte sich eifrig vor, aber es wirkte gezwungen. »Und sie war im ganzen Land unterwegs, Wylie, hat im Hintergrund Fäden gezogen, Leute getroffen, Wissenschaftler, Journalisten und Politiker angeworben. Sie hat eine Hilfsmannschaft zusammengestellt. Alles zu deinem Schutz.«
»Meinem Schutz?« Ich schluckte mit einem Kloß im Hals und umschloss die Gefängnismauern mit einer Geste. »Das hier soll sicher sein?«
»Du lebst, Wylie«, sagte Rachel. »Oder etwa nicht?«
»Yo, hallo?«, ruft der Wächter mit den langen Haaren zu mir herüber. Ich stehe immer noch am Ausgang. Klingt, als hätte er schon eine ganze Weile auf den Knopf gedrückt. »Willst du hierbleiben? Na los, geh schon!«
Nein, ich will auf keinen Fall eingesperrt bleiben. Ich gebe mir einen Ruck, umklammere meine knittrige Plastiktüte fester. Außer den gammeligen Kleidern befinden sich darin ein Umschlag mit dem, was von Rachels Geld übrig ist (getrocknete, zerknitterte achtzig Dollar), und der Ehering meiner Mutter. Ein Teil von mir möchte den Ring herausfischen und ihn festhalten. Ein Teil von mir will ihn in den nächsten Gulli werfen. Dass Mom ihren gravierten Ring abnahm und zurückließ, war Rachels Idee gewesen. Übertrieben, hat Rachel jetzt zugegeben. Aber sie hat auch früher schon Leuten beim Verschwinden geholfen. Besser auf Nummer sicher gehen.
Endlich trete ich in die morgendliche Julisonne hinaus. Es ist sieben Uhr, eine seltsam frühe Entlassungszeit, und jetzt schon heiß. Ich schirme meine Augen gegen die blendende Sonne ab und sehe mich auf dem Parkplatz um. Die schwüle Luft drückt mir schwer auf die Lunge. Seit ich verhaftet wurde, waren meine Ängste erbarmungslos. Als hätte man mir einen Betonklotz auf die Brust geschnallt, der mich langsam erdrückte. Dr. Shepard sagte, das sei zu erwarten gewesen – der Stress des Gefängnisaufenthaltes, die Klaustrophobie.
Nur dass es jetzt, wo ich draußen bin, nicht viel besser zu werden scheint. Ich muss weiter in Bewegung bleiben. Bei mir hilft immer die Bewegung nach vorn; das ist das einzig Gute, was ich aus dem Grauen des Camps in Maine gelernt habe.
Erst als ich losgehe, sehe ich ihn endlich; er lehnt an der Motorhaube des Autos am anderen Ende des Parkplatzes. Als wäre er lieber nicht hier. Er drückt sich ab und winkt, lächelt viel zu breit.
Gideon.
Selbst aus dieser Entfernung spüre ich seine Schuldgefühle. Je länger Dad verschwunden ist, desto mehr gibt sich Gideon die Schuld. In letzter Zeit besteht Gideon nur noch aus Schuldgefühlen.
Ich habe ihm gesagt, dass er sich für viel zu viel selbst verantwortlich macht. Die Liste der Outliers, die Gideon Dr. Cornelius gegeben hat, mag diesem leichteren Zugang zu einer größeren Gruppe von Outliers verschafft haben, aber ich war diejenige, die Dad darin bestärkt hat, nach D.C. zu fliegen, wo er von Gott weiß wem entführt wurde. Jemand, der für Quentin arbeitet, nehme ich immer noch an. Auch wenn Quentin ehrlich entsetzt wirkte, als ich ihm an dem Tag, als er mit seiner Baseballmütze im Gefängnis aufgetaucht ist, von Dad erzählte. Aber wer sonst? Senator Russo? Klar, Dad sollte sich mit ihm treffen, aber Rachel hat die Polizei von D.C. gezwungen, ihn in alle Richtungen unter die Lupe zu nehmen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie je ein Treffen geplant hatten, und es gibt massenhaft Papiere, die schwarz auf weiß beweisen, dass Russo zu der Zeit in Arizona war.
Und ich bin vielleicht immer noch überzeugt, dass Russo etwas richtig Schlimmes getan hat, aber nicht mal ich glaube, dass er meinen Dad entführt hat. Und bisher konnte auch niemand die Frau auftreiben, die angeblich Dads Handy hatte. Jetzt ist es ausgeschaltet oder zerstört. So oder so können sie es nicht aufspüren. Womit nur noch ein einziger Hinweis darauf bleibt, was passiert ist, nämlich ein Video einer Sicherheitskamera, auf dem er zu sehen ist, wie er den Flughafen mit jemandem verlässt und in einen schwarzen Kombi steigt. Ich habe das Video nicht gesehen, aber Rachel. Sie sagt, Dad sieht darauf aus, als würde er »normal« gehen, also freiwillig. Andererseits hat er auch erwartet, von jemandem aus Russos Büro abgeholt zu werden. Es überrascht also nicht, dass er mitging, wer auch immer das war.
Der Mann – wir nehmen an, es ist ein Mann – ist nur von hinten zu sehen. Eher klein und mit Kapuze. Mehr kann Rachel nicht sagen. Im Grunde könnte es jeder sein. Sogar Quentin. In meinem Kopf führen immer noch alle Wege zu ihm.
Ich habe Rachel versprochen, dass ich Gideon das von Mom erzählen würde. Aber jetzt, da er hier auf der anderen Seite des Parkplatzes steht, wünsche ich mir, ich hätte mich geweigert. Denn ich weiß, wie weh es tut, dass sie gelogen hat. Ich war in letzter Zeit oft sauer auf Gideon, aber diesen Schmerz wünsche ich ihm nicht. Ich wünsche ihn niemandem.
Gideon macht ein paar Schritte auf mich zu und winkt wieder. Als ich über den Parkplatz auf ihn zugehe, rauscht ein weißer Kastenwagen vor mir vorbei. So dicht, dass ich zurückzucke. Ich sehe zu, wie der Van hart vor dem Tor der Strafanstalt bremst. Das Tor schwingt auf, und er rast hinein. Der Wächter hatte recht – worauf warte ich noch? Während man Zeit vergeudet, passieren schreckliche Dinge.
»Hi«, sagt Gideon, als ich endlich bei ihm ankomme. Er deutet auf meine Tüte. »Brauchst du Hilfe?«
Das ist lieb. Aber wenn Gideon lieb ist, kommt mir die Welt unsicher und verkehrt vor.
Selbst ein nicht lieber Gideon wäre im Moment nicht meine erste Wahl. Mir wäre Jasper lieber gewesen. Dann könnte ich ihn endlich in die Arme nehmen, wie ich es schon seit zwei Tagen tun möchte. Aber meine Freilassung kam so plötzlich. Erst gestern, nachdem Jasper den Besucherraum verlassen hatte, haben sie mir gesagt, dass Kaution für mich hinterlegt wurde. Und als ich Jasper heute auf dem Handy anrufen wollte, kam nur die Ansage: Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht erreichbar. Ich versuche, mir keine Sorgen zu machen. Jasper hat wahrscheinlich nur vergessen, die Rechnung zu bezahlen, rede ich mir ein. Aber jedes Mal glaube ich es ein bisschen weniger.
»Geht schon«, sage ich zu Gideon, während ich um das Auto unseres Vaters herumgehe. »Aber danke«, füge ich in der Hoffnung hinzu, dass er aufhört, mich anzusehen, als wäre ich das Einzige, was ihn vorm Ertrinken retten kann.
»Wohin?«, fragt Gideon, als wir im Auto sitzen, und versucht dabei, fröhlich zu klingen, ungezwungen. »Willst du was frühstücken oder so? Das Essen da drin ist bestimmt furchtbar.«
»Ähm, vielleicht später«, antworte ich. Ich sollte Gideon sofort von Mom erzählen. Es hinter mich bringen. Stattdessen blicke ich nur aus dem Fenster. »Fahren wir. So weit weg von hier wie möglich.«
Ich kann es ihm einfach nicht sagen. Noch nicht.
Gideon hat seinen Führerschein ganz neu. Und wie sich herausstellt, ist er ein echt schlechter Fahrer. Nervös und langsam, aber dann plötzlich wieder zu schnell. Nicht dass ich mir ein Urteil erlauben sollte. Gideon hat sich hinters Steuer gewagt, das kann ich von mir nicht behaupten. Aber als er schließlich ruckartig vom Parkplatz des Gefängnisses fährt, werde ich im Sitz nach hinten geworfen. Mir ist jetzt schon schlecht.
»Sorry«, sagt er und steigt hart auf die Bremse. »Ich hab’s immer noch nicht so ganz raus.«
Ich nicke und drehe mich wieder zum Fenster, sehe zu, wie die heruntergekommenen Einkaufszentren und mit Brettern zugenagelten Fast-Food-Restaurants vorbeiziehen. Die Gegend um die Jugendstrafanstalt ist hässlich und trostlos. Ich müsste mich eigentlich besser fühlen, jetzt, da ich sie hinter mir lasse. Stattdessen verstärkt sich meine Angst. Als wüsste ich schon, dass das, was vor uns liegt, schlimmer ist als das hinter mir. Denn dieses Gefühl ist nicht nur meine Angststörung. An einem von den guten Tagen habe ich gelernt, den Unterschied zu erkennen.
Gideon und ich fahren zwanzig Minuten vor uns hin, tauschen harmlose Bemerkungen zwischen langen Episoden des Schweigens aus. Wie war deine Zellennachbarin? Sehr nett. Wie ist das Essen? Sehr schlecht. Hat jemand versucht, dich zu verprügeln? Nein.
Jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache und ihm nicht sage, dass Mom noch lebt, fühle ich mich mehr wie eine Lügnerin.
Als wir endlich ins Stadtzentrum von Newton fahren, bin ich erleichtert. Es sieht genauso aus wie vorher, kommt mir aber seltsam fremd vor. Erst als wir noch einmal rechts abgebogen sind, wird mir klar, dass wir in Cassies Straße sind. Und weiter vorn steht es: Cassies Haus mit seinem spitzen Dach, wie ein Lebkuchenhaus, und der wie von Eis überzogenen Fassade, malerisch wie eh und je. Ich fühle den Moment, als Gideon sein Fehler bewusst wird. Er mag kein Outlier sein, aber er ist auch kein Idiot.
»Oh, ähm, ich … Mist.« Er tritt so hart auf die Bremse, dass ich mich am Armaturenbrett abstützen muss. »Tut mir leid, ich hab nicht nachgedacht. Ich kann einfach umdrehen, wenn du …«
»Nein.« Und sogar ich bin überrascht, wie nachdrücklich das klingt. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. »Ich bin nicht, ähm, ich war seit ihrer Beerdigung nicht mehr hier. Ich weiß nicht … Irgendwie will ich ihr Haus sehen.«
Wollen ist das falsche Wort. Müssen trifft es besser. Fast schon zwanghaft. Ich habe das Gefühl, als läge in der Vergangenheit – in Cassies Vergangenheit, in unserer – so etwas wie eine grundlegende Wahrheit verborgen. Als könnten wir uns nur aus dieser schrecklichen Dauerschleife des Kummers befreien, wenn wir uns wieder an den Anfang zwingen.
»Kannst du dort anhalten, nur kurz?« Ich zeige auf den Straßenrand.
»Ehrlich?«, fragt Gideon und umklammert das Lenkrad noch fester, darübergebeugt wie ein alter Mann. Er ist mit dem Fahren schon völlig überfordert, ganz zu schweigen davon, auch noch mit mir zurechtkommen zu müssen. »Bist du sicher?«
»Ja, ich bin sicher«, lüge ich. Zum Glück kann Gideon das nicht wissen. »Bitte, nur eine Minute.«
Schließlich bleibt Gideon ruckartig am Straßenrand stehen. Das Haus sieht aus wie immer. Seit Cassies Beerdigung sind erst zwei Monate vergangen, trotzdem habe ich mehr Verfall erwartet. Vielleicht musste ich deshalb hier halten: um mich zu erinnern, dass die Welt weiterrast, egal, wie viele von uns in ihren Sog geraten.
Nein, das ist es nicht. Das klingt gut, aber deshalb bin ich nicht hier. Es ist etwas anderes. Etwas Spezifischeres. Cassies Haus. Cassies Haus. Warum?
Cassies Tagebuch vielleicht? Das könnte sein. Jasper und ich haben nie herausgefunden, wer ihm diese Seiten geschickt hat.
»Wen interessiert’s, wer sie geschickt hat?«, fragte Jasper.
Wir saßen einander gegenüber im Besucherraum der Jugendstrafanstalt. Tag dreizehn meiner Inhaftierung, Tag dreizehn, an dem Jasper mich treu besuchen kam. Er saß, wie er es immer tat, die Hände unter die Oberschenkel geschoben, auf dem harten Plastikstuhl. Damit er nicht aus Versehen versuchte, meine Hand halten zu wollen. Er hatte es einmal vergessen und hätte fast Besuchsverbot bekommen. Keine Berührungen. Kein Austausch von Gegenständen. Hemd und Schuhe verpflichtend. Es gab nicht viele Regeln. Aber die wenigen wurden durchgesetzt.
»Mich interessiert, wer sie geschickt hat«, erwiderte ich. »Es nicht zu wissen macht mich nervös. Dich sollte es auch nervös machen.«
»Nervös?«, fragte Jasper.
Ich suchte nach einem Unterton in seiner Stimme. Dich macht doch immer alles nervös. Aber so meinte er es nicht. Jasper hielt nichts von Subtext. Das war eines der Dinge, die ich an ihm liebte.
Ja, liebte. Ich hatte es ihm noch nicht gesagt. Es war eher so eine Idee, die ich mal anprobierte. Aber bisher passte sie. Viel besser, als ich gedacht hätte. Und ich wartete ständig darauf, dass ich mich deswegen dumm fühlte, als hätte man mich in etwas hineinmanipuliert. Aber es fühlte sich an, als wäre ich mit Vertrauen dorthin gelangt.
»Wir sollten zumindest nachforschen«, sagte ich.
»Es war Maia. Darauf haben wir uns doch geeinigt.«
»Du hast dich geeinigt«, sagte ich. »Ich will eine Bestätigung.«
»Warte, du bist doch nicht eifersüchtig, oder?«, neckte mich Jasper. Ich warf ihm einen finsteren Blick zu, und er hob beschwichtigend die Hände. »Sorry, schlechter Witz.«
Und dann wurde er rot, also richtig, was irgendwie altmodisch war. Andererseits hatte unser zweiwöchiges Gefängnis-Liebeswerben auch nur aus unschuldiger Konversation und Hände bei sich behalten bestanden, und das in sechsundzwanzigminütigen überwachten Abschnitten. In Wahrheit kannten wir uns – trotz allem, was wir zusammen durchgemacht hatten – nicht so gut. Aber während wir uns einander langsam öffneten, passte alles immer besser.
Wie sich herausstellte, war Jasper albern. Viel mehr, als mir klar gewesen war. Und darunter so schonungslos und herzzerreißend sensibel. Er erzählte viel von seinem Dad und was es hieß, Angst zu haben, selbst Eigenschaften zu entwickeln, die man so sehr hasst. Er benutzte diese Angst, um zu erklären, dass er in gewisser Weise meine Ängste verstand. Irgendwie. Und ich kapierte den Zusammenhang nicht. Aber ich liebte Jasper, weil er versuchte, einen herzustellen.
»Ich muss Maia sagen hören, dass sie es war, die die Tagebuchseiten geschickt hat, bevor ich es glaube«, sagte ich. »Sonst verfolgt mich das noch ewig.«
Jaspers Gesicht wurde weich. »Willst du, dass ich Maia frage?« Es war ein Pro-forma-Angebot.
Ich nickte trotzdem. »Ja, bitte.«
Jasper holte Luft und schloss die Augen. »Okay«, sagte er gedehnt. »Aber nur, weil ich …« Wieder schoss ihm die Röte in die Wangen. Er wartete kurz, bevor er zu mir aufblickte. »Für dich tue ich es. Aber nur für dich.«
Aber jetzt, da ich hier sitze und zu Cassies Haus hinaufstarre, geht mir auf, dass es dumm ist, Maia zu fragen. Sie wird es nur abstreiten. Vielleicht wollte ich deshalb hier haltmachen, um Cassies Mom Karen zu fragen. Sie kann uns sagen, ob Maia je mit dem Tagebuch in Cassies Zimmer allein war. Möglicherweise weiß sie sogar noch mehr.
»Ich muss Karen kurz was fragen«, sage ich, löse den Sicherheitsgurt und öffne die Autotür. »Ich bin gleich wieder da.«
»Echt jetzt?«, fragt Gideon, aber ich bin schon halb zur Tür hinaus. »Puh, dann komme ich mit.«
Erst auf dem Weg zum Haus bemerke ich das Unkraut zwischen den Steinplatten. Das Haus verfällt mehr, als mir klar war. Karen vermutlich auch.
»Kann ich euch helfen?«, ruft eine Frau aus dem Nachbargarten herüber, noch bevor wir an der Tür ankommen. Ihre Stimme ist scharf, abweisend.
Als ich mich umdrehe, sehe ich Mrs Dominic, Cassies missmutige grauhaarige Nachbarin, in einem lindgrünen Jogginganzug, eine Einkaufstüte in der rechten Hand, auch wenn es mir extrem früh vorkommt, dass jemand jetzt schon vom Einkaufen zurückkommt. Cassie mochte Mrs Dominic nie. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde gleich herausfinden, warum.
»Wir wollen zu Karen«, sagt Gideon, als ich stumm bleibe.
Mrs Dominic starrt uns noch eindringlicher an, ihr Blick wandert an uns auf und ab. Wir führen nichts Gutes im Schilde. Das ist beschlossene Sache. Sie kommt zwei Schritte näher, jetzt steht sie fast auf Cassies Rasen. Aber nicht ganz.
»Warum?«, fragt sie.
In meinem Magen rumort es eiskalt – meine eigenen Ängste. Doch dann folgt diese inzwischen schon vertraute kratzige Outlier-Hitze. Die dreht sich nur um Mrs Dominic. Sie ist zu verärgert über uns, zu neugierig. Ganz falsch. Ich möchte ihr gar nichts sagen. Und was geht es sie überhaupt an?
Ich lächle gezwungen. »Danke«, sage ich fest. »Aber wir kommen schon zurecht.«
Als hätte sie ihre Hilfe angeboten, nicht ihr Misstrauen.
»Tja, Karen ist sowieso nicht da. Da ist niemand«, freut sich Mrs Dominic, dass sie uns enttäuschen kann. »Sie ist weggegangen.«
»Wohin weggegangen?«, frage ich viel zu bestürzt, das weiß ich.
Mrs Dominic wippt auf den Fersen. »Das kann ich leider nicht sagen.«
Nicht können bedeutet eindeutig nicht wollen.
»Nach dem, was diese arme Frau durchgemacht hat, ist es keine Überraschung, dass sie nicht hierbleiben konnte. Ihr könntet mir eure Adresse geben, dann gebe ich sie weiter, wenn sie zurückkommt.«
Das ist ein Vorwand, um an unsere Namen heranzukommen. Sie hat nicht vor, irgendetwas weiterzugeben. Ich muss ihr zugutehalten, dass sie ziemlich überzeugend ist. Oder es zumindest für alle anderen wäre.
»Ist schon in Ordnung.« Ich ziehe Gideon am Arm mit. »Wir wollten gerade gehen.«
EndOfDays-Blog
5. November
Das Entscheidende ist: Wir müssen alle bereit sein, wenn wir aufgefordert werden, das Richtige zu tun. Was auch immer es uns persönlich kosten mag. Die Liebe des Herrn fordert Opfer. So zeigen wir, dass wir treue Diener einer höheren Macht sind.
Wenn wir das Gute sehen wollen, das folgt, wenn wir in unserem eigenen Leben treu sind, müssen wir zu Opfern bereit sein. So können wir zeigen, dass wir all dessen würdig sind, was für uns geopfert wurde. Und eines dürfen wir nicht zulassen: eine Welt, die auf Kosten unschuldiger Leben auf die nächste wissenschaftliche Erkenntnis zurast.
Wir müssen bereit sein, uns solchen Kräften in den Weg zu stellen. Wir müssen bereit sein, rechtschaffen für die Unschuldigen und Schwachen zu kämpfen. Koste es, was es wolle.
Gehet hin in Frieden, alle miteinander. Ins Licht.
Riel
Riel liegt in Leos schmalem Bett. Die Augen hat sie in der Dunkelheit weit geöffnet. Der schlafgestörte Leo besitzt Superjalousien, die den Raum stockfinster machen, obwohl es fast acht Uhr morgens ist. Während Leo im Schlaf schwer atmet, versucht Riel, sich den Nachthimmel voller Sterne vorzustellen. Lilablaue Schwärze und winzige Lichtpunkte. Wie Glitzer. Ihre Schwester Kelsey liebte so einen Scheiß. Zu den Sternen hinaufzublicken. So zu tun, als wären sie da, auch wenn sie es nicht waren. Aber Riel sieht nur Schwärze. Das war schon immer so.
Riel dreht sich herum, schmiegt sich enger an Leo. Hofft, dass sein gleichmäßiges Atmen sie wieder einschlafen lässt. Aber dazu wird es nicht kommen. Das tut es nie.
Nachdem ihre Eltern gestorben waren, hat Kelsey einmal draußen in der Eiseskälte geschlafen, nur damit sie sich »ihnen nahe fühlen« konnte. Den Sternen? Ihren Eltern? Riel hat nicht gefragt. Kelseys Erklärungen machten immer alles nur noch schlimmer.
Trotzdem war Kelsey eine alte Seele, ein sensibler Geist. Eine Künstlerin, der von Geburt an das dicke Fell fehlte. Und nicht nur, weil sie Outlier war. Riel ist auch eine, aber sie war schon immer eisenhart. Sie würde einen beschissenen atomaren Winter überleben, sogar wenn sie versuchen würde zu sterben.
Riel war achtzehn und neu in Harvard, Kelsey erst sechzehn, als ihre Eltern im letzten November starben. Von einer Sturzflut weggeschwemmt, während sie provisorische Behausungen in Arkansas bauten. Denn solche Menschen waren sie. Gute Menschen. Menschen, die dabei starben, dass sie das Richtige taten.
Etwas Gutes hat Riel auch mit Level99 bewirken wollen. Und vielleicht tat sie das sogar auch, bis Quentin im April daherkam, nur wenige Wochen nach Kelseys Tod. Riel war immer noch am Boden zerstört von ihrer Trauer, und Quentin klang absichtlich so, als könnte Kelsey noch leben, wenn da nicht ein ehrgeiziger Mistkerl gewesen wäre: Dr. Ben Lang. Dr. Lang interessierte sich nur dafür, dass ihn seine Neuentdeckung – diese Outliers – reich machten. Und so beschloss Riel, dass nur noch eines zählte: dass er bezahlte. Natürlich war ihr von Anfang an klar, dass Quentin ein Arsch war. Ein Narzisst, dem man nicht vertrauen konnte. Aber das war ihr weniger wichtig, als dafür zu sorgen, dass Dr. Lang bekam, was er verdiente.
Tief in ihrem Inneren wusste sie auch, dass Kelsey von Anfang an verloren gewesen war, unabhängig von Dr. Lang. Dass es rein gar nichts geändert hatte zu wissen, dass sie Outlier war. Vielleicht wurde das Leben dadurch nicht leichter, aber es war auch nicht ihr Hauptproblem. Kelsey hatte schon lange vor dem Tod ihrer Eltern angefangen zu trinken. Riel hatte sie darüber sprechen hören, Kelsey Hilfe zu besorgen. Aber dann waren sie tot. Mit den Drogen fing sie erst nach ihrer Beerdigung an. Gras, dann Pillen. Mit Kelsey ging es bergab wie auf einem beschissenen Schlitten.
Riel hatte noch versucht, sie abzufangen, aber sie war schon weg.
»Warte, mit wem gehst du?«, fragte Riel an diesem letzten Abend, als Kelsey in ihrem immer noch mädchenhaften Zimmer – rosa Wände, Poster von Boybands – herumrannte und sich anzog. Es war März, ein halbes Jahr nach dem Tod ihrer Eltern. Zum ersten Mal wirkte Kelsey glücklich, ohne völlig high zu sein.
»Mit meiner Freundin«, antwortete Kelsey, während sie an ihren tollen dunklen Locken herumfummelte. Sie war schön, aber auf eine weiche, elegante Art. Riel war auch schön, aber anders.
»Was für eine Freundin?«
»Du weißt schon, die ich im Museum kennengelernt habe. Grace-Ann.«
»Grace-Ann. Stimmt. Bist du sicher, dass sie überhaupt so heißt?«
»Warum sollte sie nicht so heißen?«, fragte Kelsey mit einem Auflachen.
»Ich weiß nicht. Er klingt erfunden. Wie aus Unsere kleine Farm oder so. Und die Party von dieser Grace-Ann ist irgendwo im Nirgendwo?« Riel hatte kein gutes Gefühl bei dieser Party. Sogar ein ganz schlechtes. Und auch, was diese Grace-Ann betraf, schon vom ersten Mal an, als Kelsey sie erwähnt hatte. »Du wohnst zehn Minuten vom Bostoner Zentrum entfernt. Geh dort aus.«
»Es ist ihre Party, und da wohnt sie eben. In einer Wohngruppe übrigens. Weil sie auch ihre Eltern verloren hat. Sie sind abgehauen, nicht gestorben, aber es kommt aufs selbe raus.« Kelsey hielt inne und drehte sich zu Riel um. Traurigkeit wallte in ihr auf, Riel fühlte es. »Das haben wir beide gemeinsam, deshalb geht es mir ein bisschen besser. Okay? Abgesehen davon klingt es lustig. Die Party findet in einem alten Forschungslabor statt. Nichts Illegales. Nur Spaß. Sonst gibt’s ja nicht mehr viel Spaß.«
Mit Grace-Ann hatte Kelsey auch den Großteil des Winters verbracht, sie hatten sich auf dem Gelände der nahe gelegenen Unis herumgetrieben und nach Jungs Ausschau gehalten. Einmal waren sie in irgendeinen Psychotest gestolpert und hatten von den zwanzig Mäusen, die sie dafür bekommen hatten, Bier gekauft. Riel war froh, dass es nicht Harvard war. So kannte sie die Jungs, mit denen sie dieses Bier geteilt hatten, wenigstens nicht. Trotzdem: so viele Risiken. Zu viele.
»Nein«, sagte Riel. »Du gehst nicht hin.«
»Nein?« Kelsey lachte.
»Nein«, wiederholte Riel und verschränkte die Arme. »Ich habe kein gutes Gefühl. Du darfst nicht gehen.«
Kelsey lachte nur noch mehr. »Hör mal, ich hab dich lieb, Rie-Rie«, sagte sie. »Aber mal im Ernst, wie willst du mich aufhalten?« Sie kam rüber, um Riel zu umarmen. »Mach dir keine Sorgen, ich passe auf. Versprochen.«
Denn so war es: Riel war verantwortlich, obwohl sie nicht verantwortlich war. Sie konnte nicht mehr tun, als am Straßenrand zu stehen und lautlos zu schreien: Pass auf dich auf!, während sich ihre Schwester in den Verkehr stürzte.
Am nächsten Morgen war Kelseys Bett leer und unberührt. Erst als Riel das ganze Haus durchsuchte und dabei unaufhörlich dachte: Ich hätte sie aufhalten können, ich hätte sie aufhalten müssen, ich hätte sie aufhalten können, sah sie schließlich aus dem Fenster. Und entdeckte etwas. In der Einfahrt.
Riel rannte hinaus, mit hämmerndem Herzen und zitternd. Wählte schon den Notruf auf ihrem Handy, das sie umklammerte. Aber als sie endlich bei Kelsey ankam, die mit ausgebreiteten Gliedern dort lag, sah sie, dass es viel zu spät für Hilfe war. Ihre Schwester war steif und blau. Schon seit Stunden tot. Hier hingeworfen, sicher von Grace-Ann, irgendeinem Mädchen ohne Eltern und Gesicht und vielleicht mit einem erfundenen Namen. Irgendein Mädchen, das Riel nicht finden und beschuldigen konnte.
Und so musste am Ende Dr. Lang herhalten.
Wylie behauptete, jemand hätte diesen Psychotest in ihre und Kelseys Ausgabe von 1984 geschrieben. Aber dieser Jemand war nicht Kelsey gewesen. Sie hatte damals nicht wissen können, dass der Test etwas mit den Outliers zu tun hatte. Es war ihr nur um die Jungs und die zwanzig Mäuse, das Bier und diese furchtbare Scheißfreundin gegangen. Das war sicher diese »falsche Kelsey«, die Wylie kennengelernt hatte.
Endlich rührt sich Leo. Ohne es zu merken, hat Riel ihn zu fest gedrückt.
»Mach die Augen zu«, flüstert er. Obwohl sie hinter ihm liegt, weiß er es. »Versuch, noch mal zu schlafen.«
Leo fragt nicht, was los ist. Das tut er nie. Er stellt keine Fragen. Erwartet keine Antworten. Deshalb bleibt Riel. Deshalb und weil sie Leo liebt. Eines Tages wird sie es ihm vielleicht sogar sagen. Andererseits hat sie einen unfairen Vorteil: Sie kann schon fühlen, dass Leo sie liebt.
Sie starrt auf Leos Rücken. »Ich bin schon zu lange wach.«
»Ich könnte dir Tee machen.«
Ihr Dad hätte Leo und seinen Tee gemocht. Ihre Mom hätte seine Treue zu schätzen gewusst. Ich muss immer an Kelsey denken. Das ist die Wahrheit, aber Riel sagt es nicht. Wenn sie es täte, müsste sie vielleicht weinen. Und wenn sie einmal anfängt, wird sie nie wieder aufhören. Scheiße. Es entgleitet ihr.
»Ich werde verfolgt«, sagt Riel schließlich. Darüber denkt sie eigentlich gar nicht nach. Aber vielleicht sollte sie es. Es ist auf jeden Fall eine gute Ablenkung von Kelsey.
»Was?«, fragt Leo und klingt jetzt besorgter, als sie erwartet hat. Er stemmt sich im Bett hoch und dreht sich zu ihr um. Riel wünscht sich, sie hätte nichts gesagt. »Wer verfolgt dich?«
»Ich weiß es nicht.«
Doch sie hat so einen Verdacht. Die Agenten, die im Haus ihres Großvaters aufgetaucht sind.
»Wir müssen unbedingt Wylie Lang finden«, verkündete Agent Klute, als Riel endlich zur Haustür ihres Großvaters auf Cape Cod zurückgekehrt war. Bis dahin waren Wylie und Jasper schon in der Dunkelheit verschwunden und in Sicherheit.
Und Klute war total sauer. Riel fühlte, wie gern er ihr den großspurigen Blick aus dem Gesicht geschlagen hätte. Also bat sie ihn besonders freundlich herein. Nur um ihn zu nerven.
»Ach, kommen Sie doch herein und sehen Sie selbst nach«, sagte sie mit einer huldvollen Handbewegung. »Sie ist nicht hier. Und ich habe nichts zu verbergen.«
Klute rührte sich aber nicht – nichts warf die Leute so gut aus der Bahn, als wenn sie bekamen, was sie wollten.
»Ähm«, sagte Riel. »Kommen Sie nun rein oder nicht?«
»Ja, wir kommen rein«, entschied sich Klute doch noch, winkte sie zur Seite und trat durch die Tür.
»Wie gesagt, Wylie ist nicht hier«, sagte Riel, als Klute und sein Partner schließlich im ganzen Haus herumgetrampelt waren. »Ihr Dad, Dr. Lang, ist in D.C. verschwunden. Wahrscheinlich ist sie dort, um ihn zu suchen. Vielleicht läuft sie dort sogar Opa über den Weg?«
Agent Klute sah nicht zu Riel herüber, aber sie fühlte das winzige Zucken, als sie Dr. Lang erwähnte. Es war unverkennbar. Es gab eine Verbindung zwischen Dr. Lang und ihrem Großvater, kein Zweifel. Sie waren vielleicht Jaspers Handy gefolgt, aber das war nicht der einzige Grund, warum diese Agenten im Haus ihres Großvaters waren. Bei Weitem nicht.
Stunden später, nachdem die Agenten das Haus und das Grundstück gründlich durchsucht hatten, einmal und dann noch einmal, und nachdem sie alle möglichen Fragen auf mindestens drei verschiedene Arten gestellt hatten, ließen sie Riel und Leo endlich gehen. Oder um genauer zu sein: Sie warfen sie aus dem Haus von Riels Großvater.
Agent Klute kam Riels Gesicht ganz nahe, als sie hinausging. »Und halte dich von Wylie Lang fern«, knurrte er. »Halte dich aus der ganzen Sache heraus.«
»Was für einer Sache?«, fragte Riel verächtlich. Gewalt. Eine Welle der Gewalt ging von Agent Klute aus. So stark, dass Riel beinahe der Atem stockte. »Wenn Sie vielleicht erklären könnten …«
Da packte Klute sie am Arm und zog sie mit einem Ruck an sich; der unerwartet auflodernde Schmerz ließ Riel fast aufschreien.
»Halt dich fern. Von allem. Vor allem von Wylie Lang«, wiederholte Agent Klute mit zusammengebissenen Zähnen. Dann zeigte er auf Leo. »Wenn nicht, wird er dafür bezahlen. Dafür sorge ich höchstpersönlich.«
»Wer verfolgt dich?«, fragt Leo. »Was meinst du damit?«
Riel wollte Leo keine Angst machen. Jetzt tut es ihr leid, dass sie es ihm gesagt hat. »Ich meine, nicht ständig. Es ist keine Armee oder so was. Aber ab und zu, wenn ich draußen bin, merke ich, dass mich jemand beobachtet. Vielleicht. Ich habe den Arsch Klute zum Glück nicht noch mal gesehen. Aber ich glaube, ich habe den weißen Van gesehen, mit dem sie bei meinem Großvater waren.«
»Aber Wylie ist im Gefängnis, und du hast nicht mit ihr gesprochen«, sagt Leo. »Wie viel weiter sollst du dich denn noch von ihr fernhalten?«
Riel zuckt die Schultern. »Es geht nicht nur um Wylie.«
»Aber du hast dich doch in den Rest auch nicht mehr eingemischt, oder?«, fragt Leo.
»Ich war nicht mehr bei Level99, seit wir bei meinem Großvater waren. Das weißt du doch«, sagt Riel. »Ich verlasse ja kaum dein Zimmer.«
»Gut.« Leo legt sich wieder hin. Atmet aus, als wäre er erleichtert. Ist er aber nicht. »Irgendwann verlieren sie das Interesse daran, oder?«
»Ich hoffe es«, sagt Riel. »Denn so langsam habe ich das Gefühl, mir gehen die Verstecke aus.«
Als Riel wieder aufwacht, ist es neun Uhr morgens. Die Rollos sind hochgezogen, und Leos kleines Wohnheimzimmer ist lichterfüllt, der schmale Streifen Bett neben ihr leer. Riel streicht mit der Hand über das kühle, knittrige Laken. Leo hat Harvard-Sommerkurse und ein Praktikum. Das ist der einzige Grund, warum er im Moment überhaupt ein Wohnheimzimmer hat. Ein winziges Einzelzimmer – Schreibtisch, Bett, das war’s. Übernachtungsbesuch, ganz zu schweigen von Mitbewohnern, ist gegen die Regeln. Aber Leo hat darauf bestanden, dass Riel blieb. Sie konnte kaum etwas dagegen sagen, schließlich konnte sie sonst nirgendwohin.
Vorher hat Riel seit Kelseys Tod im März im Haus von Level99 geschlafen. Aber es ist gefährlich für Level99, wenn sie jetzt dort ist. Sie will nicht, dass Agent Klute sie sucht und die anderen findet. Außerdem kann sie vielleicht auch einfach eine Pause gebrauchen. Von allem. Leos Zimmer scheint ihr ein sicheres Versteck zu sein.
Riel nimmt ihr neues Wegwerfhandy vom Nachttisch. In letzter Zeit wechselt sie ihr Handy wöchentlich. Die Einzigen, die die Nummer haben, sind Leo und Level99. Sie hat eine Nachricht bekommen. Vielleicht ist sie davon aufgewacht. Ein »?«, sonst nichts. Es ist von Brian. Es bedeutet: Kommst du heute? Brian fragt jeden Tag nach. Er will natürlich nicht, dass Riel wirklich kommt. Er ist gern der Anführer von Level99. Er lässt sich nur gern bestätigen, dass er es weiterhin ist.
Riel erinnert Brian ständig daran, dass sie zurückkommt, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Dass er nur vorübergehend der Anführer ist und nur um Level99 zu schützen – auch wenn es für Riel im Moment komplizierter ist. Vielleicht weiß Brian sogar, dass sie hin- und hergerissen ist. Immer wieder taucht jemand in Riels Online-Leben auf. Das hat sie bemerkt. Sicher Brian, der nach ihr sieht. Ist auch in Ordnung, das ist jetzt schließlich seine Aufgabe: Level99 zu schützen.
Aber was ist dann Riels Aufgabe? Sich selbst zu schützen? Wylie? Die Outliers? Sie weiß es nicht mehr, und dadurch fühlt sie sich verlorener, als sie zugeben möchte.
»Mein Dad ist bei deinem Großvater.« Das hat Wylie an dem Abend gesagt, bevor sie ins Wasser tauchte. Und dann war da dieses schuldbewusste Zucken von Agent Klute, als Riel die Spur verfolgte. Ihr Großvater. Er ist ein Arschloch, das ist klar. Aber wie und warum sollte er mit den Outliers und Dr. Ben Lang zu tun haben? Das ergibt keinen Sinn.
Und wenn doch, wie, verdammt noch mal, konnte sie das nicht bemerken? Und das als Outlier?
Das ist das Problem, oder? Lesen ist keine übersinnliche Wahrnehmung. Es ist keine Kristallkugel. Gefühle und Instinkt sind schwer greifbar. Undeutlich. Sie ändern sich. Verschwimmen. Und die Leute werden von Outliers den Beweis verlangen, dass sie Gedanken lesen können. Sonst werden sie nicht glauben, dass sie irgendetwas können. Es wird um alles oder nichts gehen. Weder hier noch da ist es richtig, man wird dazwischen zerquetscht.
Senator David Russo ist Kelseys und Riels Großvater mütterlicherseits und hat ihren Dad immer gehasst. Seiner Meinung nach haben ihr Dad und seine kommunistischen aka liberalen Ideale ihre Mutter verdorben. Damit sind Riel und Kelsey die Früchte seines giftigen Baums. Ihr Dad war außerdem Afroamerikaner, und Riel hatte schon immer den Verdacht, das war sein größeres Problem mit ihrem Dad und mit ihnen.
Als ihre Eltern starben, wurde beschlossen, dass die Mädchen alt genug seien, für sich selbst zu sorgen. Das stimmte theoretisch, wenn auch nicht in der Praxis. Riel war seit drei Monaten in Harvard und studierte Computerwissenschaften. Der Plan war, dass sie nach Hause zog und zur Uni pendelte, bis Kelsey mit der Highschool fertig war. Kein Problem. Durch den Fonds ihrer Mutter hatten sie auch massenhaft Geld. Kein Problem. Die Schwester ihrer Mutter – Tante Susan, eine Bankerin aus Manhattan, die keine Kinder hatte – würde ab und zu nach ihnen sehen. Kein Problem. Sie waren sowieso brave Kinder, verantwortungsbewusst.
Dass sie allein für sich sorgen konnten, hieß natürlich nicht, dass sie es auch sollten.
Sie hatten ihren Großvater zuletzt gesehen, als er zur Beerdigung ihrer Eltern kam – die Presse sah schließlich zu. Und er sprach bei der Beerdigung auch nicht mit ihnen. Er sprach zu ihnen: ein paar höfliche Worte, in ihre Richtung geworfen wie abgelaufene Süßigkeiten von einem Festzugswagen.
Erst nach der Beerdigung hat Riel das Haus ihres Großvaters auf Cape Cod ausfindig gemacht und angefangen, gelegentlich dort einzubrechen, um ihn zu verwirren. Sie ist nicht stolz darauf, aber es ist befriedigend.
Riel will gerade Brians Nachricht beantworten – nö, komme nicht – , als sie sieht, wie ein Umschlag unter Leos Tür durchgeschoben wird. Nö. Das denkt Riel auch darüber. Will ich nicht. Aber im Moment ist es keine Option, unter der Tür durchgeschobene Umschläge zu ignorieren.
Riel steht auf und holt ihn. Vorsichtig. Darin ist ein einzelnes Blatt Papier, darauf ein einziger handgeschriebener Satz: Sie wissen, dass du sie hast.
Scheiße. Das reicht, verdammt. Zitternd vor Wut reißt Riel Leos Tür auf und schaut den Flur auf und ab. Sie will Klute, oder wer auch immer das Ding hiergelassen hat, anschreien. Aber es ist niemand zu sehen.
Mit klopfendem Herzen schließt Riel die Tür und betrachtet noch einmal eingehend das Blatt Papier. Die Worte sind leider immer noch da. Riel hatte recht, ihr ist wirklich jemand gefolgt – ihr Großvater, seine Leute, Klute. Sie wussten die ganze Zeit genau, wo sie ist. Leos Zimmer, dieses kleine, sichere Viereck: weg. Wie so vieles.
Sie wissen, dass du sie hast? Was – haben? Riel braucht einen Moment. Wylies Bilder? Den Umschlag, den sie Riel in die Hand gedrückt hat, bevor sie aus dem Haus ihres Großvaters rannte.
Riel hat bis jetzt nur einen kurzen Blick darauf geworfen, damit sie wusste, was sie hatte: Fotos von Gebäuden – schlechte, verschwommene Fotos. Offensichtlich waren sie Wylie wichtig, aber beim bloßen Hinsehen wurde nicht klar, warum. Einmal hatte Riel gesehen, wie Leo sie in der Dunkelheit durchblätterte. Am nächsten Tag hatte er ihr gesagt, sie solle sie loswerden. Nicht wegen dem, was darauf war, sondern weil sie Wylie gehörten. Und er hatte recht gehabt. Natürlich.
Das Brew liegt drei Straßen von Leos Wohnheim entfernt. Hier gibt es lange, knorrige Holztische, ständig bis auf den letzten Platz besetzt von über Laptops gebeugten nerdigen Typen. Das sind Riels Leute, auch wenn sie mit ihrem modischen Trägershirt, der tief hängenden Jeans, dem Tattoo und den Piercings nicht ganz so aussieht. Aber im Herzen wird Riel immer ein totaler Nerd sein.
Wie immer am Morgen gibt es keinen freien Platz im Brew. Riel muss sich zehn Minuten herumdrücken, bis endlich ein Tisch frei wird. Während sie wartet, wird ihr bewusst, dass sie nicht wissen kann, ob es hier ungefährlicher ist als in Leos Zimmer. Aber wenigstens gibt es hier Zeugen, falls sie entführt wird.
Nachdem Riel sich gesetzt hat, zieht sie den Umschlag mit Wylies Fotos aus der Tasche, sieht den Namen auf dem Umschlag: David Rosenfeld