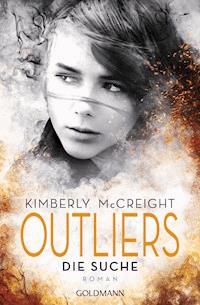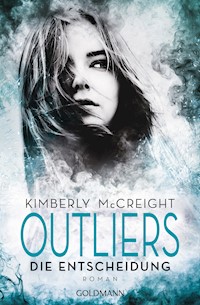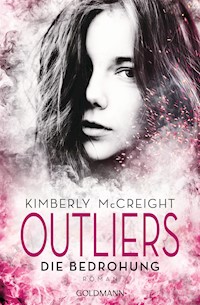
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Wylie hat alles versucht, um ihrer Freundin Cassie zu helfen – vergeblich. Nur sie und Highschoolschwarm Jasper konnten aus Camp Colestah, wo die drei festgehalten wurden, fliehen. Und die schüchterne Sechzehnjährige hat etwas über sich erfahren, das ihre gesamte Welt zum Einsturz und sie ins Visier gefährlicher Mächte bringt. Sie kann die Gefühle ihrer Mitmenschen lesen. Und sie ist nicht die Einzige. Wylie steht vor einer Zerreißprobe. Ist ihre Freundschaft zu Jasper stark genug, um die Gefahren, die ihnen bevorstehen, zu überstehen? Und hat Wylie die Kraft, um den anderen Mädchen zu helfen, die so sind wie sie?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Buch
Alles begann mit einem Hilferuf ihrer besten Freundin Cassie. Die schrecklichen Geschehnisse, die darauffolgten, wird die 16-jährige Wylie nie wieder vergessen. Die gefährliche Suche nach Cassie in den Wäldern Maines, auf die sie sich zusammen mit Highschoolschwarm Jasper begab. Das unheimliche Camp Colestah, wo Wylie, Jasper und Cassie gefangen gehalten wurden. Die verheerenden Flammen, denen nur Wylie und Jasper entkommen konnten. Doch auch zurück zu Hause bei ihrer Familie kann Wylie nicht aufatmen. Albträume und Schuldgefühle plagen sie, und sie ist dort alles andere als sicher. Denn die schüchterne Wylie hat etwas über sich erfahren, das ihre gesamte Welt zum Einsturz und sie zunehmend ins Visier gefährlicher Mächte bringt: Sie kann die Gefühle ihrer Mitmenschen lesen. Und sie ist nicht die Einzige. Wylie steht vor einer Zerreißprobe. Ist ihre Freundschaft zu Jasper stark genug, um die Gefahren, die ihnen bevorstehen, zu überstehen? Und hat Wylie die Kraft, um den anderen Mädchen zu helfen, die so sind wie sie?
Weitere Informationen zu Kimberly McCreight sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Kimberly McCreight
OUTLIERS
Gefährliche Bestimmung
DIEBEDROHUNG
Band 2
Roman
Deutsch von Karen Gerwig
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Scattering« bei Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2018
Copyright © 2017 by Kimberly McCreight
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Catherine Beck
KS · Herstellung: kw
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-22165-2V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für alle Mädchen, denen gesagt wurde, sie seien zu sensibel.Für alle Frauen, die sich selbst beigebracht haben, es nicht zu sein.
Das Leben ist ein Traum. Was uns umbringt, ist das Erwachen.
VIRGINIAWOOLF, Orlando
Anmerkung der Autorin
Dies hier ist eine erfundene Geschichte. Was ihr hier lest, ist nicht in Wirklichkeit passiert. Zumindest noch nicht.
Prolog
Ich stehe barfuß im Dunkeln an der scharfen Felskante und starre auf die ausgedehnte schwarze Wasserfläche vor mir. Mir ist kalt. Und ich frage mich, ob ich es wirklich ganz bis zu diesem kleinen Licht auf dem Hafenkai in der Ferne schaffen kann. Es kommt mir so unendlich weit weg vor, das Wasser ist so erschreckend ruhig, als warte es nur auf jemanden, der dumm genug ist, es zu versuchen.
Ich bin keine besonders gute Schwimmerin, auf jeden Fall nicht annähernd gut genug. So weit bin ich noch nie geschwommen. Nicht voll angezogen, nicht in der Dunkelheit. Ein unbekanntes Gewässer mit allen Streichen, die einem ein stecknadelkopfgroßer Lichtpunkt am Horizont spielen kann: Wer weiß, was da alles schiefgehen kann? Aber ich habe keine Wahl. Sie kommen, um uns zu holen. Eigentlich mich. Sie sind schon hier. Stimmen in der Ferne, die langsam näher kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.
Aber das echt Verrückte ist: Obwohl es wirklich übel aussieht, glaube ich tief in mir, dass ich die zwei Kilometer oder noch mehr zu diesem Hafen schwimmen kann. Eigentlich weiß ich es sogar. Vielleicht ist das alles, was zählt. Denn wenn ich eines in den letzten Wochen gelernt habe, dann, dass Stärke nur ein anderes Wort für Glauben ist. Und wahrer Mut ist, die Hoffnung nicht aufzugeben.
Im Moment bin ich sowieso mit meinen Zweifeln am Ufer allein. Ich weiß, dass ich mich nicht davon überwältigen lassen darf. Ich muss meinem Instinkt vertrauen.
Also hole ich noch mal tief Luft, bevor ich einen Schritt nach vorn mache und den Blick fest auf den weit entfernten Horizont richte. Und dann schwimme ich los.
1
Ich stehe in unserem Hausflur und starre auf die Nachricht von Jasper. Auf dieses eine Wort: Lauf.
Eine Minute lang. Eine Stunde lang. Ewig.
Mein Herz hämmert mir gegen die Rippen, während ich den Blick gesenkt halte. Die sechs Agenten sagen etwas. Ihre Namen – Agent Klute und Agent Johansen und Agent Sonstwie und Nochwas. Lauf. Lauf nicht. Lauf. Lauf nicht. Sie sagen noch mehr: Department of Homeland Security. Eine Inlandsbedrohung ausschließen. Der Rest ist nur ein Summen.
Lauf. Lauf nicht. Lauf. Lauf nicht.
Lauf.
Ich wirble zur Treppe herum, das Handy umklammert wie eine Handgranate. Erst weglaufen. Dann Fragen stellen. Das hat Quentin mir beigebracht.
»Wylie?«, ruft Dad hinter mir her. Verblüfft. Verwirrt. Besorgt. »Wylie, was tust du …?«
Stimmen und Gedränge hinter mir, während ich auf die Treppe zustürme. Nicht umdrehen. Nicht langsamer werden. Weiter und dann die Treppe hinauf. Weiter hinauf. Das muss ich tun.
Aber warum nach oben? Sollte ich nicht zur Hintertür hinausrennen statt weiter ins Haus hinein? Das Bad im oberen Stockwerk und der flachere Teil des Hausdachs. Das muss es sein. Ein Fluchtweg. Als ich das Treppengeländer packe, rutsche ich aus.
»Miss Lang!«, ruft einer von ihnen. So nah, dass ich fast seinen Atem spüren kann.
»Halt! Lassen Sie sie in Ruhe!« Dad klingt so wütend, dass ich seine Stimme kaum erkenne. Viele andere Stimmen schreien zurück. Keuchend und stampfend quäle ich mich die Treppe hinauf. »Sie können nicht einfach in unser Haus hereinplatzen!«
»Beruhigen Sie sich, Dr. Lang!«
»Hey! Stopp!« Wieder die Stimme hinter mir. Jetzt noch näher. Als ich oben an der Treppe ankomme, mache ich einen Satz in den oberen Flur.
Das Badezimmer. Dorthin muss ich. Konzentrier dich! Konzentrier dich! Schneller! Schneller! Bevor er mich schnappt. Die Tür ist nicht weit weg. Und ich werde nur eine Sekunde brauchen, um das Fenster zu öffnen und hinauszuklettern. Nach einer schnellen Rutschpartie auf den Boden werde ich es tun, und nicht zum ersten Mal: rennen, als ob der Teufel hinter mir her wäre.
Ich stürme den Flur entlang; immer noch direkt hinter mir höre ich laute Schritte. »Wylie!«, ruft der Mann, aber hölzern, als wollte er nicht zugeben, dass ich überhaupt einen Namen habe.
»Das ist unser Haus!«, schreit Dad wieder. Er klingt, als wäre er näher an der Treppe.
»Dr. Lang, Sie müssen hierbleiben!«
Mein Blick ist fest auf die Badezimmertür am Ende des Flurs gerichtet. Sie kommt mir so weit weg vor. Der Flur ist endlos. Aber ich muss zu dieser Tür. Fenster auf. Rausklettern. Einen Schritt nach dem anderen. So schnell ich kann.
»Miss Lang!«
Wieder die Stimme, viel näher. Zu nah. Und nervös. Er ist nah genug, um mich zu packen, hat aber zu viel Angst, mich zu verletzen. »Kommen Sie schon! Stehen bleiben! Was tun Sie denn?«
An der ersten Tür rechts vorbei. Noch zwei vor mir.
Doch dann verfängt sich mein Fuß im Teppich. Ich schaffe es gerade noch, die Hände hochzureißen, sodass ich mit dem Handballen an die Wand knalle und dann mit der Schulter und nicht mit dem Gesicht. Trotzdem macht mich der stechende Schmerz benommen, als ich auf dem Boden lande. Ich glaube, mir wird schlecht, während ich mich zusammenrolle und den Arm an den Bauch drücke. Ich wage nicht hinzusehen. Zu große Angst, dass vielleicht der Knochen herausschaut.
»O Gott, geht es Ihnen gut?« Der Agent ist vor mir stehen geblieben. Jetzt sehe ich, dass es der Kleine mit den übertrieben muskulösen Armen ist, die steif abstehen. Und er ist eindeutig so nervös, wie er klang. Aber auch verärgert. Er blickt den Flur entlang, als prüfe er ihn auf Zeugen. »Verdammt. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen nicht wegrennen.«
Ein paar Minuten später sitze ich auf der durchgesessenen Couch in unserem kleinen Wohnzimmer, und Dad hält einen Eisbeutel an mein pochendes Handgelenk. Von den Schmerzen vibriert mein Gehirn. Die Männer haben sich schweigend so hingestellt, dass sie die Tür, die Treppe und den Flur zur Hintertür versperren. Jeden möglichen Fluchtweg. In dem kompakten Rahmen unseres alten viktorianischen Hauses sehen sie sogar noch größer aus als draußen. Jetzt gibt es eindeutig keinen Ausweg mehr.
»Ich glaube nicht, dass es gebrochen ist«, verkündet Agent Klute und späht auf meinen Arm, aber nicht annähernd genau genug, um es beurteilen zu können.
Mein Dad steht vor mir und dreht sich angriffslustig zu Agent Klute um. Im Vergleich sieht er so winzig aus wie ein kleiner Junge.
»Verschwinden Sie endlich aus meinem Haus!«, schnauzt er und zeigt zur Tür. »Sofort! Das meine ich ernst! Sie alle: raus!«
Als würde er versuchen, Klute mit Gewalt rauszuwerfen, wenn er muss. Die Wut hat meinen Dad blind für ihren Größenunterschied gemacht. Beim Versuch, mich zu beschützen, würde er sterben, das erkenne ich jetzt ganz deutlich. Ich wünschte, ich hätte das schon vorher gewusst. Ob es etwas an dem geändert hätte, was in dem Lager passiert ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht auch alles.
»Wir können leider nicht gehen, Dr. Lang.« Klute senkt den Kopf. »Erst wenn Wylie unsere Fragen beantwortet hat.«
Er versucht, nicht bedrohlich zu wirken, sondern entschuldigend. Es klappt nicht. Vor allem, weil es ihm eigentlich nicht leidtut. Das weiß ich. Ich kann seine Gefühle gut genug lesen, dass keine Zweifel bleiben. In Wirklichkeit fühlt Agent Klute sehr, sehr wenig. Es ist erschreckend. Dad tritt näher an ihn heran, seine Wut wächst.
»Sie können nicht einfach in mein Haus eindringen und meine Tochter jagen. Sie ist hier das Opfer«, sagt er. »Selbst wenn sie eine Kriminelle wäre, bräuchten Sie eine richterliche Anordnung, um in ein Haus zu kommen. Das ist nicht legal. Gott helfe Ihnen, wenn ihr Handgelenk gebrochen ist.«
»Um das klarzustellen, Dr. Lang, Ihre Tochter ist vor Bundesagenten davongelaufen. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie gefährlich das ist?«
Fast hätte Dad gelacht. Dann legt er die Fingerspitzen wie im Gebet an die Lippen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Die Wut hat sogar seine Gesichtsform verändert, und ich spüre, was für eine Mühe er sich gibt, ruhig zu bleiben. Zu tun, was getan werden muss.
»Raus. Raus. Raus«, sagt Dad – langsam, ruhig und fest. Wie ein Trommelrhythmus. »Sofort. Sonst helfe mir Gott …«
»Wie ich schon sagte, das können wir nicht.« Agent Klute ist immer noch so gruslig ruhig. »Wylie ist eine wichtige Zeugin bei einem Mehrfachmord, der mit Inlandsterrorismus zu tun haben könnte. Sie muss jetzt mit uns kommen und ein paar Fragen beantworten. Das ist alles.«
»Ha!«, höhnt Dad. »Ich rufe rechtlichen Beistand an.«
Welchen rechtlichen Beistand?, denke ich, während Dad nach seinem Handy greift und wählt. Und doch wirkt er so sicher, als er das Telefon ans Ohr hält. Die Zeit dehnt sich, während wir dastehen und darauf warten, dass jemand seinen Anruf annimmt, dass Dad etwas sagt. Ich spüre, wie Agent Klute mich anstarrt, und versuche, den Blick nicht zu erwidern, aber ich kann nicht anders.
Natürlich ist sein kalter Blick auf mich gerichtet, sein Mund steht ein wenig offen, sodass ich die riesigen weißen Zähne sehen kann. Ich stelle mir vor, wie sie mich beißen. Aber ich spüre nichts von der Feindseligkeit, die ich erwartet hätte – keinen Ärger, kein Misstrauen oder Unmut. Da ist nur eines: Mitleid. Und das ist noch viel beängstigender.
Ich verschränke die Arme, während sich mein Magen zusammenkrampft. Vielleicht sollte ich ihre Fragen einfach beantworten. Vielleicht geht das alles dann schneller wieder weg. Dummerweise habe ich das grässliche Gefühl, dass das hier – egal was ich sage – der Anfang von etwas ist und nicht das Ende.
Atme!, ermahne ich mich. Atme. Denn der Raum wird schmaler, der Boden fängt an zu schwanken. Und jetzt ist sicher nicht der richtige Moment, um ohnmächtig zu werden. Ich bin seit sechsunddreißig Stunden ein Outlier, aber ich weiß, ich kann immer noch total durchdrehen.
»Hallo, Rachel, hier ist Ben«, sagt mein Dad schließlich ins Telefon. »Kannst du mich bitte so schnell zurückrufen, wie es geht? Es ist ein Notfall.«
Rachel. Klar. Natürlich ruft Dad sie an. Rachel war die beste Freundin meiner Mutter. Oder ehemalige beste Freundin. Nachdem sie und Mom jahrelang keinen Kontakt hatten, erschien Rachel bei der Beerdigung wie aus dem Nichts. Seitdem ist sie wie ein Ausschlag, den wir nicht loswerden. Sie will helfen. Oder behauptet es zumindest. Mein Dad sagt, das ist vermutlich ihre Art, mit ihrer Trauer fertigzuwerden. Wenn ihr mich fragt, ist das, was – oder wen – sie wirklich will, mein Dad.
Jedenfalls ist das Ganze schräg. Sie ist schräg, und ich vertraue ihr nicht.
Aber ob ich sie nun mag oder nicht: Rachel ist Strafverteidigerin. Sie muss wissen, was man in so einer Situation tut. Und Rachel ist vielleicht als Mensch echt beschissen – Mom wollte nie erzählen, warum sie sich verkracht haben – , aber selbst sie sagte immer, Rachel sei der Mensch, den sie anrufen würde, wenn sie mal echt Probleme hätte, denn »Rachel könnte sogar für einen öffentlichkeitsgeilen Massenmörder einen Freispruch erwirken«. Und Mom meinte das nicht als Kompliment.
»Dr. Lang, wenn Wylie nichts zu verbergen hat, sollte es kein Problem sein, wenn sie mit uns redet«, sagt Agent Klute, als Dad auflegt.
»Vielleicht wäre es nicht so ein Problem, wenn Sie mich nicht angegriffen hätten«, sage ich, denn es scheint, als könnte Dad ein bisschen Hilfe gebrauchen.
»Hey, Sie sind hingefallen!«, schaltet sich der kleine Agent ein. »Ich habe Sie nicht angefasst!«
Das stimmt natürlich, aber das ist wohl kaum das maßgebliche Argument.
Agent Klute blickt mich stirnrunzelnd an. Das alles läuft nicht so, wie es soll. Und jetzt ist er verärgert, aber nur ein bisschen. Als hätte er sich gerade einen Spritzer Suppe auf ein helles Hemd gekleckert. »Ich kann Ihnen versichern, Dr. Lang, bei Verdacht auf Terrorismus haben wir sehr umfassende Befugnisse beim Befragen von Zeugen. Und wir brauchen keine richterliche Verfügung. Wylie steht nicht unter Arrest. Zumindest noch nicht.«
»Danach« – Dad zeigt auf mich, besonders auf meinen Arm – »beantworten wir Ihre Fragen nur, wenn unsere Anwältin uns sagt, dass wir müssen.«
Agent Klute holt Luft. »Na gut. Wann wird sie hier sein?«
»Ich weiß es nicht.« Dad versucht zu klingen, als hätte er damit die Oberhand. Aber er weiß, dass es nicht so ist, und er macht sich Sorgen, was aus dem Ganzen hier wird. Das fühle ich klar und deutlich.
Agent Klute starrt Dad ausdruckslos an. »Dann warten wir einfach auf Ihre Anwältin. So lange es dauert.«
Danach sitzen Dad und ich eine Weile, vielleicht eine halbe Stunde, schweigend nebeneinander auf der Couch. Die Agenten stehen still wie Statuen in jeder Ecke. Agent Klute ist der Einzige, der sich bewegt; er geht auf und ab, während er Nachrichten tippt. Mit jeder wird er fahriger, unter seinen schweren Schritten knarrt unser Boden unheimlich.
Ich möchte Jasper schreiben, aber wer weiß, was er sagen wird? Und falls die Agenten mich wirklich zur Befragung mitnehmen, könnte es gut sein, dass sie mir mein Handy wegnehmen. Es ist sicherer, wenn ich erst mit Jasper rede, wenn sie weg sind.
Mein Dad ruft Rachel noch zweimal an, aber beide Anrufe gehen auf die Mailbox. Und so warten wir weiter. Noch eine halbe Stunde vergeht. Dann eine Stunde. Ich kann nicht fassen, wie unbequem unsere Wohnzimmercouch ist. Ich glaube nicht, dass jemals jemand so lange darauf gesessen hat – ich jedenfalls nicht. Irgendwann muss ich mal, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass jemand mitkommt. Und ich bin mir sicher, das werden sie.
Gerade als ich denke, ich werde keine andere Wahl haben, als einen Toiletten-Babysitter zu ertragen, vibriert Agent Klutes Handy laut in seiner Hand. »Entschuldigung, den Anruf muss ich annehmen«, sagt er, nickt den anderen Agenten zu, damit sie wissen, dass sie vorübergehend zuständig sind, bevor er das Haus verlässt.
Als sich die Haustür hinter Agent Klute schließt, klingelt endlich Dads Handy. »Rachel«, sagt er verzweifelt und erleichtert. Er ist still und hört eine Weile zu. »Na ja, nicht so toll, um ehrlich zu sein. Könntest du rüberkommen? Es ist so was wie ein Notfall. Nein, nein, nichts Derartiges.« Er macht eine Pause und holt tief Luft, als er aufsteht. Aber er geht nicht los. Er bleibt einfach vor der Couch stehen und wirkt so wacklig, als würde sich ein Teil von ihm auflösen. »Hier sind ein paar Bundesagenten, und sie wollen Wylie ausfragen, und ich … sie hat eine Menge durchgemacht, und ich möchte es auf einen anderen Termin verlegen.« Wieder Schweigen, während Rachel antwortet. »Das habe ich. Sie haben sich geweigert. Sie sagten, weil das mit Inlandsterrorismus zu tun habe und Wylie keine Verdächtige sei …« Noch mehr Stille. »Ja, okay. Okay. Danke, Rachel.«
Ihm scheint es besser zu gehen, er wirkt hoffnungsvoller, als er sich wieder zu mir umdreht. »Was hat sie gesagt?«, frage ich.
»Dass wir das Richtige tun«, antwortet er. »Wir sollen einfach hier warten. Sie ist unterwegs.«
Als Agent Klute wieder hereinkommt, hat Dad noch das Telefon in der Hand. »Wir melden uns bald, Dr. Lang«, sagt Klute nüchtern, als sei das die Fortsetzung eines Gesprächs. Als wären wir uns schon darüber einig. »Wir verlegen die Befragung auf einen anderen Termin.«
Aber warum? Ich kaufe Agent Klute nicht ab, dass er abhaut, weil er Angst vor einer Anwältin hat, die er gar nicht kennt. Er weiß nicht mal, dass Rachel doch noch zurückgerufen hat. Klute nickt seinen Männern zu. Jetzt gehen sie aus eigenen Gründen. Schlechten Gründen.
»Wohin gehen Sie?«, frage ich, obwohl es vermutlich besser wäre, kein Wort zu sagen. Schließlich will ich nicht, dass sie doch bleiben.
Als mich Agent Klute ansieht, fühle ich es wieder: Mitleid. Und diesmal ist es noch schlimmer. So endgültig und tief. Er nickt wieder. »Wir melden uns.«
Ich sehe zu, wie sich Klute und seine Männer sammeln und durch die Tür verschwinden. Und ich stelle es mir vor wie diesen unheimlich stillen Moment, wenn das Wasser aufs Meer hinausgezogen wird, direkt bevor ein Tsunami aufs Ufer kracht. Lautlos und überraschend und unendlich entsetzlich.
2
Sechs Wochen später
Ich öffne die Augen, und um mich herrscht Dunkelheit. Mein Zimmer. Mitten in der Nacht. Jasper ruft an. Ohne hinzusehen, weiß ich schon, dass er es ist. Aber ich greife nicht nach meinem Handy. Manchmal ruft er nur einmal an und legt wieder auf. Und heute Nacht will ich zum ersten Mal seit langer Zeit nur schlafen.
Seit wir vor sechs Wochen aus Maine zurückgekommen sind, sind Jaspers nächtliche Anrufe normal geworden. Jasper ruft natürlich von seinem neuen Handy an. Denn es war nicht er, der mir damals, als die Agenten vor meiner Tür standen, geschrieben hat, ich solle weglaufen.
Sobald Agent Klute und seine Freunde unser Haus verlassen hatten, rief ich Jasper zurück – ich wollte sichergehen, dass es ihm gut ging, wollte wissen, warum genau er mir gesagt hatte, ich solle weglaufen. Aber er ging nicht an sein Handy. Nachdem ich ihn weitere zwei Stunden nicht erreichte und auch keine Festnetznummer seiner Familie ausfindig machen konnte, bestand ich darauf – gegen Dads entschiedenen Widerspruch – , dass wir zu Jaspers Haus fuhren und nach ihm sahen.
Jasper ging es prima, als er endlich an die Tür kam – verschlafen, verwirrt, aber alles in Ordnung. Er hatte nicht mal sein Handy bei sich, hatte es nicht mehr gesehen, seit Quentin es ihm im Lager abgenommen hatte.
Die örtliche Polizei hatte mein Handy in der Haupthütte gefunden und es mir an dem Morgen während einer der vielen Befragungen an der Raststätte wiedergegeben. Aber Jasper und ich wurden damals einzeln befragt. Ich war einfach davon ausgegangen, dass er seins auch wiederbekommen hatte. Eigentlich hatte ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Aber die Polizisten hatten Jaspers Handy nie gefunden.
Doch jemand hatte mir im genau richtigen Moment geschrieben, ich solle weglaufen. Und mit welchem schrecklichen Ziel, das konnte ich mir nur ausmalen. Vielleicht hatte derjenige gehofft, wenn ich wegliefe, würde mir etwas zustoßen.
Mein Dad kontaktierte Agent Klute später, als uns klar wurde, dass die Nachricht nicht von Jasper gekommen war. Klute hatte sie sich angesehen und ein bisschen später verkündet, das Ganze sei irgendein Streich gewesen. Wir bedrängten ihn, uns Einzelheiten zu verraten. Ein Streich ergab keinen Sinn. Aber Agent Klute rief irgendwann nicht mehr zurück, und dagegen konnten wir nur schwer etwas sagen, wenn wir selbst nie wieder etwas von ihm hören wollten.
Jetzt piepst mein Handy wieder. Ich taste auf dem Nachttisch danach und denke wieder mal, dass ich einen weniger schrillen Klingelton einstellen sollte. Andererseits werde ich wohl immer schreckhaft sein, egal mit welchem Klingelton.
Es ist eine echte Leistung, dass ich überhaupt geschlafen habe. Weder Jasper noch ich konnten viel schlafen, seit wir aus Maine zurück sind – zu viel Reue, zu viel Schuld. Also überstehen wir die endlosen Nächte gemeinsam am Telefon und reden über alles und nichts. Und ich liege auf dem Bett und starre die alten Fotos an den Wänden meines Zimmers an und denke, ich sollte sie abnehmen, weil sie mich an Mom erinnern. Und genau aus diesem Grund werde ich es nie tun.
Jasper und ich versuchen, nur über leichte Themen zu sprechen, um die Dunkelheit auszublenden. Vielleicht klappt es genau deshalb nicht. Das »Was wäre, wenn« der Entscheidungen, die wir an dem Abend trafen, als wir nach Norden fuhren – was, wenn wir es Cassies Mom sofort erzählt hätten, was, wenn wir Cassie ignoriert und früher irgendwo anders zur Polizei gegangen wären – , ist im Vergleich zu unseren Themen viel zu laut. Aber das viele Reden hat Jasper und mich näher zusammengebracht. Manchmal überlege ich, wie lange sie halten wird oder wie echt sie sein kann, diese Freundschaft, die aus so viel Schrecklichem geboren ist. In anderen Momenten möchte ich nicht darüber nachdenken. Ich möchte überhaupt nicht zu genau nachdenken. Es gibt zu viele Fragen, auf die ich keine Antwort kenne.
Auf ihre übliche Therapeutinnen-Art hat Dr. Shepard gesagt, sie halte es für keine gute Idee, wenn wir das Ganze zu oft wiederkäuen, und ich gebe ihr recht. Jasper kann aber nicht anders. Klar überlegen wir beide, was gewesen wäre, wenn irgendwas anders gelaufen wäre, aber es war Jasper, dem Cassie direkt die Schuld dafür gab, dass wir im Camp festgehalten wurden. Jedes Mal, wenn er davon anfängt, sage ich dasselbe: Nein, es ist nicht deine Schuld, Jasper. Cassie ist wegen Quentin tot, nicht deinetwegen. Und das glaube ich auch.
Aber Jasper glaubt mir nicht. Manchmal, wenn ich ihm in die Augen blicke, habe ich das Gefühl, ich sehe jemandem dabei zu, wie er langsam verhungert. Und ich stehe mit Armen voller Essen daneben.
Nicht dass es mir total gut gehen würde. Ich habe immer noch furchtbare Albträume und weine jeden Tag mindestens einmal. Normale Zeichen der Trauer und seelischer Erschütterungen, sagt Dr. Shepard. Meine Ängste sind auch nicht in dem Moment verschwunden, als mir gesagt wurde, ich sei ein Outlier.
Aber in letzter Zeit bekommt das Feuer weniger Sauerstoff. Ich arbeite daran, die Empfindungen anderer Leute von meinen eigenen Ängsten unterscheiden zu lernen. Wie sich herausstellt, fühlen sie sich ein bisschen anders an. Meine eigenen Ängste sind älter, lauern tiefer in mir, während die der anderen Leute höher in meiner Brust sitzen. Und jetzt helfen Dr. Shepards Atemübungen, ihre Achtsamkeitsmeditationen und ihre positiven Selbstgespräche – alles Dinge, zu denen sie mir schon immer geraten hat – langsam wirklich. Wahrscheinlich, weil ich eher bereit bin, daran zu glauben.
Endlich bekomme ich das Handy zu fassen, lasse es aber beinahe fallen, bevor ich rangehe.
Mein »Hey« klingt kaum verständlich. Ich räuspere mich. »Alles klar?«
»Mist, hast du geschlafen?«, fragt Jasper. Er klingt fast beleidigt, betrogen von meiner mangelnden Schlaflosigkeit.
»Ähm, eigentlich nicht«, lüge ich. »Ich habe nur … Alles klar?« Dann fällt mir wieder ein, warum er vermutlich so spät angerufen hat. Denn es ist spät, sogar für ihn. »Ach, warte, das Abendessen mit deiner Mom. Wie war’s?«
Jasper wollte ihr sagen, dass er Zweifel daran hat, ob er fürs Boston College Eishockey spielen soll. Und mit Zweifeln meine ich, er hat seine Meinung total geändert. Das Sommercamp für neue Studenten fängt in ein paar Tagen an, und er hat nicht vor hinzugehen. Und das College wird nicht für sein Sportstipendium aufkommen, wenn er nicht Eishockey spielt. Kein Eishockey, kein Boston College.
Aber Jasper hat kein Problem damit. Überhaupt keins. Er weiß nicht einmal mehr, ob er überhaupt noch aufs College will. Um genau zu sein, klingt Jasper in letzter Zeit nur dann wenigstens halbwegs glücklich, wenn er darüber redet, das Boston College sausen zu lassen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass nie wieder Eishockey zu spielen seine eigene Bestrafung dafür ist, was Cassie passiert ist. Denn sosehr Jaspers Mom ihn zu dem Sport gedrängt hat, er liebt ihn auch. Ihm den Rücken zu kehren ist seine Art, sich zu bestrafen.
»Das Essen war okay«, sagt Jasper, aber er klingt abgelenkt, als wäre das nicht der Grund für seinen Anruf.
»Was hat sie gesagt?« Ich setze mich im Bett auf und schalte das Licht ein.
»Gesagt? Worüber?«
»Ähm, das Eishockey?«, frage ich und hoffe, mein Tonfall bringt ihn wieder zu sich. »Alles klar bei dir? Du klingst echt verpeilt.«
»Ja, ja. Mir geht’s gut.« Es klingt kein bisschen überzeugend. »Das Ding mit meiner Mom lief nicht gut. Aber na ja, das hatte ich ja auch nicht erwartet.« Er klingt auch nicht mitgenommen, nur völlig leer. Ich warte auf Details, aber er bleibt still.
»Erlaubt sie dir, es nicht zu machen?«, frage ich, und mein Blick bleibt an meinem Foto der alten Frau mit ihrer karierten Tasche und den Brotkrumen hängen. Das Foto, das Jasper beim ersten Mal, als er hier war, am Tag, an dem wir auf der Suche nach Cassie losgerast sind, deprimierend nannte. Ich frage mich, ob er es jetzt immer noch so sehen würde.
»Definiere ›erlauben‹«, sagt er, dann versucht er zu lachen, aber es klingt keuchend und hohl.
Mein ganzer Körper spannt sich. »Jasper, komm schon, was ist passiert?«
»Ach, du weißt schon, so ungefähr, was ich erwartet hatte«, sagt er. Er versucht, sich zu fangen, aber ich höre die Anstrengung in seiner Stimme. Außerdem fühle ich sie, selbst übers Telefon. »Nur schlimmer, irgendwie.«
»Wie schlimmer?«, frage ich, auch wenn ich ihn wohl eher ablenken als nach Einzelheiten ausfragen sollte. Wie immer in letzter Zeit fühle ich mich total überfordert.
»Meine Mom sagte, wenn ich nicht Eishockey spiele – ins Sommercamp gehe und so – , kann ich nicht unter ihrem Dach leben.« Er schweigt kurz und seufzt. »Na ja, es ist nicht so, als wäre sie ein völlig anderer Mensch geworden, nur weil ich fast gestorben wäre.«
Ich bin mir nicht sicher, ob er das als Witz meint. Aber die komische Spannung in seiner Stimme ist reine Traurigkeit. Mir tut davon selbst die Brust weh. »Das tut mir leid.« Wenn es nur mehr zu sagen gäbe. Aber alles Weitere wäre eine Lüge, und ich weiß, wie das ist. Jasper verdient etwas Besseres.
»Vielleicht hat sie ja recht.«
»Also überlegst du, doch zu spielen?« Ich klinge zu hoffnungsvoll. Ich kann nicht anders. Ich mag Jaspers Mutter nicht, aber ich gebe ihr recht, dass er ans Boston College gehen und Eishockey spielen sollte. Im Moment ist er zu verwirrt, um sich das eine zu nehmen, das ihm noch Freude macht.
»Auf keinen Fall«, sagt er, als sei das der absurdeste Vorschlag aller Zeiten. »Ich spiele ganz sicher nicht.«
Jetzt schlägt mein Herz schneller. Ja, es gibt eine Grenze zwischen Jaspers negativen Gefühlen, die ich lesen kann, und meinen eigenen Ängsten, aber sie ist immer noch total verschwommen. Sicher kann ich im Moment nur sagen, dass mich dieses Gespräch echt beunruhigt.
Ob das an mir oder Jasper liegt, ist noch die Frage.
»Ich habe es also in Ihr richtiges Büro geschafft«, sagte ich bei unserem ersten persönlichen Treffen eine Woche nach dem Camp zu Dr. Shepard. Ich wollte gelobt werden. Diese ganzen traumatischen Erlebnisse, und ich schaffte es trotzdem aus dem Haus.
Sie nickte mir zu und lächelte leicht, hübsch und zart, wie sie immer aussah in ihrem großen roten Sessel. Immer noch wie Alice im Wunderland. Ich war erleichtert, dass sich das nicht geändert hatte.
»Ich freue mich, dass du hier bist«, sagte Dr. Shepard.
Das war nicht unbedingt die Lobrede, auf die ich gehofft hatte. Aber das war ganz ihr Stil: nicht zu viel aus irgendwas machen. Weder aus dem Guten noch aus dem Schlechten. Sie wollte, dass ich Erwartungen an mich selbst hatte, aber auch deutlich machen, dass sie selbst keine hatte.
Danach plauderten wir eine Weile: wie ich meine Tage verbrachte, wie es zu Hause war. Aber wir konnten nicht ewig um das herumreden, was in dem ehemaligen Ferienlager passiert war.
»Wissen Sie was, ich hatte weniger Angst, während ich Cassie gesucht habe«, warf ich mich schließlich selbst ins kalte Wasser, wahrscheinlich ein bisschen zu aggressiv. »Hätte ich nicht mehr Angst haben müssen? Ich hatte schließlich Probleme, das Haus zu verlassen. Um genau zu sein, habe ich es ja vorher überhaupt nicht mehr verlassen.«
»Ängste sind variabel, Wylie. Es gibt keine zwei Leute, bei denen sie sich auf dieselbe Weise manifestieren. Es gibt kein ›müsste‹. Selbst bei einem Menschen können sich die Ängste mit der Zeit und den Ereignissen im Leben verändern – der Unfall deiner Mutter hat deine Ängste sicherlich verschlimmert, bis du für kurze Zeit nicht mehr aus dem Haus gehen konntest. Vermutlich hat der Adrenalinstoß, nachdem du gebeten wurdest, Cassie zu helfen, deine eigenen Ängste vorübergehend überdeckt. Das eine Mal passten die Alarmglocken, die in dir losgingen, zur wirklichen Gefahr, in der du warst. Es ist nicht verwunderlich, dass deine Ängste dann weniger spürbar waren.«
»Also ist das mein Heilmittel? Die ganze Zeit in irgendwelchen verrückten Notsituationen sein?«
Dr. Shepard zog die Mundwinkel herunter. Sie war noch nie ein Fan von Sarkasmus gewesen. »Menschen gehen durch Phasen voller Angst und kommen auf der anderen Seite wieder heraus. Andere haben ihr ganzes Leben lang periodisch gute und schlechte Phasen. Bei Angststörungen gibt es keine Einheitserklärungen oder Vorhersagen, Wylie. Nichts Absolutes. Das Unbekannte kann entmutigend sein, aber auch anspornend. Du bist jetzt hier. Vielleicht sollten wir da anfangen.«
»Glauben Sie, meine ›Erhöhte Emotionale Wahrnehmung‹, dieses ›Outlier‹-Ding« – ich setzte das Wort mit den Fingern in Anführungszeichen und verdrehte die Augen im natürlich total durchsichtigen Versuch zu zeigen, dass ich es nicht besonders ernst nahm – »könnte die ganze Erklärung dafür sein, was mit mir nicht stimmt?«
Mein Dad hatte vorher angerufen, um Dr. Shepard zu erklären, was in dem Camp passiert war und wie es mit seiner Forschung zusammenhing, inklusive seiner neuen Wortschöpfung »Erhöhte Emotionale Wahrnehmung« oder »EEW«. Ich glaube, ihm gefiel an dem neuen Ausdruck, dass man damit gar nicht erst auf einen Vergleich mit übersinnlicher Wahrnehmung kam. Außerdem hatte er ihr erzählt, ich sei ein Outlier und was das bedeutete. Es war eine Erleichterung, nicht alles genau erklären zu müssen, vor allem nicht, dass ich ein Outlier war, was ich zu einem Teil aufregend fand, zu einem Teil verwirrend und zu tausend Teilen beängstigend. Es war, als würde man erfahren, dass man jahrelang einen riesigen gutartigen Tumor in seinem Bauch herumgetragen hat. Klar gibt es bei so was gute Neuigkeiten: Man ist nicht krank und vier Kilo leichter, wenn das Ding von der Größe einer Wassermelone entfernt ist. Aber man muss trotzdem mit dem erschreckenden Gefühl klarkommen, dass da etwas in einem saß. Und noch schlimmer: Man hatte die ganze Zeit keine Ahnung davon gehabt.
»Was nicht mit dir stimmt?«, fragte Dr. Shepard. »Richtig und falsch sind keine sinnvollen Ausdrücke, wenn man über Ängste spricht.«
»Sie wissen, was ich meine«, sagte ich, aber wie sollte sie? Ich wusste es nicht mal selbst genau. Ich wollte klare Antworten (wie viel Angst hatte ich eigentlich?), wollte andere aber meiden (was bedeutete es eigentlich, ein Outlier zu sein?). Ich wollte meine Ängste abladen, ohne für mich anzunehmen, dass ich ein Outlier war, wollte mir meine Wahrheit selbst herauspicken. »Halten Sie es für möglich, dass ich in Wirklichkeit gar keine Angststörungen habe?«
Dr. Shepard sah mich an, und ich spürte mit verwirrender Klarheit den Moment, als sie beschloss, mit offenen Karten zu spielen, statt sich für das gute alte therapeutische Ausweichspiel zu entscheiden. Es war nicht unbedingt beruhigend, wenn man Leute so leicht durchschauen konnte. Dadurch wurden alle so viel schwächer, ihre Begabungen viel gewöhnlicher.
»Ich halte Achtsamkeit für eine starke Sache, Wylie. Verstehst du das?«
Ich nickte. Aber dann dachte ich noch mal darüber nach. »Nein, eigentlich verstehe ich es nicht.«
»Diese Erhöhte Emotionale Wahrnehmung hätte deine Ängste sicherlich verschlimmern können. Es könnte sein, dass du bei manchen Gelegenheiten die Gefühle anderer für deine eigenen gehalten hast. Trotzdem würde ich sagen, es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Erklärung für all deine Ängste ist, dass du ein Outlier bist. Ich will dich etwas fragen: Fühlst du dich jetzt ängstlich?«
Ich versuchte, Luft zu holen. Es war nicht leicht, und in meiner Magengegend war auf jeden Fall diese kalte Schwere. »Ja, eindeutig.«
Auch wenn meine Angst sich jetzt, wo ich ihre eigenartige Kälte einzeln spüren konnte, eigenständiger anfühlte. Eher wie ein Rucksack und nicht wie eines meiner Organe.
»Ich kann dir immerhin versichern, dass die Angst, die du jetzt gerade spürst, deine eigene ist, nicht meine, Wylie. Sprich: Ich glaube, die Antwort ist: ja, du hast Angst, und ja, du hast diese Erhöhte Emotionale Wahrnehmung. Wo die Grenze ist, musst du selbst für dich herausfinden.«
Genau das war das Problem. In den ersten Stunden, nachdem Jasper und ich entkommen waren, immer noch erschüttert von dem, was Cassie passiert war, hatte ich das Gefühl gehabt, ein Outlier zu sein könnte die Antwort auf alles bieten, was je mit mir nicht gestimmt hatte. Das Geheimnis meiner Freiheit. Aber »ein Outlier sein« verwandelte sich schnell in eine bodenlose Truhe voller Fragen und noch mehr Fragen. Bisher hatte ich beschlossen, den Deckel fest verschlossen zu halten, denn nur ich hatte den Schlüssel und konnte ihn benutzen, wann ich es wollte.
Aber jetzt noch nicht. Ich hatte höflich alle »Folgetests« meines Dads abgelehnt und darauf verzichtet, mir von ihm beibringen zu lassen, »mehr« mit meiner Erhöhten Emotionalen Wahrnehmung und meiner »Lesefähigkeit« zu tun. Ich hatte auch bewusst nicht erfahren wollen, wohin Dads Forschung führen sollte. Ich kannte nur die beiden Hauptfragen: den »Spielraum« der Outlier-Fähigkeit (was wir tun könnten, wenn wir üben würden) und die »Quelle« der Outlier-Fähigkeit (woher sie kam).
Nachdem er zufällig die drei ursprünglichen Outliers entdeckt hatte – mich und die anderen beiden Mädchen – , hatte Dad zusätzliche »Forschungsstudien« mit einer Handvoll Freiwilliger gemacht, aber nichts, das man hätte veröffentlichen können. Während dieser Studien hatte er bemerkt, dass die Outlier alle Mädchen waren und nur Teenager. Das alles war vor den Ereignissen in dem Lager gewesen. Jetzt hatte Dad die meiste Zeit mit Anträgen verbracht, um das Geld zusammenzubekommen, das er für eine richtige, expertengeprüfte Studie brauchte, mit der er die Existenz der Outlier beweisen könnte. Dann – und nur dann – könnte er zu den komplexeren Themen Quelle und Spielraum kommen. Im Moment war es für die Wissenschaft so, als wäre nichts passiert.
ENDE DER LESEPROBE