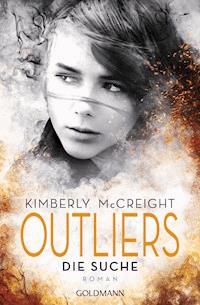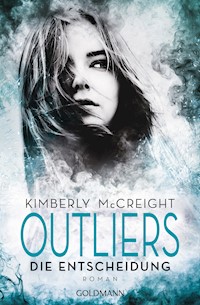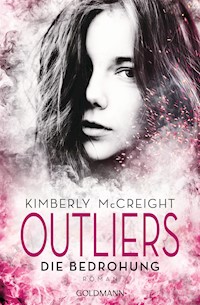9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Fünf beste Freunde, ein tödliches Geheimnis und ein Wochenende der Wahrheit: Kimberly McCreights psychologischer Thriller »Freunde. Für immer.« ist ebenso hinterhältig wie hochspannend und unvorhersehbar. Nichts schien die College-Freunde Jonathan, Derrick, Keith, Stephanie, Maeve und Alice trennen zu können – bis Alice sich aus Schuldgefühlen das Leben nahm. So steht es jedenfalls offiziell im Polizei-Bericht. Zehn Jahre später treffen sich die Freunde in Jonathans Wochenendhaus in den Catskill Mountains – einem beliebten Feriengebiet der New Yorker –, um seinen Junggesellenabschied zu feiern. Doch dann sind Keith und Derrick plötzlich verschwunden. Die Polizei findet lediglich ihren Wagen, darin eine Leiche mit zertrümmertem Gesicht. Hat die Vergangenheit noch eine Rechnung mit den Freunden offen? Für Detective Julia Scutt, die den Fall übernimmt, werden die Ermittlungen ebenfalls zu einer unheimlichen Reise in die Vergangenheit: Als Julia acht Jahre alt war, fand man die Leiche ihrer Schwester mit ähnlichen Verletzungen, von der Freundin, die sie begleitet hatte, fehlt bis heute jede Spur … Trickreich und in hohem Tempo führt die New York Times-Bestseller-Autorin Kimberly McCreight durch einen psychologischen Thriller, den man kaum aus der Hand legen kann. »Dieser großartige Thriller der US-amerikanischen Autorin lässt den Leserinnen absolut keine Atempause. Mit wechselnden Erzählperspektiven, unglaublich gut konzipierten Charakteren und überraschenden Wendungen, sodass es bis zum Schluss durchgehend hoch spannend bleibt.« VOGUE »Ein echter Pageturner, der mich nicht mehr losließ.« Bestseller-Autor Harlan Coben über Kimberly McCreights Thriller »Eine perfekte Ehe«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Ähnliche
Kimberly McCreight
Freunde. Für immer.
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristina Lake-Zapp
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Nichts schien die College-Freunde Jonathan, Derrick, Keith, Stephanie, Maeve und Alice trennen zu können – bis Alice sich aus Schuldgefühlen das Leben nahm. So steht es jedenfalls offiziell im Polizei-Bericht. Zehn Jahre später treffen sich die Freunde in Jonathans Wochenendhaus in den Catskill Mountains – einem beliebten Feriengebiet der New Yorker –, um seinen Junggesellenabschied zu feiern. Doch dann sind Keith und Derrick plötzlich verschwunden. Die Polizei findet lediglich ihren Wagen, darin eine Leiche mit zertrümmertem Gesicht. Hat die Vergangenheit noch eine Rechnung mit den Freunden offen …
Für Detective Julia Scutt, die den Fall übernimmt, werden die Ermittlungen ebenfalls zu einer unheimlichen Reise in die Vergangenheit: Als Julia acht Jahre alt war, fand man die Leiche ihrer Schwester mit ähnlichen Verletzungen, von der Freundin, die sie begleitet hatte, fehlt bis heute jede Spur …
Inhaltsübersicht
WIDMUNG
MOTTO
PROLOG
ALICE
DETECTIVE JULIA SCUTT
MAEVE
DETECTIVE JULIA SCUTT
STEPHANIE
Zwei Wochen zuvor
KEITH
ALICE
DETECTIVE JULIA SCUTT
JONATHAN
DETECTIVE JULIA SCUTT
DERRICK
Zwei Wochen (und zwei [...]
DETECTIVE JULIA SCUTT
ALICE
MAEVE
DETECTIVE JULIA SCUTT
STEPHANIE
DETECTIVE JULIA SCUTT
ALICE
KEITH
DETECTIVE JULIA SCUTT
Zwei Wochen (und vier [...]
JONATHAN
DETECTIVE JULIA SCUTT
ALICE
DERRICK
DETECTIVE JULIA SCUTT
MAEVE
Zwei Wochen (und fünf [...]
DETECTIVE JULIA SCUTT
STEPHANIE
DETECTIVE JULIA SCUTT
KEITH
JONATHAN
DETECTIVE JULIA SCUTT
ALICE
DERRICK
Drei Wochen zuvor
DETECTIVE JULIA SCUTT
BETHANY
DETECTIVE JULIA SCUTT
DANK
Leseprobe »Die perfekte Mutter«
Für die Freunde, die mich vorlanger Zeit gerettet haben.
Für die, die das immer noch tun.
Keine Freundschaft ist Zufall.
O. Henry, Heart of the West
PROLOG
Du hast damit angefangen. Also bist du auf gewisse Weise auch dafür verantwortlich, wie es geendet hat. »Das ist doch lächerlich«, würdest du sagen. Und vielleicht ist es unfair, dir unter den gegebenen Umständen die Schuld zuzuschieben. Doch an dieser Stelle kann ich nichts weiter tun, als die Wahrheit zu erzählen. Wie dem auch sei – niemand hätte exakt vorhersagen können, wie sich die Dinge entwickeln. Und ganz gewiss nicht ich. All der Kummer, all die Existenzen, all das Potenzial – aus und vorbei, mit einem einzigen Wimpernschlag.
Zu viel Loyalität – das ist das eigentliche Problem. Beste Freunde sollten einem zur Seite stehen, ganz gleich, was passiert. Sie sehen über deine gelegentlich unangenehme Art und deine unschönen Verschrobenheiten hinweg und nehmen dich so, wie du bist. Das ist das Schöne an echter Freundschaft. Aber enge Freunde lassen dir womöglich zu viel durchgehen. Und was sich anfühlt wie absolute Akzeptanz, was sich als bedingungslose Liebe tarnt, kann toxisch werden. Vor allem dann, wenn sich dein Freund in Wirklichkeit einen Komplizen wünscht, jemanden, der sein eigenes Fehlverhalten entschuldigt. Das Schlechteste aus dir herauszukitzeln, nur damit ihr gemeinsam schlecht sein könnt, ist gleichzusetzen mit Grausamkeit und hat nichts zu tun mit Wohlgesinntheit. Und mit Liebe hat es erst recht nichts zu tun.
Nicht dass ich dich jemals für grausam gehalten hätte. Ich dachte, du wärst lustig und clever und absolut umwerfend. Gott, wie sehr ich dich geliebt habe! Nicht auf eine sexuelle Art und Weise – dafür habe ich dich viel zu sehr angebetet. Aber machen wir uns nichts vor, du hast meine Liebe nie in dieser Form erwidert. Vielleicht habe ich beschlossen, dass ich das nicht akzeptieren kann. Vielleicht ist mir klar geworden, dass es nicht wirklich Liebe war, die du mir entgegengebracht hast, ganz gleich, wie oft du deine Gefühle für mich so bezeichnetest. Mitleid, vielleicht, aber nicht Liebe. Und deshalb habe ich das Ich über das Wir gestellt. Auch wenn sich das Wir für den Moment gut anfühlte, wusste ich doch, dass es mich irgendwann zerstört.
Aber ich spreche nur für mich. Und ich werde nicht die Schuld auf mich nehmen für alles, was passiert ist. Wenn du einen Freundeskreis hast wie diesen – schön und dynamisch und smart und eigensinnig –, kann alles ausgesprochen kompliziert werden. Vor allem bei den zahllosen verworrenen Beziehungen und der langen Vorgeschichte ist es wahrscheinlich, dass die Begierde irgendwann wegbricht.
Es ist, als säße man auf einem Pulverfass, das einem früher oder später um die Ohren fliegt.
ALICE
Es war das Mädchen aus dem Kunstgeschichte-Kurs, das mir die Nachricht überbrachte. Das Mädchen mit den strähnigen braunen Haaren und dem ironischen Prinzessinnen-T-Shirt, das sehr nett ist. Und gleichzeitig sehr nervend. Arielle. Oder Erin. Oder so ähnlich. Sie sprach mich an, als wir den Seminarraum verließen. Das macht sie oft. Sucht immer nach einer Möglichkeit, in meine Clique zu kommen. Das sind wir eben am Vassar College: heiß begehrt. Selbstverständlich sehen die Leute nur unsere makellose Fassade – unsere schönen Gesichter und die angesagten Klamotten, die Art und Weise, wie wir einen Raum vereinnahmen gleich einer Flutwelle, die jeden Zentimeter für sich beansprucht.
Hast du das gehört? Ihr Atem an meinem Ohr war heiß und feucht und roch nach Minzkaugummi und Zwiebeln. Man hat einen Toten gefunden. Sie klang erschrocken, aber auch ein wenig aufgeregt. Ihre Mundwinkel zuckten.
Wovon redest du?, fragte ich. Wo?
Gleich vor dem Hauptgebäude.
Weiß man, wer er ist?
Ihr Gesicht hellte sich auf. Es gefiel ihr, diejenige zu sein, die etwas wusste. Die Insiderin. Wahrscheinlich dachte sie, sie könne auf diese Weise bei den coolen Kids einen Fuß in die Tür bekommen.
Er war nicht an unserem College. Wahrscheinlich wurde er ermordet. Eine Sekunde später gab sie zu, dass sie sich Letzteres nur ausgedacht hatte. Man geht davon aus, dass er vom Dach des Hauptgebäudes gestürzt ist. Vermutlich ein Einbrecher.
Tot. Tot. Tot. Natürlich war er tot, als sie ihn gefunden haben. Ich versuchte, tief durchzuatmen, aber es half nichts. Das hier war etwas, was wir niemals rückgängig machen konnten. Etwas, was sich nicht wieder hinbiegen ließ. Jemand war tot, und es war einzig und allein unsere Schuld.
Schon jetzt war mir klar: Es würde uns auf ewig verfolgen.
Zehn Jahre später
DETECTIVE JULIA SCUTT
Ich halte hinter dem zweiten Streifenwagen an, der am Ende der langen, kurvenreichen Zufahrt parkt. Die Blinklichter tauchen die umstehenden Bäume in ein zuckendes Licht. An der Unfallstelle mehrere Meilen entfernt sind weitere Fahrzeuge im Einsatz. Sämtliche Wagen, die wir haben, sind ausgerückt, auch wenn das nicht viele sind in Kaaterskill, einer kleinen Stadt in den Catskills, etwa dreißig Fahrminuten entfernt von dem Wasserfall, dem sie ihren Namen zu verdanken hat.
Die Unfalldetails – wenn man denn von einem Unfall ausgeht –, die wir bislang kennen, sind schrecklich. Ein Beifahrer ist tot, der Fahrer wird vermisst und ist vermutlich verletzt, worauf das Blut an der offenen Fahrertür schließen lässt. Aber der Wagen steht sehr tief im Wald, weit entfernt von der Stelle, an der er augenscheinlich von der Straße abgekommen ist. Könnte darauf hinweisen, dass es sich möglicherweise doch nicht um einen Unfall handelt.
Während die Streifenpolizisten und die Suchtrupps den Wald durchkämmen und nach dem verschwundenen Fahrer Ausschau halten, habe ich mich in den frühen Stunden des Sonntagmorgens auf den Weg hierher gemacht. Zu dem Haus, in dem sich der Rest der Clique befindet. Alte College-Freunde, hat man mir mitgeteilt. Wochenendhausbesitzer. Dass es sich um Wochenendhausbesitzer handelt, lässt schon das Haus erkennen: modernisierter Luxus mit Türmchen und Rondellen und einer blitzsauberen Rundum-Veranda. Sogar die Zufahrt ist blitzsauber und mit glatten, runden Kieseln bedeckt.
Sie kommen aus der Stadt – Brooklyn, Manhattan, egal. Die Wochenend-Hipster sind alle gleich, Millennials mit massenhaft Geld, einer liberalen politischen Haltung und überkandideltem Geschmack. Die Einheimischen hassen sie, aber sie lieben das Geld, das diese Leute ausgeben.
Dass Wochenendgäste involviert sind, verkompliziert die Ermittlungen, vor allem, falls sich herausstellen sollte, dass es sich nicht nur um einen gewöhnlichen Autounfall handelt. Auch vor Kaaterskill macht das Verbrechen heutzutage nicht halt. Die meisten Straftaten haben etwas mit der Opioidschwemme zu tun, die überall in den Catskills zum Problem geworden ist. Und wenn ein Wochenendausflügler aus Manhattan hier zu Tode gekommen ist, kann man sicher sein, dass die New York Times lang und breit darüber berichten wird. Was dem Boss nicht sonderlich gefallen dürfte.
Als ich die Tür meines Streifenwagens öffne, fängt es an zu regnen. Tropfen, schwer und groß wie Murmeln, prasseln auf die Windschutzscheibe. Mist. Regen ist gar nicht gut, wenn wir Hunde einsetzen müssen.
Ich straffe die Schultern und gehe die Zufahrt entlang zum Haus. Als Frau hat man es schwer, sich bei polizeilichen Ermittlungen Autorität zu verschaffen, noch dazu, wenn man aussieht »wie eine Cheerleaderin mit Knarre«, wie mich ein unter Drogen stehender Autofahrer tatsächlich einmal bezeichnet hat. Allerdings habe ich hervorragende Instinkte und schrecke nicht davor zurück, mich so tief zu verbeißen, dass ich auf Knochen treffe. Zumindest behauptete das der Lieutenant. Bevor er sich in seiner Einfahrt den Kopf wegballerte, während im Haus seine Frau schlief – Opioide kennen keine sozialen Unterschiede.
Nächsten Monat will Chief Seldon entscheiden, wer seine Nachfolge antritt. Meiner Meinung nach sollte ich das sein. Ich kann die höchste Aufklärungsrate vorweisen. Aber Seldon hat seine Zweifel. Wenn du eine Frau bist, wird alles in deiner Vergangenheit hinterfragt, selbst Dinge, für die du keinerlei Verantwortung trägst, und dann wird dir der Stempel labil aufgedrückt, unauslöschbar, wie ein Tattoo.
Ich hole ein letztes Mal Luft, dann öffne ich die Haustür. Ich habe es im Griff, worum auch immer es gehen mag. Das weiß ich. Zumindest solange ich mir nicht selbst den Boden unter den Füßen wegreiße.
MAEVE
Endlich kamen die Bäume in Sicht, erst das Astwerk und dann die verschiedenen Blätter, die sich an den Rändern bereits orange verfärbten. Fast zwei Stunden lang waren die Wälder wie brau-grüne Streifen an unserem Autofenster vorbeigezogen, während wir drei über den kurvenreichen Taconic State Parkway Richtung Norden fuhren.
Ich dachte daran, wie ich über ebendiese Straße das erste Mal zum Vassar College gefahren war. Wie nervös ich mich damals gefühlt hatte – nervös und lebendig. Das College hatte für mich einen Neuanfang bedeutet, eine Chance, endlich der Mensch zu sein, der ich sein wollte. Und ich hatte meine Chance genutzt. Ich hatte sehr viel über mich selbst herausgefunden, von der erstklassigen Ausbildung mal ganz abgesehen. Das Wichtigste aber war, dass ich diesen unglaublichen Freundeskreis gefunden hatte. Wo wäre jeder Einzelne von uns jetzt ohne die anderen? Eine komplizierte Frage im Rückblick auf unsere Geschichte. Aber kompliziert war es bei uns immer. Was nie kompliziert war, war die tiefe Zuneigung, ja Liebe, die wir füreinander empfanden. Wir waren einander von Anfang an aufs Innigste verbunden gewesen, und wir waren es bis heute.
Keiner von uns hatte eine großartige Beziehung zu seiner richtigen Familie, aber ich war die einzige Waise, wenn auch aus freien Stücken – da bin ich ganz ehrlich. Ich hatte meine Eltern aus meinem Leben verbannt, weil sie mir gegenüber ein emotionales und körperliches Missbrauchsverhalten an den Tag gelegt hatten. Meine neuen Freunde kannten einige der schockierenderen Details, aber sie verurteilten mich nie. Sie akzeptierten mich voll und ganz, obwohl ich nach dem Bruch mit meinen Eltern verzweifelt finanzieller Unterstützung bedurfte und permanent knapp bei Kasse war.
Doch in diesem Augenblick kehrten wir nicht nach Vassar an den Campus zurück, trotz der vertrauten Kurven des Taconic State Parkways. Heute fuhren wir unselige zusätzliche fünfzig Meilen weiter nach Nordwesten, tief hinein in die Catskill Mountains. Jonathan hatte sich dort ein Wochenendhaus gekauft, ausgerechnet in Kaaterskill. Nicht gerade ein Ort, den ich mir ausgesucht hätte, aber es gab absolut keine Möglichkeit, sich vor diesem Wochenende zu drücken. Es hieß vielmehr: Alle Mann an Deck für Keith.
Und deshalb war ich hier, bereit, das zu tun, was ich am besten konnte: das Positive sehen. Das Positive an diesem Wochenende war, dass wir Keith helfen würden. Dass ich außerdem die Chance bekäme, Jonathan über Bates auszuhorchen, wäre ein weiterer Vorteil.
Jonathan hatte uns einander vorgestellt. Bates und er hatten sich an der Horace Mann School kennengelernt, und nun musste ich Jonathan doppelt dankbar sein – für meinen Freund und dafür, dass er mir einen sehr, sehr guten Job in der PR-Abteilung der Cheung Charitable Foundation verschafft hatte. Die Stiftung war ein Ableger des Hegdefonds seines Vaters.
Ich denke, meine Freunde waren überzeugt, dass ich wegen des Geldes mit Bates zusammen war. Dass ich versuchte, wieder das Luxusleben zu führen, das ich verloren hatte, als ich die Brücken zu meinen Eltern abbrach. Aber Bates hatte Goldman Sachs aufgegeben, um bei der Robin Hood Foundation zu arbeiten – es war ihm sehr wichtig, die Welt zum Guten zu verändern. Er war sogar ehrenamtlich für den Boys & Girls Club tätig – eine Non-Profit-Organisation, die außerschulische Programme für junge Menschen anbietet. Auch ich meldete mich freiwillig, dank ihm. Mit Bates zusammen zu sein, hatte mich zu einem besseren Menschen gemacht. Bates hatte mich nicht verurteilt für die Geschichten, die ich ihm über meine brutale Kindheit erzählte, denn er war ein warmherziger, unvoreingenommener Mann. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich den Eindruck, ich könnte in Gegenwart eines anderen Menschen wirklich ich selbst sein. Ganz so weit war ich zwar noch nicht, aber ich arbeitete daran.
Ich drückte den Knopf an der Mittelkonsole, ließ das Beifahrerfenster herunter und atmete die Luft des Hudson Valley ein, die nach Kamin und trockenen Blättern roch.
»Ich kann nicht glauben, dass du heiratest«, sagte ich und schaute zu Jonathan hinüber. Seine tiefbraunen Augen waren auf die Straße gerichtet, seine Lippen zusammengepresst. Oh, das war falsch rübergekommen. Beinahe negativ. Ich streckte den Arm aus und legte meine Hand auf seine. »Ich meine, ich freue mich für dich.«
Das entsprach der Wahrheit – ich freute mich tatsächlich für Jonathan. Er verdiente es, endlich mit jemandem zusammen zu sein, der seine Großzügigkeit verdient hatte. Denn Jonathan war mitunter zu großzügig, sogar mit uns. Ich hatte ihn unzählige Male gewarnt: Den Menschen allzu schnell das zu geben, was sie wollten, war keine Garantie dafür, dass sie einen auch liebten.
Jonathan lächelte, aber sein Lächeln wirkte ein wenig gezwungen. »Ich freue mich auch für mich.«
»Wann genau findet die Hochzeit eigentlich statt und wo?«, fragte ich und durchwühlte auf der Suche nach meinem Handy meine übergroße Hammitt-Tasche – schick, aber nicht zu protzig. Protzig war taktlos, wenn man für eine Stiftung arbeitete. Diesbezüglich hatte Bates recht.
Vermisse dich jetzt schon, tippte ich eilig, als ich das Smartphone gefunden hatte, und drückte auf Senden. Bates hatte in der vergangenen Woche sehr hart gearbeitet. Es war deshalb verständlich, dass er mich gestern Abend nach dem Essen nicht zu sich nach Hause eingeladen hatte. Trotzdem fiel es mir schwer, das unbehagliche Gefühl abzuschütteln, mit dem ich aufgewacht war. Vor allem jetzt, da ich den ganzen Tag über nichts von ihm gehört hatte. Dass ich bereits nervös war, machte es nicht besser. Ich musste unbedingt aufhören, permanent an diese anonyme E-Mail zu denken.
»Wir haben das Datum noch nicht festgelegt. Irgendwann im Mai oder Juni, denke ich.« Jonathan wedelte unbestimmt mit der Hand. »Wahrscheinlich heiraten wir in der Stadt. Du kennst meine Eltern: Gott bewahre, dass sie Manhattan verlassen müssen.«
»Ihr habt den Mai oder Juni ins Auge gefasst?«, fragte Stephanie vom Rücksitz aus. Sie hatte endlich die Telefonkonferenz beendet, die uns seit fast einer Stunde zum Schweigen verdonnert hatte. »Du solltest die Details so schnell wie möglich festzurren, Jonathan Cheung, wenn du nicht willst, dass dich die New Yorker Hochzeitsmaschinerie bei lebendigem Leibe verschlingt.«
Ich war ein kleines bisschen neidisch, weil Jonathan eine Hochzeit plante. Bates und ich waren zwar erst seit vier Monaten zusammen, es war also noch viel zu früh, um an einen Antrag zu denken, doch in Wahrheit hoffte ich tatsächlich auf etwas mehr Tempo. Das war das Problem, wenn man so viel von dem bekam, was man sich wünschte – am Ende wollte man immer noch mehr.
»Peter und ich sind eben gern spontan«, hielt Jonathan dagegen.
»Das ergibt Sinn«, sagte ich, obwohl ich mir da nicht so sicher war.
»Wie weit ist es denn noch bis zu deinem Haus?«, wollte Stephanie wissen. »Nichts für ungut, aber hier hinten fühlt man sich wie in einem U-Boot. Musstest du einen Aufpreis bezahlen, damit deinen Mitfahrern auf alle Fälle übel wird?«
Stephanie hatte Jonathan aufgezogen, seit er mit seinem brandneuen Tesla vor uns angehalten hatte. Der teure Wagen war untypisch für ihn. Für gewöhnlich stellte er seinen Reichtum, der selbst für privilegierte Vassar-Standards augenfällig war, nicht zur Schau. Jonathans Vater lebte nach der Devise, dass es wichtiger war, Geld zu verdienen, als die Leute wissen zu lassen, dass man welches hatte. Ich denke, das war sein wahres Problem mit Jonathan: Er war ihm nicht ehrgeizig genug, schon gar nicht im Vergleich mit seinen absolut liebenswerten, ungleich tatkräftigeren älteren Schwestern.
»Nur noch ungefähr fünfzehn Minuten.« Jonathan schloss die Hände fester ums Lenkrad. Er machte sich definitiv Sorgen – wegen des Wochenendes, wegen Keith. Wir alle machten uns Sorgen.
»Okay, aber ich warne dich, ich habe den ganzen Tag über noch nichts gegessen.« Stephanies niedriger Blutzuckerspiegel verwandelte ihre spitzen, doch stets lustigen Bemerkungen in Stacheln, die blutige Spuren hinterließen.
Ich blickte auf meine Hundert-Dollar-Acrylnägel, die auf meiner perfekten Wochenendhose von Theory lagen – ergattert im Schlussverkauf bei Saks. Auf dem College hatte mir Stephanie manchmal vorgehalten, dass ich mich zu sehr auf Äußerlichkeiten fokussieren würde – teure Besitztümer, schöne Menschen –, und vielleicht war ich tatsächlich ein wenig oberflächlich gewesen. Doch damals hatte ich nicht einmal ansatzweise so ausgesehen wie jetzt und hatte immer gedacht, was für ein Privileg es doch war, über solchen Dingen zu stehen. Mitunter dachte ich immer noch so. Man musste sich doch nur mal Jonathan anschauen – er machte sich nichts daraus, Geld zu verdienen, weil er es nicht nötig hatte.
Ich konzentrierte mich wieder auf den Blick aus dem Fenster. Um uns herum gab es nichts als Bäume, Bäume und noch mehr Bäume. Ihre knorrigen Äste und Zweige waren voller spektakulär gefärbter Blätter, die uns vor der Sonne abschirmten. Schön, aber ein wenig ominös. Ich ließ mein Handy zurück in die Handtasche gleiten.
»Wir sollten die restliche Zeit nutzen, um uns eine Strategie zurechtzulegen«, schlug Jonathan vor. »Derrick und Keith dürften nicht weit hinter uns sein.«
»Eine Strategie?«, spottete Stephanie.
Als ich einen Blick nach hinten warf, sah ich, dass sie tief in den Rücksitz gerutscht war, die Ärmel ihrer modischen Anzugjacke hochgeschoben und die High Heels abgestreift hatte. Ihre Arme waren fest vor der Brust verschränkt, was sie aussehen ließ wie ein mürrisches Kind. Stephanie war schon immer groß gewesen und apart wie ein Supermodel, und der momentan angesagte natürliche Look unterstrich ihre großen, bernsteinfarbenen Augen, die hohen Wangenknochen und die hellbraune Haut nur noch mehr. Doch Stephanies Schönheit war seit jeher unerreichbar – sinnlos, sie zu begehren. Obwohl ich genau das mitunter immer noch tat.
Jonathan beäugte Stephanie im Rückspiegel. »Wenn es funktionieren soll, müssen wir eine einheitliche Front bilden.«
»Wir sind uns doch einig«, warf sie ein. »Keith muss einen Entzug machen, daran besteht kein Zweifel.«
»Und wir werden ihn dazu bringen«, sagte ich mit weit mehr Überzeugung, als ich tatsächlich empfand. Schließlich war ich diejenige, die Keith beim letzten Mal dazu gedrängt hatte. Ich hatte den Ausdruck in seinen Augen gesehen, und ich wusste, dass er verzweifelt von dem Zeug loskommen wollte.
»Warte, was zum Teufel ist das?« Stephanie deutete mit ihrem langen Zeigefinger nach links.
Oben auf einem Hügel, ein kleines Stück zurückversetzt von der Straße, stand ein uraltes Bauernhaus, das komplett in sich zusammengefallen war. Übrig geblieben war nur eine Hülle aus zersplitterten Brettern, zerbrochenen Fenstern und einem abblätternden Lattenzaun. Ringsherum befanden sich mehrere Nebengebäude, die nicht viel vertrauenerweckender wirkten. Wirklich bedrohlich aber sah die Baracke davor, am Fuß des Hügels, aus: ein niedriger, rechteckiger Kasten, vermutlich eine ehemalige Scheune, der sich nach links neigte und mit seinen Sperrholzverschlägen an ein provisorisches Motel erinnerte. Dem Anschein nach lebten dort Menschen: Drinnen brannte Licht, eine der Türen war ein kleines Stück geöffnet. Draußen lagen überall Kleidungsstücke, an einem Ende des Kastens türmte sich ein großer Müllberg – Flaschen, Dosen, Essensbehälter.
Als wir daran vorbeifuhren, erblickte ich hinter der Scheune ein großes Lagerfeuer, in dessen Schein zwei dürre Gestalten hockten.
»Ich kann nicht glauben, dass dort jemand wohnt«, sagte ich. »Ich meine – das ist so traurig …«
Jonathan zuckte die Achseln. »Es gibt hier draußen jede Menge Opioid-Abhängige, und nicht jeder hat Freunde wie uns, die für sie da sind. Oder die Kosten für den Entzug übernehmen. Keith muss die Mittel dafür nicht selbst auftreiben.«
»Ich möchte ehrlich sein, Jonathan, die Umgebung ist weniger charmant, als ich sie mir vorgestellt habe«, ließ sich Stephanie vernehmen. »Wie in einem Horrorfilm, bei dem man von vornherein weiß, dass die schwarzhäutige Freundin als Erste stirbt.«
»Hier stirbt niemand«, sagte ich. »Darüber macht man keine Witze.«
»Ähm, ich mache keine Witze«, stellte sie klar. »Hilf mir doch noch mal auf die Sprünge, Jonathan: Warum hast du diesen Ort hier gewählt, wenn du mit deinen schier unerschöpflichen finanziellen Ressourcen praktisch an jedem anderen Platz der Welt ein Haus hättest kaufen können?«
»Seltsam, Maeve hat mich dasselbe gefragt – mehr als einmal.« Er warf einen Blick in meine Richtung.
»He, ich habe es nur nett gemeint«, sagte ich und hob abwehrend die Hände. »Ich wollte sichergehen, dass du es dir genau überlegt hast, das ist alles. Die Gegend hier ist schon ein wenig … abgeschieden.« Was absolut stimmte.
»Peter und ich hatten Montauk in Erwägung gezogen, aber Montauk ist so furchtbar angesagt.«
»Und da hast du dich stattdessen für Methadon Valley entschieden?«, nörgelte Stephanie.
»Auch unsere Freunde Justin und Bill haben ein paar Orte weiter gerade ein Haus gekauft. Ihr wisst doch, die mit dem Restaurant in der Perry Street.« Ich nickte, als er mir einen Seitenblick zuwarf, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass er je einen Justin oder einen Bill erwähnt hatte. »Die beiden sind schon seit Ewigkeiten verheiratet.«
Vermutlich waren sie mehr Peters Freunde als Jonathans. Man konnte Jonathan zwar nicht gerade als ungesellig bezeichnen, aber neben der Stimmungskanone Peter mit seinem Waschbrettbauch und dem unwiderstehlichen Surfer-Charme wirkte jeder introvertiert.
Als wir uns der kleinen Stadt näherten, wichen die Bäume Häusern, die dicht zusammenstanden und eher klein waren, doch wenigstens nicht verfallen. Auf der rechten Seite befand sich eine Cumberland-Farms-Tankstelle mit einem kleinen Supermarkt, einer Pizzeria und diversen Markt- und Fast-Food-Ständen. Als wir vor einer roten Ampel anhielten, sahen wir einen drahtigen, alten Weißen mit Baseballkappe und einem langärmeligen Gatorade-T-Shirt an einer der Zapfsäulen stehen. Er musterte argwöhnisch unseren Wagen. Ich wandte mich ab, als sich unsere Blicke trafen.
»Der Kaffee ist gar nicht so schlecht bei denen«, verkündete Jonathan munter. »Als Peter mir das erzählte, habe ich gelacht. Und dann haben wir uns gestritten, weil ich angeblich so ein Snob bin. Keine Ahnung, vielleicht bin ich das tatsächlich. Wie dem auch sei, Peter hatte recht mit dem Kaffee. Die Leute, die dort arbeiten, sind ebenfalls nett. Leider sind nicht alle in Kaaterskill so freundlich zu den Wochenendhausbesitzern.«
»Was soll das heißen?«, fragte ich, unfähig, dem Drang zu widerstehen, mein Handy erneut aus der Tasche zu ziehen und nachzusehen, ob mittlerweile eine Nachricht von Bates eingegangen war. Noch immer nichts.
»Die Einheimischen sind nicht von der fortschrittlichsten Truppe, und die Wochenendgäste, mich inbegriffen, können anspruchsvoll und unsensibel sein. Nehmt zum Beispiel dieses Auto.« Er schüttelte den Kopf. »Damit hierherzufahren ist im Grunde so, als würde man mit einer Arschloch-Fahne wedeln.«
»Immerhin gibst du hier Geld aus«, stellte Stephanie diplomatisch fest. »Das müsste doch in ihrem Sinne sein.«
»Sie interessieren sich nur für die Vorteile, ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu wollen. Genau wie alle anderen«, erwiderte Jonathan. »Wir sind übrigens gleich da, und das Haus ist bezaubernd, Stephanie. Warte, bis du die Kamine siehst.«
»Ich hoffe, du hast etwas zu essen da«, sagte sie. »Und sollte ich irgendwo eine MAKE-AMERICA-GREAT-AGAIN-Kappe entdecken, mache ich umgehend die Fliege.«
Wir bogen links in die Main Street ein, die von entzückenden Geschäften gesäumt war: Pilates Perch, Patisserie Lenox, De-Marchin-Antiquitäten; außerdem entdeckte ich eine hübsche Teestube. Die holzverkleideten Ladenfronten waren in leuchtenden Farben gestrichen und mit originellen, ansprechenden Schildern versehen. Dazwischen gab es allerdings immer wieder dunkle Eingänge und mit Brettern zugenagelte Schaufenster. Je weiter wir fuhren, desto häufiger tauchten sie auf, wie die Symptome einer sich schnell ausbreitenden Infektion.
»Die Innenstadt ist wirklich allerliebst, Jonathan«, sagte ich. »Wir sollten später noch einmal herfahren und einen Spaziergang machen.«
»Wird die malerische Tour stattfinden, bevor oder nachdem wir Keith in den Kofferraum gestopft und ins Bright Horizons gebracht haben?«, fragte Stephanie, deren Ton jetzt eher traurig als sarkastisch klang.
»Nun mach mal halblang«, beschwichtigte ich sie. »Wir haben es doch schon einmal geschafft, ihn ohne jede Gewaltanwendung zu einem Entzug zu bewegen. Und wenn wir Keith diesmal nicht überzeugen, gibt es immer noch ein nächstes Wochenende, richtig? Zumindest haben wir dann den Dialog eröffnet.«
»O nein. Keith muss in die Klinik, und zwar an diesem Wochenende«, widersprach Jonathan nervös. »Bis Montag. Wenn nicht, zieht mein Vater den Kredit zurück, und dann verliert Keith die Galerie – das ist euch klar, oder? Dad hielt den Kredit schon für ›kriminell großzügig‹, bevor er herausfand, dass Keith süchtig ist. Jetzt schäumt er, denn seiner Ansicht nach ist es eine Schande, dass ich überhaupt einen Freund wie Keith habe. Weitaus beschämender ist allerdings, dass ich zugelassen habe, dass er meinen alten Herrn derart ausnutzt. Die einzige Möglichkeit, ihn zu beschwichtigen, besteht darin, Keith in die Entzugsklinik zu verfrachten.«
Es erstaunte mich nicht, dass Jonathans Vater sauer war. An seiner Stelle wäre ich ebenfalls außer mir gewesen. Keith verwendete einen Teil des geliehenen Geldes definitiv dafür, seinen Drogenkonsum zu finanzieren, und zwar ziemlich unverhohlen.
»Vielleicht hat dein Dad recht«, gab Stephanie zu bedenken. »Keith steckt mittlerweile tiefer in der Patsche als je zuvor. Manchmal habe ich den Eindruck, er versucht, sich umzubringen.«
»Überrascht dich das?«, fragte Jonathan.
»Es ist jetzt zehn Jahre her – wie lange soll Alice Keith denn noch als Vorwand dienen?«, entgegnete Stephanie.
»Keine Ahnung«, erwiderte Jonathan. »Für immer?«
»Wir haben sie alle sehr gemocht«, fuhr Stephanie fort. »Es geht jedem von uns schlecht bei der Vorstellung, was mit ihr passiert ist, aber irgendwann muss mal Schluss sein.«
»Das ist richtig«, pflichtete ich ihr bei. »Allerdings hat Keith sie geliebt, weshalb ihm das Ganze am meisten zugesetzt hat.«
»Dann ist Alice also unsere Ausrede dafür, ihm immer wieder einen Freifahrtschein zu geben?«, wollte Stephanie wissen. »Fühlen wir uns so schuldig, dass wir es zu gut mit ihm meinen?«
Wir schwiegen für eine Weile.
»Entzug«, sagte ich schließlich bestimmt. »Wir müssen ihn nur dazu bringen, sich einweisen zu lassen, dann lassen wir die Profis übernehmen. Diesmal wird es funktionieren.«
Ich glaubte tatsächlich daran. Das letzte Mal, als wir Keith dazu überredet hatten – als ich Keith dazu überredet hatte –, war es offensichtlich zu früh gewesen. Seit unserem Abschluss war gerade mal ein Jahr vergangen. Achtzehn Monate zuvor war der Wagen, den Alice gefahren hatte, leer in der Nähe der Kingston-Rhinecliff Bridge entdeckt worden. Sechzehn Monate danach stufte man ihren Tod offiziell als Selbstmord ein, obwohl ihr Leichnam nie gefunden wurde. Ich stellte mir vor, wie ihr Skelett – vom Wasser gebleichte, glatt geschliffene Knochen – auf dem Grund des Hudson River zwischen Felsbrocken klemmte, und schauderte.
»Maeve hat recht«, sagte Jonathan. »Wir müssen Keith ins Bright Horizons schaffen, das ist alles. Wir schaffen das. Ich weiß, dass wir das schaffen.«
Der Sonnenuntergang überzog den Himmel bereits mit orangefarbenen Streifen, als Jonathan endlich vor einer hohen, perfekt getrimmten Hecke abbremste. Dahinter waren die Kronen Dutzender hoher Bäume zu sehen. Erst als wir auf die gekieste Zufahrt einbogen, kam das Haus selbst in Sicht: ein atemberaubendes Gebäude im Queen-Anne-Stil mit Ecktürmchen, Vordächern, Balkonen und einer breiten, rundum verlaufenden Veranda. Vier Schaukelstühle aus Holz neben der jagdgrün gestrichenen Haustür vervollständigten das Bild. Mir blieb die Luft weg.
Wir fuhren näher heran, und ich konnte sehen, dass die Fenster für ein älteres Haus wie dieses außergewöhnlich groß waren, als hätte man sie nachträglich eingebaut. Die scharfen, präzisen Kanten, das quadratische Dach, die perfekt rechteckigen Eingangsstufen verliehen ihm ein unerwartet modernes Aussehen. Drinnen brannten bereits mehrere Lampen, was bei dem schnell schwindenden Tageslicht warm und einladend wirkte. Laut Jonathan hatte Peter bereits alles für unsere Ankunft vorbereitet. Peter mochte vielleicht nicht perfekt sein, aber er kümmerte sich gut um Jonathan.
»Ich freue mich so, dass du und Peter einander gefunden habt«, sagte ich. »Eure Beziehung ist …«
Beneidenswert. Aber das sprach ich nicht aus. Jonathan war mein Freund. Ich freute mich für ihn.
»Er kann froh sein, dass er dich hat, Jonathan. Genau wie wir alle.« Stephanie schlang ihre Arme von hinten um Jonathan. So lockte sie einen jedes Mal aus der Deckung – ohne Vorwarnung legte sie ihre Rüstung ab, und dann war man ihr ausgeliefert. »Wahre Liebe – wenigstens einer von uns hat sie gefunden.«
»Komm schon, Derrick hat Beth«, sagte Jonathan todernst.
Und zum ersten Mal, seit wir New York verlassen hatten, fingen wir alle an zu lachen.
DETECTIVE JULIA SCUTT
Officer Nick Fields steht am Eingang, die Hand auf der Waffe, als ich das Haus betrete. Himmelherrgott. Fields sollte niemals eine Tür sichern. Er ist alt für einen Streifenpolizisten, hat einen grau melierten Schnäuzer und einen dicken Bauch, und er ist viel zu nervös für Außeneinsätze.
Ich begegne seinem Blick. »Wo sind sie?«
»Da entlang.« Er deutet mit seinem fetten Daumen über die Schulter auf eine offene Tür. »Wirken ziemlich erschüttert.«
»Verständlich.« Einer ihrer Freunde ist tot, ein weiterer wird vermisst, und wir wissen noch nicht einmal, wer wer ist. Ich nicke Fields zu und gehe an ihm vorbei. »Pass auf, dass du niemanden erschießt.«
Als ich das Wohnzimmer durchquere, fallen mir die teuren Teppiche, die exquisiten Möbel und die angesagten Bildbände ins Auge. Eine Wand ist mit einer breit gestreiften, blauen Tapete bedeckt; neben einem schmalen Beistelltisch steht ein frisch aufgepolsterter, antiker Sessel. Alles ist auf diese perfekte Art zusammengewürfelt, die reiche Leute zu lieben scheinen – elegant, aber gemütlich. Und höllisch teuer.
Die meisten Einheimischen würden diesen Wochenendhausbesitzern jeden einzelnen Quadratzentimeter missgönnen. Ich verstehe das. Ich weiß aber auch, dass Geld die Menschen nicht zwingend zu Monstern macht. Deshalb habe ich Hudson verlassen, wo ich aufgewachsen bin – auf der anderen Seite des Flusses gelegen und ein bisschen größer als Kaaterskill –, und bin an die University of California gegangen; anschließend war ich ein Jahr lang bei einem Hightech-Start-up in San Francisco tätig.
Das alles habe ich für meine Mom getan. Ich habe immer gewusst, dass ich einmal zur Polizei gehen würde – hier, in Kaaterskill. Als ich nach Hause zurückkehrte, um mich bei der Polizeiakademie einzuschreiben, wollte meine Mom wissen, warum ich mich für einen so gefährlichen, schlecht bezahlten Job entschied, wo mir doch sämtliche Möglichkeiten offenstanden. Natürlich kannten wir beide die Antwort auf diese Frage. Wir waren bloß ziemlich überzeugend, wenn wir so taten, als wäre dem nicht so.
Meine Gedanken schweifen unvermittelt dorthin. Zu der ganzen Sache. Verdammt. In letzter Zeit braucht mein Gehirn nur den kleinsten Impuls. Das liegt an diesem dämlichen Podcast. Die letzte Folge wurde vor ein paar Wochen ausgestrahlt, und seitdem spricht die gesamte Stadt darüber. Es ist schwer, das auszublenden. Aber ich werde verflucht noch mal nicht zulassen, dass mich irgendwer mit seiner perversen Vorstellung von Unterhaltung aus der Bahn wirft, nicht nach so langer Zeit. Es ging mir gut. Es geht mir gut. Und das soll auch so bleiben.
Ich betrete ein großes Wohnzimmer. Zwei rote Ledersofas stehen einander gegenüber, zwei Frauen – eine weiß, die andere schwarz – und ein ostasiatischer Mann, alle Ende zwanzig, Anfang dreißig, sitzen dicht beisammen. Sie sind attraktiv und strahlen Wohlstand aus – Glamour, um genau zu sein –, mit ihrer Kleidung und ihrer Attitüde. Allerdings wirken sie sichtlich aufgewühlt, ihre Augen sind glasig und rot gerändert. Ich hebe den Blick, sehe mich um und entdecke am gegenüberliegenden Ende des Raumes die beiden Officer Tarzian und Cartright, die in Richtung der Sofas nicken.
Ich wende mich wieder den drei Wochenendgästen zu. »Detective Julia Scutt.«
Sie stellen sich vor – Stephanie Allen, Jonathan Cheung, Maeve Travis – und bieten mir an, sie beim Vornamen zu nennen.
»Wissen Sie schon, wen Sie gefunden haben?«, erkundigt sich Stephanie und zieht die goldgefleckten Augen schmal. Ihre Frage klingt leicht vorwurfsvoll. Alles, was wir im Augenblick wissen, ist, dass Derrick Chism und Keith Lazard – beide weiß, beide dreißig Jahre alt, beide ungefähr eins achtzig groß – vermisst werden. Vermutlich handelt es sich bei unserem Toten um einen der zwei Männer.
»Der Wagen gehört Derrick, dann wird er wohl auch gefahren sein«, sagt Jonathan, den Blick auf seine Freundinnen geheftet. Er trägt eine von diesen Strickbeanies, die die Hipster so lieben. Die Mütze bringt seine eleganten Wangenknochen und den vollen Mund zur Geltung, trotzdem wirkt sie ein bisschen albern.
»Es sei denn, Derrick hat Keith gebeten, dorthin zu fahren«, wirft Stephanie ein.
»Wenn Sie uns hinbringen, könnten wir Sie bei der Identifizierung unterstützen«, bietet Jonathan an.
»Das ist leider nicht möglich. Die Gegend ist nicht sicher. Wir wissen nicht, ob es sich tatsächlich um einen Unfall handelt oder ob wir es mit einem bewusst herbeigeführten Vorfall zu tun haben. In diesem Fall befände sich ein potenziell gefährlicher Tatverdächtiger auf freiem Fuß.« Das ist reine Spekulation, aber ich werde die drei auf keinen Fall zur Unfallstelle führen. Ihre bloße Anwesenheit könnte die Ermittlungen beeinträchtigen und sie als Zeugen unbrauchbar machen, vorausgesetzt, ich halte sie nicht per se für verdächtig, was ich im Augenblick noch nicht weiß.
»Dann sind Sie also nicht der Ansicht, dass es ein Unfall war?«, fragt Stephanie.
»Die Position des Fahrzeugs spricht dagegen«, sage ich.
»Was bedeutet das genau?«, will Jonathan wissen.
»Es bedeutet, dass es sich womöglich nicht um einen Unfall handelt«, antworte ich. »Ich werde veranlassen, dass Sie die Fotos der Spurensicherung sichten können. Vielleicht können Sie Ihren Freund auf diese Weise identifizieren. Sie sollten allerdings wissen, dass er schwere Gesichtsverletzungen davongetragen hat, die eine Identifizierung eventuell unmöglich machen.«
Ich möchte sie nicht noch mehr aufregen, aber ich will ihren Fokus von der Identifizierung abziehen. Natürlich ist das wichtig, aber im Moment ist es viel wichtiger, dass ich einen Eindruck bekomme, was zum Teufel hier passiert sein könnte.
»Das ist furchtbar«, sagt Maeve. Sie sieht aus, als wäre ihr übel. Benommen starrt sie auf ihre zarten, manikürten Hände und dreht die Ringe an ihren Fingern. Sie wirkt noch zurechtgemachter als die beiden anderen, mit ihrem maßgeschneiderten Outfit und den perfekten Fingernägeln. Als würde sie sich ein klein wenig mehr Mühe geben, weil sie nicht ganz so attraktiv ist. Sie zählt zu den Frauen, die man schon einmal gesehen zu haben glaubt, doch man weiß nicht mehr, wo. »Ich denke nicht, dass ich die Fotos sehen möchte.«
Alle drei machen gequälte Gesichter und schweigen für einen Moment. Ich kann mir vorstellen, wie sie sich fühlen, und es tut mir leid. Offenbar sind sie zutiefst aufgewühlt.
»Ich schlage vor, wir lassen erst einmal einen Fingerabdruckabgleich vornehmen und sehen dann weiter. Vielleicht brauchen wir Sie gar nicht für die Identifikation. Die beiden müssen ja nicht zwingend ein Vorstrafenregister haben, um in der Datenbank gespeichert zu sein, oftmals genügen schon bestimmte Dokumente oder Arbeitgeber, die einen Hintergrundcheck verlangen …«
Ich lasse meine Worte verklingen und warte ab, ob jemand aufspringt und mit irgendwelchen Vorstrafen aufwartet.
»Sie könnten doch einfach die Fingerabdrücke mit denen vergleichen, die Sie auf Keith’ und Derricks Sachen finden«, schlägt Jonathan vor.
»Das ist schwieriger, als man annimmt. Wir brauchen auch noch einen DNA-Test, doch laut der Officer« – ich nicke in Cartrights und Tarzians Richtung – »befinden sich Ihre Zahnbürsten und Waschutensilien alle zusammen in einem Badezimmer, sodass wir nicht wissen, was wem gehört. Können Sie die Sachen unterscheiden?«
Sie schütteln alle drei den Kopf.
»Wenn alles andere nicht greift, können wir immer noch zu den beiden nach Hause fahren, um DNA für den Abgleich sicherzustellen. Aber eins nach dem anderen. Es ist durchaus möglich, dass Ihr vermisster Freund jeden Moment auftaucht. Mir ist bewusst, wie schwierig die Situation für Sie ist, dennoch bitte ich Sie um Geduld. Wäre es möglich, dass Sie diesem Officer«, ich deute auf Cartright, »Ihre vollen Namen, Adressen und Geburtsdaten nennen? Und bitte teilen Sie uns alles mit, was Sie über Ihre zwei Freunde wissen. Jedes noch so unbedeutend erscheinende Detail könnte hilfreich sein.«
Cartright zögert – als wäre eine solch niedere Aufgabe unter seiner Würde. Cartright ist ein Arschkriecher und überzeugter Seldon-Anhänger. Als ich ihn anfunkele, tritt er endlich vor, Notizblock und Kugelschreiber in der Hand.
»Das ganze Programm«, sage ich zu ihm, womit ich meine, dass er sie alle überprüfen soll, nicht nur die beiden vermissten Männer. Ich hoffe, Cartright begreift, was ich von ihm will.
»Dann gehen Sie also davon aus, dass derjenige …« Jonathan versagt die Stimme. Er räuspert sich. »… dass derjenige, der nicht tot ist, irgendwo da draußen herumirrt? Aber wo sollte er sein?«
»Suchtrupps durchkämmen die Wälder«, versichere ich ihm. »Wir werden ihn finden.«
»Wie viele Polizisten können Sie in dieser Gegend für die Suche abstellen?« Stephanie steht auf und fängt an, im Zimmer auf und ab zu tigern. »Sämtliche verfügbaren Kräfte müssen raus. Sie müssen den Überlebenden finden, bevor es zu spät ist.« Sie bleibt stehen, verschränkt die Arme vor der Brust und sieht mich mit gerunzelter Stirn an. »Wenn Keith oder Derrick etwas zustößt, weil Sie nicht schnell genug waren, sind Sie dafür verantwortlich.«
Ich lasse mir nicht anmerken, wie verärgert ich bin. »Keine Sorge, wir haben genügend Leute. Ein spezieller Suchtrupp der State Police ist im Einsatz …«
»Es war meine Idee«, fällt Jonathan mir ins Wort. Er scheint plötzlich zu schrumpfen, als wollte er in der Couch verschwinden. »Dass er hergekommen ist, meine ich. Das ist mein Haus. Wir sind hier, um meinen Junggesellenabschied zu feiern.«
Ein Junggesellenabschied? Nun, das wirft ein anderes Licht auf die Sache.
»Was passiert ist, hat nichts mit deinem Junggesellenabschied zu tun«, stellt Stephanie klar. Ihr Ton ist scharf. Sie reckt das Kinn vor. »Das ist völlig irrelevant.«
»Ich möchte nur sichergehen, dass sie die Fakten kennt.« Er weicht Stephanies Blick nicht aus. Vielleicht ist er doch nicht so ein Schwächling, wie es auf den ersten Blick scheint.
»O Gott!«, stößt Maeve hervor und wird blass. »Ich kapier’s einfach nicht. Das ist so … Die beiden waren doch gerade noch hier.«
»Genau deshalb benötigen wir Ihre Hilfe«, sage ich.
»Die zwei sind unsere besten Freunde.« Stephanie sieht die anderen an, dann wieder mich. »Wir sagen Ihnen alles, was Sie wissen möchten, Detective.«
STEPHANIE
Ich sah Jonathan die Vordertreppe hinaufsteigen, in seiner hautengen Jeans und einem leuchtend orangefarbenen Kaschmirpulli – Peters Einfluss. Wäre es nach ihm gegangen, hätte Jonathan sich gekleidet, als wäre er einem Brooks-Brothers-Katalog entsprungen – überdimensionierter Preis, unterdimensionierter Sinn für Mode. Ich verspürte einen absurden Anflug von Neid. Wünschte ich mir etwa auch einen Freund, der meine Kleidung aussuchte?
»Wissen wir, wann Keith und Derrick eintreffen?«, fragte Maeve.
Ich schaute die kurvenreiche Zufahrt hinunter, die totenstill in der Dunkelheit lag. Wegen der Bäume war es schlagartig dunkel geworden. »Wir wissen ja noch nicht einmal mit Sicherheit, ob sie die Stadt verlassen haben«, erwiderte ich. Keith tauchte häufig mal ab, scheinbar willkürlich, erwiderte unsere Anrufe nicht, tat so, als gäbe es uns nicht mehr. Typischer Süchtigen-Nonsens. Wir sollten lieber darauf gefasst sein.
»Keith hat mir heute Morgen eine Textnachricht wegen des Junggesellenabschieds geschickt«, sagte Jonathan mit einem Blick über die Schulter und suchte dann im Licht der Außenlampe nach dem richtigen Schlüssel. »Er hat behauptet, er freue sich darauf, was durchaus ermutigend ist.«
»Wo du das Thema gerade anschneidest: Wie lange willst du diese Junggesellenabschied-Scharade eigentlich noch durchziehen?«, wollte ich wissen. »Ist das nicht lediglich ein Aufschub des Unausweichlichen?«
»Wir hätten im Wagen darüber reden können, wärst du nicht die ganze Fahrt über am Telefon gewesen«, frotzelte Maeve und riss erschrocken die Augen auf, als ich ihr einen finsteren Blick zuwarf. Sofort ruderte sie zurück. »Komm schon, Steph, ich mache doch nur Spaß.«
Maeve konnte die Vorstellung, dass irgendwer sauer auf sie war, nicht ertragen. Sie würde sich ein dickeres Fell zulegen müssen, wenn sie als Upper-East-Side-Trophäenfrau überleben wollte. Solche Frauen konnten gnadenlos sein. Allerdings waren ihre Erstsemesterkommilitonen aus Charleston vermutlich auch nicht besonders kuschelig gewesen.
Und Maeve hatte recht, was das Telefonat betraf: Ich hätte es verschieben sollen. Ich vergrub mich in Arbeit, wenn mir nicht nach Gesellschaft zumute war – ein Trick, den ich von meinen arbeitsbesessenen Professoreneltern gelernt hatte. Und während der vergangenen Wochen war ich definitiv allem und jedem aus dem Weg gegangen.
»Tut mir leid wegen der Telefonkonferenz«, sagte ich. »Das war blöd von mir.«
»Ich schicke Keith eine Textnachricht und frage, wo sie sind«, bot Maeve an. Sie blickte aufs Handy, und für eine Sekunde verdüsterte sich ihr Gesicht – vermutlich ging es um Bates –, doch es gelang ihr, ein Lächeln aufzusetzen, als sie eine kurze Nachricht eintippte.
Jonathan öffnete die Haustür. »Willkommen in Locust Grove!«, rief er mit einer Verbeugung und winkte uns hinein.
Das Haus duftete nach Geißblatt mit einem Hauch Zitrone – vielleicht war das auch nur den umweltfreundlichen Putzmitteln geschuldet. Mobiliar und Einbauten hielten eine Balance aus modernem Flair und rustikalem Bauernhaus, wie der abstrakt gemusterte Teppich im Eingangsbereich mit dem antik aussehenden Tisch, der wiederum vollgepackt war mit einer eklektischen Sammlung an Kunstbüchern und einer Steinurne voller frischer Äpfel. Natürlich war es wunderschön, wie jedes Haus, in dem Jonathan je gewohnt hatte. Hier allerdings wirkte der Dekor persönlicher, als wäre jedes einzelne Stück liebevoll ausgewählt worden.
»Es ist großartig, Jonathan«, sagte ich, und das war es.
Doch als ich mich weiter im Locust Grove umsah, fühlte ich mich leer. Ich kam nicht umhin, das Haus mit meinem stylishen Apartment in Midtown Manhattan zu vergleichen, das ich in erster Linie deshalb gemietet hatte, weil es in der Nähe von meinem Büro lag. Meine Einrichtung stammte aus einem der lässig eleganten Möbel-Outlets, die man in jeder Vorstadt-Mall findet, manches hatte ich praktischerweise online bestellt. Es war ein nettes Apartmenthaus mit einem netten Gym, das ich nie benutzte, netten Portiers, deren Namen ich nicht kannte, und voller Dinge, die so nett waren, dass ich, ohne in Verlegenheit zu geraten, Gäste zu mir einladen konnte – was ich ohnehin nie tat.
Jonathan ließ lächelnd den Blick schweifen. »Peter hat alles selbst hergerichtet. Ihr hättet das Haus sehen müssen, als wir es gekauft haben. Ein reines Desaster!«
Aus dem Wohnzimmer drang ein seltsames Rascheln. Eine Maus? Wir spähten angespannt in die entsprechende Richtung.
»Buh!«
Ich zuckte zurück und stieß mir den Kopf an der Wand hinter mir. Ein Mann tauchte auf der Türschwelle auf und lachte. Für einen Moment weigerte sich mein Gehirn, sein Gesicht zuzuordnen.
Dann erkannte ich ihn. Finch. Ja, er war es, definitiv. Der Star unter Keith’ Künstlern. Direkt vor uns, in Fleisch und Blut. Grauenhaft.
»Entschuldigung, Entschuldigung!« Keith tauchte neben Finch auf, die Augen weit aufgerissen, das braune Haar verwegen zerzaust, in Anzugjacke, Jeans und einem grün karierten Button-down-Hemd. Seine Galerie-Kluft. »Das war eine schlechte Idee von Finch.«
»Keith, was zum Teufel …?«, rief Maeve mit bewundernswert fester Stimme.
»Kommt schon, es war doch lustig«, hielt Finch mit einem verschlagenen Grinsen dagegen, bei dem seine perfekten Zähne aufblitzten – zum Glück nicht in meine Richtung.
Das Licht aus dem Wohnzimmer erleuchtete seinen Rücken und überzog sein volles, schulterlanges Haar mit einem goldenen Schimmer, der an einen Heiligenschein erinnerte. Seine grünen Augen funkelten – ein eindrucksvoller Mann, daran gab es nichts zu rütteln. Allerdings war er für meinen Geschmack zu geschniegelt, mit seinen weißen Dreihundert-Dollar-T-Shirts, dem leichten Bartschatten und der stets gebräunten Haut. Außerdem war er abscheulich arrogant.
Das letzte Mal war ich Finch vor einem Monat begegnet, bei einem Empfang ihm zu Ehren im Cipriani. Ich war nur hingegangen, weil Keith behauptet hatte, sie brauchten Gäste. Natürlich waren bereits Hunderte von Leuten da, als ich nach einem brutal anstrengenden Arbeitstag endlich eintraf. Typisch Keith – erst bat er einen verzweifelt um einen Gefallen, dann vergaß er, dass man überhaupt existierte. Finch hatte mich mit einer zu engen Umarmung begrüßt und anschließend mein Kleid als »abenteuerlich« bezeichnet, in einem Ton, bei dem ich am liebsten nachgefragt hätte, was er damit meine, um ihn anschließend zusammenzustauchen. Jetzt wollte mir partout nicht einfallen, ob ich überhaupt etwas erwidert hatte. Ich konnte mich ohnehin nicht besonders deutlich an jenen Abend erinnern – nur wie er geendet hatte, war mir im Gedächtnis geblieben.
Ich blinzelte Finch an, als könnte ich ihn dadurch dazu bringen, sich in Luft aufzulösen. Keith hatte vermutlich gespürt, dass wir etwas planten, und Finch als menschlichen Schutzschild mitgebracht. Was für ein Desaster.
Derrick erschien auf der Bildfläche. Er drückte sich verlegen an der Rückseite des Wohnzimmers herum, wo er sich offensichtlich die ganze Zeit über versteckt hatte. Entnervt strich er mit der Hand seine braunen Haare zurück, die jetzt länger waren, zotteliger, wenngleich auf eine attraktive Art und Weise. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, stellte ich überrascht fest, wie gut er heutzutage aussah, so viel besser als während unserer College-Zeit. Er hatte sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt.
»Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt das lassen«, tadelte er Finch und Keith, ganz der missbilligende Literaturprofessor, der er war, und schob seine Schildpattbrille auf den Nasenrücken. »Aber natürlich hört ja niemand auf mich.«
Auf Derrick hörte nie jemand.
»Wo ist dein Auto, Derrick?«, fragte Jonathan und blickte mit zusammengezogenen Brauen aus dem Fenster über die Zufahrt. Er klang verärgert. »Und wie seid ihr hier reingekommen? Ihr habt doch nicht etwa ein Fenster aufgebrochen?«
»Wir haben an der Straße geparkt und sind zu Fuß zum Haus gegangen. Außerdem – was denkst du? Als würden wir ein Fenster aufbrechen!« Keith wirkte verletzt.
»Wieso sollten wir einbrechen, wenn wir doch die hier haben?« Finch hielt einen Schlüssel hoch. Mit der anderen Hand stützte er sich an der Türzarge ab und dehnte sich. Sein tätowierter Bizeps spannte sich an. »Du solltest sie nicht unter der Fußmatte verstecken.« Wie immer sprach er mit seinem breiten Südstaatler-Akzent. »In Arkansas gilt so etwas als Einladung, das Haus zu betreten. Richtig, Derrick?«
»Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wovon du redest, Finch«, entgegnete Derrick. »Es war deine törichte Idee, einfach hineinzuspazieren, und Keith war so idiotisch, dir beizupflichten.«
»Ach, Keith tut sowieso, was ich sage. Das weißt du doch, Derrick. Ohne mich würde es ihn nämlich gar nicht geben. Richtig, Keith?«
»Absolut«, pflichtete Keith ihm bei, als interessierte es ihn nicht im Mindesten, wie sehr Finch ihn erniedrigte. Vermutlich hörte er nicht einmal zu. Soweit ich es beurteilen konnte, war er total high. Definitiv. »Komm schon, Steph.« Keith trat näher. »Auch du fandest es witzig, zumindest ein bisschen. Innerlich musst du doch schmunzeln.«
»Muss ich nicht«, widersprach ich und entspannte mich ein wenig, als Keith einen Arm um meine Taille schlang und mich auf die Wange küsste.
Er hatte diese Wirkung auf andere – auf alle anderen. Männer, Frauen, schwul, hetero und sonst was. Selbst ein kurzer Augenblick im Zentrum seiner Aufmerksamkeit war so, als würde man in den Sonnenuntergang blicken. Man konnte die Augen nicht abwenden, auch wenn sie anfingen zu brennen.
Ich erinnerte mich immer noch an den Abend, als Erstsemesterstudent Keith zu mir in die Bibliothek gekommen war und mich in sein Atelier geschleift hatte, damit ich mir ein Gemälde ansah.
»Bitte«, hatte er gebettelt. »Ich habe gerade das erste einer ganzen Reihe fertiggestellt. Es ist der Wahnsinn!« Er war vor meinem mit Bücherstapeln überladenen Schreibtisch auf die mit Farbe bekleckerten Knie gegangen. Ich saß Abend für Abend an diesem Schreibtisch, deshalb wusste jeder genau, wo er mich finden konnte. Und es fanden mich viele – etwas, was ich insgeheim genossen haben musste, denn ich hätte mir mühelos einen anderen Platz suchen können. »Du musst es dir ansehen.«
»Ich oder irgendwer? Falls du nur jemanden suchst, der dir versichert, wie großartig es ist, können wir das gleich an Ort und Stelle erledigen. Es ist großartig, Keith. Ich bin mir sicher, es ist einfach fantastisch!«
»Nein, nicht irgendwer. Du. Du im Besonderen musst es dir ansehen«, beharrte er mit leuchtenden Augen. »Es wird sich lohnen, das verspreche ich dir.«
Widerwillig war ich mit ihm gegangen, hatte den dunklen Campus überquert und sein Atelier betreten. Es war schon beinahe Mitternacht gewesen. Und dort, unter einem Strahler, stand eine riesige Leinwand, ein Gemälde von mir als kleines Mädchen, wie ich auf das unermesslich große, aufgewühlte Meer blickte. Ich hatte meinen Freunden die Geschichte erzählt, dass ich als Dreijährige einen Moment abgepasst hatte, in dem meine Eltern nicht aufpassten – sie waren beide am Strand in die Benotung der Semesterarbeiten vertieft gewesen –, und in die Wellen gestürmt war. Ich wäre beinahe ertrunken. In meinen Augen sagte diese Geschichte alles, was man über meine Familie wissen musste – und zeigte den subtilen Herzschmerz über die wohlwollende Gleichgültigkeit, die man mir entgegenbrachte. Die meisten Leute kapierten es nicht. Doch Keith hatte es verstanden – das bewies er mit diesem Gemälde.
»Es ist wunderschön«, sagte ich mit zusammengeschnürter Kehle. Und das war es, das leuchtende Blau-Weiß rund um die zarte Gestalt. Mein junges Ich.
Keith betrachtete das Gemälde lächelnd. »So eins fertige ich für alle an. Eine Reihe über die Familien, aus denen sie stammen. Herkunftsfamilien. Hoffentlich können die anderen mithalten.« Er schlang einen Arm um mich. Zusammen starrten wir auf das Bild, meine Füße fühlten sich seltsam haltlos auf dem Fußboden an, schwankend. »Weißt du, nur weil deine Eltern keine Gefühle haben, heißt das nicht, dass das auch für dich gilt.«
»Ich fühle Dinge«, sagte ich ruhig, ohne die Augen von dem Gemälde zu wenden.
»Ich meinte Gefühle für jemand anderen, ein atmendes Wesen«, stellte er klar. »Du kannst das zulassen, kannst immer noch die sein, die du sein willst.«
Meine Kehle war zu eng, als dass ich zu protestieren vermochte. Keith war der einzige Mensch, der meine Perfektion als das durchschaut hatte, was sie war: ein fest verschlossenes Behältnis voller Einsamkeit. Er war der Einzige, der mich darauf ansprach.
Es war gefährlich leicht, sich in Keith’ riesiges, wildes Herz schließen zu lassen, selbst wenn man nur mit ihm befreundet war. Die arme Alice hatte keine Chance gehabt. Doch das hatte mich nicht davon abgehalten, sie zu verurteilen, richtig? Ausgerechnet Liebe, hatte ich gedacht. Konnte es etwas Trivialeres geben? Wie oft hatte ich Alice geraten, endlich erwachsen zu werden und über Keith hinwegzukommen, aufzuhören, eine solche Drama-Queen zu sein. Ja, ich hatte versucht zu helfen, doch im Rückblick kam ich mir sehr kaltherzig vor. Was hatte ich damals über die ganze Sache gewusst? Was wusste ich heute?
»Du schuftest dich für den Kerl immer noch zu Tode, stimmt’s?« Als ich mich umdrehte, stand Finch neben mir und musterte mich ostentativ. »Weil du so furchtbar beschäftigt gewirkt hast.«
Er war in gewisser Weise darauf programmiert, so etwas zu sagen. Finchs gesamte künstlerische Karriere baute auf Provokation auf. Der entscheidende Punkt war, ihn zu ignorieren. Narzissten wurden einer Sache schnell überdrüssig.
»Stephanie, kannst du bitte kurz kommen?«, rief Jonathan in dem vergeblichen Bemühen, ungezwungen zu klingen.
»Entschuldige, Jonathan braucht mich«, sagte ich zu Finch und drängte mich an ihm vorbei ins Wohnzimmer.
»Das ist reine Verschwendung!«, rief Finch mir nach. »Du weißt gar nicht, was dir entgeht.«
Ich drehte mich nicht um.
»Hallo, Stephanie? Komm mal zu mir, bitte. Sofort.« Jonathan winkte mich zu sich.
»Du wolltest mir den Kamin zeigen, richtig?«, fragte ich laut, in der Hoffnung, es würde ihn daran erinnern, dass er die Ruhe bewahren musste. Auszuflippen, weil Finch hier war, würde die Lage bestimmt nicht verbessern. »Ich werde für den Rest des Wochenendes auf jegliche Beschwerden verzichten, wenn du mich vor ein Kaminfeuer setzt.«
»Ja, natürlich.« Jonathan legte eine Hand auf meinen Arm. »Es ist unglaublich, aber hier gibt es tatsächlich vier Kamine. Einer ist in dem Zimmer, das du dir mit Maeve teilst. Wie du morgen sehen wirst, bietet es einen wunderbaren Ausblick auf den Hudson und spektakuläre Sonnenuntergänge. Es ist übrigens das schönste Zimmer im ganzen Haus, deshalb habe ich es euch gegeben.«
»Habe ich das Wort ›Kamin‹ gehört?«, fragte Maeve, die sich zu uns gesellte.
»Was nun?«, schaltete sich Finch ein, der sich uns mit alarmierender Geschwindigkeit näherte. »Sollen wir Strohhalme ziehen, wer dieses beste Zimmer bekommt? Es sei denn, die Damen möchten ihr Zimmer teilen …«
»Alles in Ordnung, danke«, lehnte Maeve mit ahnungsloser Fröhlichkeit ab.
Irgendwie gab Maeve jedem einen Vertrauensbonus, trotz allem, was sie durchgemacht hatte. Es war einer der vielen Gründe, weshalb ich mir wegen Bates Sorgen machte. Jonathan hatte ihn als »verlässlichen Kerl« bezeichnet, allerdings war sein Männergeschmack nicht immer der beste. Ausgerechnet Bates? Aber Maeve war anscheinend bis über beide Ohren verknallt. Angeblich, weil Bates liebenswürdig und lustig war, und er war tatsächlich freundlich gewesen, als ich ihn kennengelernt hatte. Doch er sah auch sehr gut aus und war sehr vermögend, und Maeve ließ sich sehr leicht von glitzernden Oberflächen in den Bann ziehen. Dafür machte ich ihre grauenhafte Familie verantwortlich. Maeve hatte sie komplett aus ihrem Leben verbannt, aber sie hatte natürlich Spuren hinterlassen.
»Finch will euch doch nur foppen. Es ist uns gleich, welches Zimmer du für uns vorgesehen hast«, sagte Keith und klopfte Jonathan auf den Rücken, bevor er den Raum durchquerte und anfing, die Schränke an der gegenüberliegenden Wand zu öffnen. Endlich hatte er die Bar entdeckt. »Ah, da ist sie ja. Gut getarnt, Jonathan.«
»Klasse Idee, Keith.« Finch ließ sich auf eines der roten Ledersofas fallen. »Nach der Fahrt kann ich einen Cocktail gebrauchen.«
Drinks. Genau der richtige Anstoß, um einzugreifen. Maeve und ich tauschten einen Blick aus, dann strebte sie pflichtbewusst auf Keith zu. Ich beobachtete, wie sie versuchte, ihn vom Alkohol abzulenken, indem sie den Kopf schief legte und süß lächelte. Doch Keith war total fixiert auf seinen Drink. Von Weitem sah er absolut schrecklich aus. Keiner von uns wusste genau, was er nahm. Es hatte mit Marihuana angefangen, anschließend war er zu den Psychopharmaka Xanax und Ativan übergegangen – heftige Medikamente gegen Angststörungen und Panikattacken. Irgendwann hatte er zu Oxycodon und anderen Opioiden gewechselt, die bei starken Schmerzen verschrieben wurden. Gott allein wusste, welche Ausmaße das Ganze angenommen hatte. Unabhängig von Jonathans Dad, dem Kredit und der Galerie – es war gut möglich, dass Keith nicht mehr lange lebte, wenn wir ihn nicht in eine Entzugsklinik schafften.
Manchmal fragte ich mich, was wohl aus uns geworden wäre, hätten wir in jener Nacht auf dem Dach einfach die Polizei gerufen. Ich hatte das tun wollen, zumindest am Anfang. Bis man mich daran erinnert hatte, was das für unsere Zukunft bedeutet hätte – vor allem für meine. Doch hätten wir jemanden angerufen, wäre Alice vielleicht noch am Leben und sie und Keith immer noch zusammen. Stattdessen hallte jene Nacht bis heute in jedem Einzelnen von uns nach, äußerte sich in Jonathans krankhafter Generosität, Derricks unglücklicher Ehe mit Beth und meiner Arbeitswut. Was Maeve anging – sie hatte es verdient, endlich glücklich zu sein. Sie hatte schon genug durchgemacht.
Ich fragte mich, ob Maeve die jüngste E-Mail von Alice’ Mom bekommen hatte. Es war nicht die erste dieser Art, für gewöhnlich schrieb sie uns ein, zwei Mal im Jahr, um uns für das verantwortlich zu machen, was Alice zugestoßen war. Die letzte Nachricht hatte allerdings einen neuen, drohenden Ton angenommen: Ich weiß, was du getan hast. Trotzdem blieb uns nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass sich Alice’ Mutter wieder in ihre Trauer zurückzog. Bislang hatte sie das jedes Mal getan. Normalerweise sprachen wir über die Nachrichten, zumindest Maeve und ich, doch diesmal hatte keine von uns ein Wort darüber verloren. Ich denke, wir stimmten stillschweigend überein, dass es einfach zu viel war, uns zusätzlich zu unserer Rettungsmaßnahme für Keith auch noch damit auseinanderzusetzen.
»Hast du ein Problem mit Leuten, die freitagabends um neunzehn Uhr einen Drink zu sich nehmen?« Finch grinste schief, als ich ihn ansah. Offenbar hatte er bemerkt, dass ich Keith beobachtete. »Du kennst anscheinend nur eine Art von Vergnügen …«
»Du kannst mich mal, Finch«, sagte ich und durchquerte das Zimmer erneut. So viel zum Thema, nicht auf den Köder anzubeißen.
»Was zum Teufel macht er hier?«, flüsterte ich Derrick zu, der vor einem der Fenster stand und hinausschaute.
Er zuckte die Achseln. »Das Arschloch geben? Macht Finch das nicht immer?«
»Wusstest du, dass er mitkommt?« Es klang wie ein Vorwurf. Vielleicht war es das sogar, auf gewisse Weise.
Derrick und Finch kannten einander seit ihrer Kindheit in Arkansas, auch wenn ihr soziales Umfeld grundverschieden war. Derricks Familie war für dortige Maßstäbe wohlhabend, Finch das Produkt bitterer Armut. Ein gefundenes Fressen für die Kunstwelt. Es war Derrick, der Keith und Finch einander vorstellte, damals, als Finch noch nicht einen müden Dollar mit seiner Kunst verdient hatte und Keith mit seiner Galerie ganz am Anfang stand. Ich habe nie herausgefunden, warum Derrick Finch überhaupt den Gefallen tat, aber so war er eben: hilfsbereiter und freundlicher, als ihm guttat.
»Selbstverständlich wusste ich nicht, dass Finch mitkommen würde. Glaubst du nicht, ich hätte euch gewarnt?«, fragte er entrüstet. »Ich war bereits in der Galerie, um Keith abzuholen, als Finch aufkreuzte. Er sah Keith’ Reisetasche und wollte wissen, was wir vorhatten, und dann fragte er, ob er mitfahren könne, so, wie er es immer tut. Dir ist doch klar, dass er nur mit uns abhängen will, weil wir ihn nicht dabeihaben wollen. Wenn wir ab und an mal Ja sagen, verliert er vielleicht das Interesse.«
»Wusste Finch, dass wir alle hier sein würden?«, konnte ich mir nicht verkneifen zu fragen. »Oder dachte er, ihr wäret nur zu dritt?«
»Keine Ahnung. Ich habe explizit erklärt, dass wir zu Jonathans Junggesellenabschied fahren und dass Finch nicht eingeladen ist. Aber du kennst Keith, und Finch bekommt immer, was Finch will.« Derrick schüttelte verärgert den Kopf. »Ich hätte resoluter sein sollen, aber ich hatte Sorge, dass Keith Verdacht schöpft. Wenn Finch die Sache mit den Drogen herausfindet, wird er Keith mit Sicherheit den Vertrag kündigen. Finchs Dad war auf Meth. Wir können nichts unternehmen, solange er hier ist. Das muss warten.«
Nicht dass es wichtig wäre, was Finch herausfand, denn er hatte den Vertrag mit Keith längst gekündigt. Allerdings war ich die Einzige, die das wusste. Aber weil ich nicht wollte, dass die anderen erfuhren, wie ich an diese Information gelangt war, konnte ich niemandem davon erzählen.
»Da gibt es einen Haken«, wandte ich ein, »wir können nicht warten. Keith muss bis Montag ins Bright Horizons einchecken, sonst streicht ihm Jonathans Dad den Kredit.«
Derrick schloss die Augen. »Großartig.«
Ich sah aus dem Fenster. Im Garten an der Seite des Hauses war ein Stapel Bretter zu einem hohen Dreieck aufgeschichtet, als hätte jemand Vorbereitungen für ein Feuer getroffen.
»Was ist das?«, fragte ich und tippte mit dem Finger gegen die Scheibe.
Derrick richtete den Blick auf die Bretter. »Darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen.«
»Was hat dieser Scheiterhaufen zu bedeuten?«, rief ich Jonathan quer durchs Zimmer zu.