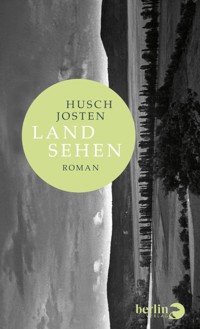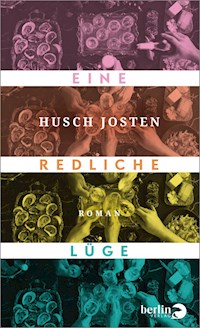
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wir sehen — und lieber nicht sehen wollen Einen Sommer lang arbeitet Elise für das gesellige Paar Margaux und Philippe in deren Ferienhaus in der Normandie. Fasziniert von den vielen illustren Gästen in der Domaine de Tourgéville, vom Leben, Wesen und der Ehe der Leclercs, wird die junge Frau zur eindringlichen Beobachterin von Sein und Schein. Sie erlebt ein Panoptikum der menschlichen Täuschungen, begreift, dass das Streben nach Glück und die Bereitschaft zum Betrug zwei Seiten derselben Medaille sind. Eines Abends jedoch wird die Gelassenheit dieses Sommers jäh und derart umfassend erschüttert, dass es auch Elises Leben für immer prägt. Ein hochaktueller Gesellschaftsroman, der im Erzählen Antworten sucht auf so viele offene Fragen unserer Zeit – klug, charmant und unwiderstehlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2021
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Stocksy/Jill Chen
Illustrationen: Alexander Paeffgen
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
Dîner: Sechs Gäste (gute Freunde), 14. Juni 2019, 20:00 Uhr
SIEBEN
ACHT
NEUN
Dîner: Dreizehn Gäste, 4. Juli 2019, 21:00 Uhr
ZEHN
ELF
ZWÖLF
Dîner: Zwei Gäste, 1. August 2019, 20:00 Uhr
DREIZEHN
Dîner: Fünf Gäste, 4. August 2019, 19:30 Uhr
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
Dîner: Fünf Gäste, 7. August 2019, 20:30 Uhr
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
26. August, ein unerwünschter Gast, 2:10 Uhr
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
Dank
Für Dich, absolut
That is one last thing to remember: writers are always selling somebody out.
Joan Didion, Slouching towards Bethlehem, 1968
EINS
Wenig nur ist von grandioserer, von vollkommenerer Tristesse als ein Seebad am Ende des Sommers. Wenn die Strandliegen fortgeräumt sind, Rollladen die Fenster der Promenadenhäuser gegen das Salz des Meeres schützen und dichte Stille über den Straßen liegt. Wenn Parkplätze akkurat markiert frei liegen, eine Plane das Karussell am Marktplatz bedeckt wie ein buntes Tuch die Hand des Zauberers, ein vergessener Sandeimer im Rinnstein rollt. Wenn die Auslagen der Konditoreien und Traiteure nackt sind und desinfiziert, das Aushilfspersonal der Gastronomen die Quartiere verlassen hat und rostige Vorhängeschlösser an den Strandbuden die nächste Saison verheißen. Ich möchte, hatte Margaux bei einem unserer Abendessen theatralisch bekundet, am letzten Tag eines Sommers sterben. Nun. Sie ist nicht tot. Aber weder hätte ich noch hätten die vielen Gäste, die sie und ihr Mann Philippe in jenem Sommer bewirteten, jemals erwartet, dass die Dinge diesen Lauf nehmen würden. Ihr Haus wird heute nur noch vermietet – die Domaine de Tourgéville. Vor Jahren habe ich als potenzielle Interessentin versucht, die Dame von der Vermittlungsagentur auszuhorchen. Ich wollte herausfinden, wem das Haus, sofern es verkauft worden war, inzwischen gehörte, ob es unverändert war. Ich wollte die Domaine noch einmal bewohnen, noch einmal ihre chlorgebleichte Sonnenwärme riechen, wollte die Vergangenheit heraufbeschwören, erkunden, wie es sich anfühlen würde, nach all den Jahren aus dem Fenster meines damaligen Zimmers aufs Meer zu sehen. Aber sie war auf Monate hinaus ausgebucht. Und all meine Fragen liefen ins Leere. Diskretion sei ihr Kapital, ließ mich Mademoiselle Nanty mit spitzer Stimme wissen; Sie wissen schon: eine Stimme in Perlenkette und Blazer. Aber sie könne mir versichern, dass die Vermieter gewissenhafte, ordentliche Menschen seien, die Wert auf den besten Zustand ihres Anwesens legten, wie es auch die Agentur tue. Dass nanti vermögend heißt, entbehrt im Zusammenhang mit dieser Geschichte übrigens nicht einer gewissen Komik.
Von meinen Eltern habe ich vieles gelernt. Etwa die Schönheit der Natur zu achten und klassische Musik zu schätzen, keinen Schund zu lesen. Dass es sich nicht gehöre, im Bademantel zu frühstücken, und wesentlich sei, Menschen nie nach ihrer Herkunft oder ihrem Bankkonto zu beurteilen, sondern nach dem, was sie zu sagen haben. Dass Menschen, die anderes als meine Eltern sagten, schneller disqualifiziert waren, als sie ihre Telefonnummer hätten aufsagen können, war, Sie ahnen es, die Ironie hinter ihrem Edelmut. Zwar tendieren die meisten Menschen dazu, sich ihrer Weltsicht sicher zu sein, doch meine Eltern nannten es euphemistisch einen Standpunkt haben, und von ihrem wichen sie nie ab. Ich bezweifelte daher schon früh, dass man zu allem einen Standpunkt haben muss. Und ebenso früh fragte ich mich, wie andere Menschen meine Eltern sahen, deren Urteil über Nichtwissende, Kurzsichtige, Esoterische, Andersdenkende zuverlässig irreversibel und vernichtend war. Folglich hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, so wenig wie möglich zu urteilen und so gut wie keine Prinzipien aufzustellen, was, ist mir inzwischen klar, paradoxerweise auch als ein Prinzip betrachtet werden kann. Die Konsequenz dieser Haltung jedenfalls waren eine andauernde mangelnde Bereitschaft zur Festlegung, Begegnungen mit allerlei experimentellen Kunst- und Musikrichtungen und ihren jeweiligen Vertretern, daraus resultierend ein Hörsturz und drei Liebesbeziehungen, denen ich ein solides Wissen über Familienserien, Engelsforschung, Verschwörungstheorien und bewusstseinsverändernde Substanzen verdanke, wobei Letzteres wiederum für meine Bekanntschaft mit Trash-Literatur sorgte, die der Drogenfahrradkurier meines damaligen Freundes ebenfalls frei Haus lieferte. Das Ergebnis meiner Haltung waren überdies Begegnungen mit Freunden, die grundsätzlich im Bademantel, Schlafanzug oder gerade noch in Unterwäsche frühstückten, sowie überhaupt: Begegnungen mit unzähligen Menschen. Zweifellos war aber die wichtigste Konsequenz aus meiner Haltung das Wissen um all ihre Geschichten. Denn meine Gewohnheit erschloss mir unbeabsichtigt vielerlei Offenbarungen. Ich hörte zu. Und ich tat dies aus einem einzigen, mir erst seit dem Sommer in der Domaine de Tourgéville klar vor Augen stehenden Grund: Ich fürchtete, unter all jenen, die mir begegneten und die mir unaufgefordert ihr Innerstes offenlegten, den einen Menschen zu versäumen, der mir wirklich etwas zu sagen hatte. Und in dieser Aussage liegt doch ein Urteil, Sie haben recht: Apfel. Stamm. So ist es wohl.
ZWEI
Margaux kam meiner Vorstellung dieses einen Menschen sehr nah. Ich erinnere mich an unser erstes Telefonat. Bestimmt wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn Sie eine fremde Stimme hören und den Menschen, dem sie gehört, sogleich sympathisch finden. Es war die ruhige, konzentrierte Art, in der sie sprach. Es war die Tonlage, die sich melodiös in meine Ohren und Gedanken legte, und es war der Inhalt unseres Gesprächs, in dem sie nicht nach Referenzen oder meiner Ausbildung fragte, sondern nach dem Buch, das ich gerade las. Es war Das Jahr der Liebe von Paul Nizon, das mir einer meiner Dozenten ans Herz gelegt hatte, und durchs Telefon hörte ich sie lächeln. Zweiunddreißig Jahre ist das her. Ich hatte gerade das Studium beendet, stand vor meiner ersten Anstellung und war nach der intensiven Unizeit der festen Überzeugung, fürs Erste genug gehört zu haben. Für eine Weile wollte ich so wenig Geschichten wie möglich. Kommilitonen, selbst die langweiligsten und unzugänglichsten unter ihnen, hatte ich durch Lebens-, Lern- und Liebeskrisen begleitet. Meine Freizeit hatte ich mit politischen Aktivisten verbracht, die – was damals sehr in Mode war – auf Demos und Plakaten für und gegen Globalisierung, China, Amerika, Europa, Mindestlöhne, Steuererhöhungen, Autobahngebühren kämpften. Mit Sozialengagierten, die für Flüchtlinge, sämtliche Religionsgruppen, Schwule, Frauenrechte, Missbrauchsopfer, Senioren, Ausländer und Kindergärtner Flagge zeigten. Mit Naturschützern, die für und gegen Atomstrom, Solarenergie, Windräder, Flugverkehr und Elektroautos Vorträge hielten. Mit IT-Experten, die für oder gegen das Aufweichen des Urheberrechts, Fitnessuhren, Big Data, Handykameras, Versicherungs-Apps und den Überwachungsstaat zu Felde zogen. Wirklich überall auf der Welt war in jenen Jahren etwas los, allerorten demonstrierten die Menschen oder gingen auf die Barrikaden. In Hongkong wegen eines Auslieferungsgesetzes, in Spanien wegen der Abspaltungsbemühungen der Katalanen, im Libanon zunächst wegen der geplanten Besteuerung einer Kommunikations-App und dann gegen die Regierung an sich, in Ecuador wegen Sparmaßnahmen, in Chile wegen der Fahrpreise für Busse und U-Bahnen, in Ägypten und Brasilien wegen Korruption, in England für und wider den Brexit, in Griechenland pro und contra Flüchtlingshilfe, weltweit fürs Klima, in meiner Heimat Deutschland gegen Neonazis und in meiner Studienheimat Frankreich in gelben Westen gegen die Rentenreform und überhaupt alles – die Franzosen tragen die Revolution nun mal in den Genen. Manchmal, gewiss nicht in allen Fällen, waren die Anlässe in Relation zum Ausmaß des Zorns überraschend klein. Allen Protesten gemein aber schien zu sein, dass sich in ihnen über den jeweiligen Anlass hinaus etwas entlud. All diese Bewegungen, habe ich damals in einer Zeitung gelesen, und es ist mir in Erinnerung geblieben, waren kopf- und führerlose, damals noch per Smartphones gesteuerte Netzwerke, kollektiv improvisiert: Jazz, keine Klassik. Jeder versuchte und suchte irgendetwas, in Wahrheit aber, so mutmaßte der Autor, in einem Überangebot von Angeboten und einer nachlassenden Nachfrage nach relevanten Nachfragen vor allem seine eigene Bedeutung in der Welt. Aus heutiger Sicht muss ich zugeben: Seine Analyse traf damals viel mehr noch auf mich zu als auf meine protestierenden Freunde.
Für mich war diese Zeit wie ein Intensivkurs in verschiedenen Fremdsprachen, und ich war begierig, sie zu lernen. Überall wollte jemand etwas loswerden, etwas erzählen, sich erklären, verbünden, rechtfertigen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Welt lief auf Hochtouren. Mir begegneten wunderbar engagierte Menschen. Ich saß nicht unbeteiligt oder beliebig als Voyeurin bei ihnen, habe nicht nichts gesagt, sondern immer meine Meinung zum jeweiligen Thema, nie aber meine Meinung über sie; ich habe Themen, nicht die Menschen beurteilt, die mit ihrem Engagement auch Gemeinschaft in Zeiten zunehmender Einsamkeit suchten. Meine Kommilitonen und Freunde stellten sich nach Kräften den Fragen der Zeit des mit neunzehn Jahren noch jungen Jahrtausends; sie schritten beispielhaft voran, Dinge zum Besseren zu verändern oder zumindest zu denken. Aber für mich waren sie durchsichtig, transparent wie Glas. Durch sie hindurch wurden die Dinge sichtbar, nicht in ihnen.
DREI
Margaux und Philippe Leclerc, von denen ich erzählen möchte und die auf den ersten Blick für alles zu stehen schienen, was ich nach den Studienjahren hinter mir lassen wollte, ausgerechnet also Margaux und Philippe – sie eine sechsundfünfzigjährige Schriftstellerin, er ein zweiundsechzigjähriger Geschäftsmann, der die Vermögen diskreter Familien verwaltete – boten mir den Sommerjob an, der meine Reise finanzieren sollte. Bevor der Ernst des Lebens begann, wie meine Eltern nicht müde wurden, mir das Berufsleben perspektivisch zu vermiesen, hatte ich geplant, mehrere Länder zu besuchen, die vor meiner Haustür lagen, von denen ich jedoch so gut wie nichts wusste. Dass ich diese Reise letztlich nicht antrat und von unserem Kontinent daher lange nur das damals für Westeuropäer Übliche kannte, dass ich also statt zwei Monaten vier mit Margaux und Philippe in der Normandie verbrachte, ausdrücklich gegen den Wunsch meiner Eltern, die nicht einsahen, warum eine vierundzwanzigjährige Hochschulabsolventin als Hausmädchen bei vermutlich neureichen Gesellschaftslöwen anheuern sollte, habe ich nie bedauert. Heute staune ich über die eigene Fehleinschätzung meiner Motive: Damals hielt ich mich für selbstbewusst und progressiv, tatsächlich aber war ich unbedarft. Mir war überhaupt nicht klar, worauf ich mich einließ und was ich in solcher Nähe zu Fremden würde erleben können. Als ich in der Domaine de Tourgéville anfing, bildete ich mir wie die meisten meiner Kommilitonen aus dem Literaturstudium ein, eine Menge zu wissen, immerhin liefern Bücher nahezu alles an Lebensgeschichten, was man sich nicht vorstellen kann. Zweifelsohne aber lernte ich erst bei Margaux und Philippe fürs Leben, und zwar mehr, als es Schul- und Studienabgängern von wohlmeinenden Direktoren, Lehrkräften, Erziehungsberechtigten, Tanten und Onkeln bei Abschlussfeiern salbungsvoll gewünscht wird. In diesem Sommer begegneten mir viele Nationalitäten, Mentalitäten und Perspektiven am Tisch meiner Arbeitgeber. Wissbegier, Interesse und Einfühlungsvermögen zeigten sich in der Gastfreundschaft der Leclercs. Es gab entspannte, herzliche, manchmal glanzvolle, gelegentlich verrückte Nachmittage und Abende, während derer sich mir ihr großmütiger Geist offenbarte. Nichts empörte sie, jede Meinung und Ansicht war willkommen und wurde respektiert; sie hörten zu, wo meine Eltern energisch widersprochen oder abschätzig den Kopf geschüttelt hätten. Der Sommer in der Normandie lieferte mir mannigfaltige Eindrücke und Einblicke in eine Welt, die ich bis dahin nicht gekannt hatte. Sorgenfrei und perfekt, dachte ich erst beglückt, später misstrauischer. Unbeschwert, in Saus und Braus schwelgend. Margaux und Philippe öffneten Tür und Tor im wörtlichen wie im metaphorischen Sinne, sie schillerten in ihrem Willen zum Glück. Einem Willen, wie er mir seither nie wieder begegnet ist. Sie mochten Gesellschaftslöwen sein, was immer dieser Ausdruck bedeutet. Mich faszinierten sie. Worauf ihr Geld und ihre Möglichkeiten gründeten, kümmerte mich nicht. Was mich bei ihnen hielt, war ihre Offenheit, ihre Freundlichkeit, ihr Interesse an Menschen. Vor allem aber waren es die Fragen, die sich mir schließlich aufdrängten, die sich ihren Gästen aber erstaunlicherweise nie stellten. Diesen Heerscharen von Parasiten und Nutznießern, die das Paar am Ende jenes Sommers in die Flucht jagten und mir eine Idee nahmen, die zurückzuholen ich entschlossen bin. Denn diese Idee war keine Illusion, davon bin ich heute, so viele Jahre später, immer noch überzeugt.
VIER
Sofern es ihn gibt, wollte der Zufall, dass ich an Margaux und Philippe geriet. Bei ihnen beworben hatte sich meine so impulsive wie unzuverlässige Studienfreundin Amélie, die sich im Mai während eines Videovortrags in Deano verliebte, den Referenten aus Seal Rocks, Australien, der sie am Ende des Abends für einen Surf-Sommer auf Hawaii begeistern konnte. Ob sie stattdessen wirklich zwei Monate lang in der Normandie für fremde Leute kochen und Geschirr spülen solle, dies allerdings für einen unglaublichen Lohn, fragte sie mich, und das war selbstverständlich eine rhetorische Frage. Wie würden Sie entscheiden, hätten Sie die Wahl zwischen Arbeit in der Normandie mit ihrem ozeanischen Klima, dem Wechsel von Sonne und Regen, einer sommerlichen Durchschnittstemperatur von zweiundzwanzig Grad und im Gegensatz dazu wogender Verliebtheit im flirrenden, palmblätterraschelnden Tropentraum der hawaiianischen Inseln? Mir aber kam dieser Job wie gerufen. Nichts denken. Nichts reden. Kochen. Spülen. Putzen. Aufräumen. Den Kopf frei machen. Später habe ich gegrübelt, ob es Zufall oder eine durch mysteriöse Vorsehung inszenierte Ereigniskette war, die mich an Amélies Stelle in die Domaine geführt hatte, aber freilich führte alles Nachdenken darüber nirgendwohin. Sie wissen so gut wie ich, dass Zufälle Begleiter unseres Seins sind. Es gibt nichts, das nicht zufällige Elemente in sich trägt, und vielleicht ist es nur unsere Aufmerksamkeit, die ein Ereignis zur Fügung erhebt; möglicherweise sind es nur unsere Pläne, die den Zufall so wirkmächtig erscheinen lassen, weil er sie in kaltblütiger Gleichgültigkeit durchkreuzt. Eine andere Frage beanspruchte meine Gedanken daher bald mehr. Und zwar ob Amélie, wäre sie statt meiner in der Normandie gewesen, dasselbe erlebt oder ob für sie alles einen anderen Gang genommen hätte. Ob wir Anwesenden in rätselhafter Wechselwirkung das Geschehen verursacht hatten oder das Geschehen seinem undurchsichtigen Gesetz der Teilnahmslosigkeit gefolgt war. Sie werden lachen: Ich weiß es bis heute nicht. Natürlich nicht. Und ich nehme an, dass Ihnen schon die Frage müßig erscheint. Für mich war sie es nie.
Die Küche, sozusagen die Zentrale der Domaine de Tourgéville, teilte ich in den ersten Tagen mit einer Fliege, die ich Thusnelda taufte. Sooft ich ihr den Weg in die Freiheit wies, so oft verweigerte sie ihn oder nahm ihn aus Dummheit nicht. Sie zog ihre Kreise durchs Haus, diesen Bau so rund wie eine Burg, brauste dumpf an den vier Fenstern der Küche entlang, schlug sich die Nase an der Scheibe (ich habe es tatsächlich nie nachgelesen: Haben Fliegen eine Nase?), setzte sich wie benommen ab, holte Luft (wie also atmen Fliegen?), krabbelte ratlos ein Stück über das Glas und brauste weiter. Sie landete sogar dann wieder am Küchenfenster, wenn sie zwischenzeitlich das gesamte Erdgeschoss durchflogen hatte: von der Küche ins Esszimmer ins Wohnzimmer ins Kaminzimmer in die Bibliothek, zur Haustür und wieder in die Küche. Zimmer nenne ich sie … tatsächlich war all das ein einziger Raum. Sie müssen sich die Domaine vorstellen, wie sie damals war. Es gab keine Wände zwischen den Bereichen. Das runde Haus war dem Stil der Normandie verpflichtet: wettergegerbtes Holz, heller Stein, Fachwerk im Obergeschoss, bodentiefe Fenster im Erdgeschoss, rotbraune Terrakotta-Schindeln auf dem Dach. In der Mitte des Hauses ein Swimmingpool, nach oben offen, der wie ein Schwimmreifen einen in seinem Zentrum gelegenen Turm umschloss. Von den glasummantelten Räumen im Erdgeschoss, die mit Sandstein ausgelegt waren, war der Pool durch eine flache Mauer und wiederum große Fenster getrennt. Alle Wohnbereiche der Domaine schauten so einerseits in die Landschaft, andererseits auf den Pool, der mich, abends beleuchtet, an einen überdimensionalen tiefblauen Donut erinnerte. In seiner Mitte, dem überdachten Turm und kleinsten Rund des Hauses, befand sich die Wendeltreppe zum oberen Stockwerk. Ein gewölbter Brückengang führte unten über das Wasser in den Turm und ein zweiter oben wieder in einen Flur, von dem rundherum die Schlafräume und Bäder abgingen. Seufzerbrücke nannte Margaux diesen Übergang, denn nach den ausgelassenen Essen und Festen, von denen sie und ihr Mann mindestens zwei pro Woche ausrichteten und von denen ich nur die schildern werde, die aufgrund der Gäste und Gesprächsthemen mit dem Ende jenes Sommers zu tun haben, empfand sie es als traurig, im nun wieder stillen Haus zu Bett zu gehen. Übrigens sei schon hier erwähnt, dass Sie sich die Namen all der Besucher, von denen ich später erzählen werde, keineswegs merken müssen. Es wären allzu viele. Die wenigen Personen von Bedeutung für meine Geschichte werden Sie sofort erkennen.
Mein Zimmer, das direkt über der Haustür lag, befand sich neben dem von Margaux und war eingerichtet wie jeder der anderen sechs Schlafräume im Haus: ein rundes, weißes Bett, das mich in den ersten Nächten unbeholfen liegen ließ, ein weißer Sessel, ein Tischchen aus Birkenholz, eine Sitzbank unterm Fenster, von der aus ich über die Wiese bis zum Meer blicken konnte. Dazu ein kleines Bad mit eingebautem Kleiderschrank, ein Waschtisch aus Holz, eine – natürlich – runde Badewanne, eine Toilette unter einem der Dachbalken. Wenn ich nach dem Aufräumen spät nach oben kam, sah ich durch den Türschlitz meist noch Licht in Margaux’ Zimmer, in dem Philippe, soweit ich es beurteilen konnte, nur ab und zu mit übernachtete. Oft erkannte ich das Flimmern des Fernsehers, manchmal hörte ich sie baden oder leise telefonieren. Trotzdem war Margaux morgens die Erste, die in Shorts und Hemd unten auf dem großen, mit einem mir nie zuvor untergekommenen weißen Kunstfellsamt bezogenen Sofa saß, Kaffee trank und Zeitung las. Kam ich dazu, stand sie auf und machte mir Kaffee. Wir saßen zusammen im Wohnbereich, an kühleren Morgen vor dem Kamin, besprachen den Tag und die anstehenden Arbeiten im Haus, an dem ich mich zwar nicht sattsehen konnte, das mir bei aller Offenheit aber verschlossen blieb. In ihrer Perfektion und Glätte wirkte die Domaine wie das Werk eines viel gebuchten Innendekorateurs oder wie eine Galerie. Museal wäre allerdings der falsche Begriff, zumal die Bilder an den Wänden weniger künstlerischen als dekorativen Anspruch hatten, so kostbar die Originale Vassilieffs vermutlich waren: Rötelzeichnungen gefeierter Filmdiven von Greta Garbo bis Jean Harlow, die lasziv und großformatig auf ihre Betrachter herabschauten. Als Margaux einmal meinen Blick auf Marlene Dietrich bemerkte, erklärte sie, Philippe und sie hätten das Haus vom Vorbesitzer und Erbauer, einem Regisseur, gekauft, wie es war, und so gut wie nichts verändert. Sicher: Es hätte mich stutzig machen müssen. Damals aber kam mir nicht in den Sinn, wie vollständig man in einem fremden Leben verschwinden kann. Damals hielt ich ihre Erklärung für charmant und unkompliziert: wie nett, die Bilder als Hommage an den Bauherrn an ihrem Platz zu lassen. Und wie unerheblich war es, dachte ich, was in einem solch besonderen Haus an den Wänden hing. Einladend, freundlich, wehrhaft lag diese Festung auf einer großen Wiese, schaute in den Wald, auf Felder, einen kleinen Teich, Spazierwege, das Meer. Zu jeder Tageszeit genoss ein anderer Bereich des Hauses das schönste Licht. Alles, selbst die Zeit, schien im Rund der Domaine in einen fließenden Zustand zu geraten, das Thusnelda sich zu ihrem Ausflugsterrain erwählt hatte: ein barrierefreies Flugfeld für unentschlossene Fliegen wie sie. Fett war sie. Schwarz. Flink. Nach acht Tagen lag sie tot in der Spüle, eines natürlichen Todes gestorben.
Und dann kam Sébastien. Autor. Im Brotberuf Kanzleiassistent eines gehbehinderten Rechtsanwalts in Paris. Zwanzig Stunden pro Woche. Als Gegenleistung durfte er im Apartmenthaus des Anwalts unterm Dach ein Zimmerchen bewohnen, das ich mir, es lag angesichts dieser wenigen Eckdaten und auch Sébastiens nachlässiger Kleidung wegen allzu nahe, als schäbige Abstellkammer mit Blumentapete und braunen Wasserflecken ums Fenster herum vorstellte. Wie er Margaux und Philippe kennengelernt hatte, erzählte er nicht. Wohl aber, dass er die beiden nur flüchtig kannte, sie ihm trotzdem zu seinem Erstaunen großherzig zwei Wochen Schreiburlaub angeboten hatten, damit er ungestört in schöner, ruhiger Umgebung Inspiration finden konnte. Sébastien, ein nicht allzu großer, bärtiger Mann von circa dreißig Jahren und einer unerträglichen Ernsthaftigkeit, mit schwarzem, dichtem Haar und dunklen Augen, immer in aufgekrempelten, ungebügelten Hosen und ausgeleierten Shirts, hatte eine höfliche, zugleich verlegen-überhebliche Attitüde, mit der er der Welt zu verstehen geben wollte, dass er mit seiner Geistesarbeit über den Dingen stand, während er in seiner zweiten Nacht in der Domaine völlig unvermittelt vor meinem Bett auftauchte, nichts sagte und wir übereinander herfielen, als hätten wir jahrelang auf diesen Moment gewartet. Ich hatte mir nicht vorgestellt, wie es sein würde. Zwischen uns hatte es keine Phase der Anbahnung gegeben, während derer man sich ausmalt, was passieren und wie es sich anfühlen könnte. Er überraschte mich also. Mit seinem Duft, seinem schmalen, kräftigen, muskulösen Körper sowie der Gleichzeitigkeit von Bestimmtheit und Zartheit in seinen Bewegungen. Es passierte alles so selbstverständlich wie das angenehme Gespräch mit dem Sitznachbarn im Zug. Als ich ihm am darauffolgenden Mittag das Frühstück aufs Zimmer brachte (ein Sandwich mit Wurst und Remoulade, ein hart gekochtes Ei, Café au Lait), sah er mich lange an, bedankte sich fürs Essen und versank wieder in seine Arbeit, was ich wunderbar fand. Es gab nichts zu sagen, und so behielten wir unser schnörkelloses Ritual für den Rest seines Aufenthalts bei: Nichts denken. Nicht reden. Kochen. Spülen. Putzen. Aufräumen. Den Kopf frei machen.
FÜNF
Ich verbrachte meine Tage mit Einkaufen, Hausarbeit, Spaziergängen am Strand; ich genoss es, auf mich gestellt mit kaum jemand anderem außer Margaux und Philippe zu sprechen. Ich las viele Bücher, die ich längst hatte lesen wollen (und laut Leseliste aus dem Studium längst hätte gelesen haben müssen). Ich streunte über Märkte und durch die Straßen von Deauville, ließ mich treiben, trank hier einen Milchkaffee, dort ein Glas Wein, fotografierte dankbare Urlauber, die frontal und sonnenbeschienen für die Ewigkeit, Großeltern und Nachbarn zum Beweis in die Kameralinsen lächelten, schwamm nachts, wenn Margaux und Philippe über die Seufzerbrücke zu Bett gingen, im warmschwarzen Donutpool. Rücklings lag ich im Wasser und betrachtete die Sterne über mir und der Normandie sowie die Kostbarkeit meiner Zeit; ich war frei und schwerelos, nichts war endgültig entschieden, alles konnte gedacht und gemacht werden, keine Verpflichtung, keine Bindung versperrte mir einen Weg, sondern alles, mein ganzes Leben, konnte von hier aus in alle Richtungen ranken. Vielleicht ahnte ich damals, wie einzigartig diese Monate waren. Ich trieb im Wasser, trank Wein und lachte zufrieden das unumwickelte Leben und die vibrierenden Sterne an. Ich muss gewittert haben, dass dieses vollkommene Glück bald verloren, dass meine Freiheit vergänglich und die Notwendigkeit für Entscheidungen unabwendbar war. Dass ich bald schon in einem Netz aus Zusagen, Absagen und Konsequenzen gefangen sein und jede einzelne davon eine unauslöschliche Spur in mir hinterlassen würde. Dass ich nichts, absolut nichts, dagegen machen, nur jetzt und hier weiter im Rund dieses Pools dahingleiten konnte.
An vielen Vormittagen begleitete mich Margaux bei den Einkäufen. Nicht um mich zu beaufsichtigen, sondern weil sie, wie sie einmal sagte, meine Gesellschaft mochte. Und ich liebte die ihre, genoss es schon, sie nur anzusehen. Es gibt Menschen, nicht allzu viele, die man gerne anschaut, und Margaux leuchtete unter diesen Privilegierten wie ein Kristall. Sie hatte, was meine Mutter ein elegantesGesicht nannte, und dem Tonfall, den diese bei der Verwendung des Ausdrucks anschlug, war zu entnehmen, dass darüber nicht viele Menschen verfügten. Ein schmales, fein gefasstes Gesicht mit graublauen Augen. Ihr Lachen einnehmend, der Mund sinnlich, ihr Blick hellwach, traurig und, wenn Sie verstehen, was ich meine: klug. Man wollte mehr über sie erfahren, Fragen stellen, doch Margaux war grundsätzlich schneller. Sie stellte Fragen. Und sie erzählte, was sie erzählen wollte, kein Wort zu viel. Lässig und klassisch, nie nach der Mode gekleidet, war sie, weißblond, die Haare schulterlang in folgsamen Wellen, eine Erscheinung, nach der sich Männer wie Frauen umdrehten. Sie strahlte Güte, Enthusiasmus, Humor aus, war liebenswürdig in der Art, die dem Gegenüber das Gefühl von Herzlichkeit ohne plumpe Vertraulichkeit vermittelte. Nie fiel sie jemandem ins Wort, egal, wie eilig sie es hatte oder wie unerheblich die Ausführungen ihres Gesprächspartners waren. Sie plapperte keine Belanglosigkeiten daher, sondern wandte sich den Menschen zu, insbesondere sehr unfreundlichen oder anstrengenden. Die interessierten sie enorm, sie hatte eine Schwäche für Querulanten, und nach solchen Begegnungen auf dem Markt oder in einem Geschäft konnte ich sehen, dass sie noch lange über diese Leute nachdachte, Gründe für ihr Handeln suchte, so wie sie in all ihren Büchern nach Gründen suchte für das, was Menschen taten und einander antaten. Damals war sie genauso alt, wie ich es jetzt bin. Sechsundfünfzig. Allerdings hat sich die Welt verändert. Meine weniger als die draußen, an Land, aber zweifellos spüre auch ich den Wandel. Vor allem jenen, der schleichend gekommen ist, nicht brachial und revolutionär, sondern der sich der Zeit eingeflüstert, sich klammheimlich in sie gestohlen hat. Seit bald fünfzehn Jahren lebe ich auf der Torus, meinem Schiff, benannt nach der umgedrehten Quadratur des Kreises, so erkläre ich es wohl am besten. Ein Torus entsteht durch das Verkleben der gegenüberliegenden Seiten eines Parallelogramms und hat schließlich die Gestalt eines Rettungsrings, und das schien mir für mein Zuhause genau der richtige Name zu sein. Für Sie heute mag das unvorstellbar sein, aber bin ich mit der Torus unterwegs, sind es Gebäude, Masten, Straßen am Ufer, die mir den Wandel vor Augen führen; Kleinigkeiten im Vergleich zu all den großen Dingen, unbestritten, aber vom Wasser aus sieht man das Ungemäße, Maßlose, Erosive, den schwankenden Boden, das Auf und Ab, die Anfälligkeit für Unvorhergesehenes und Grenzüberschreitungen viel klarer. Ich vermisse nichts auf diesem alten Schiff, so regelmäßig und zwangsläufig ich danach gefragt oder zweifelnd gemustert werde – von Landratten wie von den Besitzern üppiger Jachten, die über ganz andere Ausstattungen und technische Möglichkeiten verfügen. Nein: Auf der Torus ist es nicht immerzu feucht und modrig riechend, es ist im Winter nur mäßig kalt, und das Schiff ist nicht anfälliger für Einbrüche als eine normale Terrassentür. Meine Toilette funktioniert im Normalfall wie jede andere, und der Wassertank fürs Baden oder Duschen ist groß genug. Liege ich, wie meist, an meiner Anlegestelle, bin ich sowieso über Strom- und Wasserleitungen von außen versorgt. Das war die größte Investition: die alten Anschlüsse an die neuen an Land anzupassen und all die Auflagen zu erfüllen, denen das Schiff eigentlich nicht mehr gewachsen war. Die Umrüstung hat mich fast so viel Geld gekostet wie die Torus selbst, aber das war es mir wert. Ich möchte nirgends sonst mehr wohnen. Schiffe sind beweglich und ankern nur, wo sie sein, wo sie bleiben können. Aus gutem Grund wird ihnen, selbst wenn sie männliche Namen tragen, der weibliche Artikel vorangestellt, denn sie haben etwas Mütterliches, in ihrem gewölbten Bauch ist es vertraut und wohlig, es schaukelt, und nie ist man mit ihnen fertig: Irgendwas ist immer, so wie in den Beziehungen zwischen Müttern und ihren Kindern immer irgendwas ist. Meine Bibliothek ist groß genug, da bin ich altmodisch, ich halte gerne Bücher in der Hand. Ich habe ein Bett, von dem aus ich Möwen und Sterne sehen, eine Küche, in der ich nach Herzenslust kochen und dabei Menschen am Ufer betrachten kann, ich habe ein Gästezimmer, und ich habe wechselnde Männer, die kommen und gehen, so will ich es. Es besteht immer die Möglichkeit, abzulegen und wegzufahren, und das Einzige, das ich nach meinen Touren tun muss, ist, die Bilder in meinem Wohnzimmer wieder gerade zu rücken, weil sie durch die Rotation der Antriebswelle grundsätzlich in Schieflage geraten. Sie sehen: Mein Leben auf der alten Torus hat sich weniger verändert als Ihres. Doch schon damals, in jenem Sommer in der Normandie, standen wir an einer Zeitenwende, und kurioserweise war es uns allen bewusst. Ohne zu wissen, was schon wenige Monate später in Gestalt eines Virus auf die Welt zukam, dieses Virus, das rasant beschleunigte, was bis zu seinem Erscheinen noch träge und behäbig im Gange gewesen war, realisierten wir die epochale Bedeutung unserer Jahre, wie die Menschen vor uns wohl die Industrialisierung als unumkehrbare Zeitenwende begreifen mussten, doch stolperten wir rat- und hilflos durch sie hindurch. Zweifelsohne war auch das ein Grund, weshalb sich die meisten wie unsere Ahnen des 19. Jahrhunderts für irgendetwas ins Zeug warfen, das nur unzulänglich zu retten war. Eigentlich wussten wir alle, dass – was immer wir taten – nicht mehr aufzuhalten war, was die Zukunft an Entscheidungen getroffen hatte. So lebten wir. Einfach weiter und weiter. Sie verstehen das.
SECHS
Ging ich mit Margaux am Strand entlang, ihre marineblaue Jacke und ihr Haar meerwindverweht, gab es immer jemanden, der sich nach ihr umdrehte und ihr nachblickte. Und während sie so wirkte, als bemerke sie es nicht, beobachtete ich sie, die Freude in ihrem Gesicht, ihr Strahlen. Nicht ihr, sagte sie, wenn ich sie darauf ansprach, sondern mir habe der Blick gegolten, und womöglich hat sie das wirklich geglaubt. Ich aber wusste, dass es nicht stimmte. Ihr sah man bewundernd nach, während mir allenfalls ein anerkennendes Zungeschnalzen oder mehr und weniger plumpe Kommentare galten. Beides ist von anderer Bedeutung als der ehrfürchtige Blick, diese Achtung, die es verbietet, anzügliche Geräusche von sich zu geben. Auch das habe ich in jenem Sommer gelernt: dass ich eher der Zungeschnalztyp war, was zunächst meiner Figur gegolten haben dürfte, die sich sehen lassen konnte, meinem langen blonden Haar, das ich auch heute noch bloß irgendwie hochstecke, und überdies wohl meiner nicht von der Hand zu weisenden Jugendlichkeit geschuldet war. Neben einer kleinen Eigenart meiner Sprache, die, so hat es einmal eine Freundin behauptet, wie ein portugiesischer Akzent wirkt, so als summte ich, wies ich als Typ damals keine weiteren besonderen Merkmale auf. Es ist im Lauf meines Lebens durchaus vorgekommen, dass sich Menschen nicht an mich erinnerten, obwohl wir uns sogar schon miteinander unterhalten hatten. Ich habe früher in der Schülerzeitung meiner Schule mitgearbeitet, aber im Impressum haben sie mich vergessen. Mein Vater kam manchmal in unsere Küche, wo ich gerne am Tisch las. Er öffnete den Kühlschrank, nahm sich etwas zu trinken und ging wieder hinaus, ohne mich auch nur zu bemerken. Ich war und bin, denke ich, für viele Menschen so selbstverständlich wie unsichtbar, vermutlich sind es zwei Seiten derselben Medaille. Es hat seine Vorteile. Und es kam mir damals in der Domaine de Tourgéville zugute: Je weniger man als Zuhörer wahrgenommen wird, desto Interessanteres bekommt man zu hören.
Wenn Margaux etwas gern tat, dann war es Einkaufen. Wie man auf dem Fischmarkt den frischsten Fang oder beim Gemüsehändler die besten Kräuter und das aromatischste Obst aussuchte, all das zeigte sie mir mit der ungestümen Begeisterungsfähigkeit und Wertschätzung der Genießerin, die ihr erstes Leben, das voller Entbehrungen, nicht vergessen hatte. Über den Geruch süßer Orangen, den Duft feuchtherben Basilikums, das würzige Bouquet tiefroter Tomaten geriet sie in Verzückung. Sie kostete Trüffel und Schinken an den Marktständen, nahm jede Frucht, jedes Gemüse in die Hand, suchte jede Zwiebel geradezu andächtig aus. Wenn wir mit unseren vollen Körben auf dem Rückweg waren, aßen wir vom eben gekauften, warmen Baguette, manchmal setzten wir uns in eins der Strandcafés und tranken ein Glas Rosé dazu, dann wieder bummelten wir durch Boutiquen, und sie schenkte mir einen Pullover oder eine Jacke, weil es sie freute, wie sehr mir ihr Stil gefiel und wie ich, in Kleidungsfragen unerfahren und schüchtern, versuchte, ihn zu erlernen, ihn mir anzueignen. Sicherlich waren wir keine Freundinnen, aber unser Verhältnis als freundschaftlich zu bezeichnen, stellt keine Übertreibung dar. Sie interessierte sich für mich. Ich interessierte mich für sie. Und so erfuhr ich im Laufe der Wochen, woher Margaux kam, wie sie aufgewachsen war.
Ende der Leseprobe