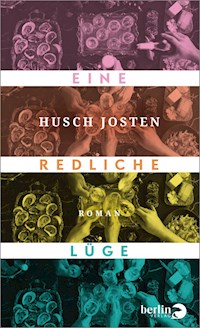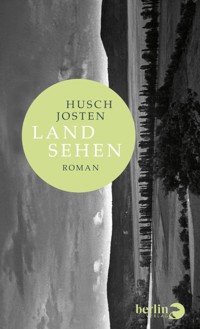
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Konrad-Adenauer-Literaturpreis 2019 Ausgerechnet Priester! Jahrzehntelang war sein Patenonkel Georg von der Bildfläche verschwunden, dieser lebenshungrige Mann, der nie etwas ausgelassen hat. Und nun ist er zurück: Als Mitglied eines umstrittenen katholischen Ordens. Eine grundlegende Wesensänderung oder Läuterung gar vermag Literaturprofessor Horand Roth bei seinem unorthodoxen Verwandten allerdings nicht festzustellen. Wie also passen Onkel und Orden zusammen? Und wie hält er's eigentlich selbst mit der Religion? An unerwarteter Stelle (auf dem Land, wo er wahrlich nie landen wollte) findet Roth die Antwort und noch mehr: ein berührendes Stück Familiengeschichte und deutscher Vergangenheit – eine kleine Heldengeschichte. Einnehmend leicht und in überraschenden Wendungen erzählt Husch Josten so tiefgründig wie humorvoll von Nähe und Freundschaft, von einem bewegten Leben und dem Ringen um ewige Fragen. »Eine wundervolle Familiengeschichte in der Husch Josten tiefgründig, dabei aber leicht und warm, von Nähe, Glaube und dem Ringen um Antworten erzählt.« Express Köln »Ein erstaunliches Buch wie man es selten findet in der Gegenwartsliteratur.« Rainer Moritz, NDR Kultur »Gemischtes Doppel« »Husch Josten analysiert schon, noch während sie erzählt, und genauso kommt dieses erstaunliche Miteinander von Tiefgang und – ja, tatsächlich, Spannung – zustande, das es sonst so selten gibt. Selbst der Titel, ›Land sehen‹, kann auf mehr als eine Art gelesen werden. Ein Roman wie das Leben selbst, mit vielen Schichten. Reich und schön und manchmal auch ein bisschen schwer.« WDR 5 »Scala«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
ISBN 978-3-8270-7977-0© Piper Verlag GmbH, München 2018 / Berlin Verlag, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2018 Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: mauritius images / United Archives GmbH / AlamytDatenkonvertierung: psb, BerlinAlle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
1 – Der Anruf kam im Juni …
2 – Ruitzhof. Gegen die Ureinwohner …
3 – Es gibt Orte, die umgehend …
4 – Nebel. Herbstkühle. Morgengrauen …
5 – Es regnet. Schon wieder …
6 – In Träumen tobt sich das Gehirn aus …
7 – Nicht amtlich, aber praktisch …
Dank
Meinen Geschwistern
Ich wünsche den Menschen die Gabe,sich mit den Augen der anderen zu sehen.
Robert Burns
1
Der Anruf kam im Juni des Sommers, da man viel vom Bienensterben sprach und Mücken nicht totzukriegen waren. Kurz nach Fronleichnam, von einem unbekannten Anschluss, gegen drei Uhr morgens. Anonyme Anrufe sind selten geworden. Kein Name auf dem Display, geschweige denn ein Bild, nicht mal eine Nummer. Vielleicht üben diese Anrufe deshalb eine gewisse Faszination aus. Durch ihre Anonymität, die früher jedem Anruf innewohnte, nur dass früher zu dramatisch klingt und den Eindruck vermittelt, alt zu sein. Vor einiger Zeit ist freundlicher. Vor einiger Zeit, die nicht verblasste Fotografien in Lederalben mit Goldverzierung meint. Vor Kurzem, als es noch Telefonzellen gab und kantige, verkabelte Geräte mit Wählscheibe und einem Klingeln, das nach Erlösung schrie. Einen Apparat, wie wir ihn zu Hause hatten. Grau, fest an die Wand geschraubt, mit langer Spiralschnur am Hörer, die die Kartoffelschalen vom Küchentisch fegte oder sich zwischen den Schranktüren verklemmte. Schrilles Läuten. Nicht Beethovens Fünfte, keine psychedelischen Tonfolgen oder neuesten Hits, sondern ein Geräusch, das Heb ab! brüllte, bis man auf- und nachgab, Glück oder Pech hatte. Früher war jeder Anruf ein solches Glücksspiel. Erst angenommen, gab es kein Entrinnen mehr. Genauso verhielt es sich mit dem Anruf meines Patenonkels Georg in jenem Sommer, Anfang Juni, kurz nach Fronleichnam.
Es war ungewöhnlich heiß für die Jahreszeit. Ich lag bei offenem Fenster im Bett und las; nachts nehme ich gerne Klassiker zur Hand, die mir das Gefühl von Schwerelosigkeit und Unzeitlichkeit vermitteln, als wäre das Leben, alles, das Jetzt, das Vorher, das Nachher, in der Nacht verankert, die Summe aller Bücher. Ich las also. Dachte mitunter an einen Freund, der in ähnlicher Situation von einem Fassadenkletterer überrascht worden war, den er mit geistesgegenwärtigem Gebrüll und einem Hemingway-Band in die Flucht geschlagen hatte. Und da klingelte mein Telefon. Es klingelt nackt und musiziert nicht etwa. Ich zuckte zusammen, sah irrationalerweise zum Fenster, hiernach erst aufs Display, erwartete das Unvorhergesehene, Verwählte, Obszöne, weil sämtliche Notrufe, die mich um diese Zeit hätten erreichen können, nicht anonym gewesen wären. Allerdings: Wenn man Unerwartetes erwartet, kommt es nicht mehr unerwartet. Doch mit der Stimme meines Onkels hatte ich wahrlich nicht gerechnet und sie sehr lange nicht gehört. Ganze drei Jahrzehnte, was wiederum dramatisch klingt, sich aber nie so angefühlt hat. »Ich bin’s, Georg«, rief er in den Hörer, und ich freute mich, freute mich unglaublich, ihn zu hören. »Ich bin’s«, rief er wieder, im Hintergrund scheppernde Musik, »Georg, also Athanasius, Bruder Athanasius, so heiße ich jetzt. Hörst du mich? Ich bin auf einem Festival mitten im Nirgendwo, ehrlich: Ich habe keine Ahnung, wo ich mich befinde, ein Feld mit Tankstelle in der Pampa, buchstäblich, Argentinien, irgendwo zwischen Buenos Aires, La Plata und lauter Rindviechern. Dass es hier überhaupt eine Telefonzelle gibt, grenzt an ein Wunder, wobei es vielmehr eine Telefonsäule ist, es regnet Bindfäden, und ein armer Tropf versucht sich auf der Bühne gerade als Benny Carter. Da musste ich an dich denken.«
Was Benny Carter mit mir zu tun hat? Dazu fiel mir nichts ein. Und wer wen verstoßen hatte – die Familie ihn oder er die Familie –, war mir nie erklärt, darüber war nie gesprochen worden. Doch erinnere ich mich an Abende aus der Zeit vor dem Zerwürfnis, als ich noch klein, zumindest in einem Alter war, in dem der Patenonkel seinem Neffen vor dem Schlafengehen vorliest. Abende, an denen Georg bei uns war. Ich erinnere mich, dass ich nach dem Vorlesen, das er stets ausufernd und abenteuerlich gestaltete, aus dem Bett in den Flur schlich, mich hinter dem samtgoldenen Vorhang der Garderobennische versteckte und durch einen Schlitz ins Wohnzimmer spähte. Denn ich erwartete begierig, es war der erste Grund für mein Wachbleiben, dass Georg sich endlich ans Klavier setzen und spielen würde. Mutter bat ihn jedes Mal, die Nachbarn um diese Uhrzeit nicht zu stören, woraufhin er lachte und immer dasselbe zur Antwort gab: Gute Musik könne niemanden stören, der einigermaßen bei Verstand war. Und in meiner unbequemen Höhle, in der es nach Leder und Regenmänteln roch, in der ich halb auf Schuhen, halb zwischen Jackensäumen und Schirmen kauerte, befand ich ein ums andere Mal, dass er recht hatte. So gern ich die Gespräche der Erwachsenen belauschte: Ich mochte vor allem Georgs Musik, sie entfachte mich, ohne dass ich wusste, worum es sich handelte. Sein Spiel hatte Temperament und Humor, war grundlegend anders als das der Mutter, die nur Klassik spielte, Getragenes vor allem, bleischwer, streng nach Noten und mit viel Pedal. Georg dagegen spielte ungestüm. Der Onkel brachte alles in Bewegung. Es fand sich wie eine vertraute Melodie in mir, als ich nun seine Stimme wiederhörte: dass Georg Dinge in Bewegung brachte. Räume, Geschichten, Menschen. Alles.
Er war zwölf Jahre jünger als Mutter. Über den Altersunterschied hatte ich mich nie gewundert, so war es eben. Später, als ich darüber hätte nachdenken können, war Georg bereits nicht mehr da, eine Gestalt von früher gewesen. Und auch das war, sooft ich an ihn gedacht hatte, irgendwann gewohnt. Sowohl äußerlich als auch im Wesen ähnelten er und Mutter einander kaum, nur an ihren schwarzen Augen waren die beiden unzweifelhaft als Geschwister zu erkennen. Große Augen mit einer orangefarbenen Nuance, gewinnend und ohne Scheu, den Gesprächspartner ausführlich zu betrachten. Georg so zu beschreiben, dass er vor dem inneren Auge sichtbar wird, scheint kaum möglich. Es gibt keine Berühmtheit, mit der er sich vergleichen ließe, und es ist wie so oft nicht damit getan, Körpermaße, Haarfarbe, Gesichtsform aufzureihen. Wenn ich ihn aber als ernsthaften Lausbub schildere, nachgiebig und streng, melancholisch und lebensfroh, sarkastisch und gütig, uneitel und sich seiner Wirkung dennoch bewusst, womöglich entsteht dann ein Bild, das ihm annähernd gerecht wird.
Mir ist in Erinnerung, dass Georg an den Abenden in der elterlichen Wohnung viel sprach, wovon ich allerdings das meiste nicht verstand. Ich hörte dazu das Murmeln der Eltern, Satzfetzen, die von aber oder also eingeleitet wurden, wozu Mutter, wie zur Besänftigung, ständig Wein oder Likör nachschenkte und Erdnüsse in einer blau gefärbten Glasschale reichte. Und da war Vater, der, was ich hinter dem Samtvorhang müde abwartete, um mich zu vergewissern, dass es auch diesmal nicht anders wäre, nach jedem Besuch von Georg den Kopf schüttelte und Mutter noch an der Wohnungstür zu verstehen gab, dass ihrem Bruder nicht zu helfen sei, worauf sie die Schultern zuckte und ich Georg noch lieber mochte. Aber eines Abends – ich war dreizehn oder vierzehn, in einem Alter jedenfalls, in dem man nicht mehr in einer Garderobe hockt und die Erwachsenen ausspäht, sondern in seinem Zimmer sitzt und der Unabwendbarkeit des Lebens ins Auge sieht – eines Abends also knallte in diese Betrübnis hinein die Wohnungstür. Das war’s. Mein geliebter Onkel kam nicht wieder.
Und blieb doch: Jahraus, jahrein rund um den vierten Advent brachte der Postbote eine Weihnachtskarte von ihm. Nur für mich. Mal aus Italien, mal von der französischen Riviera, mal aus Israel. Er wünschte mir nie ein frohes Fest, sondern schrieb in seiner dünnen, schwer entzifferbaren Handschrift Grüße wie: Italiener sind kleine Menschen, weswegen sie grundsätzlich in und auf ebenfalls kleinen fahrbaren Untersätzen unterwegs sind. Ihre Beine sind zu kurz für lange Wege. Auf zwei, drei oder selten vier Rädern brausen sie aus allen Richtungen um große Menschen herum, und jeden Tag stoße ich mir den Kopf an einem Balken in meiner Küche, weswegen ich den Espresso grundsätzlich mit einer Schale Vanilleeis an der Stirn zu mir nehme, das übrigens köstlich ist und mich mit den kleinen Menschen aussöhnt. Oder: Bei Sonnenaufgang ist außer den Fischen und ihren Jägern noch niemand unterwegs. Ich springe ins Meer, schwimme zur Badeinsel, die vor dem Hotel vor Anker liegt, sehe von dort auf die Küste und träume: Heute Mittag esse ich Hummer. Oder: Beten hilft zwar nicht gegen, aber in der Hitze. Die Kirchen und Moscheen und Synagogen sind angenehm kühl. Dicke Mauern. Kleine Ameisenrudel von Menschen rennen einer Person mit buntem Stock hinterher, um zu hören, was sie hierzu und dazu sagt. Man sitzt und schaut und denkt, und man weiß nicht wie: Am Ende ist es ein Gebet … Ich heftete seine Karten alljährlich wie Weihnachtssterne an meine Fensterscheibe, und wenn Vater rund um den vierten Advent Georgs neuerliches Lebenszeichen dort vorfand, verengte sich sein Blick und er atmete schwerer; in der Küche gab es daraufhin eine hastig geflüsterte Auseinandersetzung zwischen Mutter und ihm, über die Feiertage hing der Haussegen schief, die Eltern seufzten öfter als ohnehin, und Mutter saß noch häufiger als sonst mit einer Flasche Süßwein am Küchentisch; Süßwein, von dem ich heute weiß, dass er schneller wirkt als andere alkoholische Getränke. Und so war Georg sehr wohl bei uns und sorgte dafür, dass der familiäre Stresspegel nicht anders ausfiel als bei den übrigen neunzig Prozent der Weihnachtsfeste weltweit. Ein paar Male habe ich gefragt. Die Reaktion der Eltern war immer dieselbe: ein Kopfschütteln gefolgt von einem lang gezogenen »ach«, das in Schweigsamkeit vertrocknete.
»Also da bin ich«, führte Georg von seiner argentinischen Telefonsäule aus. »Und auf die Gefahr hin, salbungsvoll zu klingen: Ich habe mich nicht gemeldet, ja, aber ich habe viel an dich gedacht in all den Jahren, ich trage deine Handynummer schon lange mit mir herum, habe sie im Internet gefunden. Jedenfalls gerade, als ich die Musik hörte … Nun, es schien mir der richtige Moment. Daher klingele ich dich aus dem Bett.«
»Ich freue mich, von dir zu hören!« Unsinnigerweise passte ich mich seiner Lautstärke an. Ich war aufgeregt. »Hab ich dich richtig verstanden? Hast du Bruder Athanasius gesagt?«, brüllte ich.
»Ja! Stell dir vor: Ich bin Mönch geworden.«
»Mönch …«, wiederholte ich entgeistert.
»Sag jetzt nur nichts über die Wege des Herrn!«, rief Georg gegen die Musik an und lachte. »Das haut dich vermutlich um. Mehr oder weniger zumindest – je nachdem, wie es mit dir und dem Glauben steht.«
Jetzt musste ich lachen. »Ist das dein Ernst? Du hörst einen Benny-Carter-Verschnitt in der Pampa und fragst nach über dreißig Jahren Funkstille nach meinem Seelenheil? Liebe Zeit, der Mann muss wirklich schlecht sein.«
»Du machst dir keine Vorstellungen.«
Ich legte Dickens’ Erwartungen zur Seite, rückte die Brille gerade und setzte mich auf. Ich konnte nicht fassen, dass Georg am anderen Ende der Leitung war. »Ich frage lieber nicht nach dem Zusammenhang.«
»Es gibt keinen. Nehme ich zumindest an. Aber sag nur, Hora, warum eigentlich sollen wir nicht damit anfangen, ich möchte es tatsächlich gern wissen: Bist du ein gläubiger Mensch geworden?«
»Das bin ich sicher nicht«, antwortete ich ohne Zögern. Erfreut, dass er meinen Spitznamen gewählt hatte. Einen naheliegenden, zugegeben, aber er hatte ihn mir damals verliehen und ich habe ihn nie abgelegt. Georg schwieg lange. Ich nahm an, er müsse über meine Worte nachdenken, seine Antwort erwägen. Ich wartete auf die Entgegnung, aber darüber krachte, stotterte und verstummte die Hintergrundmusik, Vine Street Rumble, und unsere deutsch-argentinische Verbindung war abgerissen. Zwei anonyme Versuche, die unmittelbar folgten, waren nicht von Erfolg gekrönt. Nichts als Rauschen in der Leitung. Ich betrachtete mein Telefon, als könne das seine Aktivitäten beeinflussen, tötete enttäuscht eine Mücke, die einen blutigen Fleck auf der Wand hinterließ, nahm mein Buch und las nicht weiter.
Georgs Anruf ging mir in den folgenden Wochen nach. Ich suchte im Internet nach ihm – Bruder Athanasius – und fand seinen französischen Orden und ihn. Zu meiner Bestürzung, muss ich sagen, und leider ohne Foto. Georg. Mönch und Priester also. Aber ausgerechnet so einer? Wie konnte ein Mann wie er, den ich so ganz anders in Erinnerung hatte, sich einem erzkatholischen, ja, reaktionären Orden angeschlossen haben? Mich verfolgten die wenigen Sätze, die wir gewechselt hatten. Mich beschäftigte seine Frage. Wann hatte ich das letzte Mal über den Glauben nachgedacht? Im protestantisch geprägten Hamburg meiner Kindheit hatten wir zwar zur Minderheit der Katholiken gezählt, in der Familie war Religion aber nie Thema gewesen. Auch kein Thema, das ich mit meinem Onkel angeschnitten hätte. Gut, ich war bei den christlichen Pfadfindern gewesen. Aber nur, weil Mutter der Religion immerhin ein wenig und Vater dem Bund der Pfadfinder viel abgewinnen konnte: Regeln, Naturverbundenheit, Sport, Disziplin, Verantwortung. Abhärtung würde mir guttun, fand er, mir, dem Bücherwurm, dem Fantasten. Georg hatte sich zwar mal erkundigt, was ich auf den Fahrten trieb. Welche Lieder wir am Lagerfeuer gesungen, ob wir tatsächlich Bibelstellen interpretiert und wie viele Schwarzzelte wir aufgebaut hatten. Aber dass er alldem ein besonderes Interesse entgegengebracht hätte? Er fragte vielmehr nach meinem Schreiben. Nie vergaß er, sich zu erkundigen, ob ich an einer neuen Geschichte arbeitete und ob ich die letzte, von der ich ihm erzählt hatte, zu Ende gebracht hatte. Nie versäumte er, mir eine Idee mit auf den Weg zu geben: Schreib über ein verzaubertes Baumhaus, das geradewegs in eine Eisdiele in Rom führt. Wie wäre es mit einer Geschichte über Marsmenschen, die eine Pfefferminzteeplantage im Stadtpark anlegen? Immerhin bis zum Sippenführer war ich bei den Pfadfindern aufgestiegen. Mit sechzehn hatte ich dann genug von Meuten, Sippen, Stämmen, Gauen, Lagern und Proben, anhand derer sich mein Horizont erweitern sollte. Genug von Spähertouren, bei denen ich mich zwei Tage ohne Geld und Hilfe durch Wald und Felder zu schlagen und dabei allerhand Aufgaben zu bewältigen hatte. Genug von Regeln, die ich einmal gebrochen und dadurch apokalyptischen Zorn auf mich gezogen hatte. Ich verdanke den Pfadfindern, dass ich im Wald gut zurechtkäme, sollte man mich dort aussetzen. Ich verdanke ihnen, dass ich schnitzen und knoten, die meisten Vögel, Pilze und Bäume bestimmen kann. Vor allem aber verdanke ich ihnen eine Abneigung gegen Hierarchien und ein gesundes Misstrauen gegen die Beschwörung Gottes und der Gemeinschaft.
Ich durchsuchte mein Gedächtnis nach Georg, kramte die Kiste mit seinen Postkarten, den Briefen und Alben meiner Eltern hervor. Ja, ich habe eine solche Sentimentalitätenkiste. Sie ist neben zwei Sesseln aus den Sechzigerjahren und dem gewichtigsten Familienerbstück, dem Bösendorfer-Flügel meines Großvaters väterlicherseits, der Musiklehrer war und ihn seinerseits von einem dankbaren, vermögenden Schüler geerbt hatte, das Einzige, was ich noch von meinen Eltern besitze. Ich blätterte durch die von der Mutter penibel beschrifteten und datierten Fotoalben. Betrachtete meine bilderbuchbürgerlichen Großeltern in Hamburg, 1944. Sie, Berta, mit unwirschem Blick, grauem Haarknoten und sackigem Kleid. Er, Hubertus, mit unleserlicher Miene, schütterem Haar und Pfeife im Mund. Dazu meine elfjährige Mutter mit Schleife auf dem Kopf und einem schlichten, weißen Kleidchen, neben ihr ein etwa gleichaltriger, dürrer Junge. Ich sah den sechsjährigen Georg auf einer Schaukel am achtzehnten Geburtstag meiner Mutter (1951), sah ihn zehn Jahre später frech dreinblickend mit einer Schultasche auf einem Fahrrad und, 1968, feierlich im dunklen Anzug bei meiner Taufe. Mich, ein Bündel in weißer Strickdecke, auf seinem Arm. Mitte der Siebziger mit spitzem Hemdkragen und riesiger Hornbrille auf unserer Terrasse beim Spargelessen und daneben das letzte Foto von ihm, 1981, mit mir am Flügel in unserem Wohnzimmer. Mehr noch als mein albern entrückter Ausdruck auf diesem Bild erstaunte mich, dass es den Abend zurückbrachte und aus der Vergessenheit rief, was mir schon während des Telefonats mit Georg hätte einfallen müssen. Beim Essen hatten die Erwachsenen über den Moskau-Besuch von Schmidt und Genscher diskutiert, über den die Eltern wenig erfreut gewesen waren. Die Sowjetunion war in Afghanistan einmarschiert, zweiundvierzig Staaten hatten ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Moskau abgesagt, was Breschnew, wie man heute weiß, auf die Idee brachte, Helmut Schmidt einen Lada Niva für seine Sumpfpflanzen erforschende Frau und Hans-Dietrich Genscher ein Jagdgewehr schenken zu wollen, um ihnen Olympia doch noch schmackhaft zu machen. Am Ende hatte Loki keinen Lada und Genscher kein Gewehr bekommen, stattdessen hatten die Sowjets ihre Truppen in Afghanistan von 85 000 auf 115 000 Soldaten aufgestockt, und wenn man sich vergegenwärtigt, was aus alldem geworden ist, nicht absehbar an jenem Abend in der elterlichen Wohnung, beweist der lapidare Satz meines Onkels geradezu seherische Qualitäten: »Sicher ist nur, dass daraus nichts Gutes erwachsen wird, Hora, lass uns lieber Klavier spielen.«
Und wie er das tat! An diesem Abend übertraf er sich selbst. Cow Cow Boogie. Er trug mir auf, mit einzustimmen. Ich beobachtete seine Hand und klimperte die Töne eine Oktave tiefer nach. Er variierte und improvisierte, ich versuchte, seiner Linken blitzschnell nachzueifern. Wie weit entfernt war sein Spiel von meinem Klavierunterricht bei Frau Krostek … Er tanzte über die Tasten. Und ich? Zwei Zehnpfennigmünzen auf den Handrücken, damit ich unter Frau Krosteks staksigem Blick und ihrer pädagogisch fragwürdigen Ermahnung – Wer an einem solchen Instrument sitzen darf, muss es auch können – die Hände richtig hielt. An diesem Abend schmiss ich alles über Bord und tat es meinem Onkel nach: spielte und tanzte und trillerte und hüpfte seinen Fingern hinterher. Aneinandergedrängt schwangen unsere Oberkörper im Boogie von rechts nach links, wir lachten, ich flötete, summte, trommelte Bassisten, Trompeter, Saxofonisten und Schlagzeuger hinzu, sang yippity yi yeah, während Georg, so schien es, keine Taste unberührt ließ, mit seinen Händen von unten nach oben schwebte und zwischendurch Cowboy-Yihas ausstieß. Es roch nach Grillfleisch, Flieder und Wein. Der Stoff des Klavierschemels kratzte an meinen nackten Oberschenkeln unterhalb der kurzen Schlafanzughose. Alles davon war wunderbar. Alles stimmte. Und da kam Mutter aus der Küche und machte das Foto, das ich von allen am häufigsten betrachtet habe in den Wochen nach Georgs Anruf. In der Hoffnung, ihn zu erkennen, von seinem Gesicht etwas ablesen zu können, das ihn zurückbrachte, so, wie ich in den vergangenen fünfunddreißig Jahren immer wieder einmal versucht hatte, ihn mir ins Gedächtnis zu rufen oder gar ihn zu finden – zuletzt nach dem Tod meiner Mutter. Schließlich legte ich Cow Cow Boogie auf, setzte mich aufs Sofa und schloss die Augen. Es dauerte genau zwölf Sekunden. Mit Benny Carter war Georg da. Seine Schulter an meiner. Seine lange, schlanke Gestalt, sein dunkelbraunes Haar, sein ovales Gesicht mit der spitzen Nase und den ausnehmend schön geschwungenen Lippen. Sein Lachen. Sein Swing-Blick, his knocked out accent with a Harlem touch. Viermal hintereinander habe ich das Stück gehört. Jedes Mal ein wenig lauter, beim dritten Mal nicht mehr auf dem Sofa, sondern durch die Wohnung tanzend, beim vierten in Vorfreude. Warum eigentlich sollen wir nicht damit anfangen?, hatte er am Telefon gesagt und mich nach dem Glauben gefragt. Damit anfangen … Er würde sich wieder melden.
Und wirklich: Nach drei Wochen war es so weit. Ich befand mich im Pausenraum des Seminars und bereitete mich aufs Wochenende vor, hatte Hausarbeiten meiner Komparatistik-Hauptsemester zum Thema »Der Trinker als Held. Literarische Darstellung der Alkoholabhängigkeit bei Malcolm Lawry und Hans Fallada« in die braune Ledertasche gepackt, Kaffeebecher in die Spülmaschine geräumt, Kollegin Sarah zu ihrer Schwangerschaft beglückwünscht, als mein Handy klingelte. Anonym. Ich wusste Bescheid. Und Georg sagte, als wäre unsere Verbindung eben erst unterbrochen worden: »Da bin ich wieder. Wenn du Zeit hast, lass uns einen Kaffee trinken. Ich stehe vor der Uni.«
Übrigens schreibe ich dies auf einem Bauernhof in der Eifel, einem abgelegenen Weiler namens Ruitzhof, der kleinsten bewohnten Exklave Deutschlands, die zum Dorf Kalterherberg gehört. Im Norden, Westen und Süden grenzt ihr Gebiet an Belgien, im Osten verläuft die Trasse der Vennbahn ebenfalls auf belgischem Staatsgebiet. Hier bin ich gelandet, obwohl ich dem Landleben nie zugetan war. Meine Anwesenheit an diesem Ort, umgeben von Monschauer Hecken, Weideland und Fichtenwäldern, hat an dieser Haltung wenig geändert. An guten Tagen vermag ich der rauen Umgebung etwas abzugewinnen. Bei Sonne sind die Schieferplatten, die den Weg zum Haus ebnen, warme Inseln. Ist die haushohe Hecke, die den Rumpf des Wohntrakts vor Wind und Schnee schützt, eine wohlige Tapete. Stellt der Steinbrunnen neben der Haustür einen luxuriösen Wassertrog für Edda, meine Berner Sennenhündin, dar. An schlechten Tagen jedoch, wenn Wolkenmassive den Horizont verschlingen und unsichtbarer Regen die Luft vergraut, kann ich mir keinen trübsinnigeren Ort denken. Dann erstickt die Hecke das Haus, werden die Schieferplatten zu Rutschbahnen, und obendrein fällt mir die rostige Badewanne ins Auge, die kopfüber auf der Weide zwischen Herrn Kaulards Kühen liegt wie ein Monument des Todes. Und umgehend fühle ich mich von der Eifel erledigt. Weltverloren, obgleich die nächsten und bewohnten Höfe in Sichtweite sind. Bei solcher Witterung beschleichen mich wiederkehrend, denn es regnet hier oft, kauzige Gedanken wie: Möglicherweise sieche ich in diesem Fachwerkbau in dörrstickiger Ofenluft dahin oder ich gehe vor lauter Beschaulichkeit noch freiwillig ins Moor; das Hohe Venn liegt mit seinen Tümpeln, Schlenken und Bulten, seinen Mulden, in denen der Wasserstand steigt und sinkt, aber nicht fließt, seinen Kuppen aus Torf und Moosen, seinen unheimlichen Baumstümpfen und verwirrten Wollgräsern vor der Tür. Doch ist meine Niedergeschlagenheit, ich muss der Wahrheit Genüge tun, theatralischer Natur. Ich bin nicht suizidgefährdet, habe auch keine Todesahnungen. Ich mag einfach keinen Regen. Aber ich habe zu tun an diesem Ort. Ich habe, wie versprochen, diese Geschichte zu erzählen; ich, Horand Roth, genannt Hora, getauft nach dem Lehnsmann der Nibelungensage, dem Herrn über Dänemark, dem Sangesmeister und Helden, was mit mir so viel zu tun hat wie Zehnpfennigstücke auf dem Handrücken. Was soll ich sagen? Die Nibelungensage hatte es meiner Mutter angetan. Also: Horand Roth, eins vierundachtzig, braune Haare, schwarze Augen wie Mutter und Onkel, neunundvierzig Jahre alt, was älter klingt, sich aber – Plattitüde – nicht so anfühlt, Literaturwissenschaftler, geschieden. Nicht auf dem Papier, aber wir leben getrennt, denn ich bin, sagt Patricia, zu selbstzufrieden, zu zynisch, zu unerreichbar. Und angeblich auch zu glücklich mit mir, was mit zynisch meines Wissens nur bedingt einhergeht, aber wegen solcher und anderer Meinungsverschiedenheiten leben wir wohl getrennt, und auch wegen der Geschichte mit Jesper, ihrem Kollegen aus Kopenhagen, die nur kurz andauerte, aber ihre Perspektive verschob, wie Patricia mir eröffnete, die ihr klarmachte, dass sie nicht weiterleben will mit meiner inneren Abwesenheit, während Menschen mich ansähen und erwarteten, dass ich mich an ihren Gesprächen beteilige. Doch alles, was mir in solchen Momenten durch den Kopf geht, was passend, gar eloquent oder geistreich wäre, erscheint mir müßig oder verschwendet. Entweder hat es jemand mit anderen Worten schon gesagt oder es ist zu absurd. Gespräche dieser Art sind Gesellschaftsspiele nach Regeln, die niemand aufgestellt hat und die von allen akzeptiert sind. Es sind Gespräche aus Porzellan. Sie verursachen in mir dasselbe Nichts, wie es in meiner Kindheit Brettspiele in großen Runden taten. Man weiß die Antwort oder könnte sie spielend herleiten, natürlich, aber im Moment der Wahrheit, im Augenblick, da die Sanduhr ausläuft, die Antwort fällig wird, regiert schweigsame Leere.