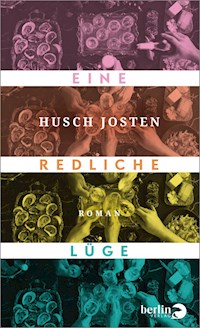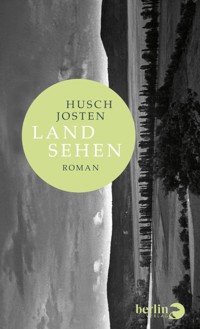10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jean Tobelmann, Gastronom in dritter Generation, hat einen eigenwilligen Stammgast – der junge Sourie erforscht mit leidenschaftlichem Ernst, wovon die meisten Menschen lieber schweigen: das Ende des Lebens. Warum? Tobelmann geht der Geschichte des humorvollen Exzentrikers auf den Grund und stößt dabei auf etwas, das verständlicher und zugleich unbegreiflicher nicht sein könnte, etwas, das weit über Souries Amour fou mit der gemeinsamen Freundin Tessa und die Verbundenheit der beiden Männer hinausweist. Schwerelos, mit feiner Ironie und Beobachtungsgabe erzählt Husch Josten von den Fallstricken des Lebens. Von wahrer Freundschaft, falschen Entscheidungen, der Suche nach Sinn und von der Liebe – unserer einzigen Waffe gegen die Sterblichkeit. »Achtung: Dieses Buch könnte Ihre Einstellung zum Tod beeinflussen. Sie könnten ihm gelassener entgegensehen, vielleicht sogar über ihn lachen. Oder das Gegenteil. Ein großer Roman über Leben und Sterben. Klug und heiter, sprachgewaltig und tiefgründig.« Bettina Böttinger »Husch Josten erzählt zart und provozierend klug eine gewaltige und unvergessliche Geschichte über Liebe und Tod. Es wird höchste Zeit, dass Josten endlich ihren Platz in der ersten Reihe der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur einnimmt.« Denis Scheck
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: plainpicture / Mark Owen und FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Doc Stechel und für Monika
»Der Tod interessiert mich.«
Stéphane Hessel
Sourie freute sich auf den Tod. Davon erzählte er – mein durchaus lebensfroher junger Stammgast – Tessa an dem hellblauen Septembertag, als die beiden in meinem Restaurant auftauchten. Sie miteinander zu sehen, war so verwirrend wie die zufällige Begegnung mit Menschen, die man sonst nur in einer bestimmten Umgebung trifft und in jeder anderen nicht zuordnen kann. Ich wusste nicht, dass sie sich kannten, und da sie derart unterschiedlichen Bereichen meiner Welt angehörten, kam ihr Zusammentreffen für mich der Kollision zweier Planeten gleich. Bezeichnenderweise fiel ihre Begegnung in das Jahr, in dem der heißeste Sommer seit Beginn der Messungen verzeichnet wurde, die Weltbevölkerung erstmals die Acht-Milliarden-Marke überschritt und sich allerorten eine diffuse Unruhe ausbreitete. Es war das Jahr, in dem das kollektive Empfinden, dass sich die Dinge ändern mussten, zur alarmierenden Gewissheit wurde, worauf alle politischen Lager in sämtliche Himmelsrichtungen losstürmten. Und jeder und jede Einzelne stürmte schließlich auch noch irgendwohin, erschrocken, überrumpelt, ratlos.
Erst als Sourie mich darüber aufklärte, dass sie einander im Pflegeheim begegnet waren, wo er als Pförtner arbeitete, fiel mir wieder ein, dass Tessa zwei oder drei Jahre zuvor von Sorgen um ihre Eltern erzählt hatte. Ich hatte es vergessen, wollte zu einer Entschuldigung anheben, aber sie wehrte ab. Vor zwei Tagen war im Augustinus-Haus nur vier Monate nach ihrer Mutter auch ihr Vater gestorben. Eben hatte sie seine Sachen gepackt und abgeholt, sein Bett wurde benötigt. Sie hatte erwogen, seine Pyjamas, Hemden, Strickjacken, die Lieblingsdecke, Rasierapparat und Aftershave dort zu lassen und nie wieder anzufassen, zu riechen, anzusehen. Aber das war ihr pietätlos erschienen. Gerade erst, so wenigstens kam es ihr vor, hatte sie die Habseligkeiten ihrer Mutter aus den Schränken geräumt, Kleider, Röcke und Nachthemden gefaltet und in einen Koffer gelegt, ohne zu wissen, warum und für wen, es verreiste ja niemand. Damals war ihr Mann Hans bei ihr gewesen, um zu helfen, aber sein Mitleid hatte es nur schlimmer gemacht. Die weichen Blicke, seine hilflose Besorgtheit bei jedem Kleidungsstück, die Ehrfurcht vor dem Nageletui ihrer Mutter. So hatte sich Tessa geschworen, nie wieder einen Koffer im Heim zu packen und schon gar nicht im Beisein von Hans, der es gut meinte, das wusste sie natürlich.
»Aber Gutmeinende kann ich derzeit am allerwenigsten vertragen«, gab sie zu. »Ich habe es doch selbst als Fledderei empfunden, alles zu durchwühlen und mitzunehmen. Jeder einzelne Gegenstand tat weh. Ich hab mir gewünscht, Hans würde mich anbrüllen: Alles nur Krempel! Das hätte geholfen. Stattdessen hatte er Tränen in den Augen, als ein Pfleger ihm eine Papiertüte mit der Brille und dem Portemonnaie meiner Mutter überreichte. Deswegen bin ich heute allein ins Heim gegangen. Und an der Pforte hat er«, sie zeigte auf Sourie, »mich netterweise zum Essen eingeladen. Erst auf dem Weg über die Brücke ist mir klar geworden, dass sein Restaurant das Tobelmann ist, Johannes. Es ist schön, dich zu sehen. Schön, gerade heute jemanden zu sehen, der meine Eltern gekannt hat. Früher, meine ich …«
Ich nahm Tessa in die Arme. Sie war eine Freundin, wie es nur Menschen sein können, die schon immer da waren. Die miterlebt hatten, wie man als unbeschriebenes Blatt leichtsinnig genug gewesen war, der Welt unverstellt entgegenzutreten und Träume zu hegen, denen die Erwachsenenwelt bestenfalls skeptisch begegnet war. Sie hatte die ihren vor vierzig Jahren konsequent verfolgt, war Fotografin geworden. Ich hatte meinen Traum vom Schriftsteller-Dasein bald an den Nagel gehängt, was sie taktvoll nie kommentierte. Trafen wir uns, was nicht allzu oft geschah, knüpften wir mühelos an, wo wir aufgehört hatten, gingen unserer Wege, trafen uns wieder. Im Alter von fünfzehn hatte sie mir mit ihren roten Locken und Efeu-Augen zeitweise den Kopf verdreht, aber gegen Hans Blumenkamp war niemand angekommen. Die beiden waren praktisch seit dem Abitur verheiratet, und wie zur Demonstration, dass sich daran nichts änderte, traf allweihnachtlich ein Fotogruß von ihnen ein. Ich ließ ihn alle Jahre wieder unbeantwortet – Weihnachtskarten habe ich noch nie etwas abgewinnen können. Nicht einmal denen von Tessa, die keine glücksposaunende Familienaufstellung, sondern schnörkellose Winterimpressionen schickte.
Ich platzierte die beiden an Souries angestammtem Tisch nahe der Bar, holte einen leichten Pfälzer Weißwein und setzte mich dazu.
»Wir kennen uns vom Sehen«, erzählte Sourie, der den Zufall unserer Zusammenführung offenbar nicht weiter bemerkenswert fand. »Schon lange. Haben uns nie länger unterhalten, aber ich wusste natürlich, dass ihr Vater vorgestern verstorben ist. So kamen wir ins Gespräch.«
Ich wunderte mich, dass er sich wie ein Schuljunge erklärte.
»Jedenfalls sprachen wir über frühere Zeiten: Kindheit, Jugend.«
»Die Zeit, in der keiner an den Tod denkt«, ergänzte Tessa. »Er hatte keinen Platz. Natürlich war er da. Jeden Tag in den Nachrichten oder in Filmen. Aber er fand ausschließlich woanders und weit weg statt, nicht wahr? Man konnte ihn mit der Fernbedienung ausknipsen. Also haben wir ihn in absurde Theorie gewickelt und für später auf dem Dachboden verstaut.«
Ich nickte nur.
»Als sie das sagte, hatte ich eine Idee«, verkündete Sourie. »Tessa hat mich auf einen Gedanken gebracht, und so habe ich sie zum Essen überredet. Man muss den Tod aus seiner Verpackung wickeln und vom Dachboden herunterholen, verstehst du?«
»Nicht ganz …«, gestand ich, aber seinen Überlegungen war gelegentlich schwer zu folgen. Manchmal kam es dem flüchtigen Lesen von Plakaten oder Werbebannern gleich, wenn das Gehirn in aller Schnelle Buchstaben falsch zusammensetzt. Erst vor wenigen Tagen war im Vorbeifahren für mich aus der Werbung für einen Firestick ein Restfick geworden, worauf ich dann doch angehalten und erneut gelesen hatte. Mit Souries rasanten Gedankensplittern, nein, mit ihm selbst verhielt es sich ähnlich. Worte zerbröselten an seinem Wesen, zerfielen in ihre Einzelteile, bezeichneten ein paar seiner Eigenschaften, schlossen jedoch die entgegengesetzten aus, die genauso zu ihm gehörten. Sourie war – anders. Zu alt für seine siebenundzwanzig Jahre. Verblüffend belesen. Zwingend. Immer liebenswürdig. Schrullig. Spielerisch. Er übte eine Anziehungskraft auf mich aus, die ich bis heute kaum erklären kann und der ich mich von Anfang an nicht entziehen konnte, sosehr ich mich generell bemühte, persönliche Kontakte zu meiden. Aber er war die Ausnahme, seit er zweieinhalb Jahre zuvor erstmals zum Essen gekommen war. Da hatte ich als Nachfolger meines Vaters, Groß- und Urgroßvaters gerade das Tobelmann übernommen, und mit der Selbstverständlichkeit zweier Menschen, die es nicht darauf anlegten, waren wir im Laufe der Zeit so etwas wie Freunde geworden. Nicht im herkömmlichen Sinn von Freundschaft. Wir verabredeten uns nicht, gingen nicht gemeinsam zu Konzerten oder ins Kino, unternahmen keine Ausflüge und trafen uns auch nicht in seiner oder meiner Wohnung. Wir sahen uns, so hatte es sich eingespielt, ausschließlich in meinem Restaurant. Wenn alle Gäste gegangen waren, saßen wir zusammen, redeten über alles und nichts, spielten Backgammon, tranken Wein, oder er half mir, wenn ich aufräumte, etwas in der Küche sortierte. Meine Belegschaft wurde nicht müde, uns damit aufzuziehen, was ein junger Kerl wie Sourie an einem doppelt so alten wie mir interessant finden mochte, und vermutlich war es wirklich der Altersunterschied, der mich davon abhielt, ihn meinen Freund zu nennen. Es machte mich verlegen, jemanden so zu bezeichnen, der mein Sohn sein konnte.
»Botschafterin gegen Einsamkeit!«, rief er. »Ist das nicht eine fabelhafte Idee? Viele unserer Bewohner erhalten nie Besuch. Für sie ist es ein Geschenk, wenn jemand kommt und mit ihnen spricht.«
Tessa nahm ein Stück Baguette, aß aber nicht.
»Ich wundere mich, dass ich nicht schon längst darauf gekommen bin«, sprach Sourie weiter. »Denk daran, was ich immer sage: Man muss sich dem Tod nähern. Nicht nur, wenn er einen selbst angeht, sondern man sollte sich frühzeitig mit ihm beschäftigen. Mit seiner Allgegenwart. Damit, dass er jeden, absolut jeden betrifft. Und gleichzeitig macht man alten Leuten eine Freude, die niemanden mehr haben.«
»Er hat mir das vorgeschlagen.« Tessa legte das Brot auf die Serviette. »Also, er hat mir vorgeschlagen, die erste Botschafterin gegen Einsamkeit im Augustinus zu werden. Gemeinsam mit ihm alte Menschen zu besuchen. Und weißt du was, Johannes? Die Vorstellung, mit Blumen und Kuchen wieder ins Heim gehen zu dürfen, ist verstörend tröstlich.« Sie betrachtete das Brotstück. »Trauertherapie für mich. Ehrenamt für ihn. Todannäherungstherapie für weitere, folgende Botschafter.«
Vielleicht lag es an Souries Freimut, seiner unaufdringlichen Verbindlichkeit und diesem kindlich Verspielten, das er ausstrahlte, ich wusste es nicht zu benennen, aber auf einmal erzählte die sonst zurückhaltende Tessa von ihren Eltern. Von den Jahren der Krankheit, von ihrem Sterben. Beherzt und möglichst sachlich schilderte sie uns, wie ihr Vater zwei Tage zuvor gestorben und der Raum mit einem Mal von wuchtiger Leere erfüllt gewesen war. Wie sie das Gesicht des Vaters betrachtet und darin Geschichten gefunden hatte, die sie ohne den Spiegel seines Blicks nie mehr sehen würde. Sie berichtete von unzähligen Nächten in Notaufnahmen, von Intensivstationen, von Ärzten und Patientenverfügungen für Mutter oder Vater und ihren vielmaligen Einwilligungen, im Ernstfall nicht zu reanimieren. Sie erzählte vom Abschiednehmen bei jedem Besuch, weil unwägbar wurde, ob sie ihre Eltern je lebend wiedersehen würde. Wie sie beide schon während ihrer letzten Jahre vermisst hatte, weil Gespräche mit ihnen nicht mehr möglich gewesen und irgendwann auch Stichworte ins Nichts gelaufen waren, die früher verlässlich einen Schwall von Schilderungen oder wenigstens Assoziationen ausgelöst hatten. Tante Hetti hat als Schneiderin gearbeitet … Onkel Josef ist im Krieg geblieben … Opa hatte einen Schäferhund, weil Hitler einen hatte … Sie erzählte vom Geruch der Krankheit, von faulen Zähnen, wund gelegener Haut, Blut und Urinbeuteln, Details, von denen sie nicht einmal Hans oder ihren Söhnen berichtet hatte, um Schwieger- und Großeltern nicht zu entwürdigen. Aber es war nicht entwürdigend, stellte sie jetzt fest. Vielmehr war es unmenschlich, nicht davon zu erzählen. Davon. Und von der Zeit. Wie merkwürdig es war, dass man Jahrzehnte existierte, Jahre und Tage und Stunden sammelte und mit Leben füllte, Zielen, Terminen, Erledigungen und Ärgernissen hinterherlief, reiste und staunte, heulte und glücklich war, sich die Zeit oft genug vertrieb, an andere verschenkte. Und dann alles, dieses ganze Dasein, mit einem Schlag beendet war.
»Ich bin erleichtert«, schloss Tessa. »Und es ist grauenhaft, so etwas zu sagen.«
Ich schob die Kartoffelsuppe weg, die ich zwischenzeitlich für beide aus der Küche geholt und die sie kaum angerührt hatte, und nahm ihre Hand. Das Verhältnis zu ihren Eltern war nicht unkompliziert gewesen, das wusste ich, schon aus diesem Grund konnte ich nachvollziehen, dass ein Teil von ihr auch entlastet war. Aber Tessa meinte eine andere Erleichterung. Die Befreiung vom jahrelangen Kampf um den Rest von Leben, den Dispens vom allumfassenden Kümmern, das Ende von Zuständigkeit, Verpflichtung und Disziplin, die ihre Eltern der einzigen Tochter auch abverlangt hatten.
Sourie holte Luft. Mir schwante, was folgen würde.
»Ich werde nicht sagen, dass es mir leidtut«, erklärte er prompt. Ich warf ihm einen Nicht-jetzt-Blick zu, er aber legte den Suppenlöffel ab und sprach weiter. »Ich weiß, man sagt in solchen Fällen etwas anderes. Es wird erwartet, dass man Anteil nimmt, sein Bedauern ausdrückt, und ja: Ich bedauere das Leid, das deine Eltern und du erleben mussten, Tessa. Aber ich werde nicht sagen, dass mir ihr Tod leidtut.«
»Wenn du jetzt von Erlösung sprichst«, antwortete sie müde, »bist du nicht der Erste. Glaub mir: Ich habe einige Erfahrung mit dem Erlösungsmotto, es wurde mir schon beim Tod meiner Mutter gerne nahegelegt. Aber es ist vermessen, von Erlösung zu sprechen, wenn jemand stirbt. Ich bin nicht erleichtert, weil sie von ihrem Leben erlöst sind, von dem sie möglicherweise gar nicht erlöst werden wollten. Ich bin erleichtert, weil ich erlöst wurde. Weil ich ihr Leid nicht mehr mit ansehen konnte. Ich weiß nichts über ihre vermeintliche Erlösung. Ich weiß nicht, was sie gefühlt oder nicht gefühlt haben. Ich habe keine gottverdammte Ahnung, was sie mitbekommen und ob sie so lange durchgehalten haben, weil sie unbedingt durchhalten wollten, all das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich kaum mehr durchgehalten habe. Meine Erlösung ist eine völlig egoistische, schäbige, furchtbare Erleichterung.«
»Sie ist nicht furchtbar, Tessa, schon gar nicht schäbig.« In Ermangelung einer besseren Idee von Anteilnahme hielt ich immer noch ihre Hand. »Du bist erschöpft.«
»Ich wollte gar nicht von Erlösung sprechen«, stellte Sourie klar. »Ich wollte erzählen, dass der Tod und ich eine besondere Verbindung haben.«
»Also, das …«, unternahm ich einen weiteren Versuch, »muss jetzt wirklich nicht …«
»Was bedeutet denn das?«, fiel mir Tessa ins Wort, erleichtert, dass Sourie keine Trostformeln von sich gab oder bedeutungsvoll schwieg, zugleich so perplex, wie ich es gewesen war, als ich diesen Satz zum ersten Mal von ihm gehört hatte.
»Frag nicht!«, sagte ich zu ihr. »Du öffnest die Büchse der Pandora.«
»Auf deren Grund immerhin Hoffnung liegt.« Tessa wandte den Blick nicht von dem jungen Mann ihr gegenüber. »Wir müssen sie nur rechtzeitig wieder schließen. Also, Sourie, was ist das für eine Verbindung zwischen dir und dem Tod?«
»Nun, der Tod lächelt uns an«, legte er los. »Er ist das unlösbare Rätsel, das Wissen, das es nicht gibt. Eine grandiose Zumutung, denn er ist auch die absolute Gewissheit. Niemand kommt an ihm vorbei, doch wir wissen nichts über ihn. Wir wissen vieles über das Sterben, aber nichts über den Tod.«
»Und das findest du grandios?«
»Ich finde es faszinierend«, antwortete er. »All die Theorien, Scharlatanerien, Geschichten, Glaubenssätze … Seit Menschengedenken nichts als Anker der Ratlosigkeit.«
»Sourie …« Aber er hörte mich gar nicht.
»Lass ihn«, bat mich Tessa. »Man erlebt nicht alle Tage eine solche Unerschrockenheit vor dem Thema, um das die meisten Menschen einen Bogen machen. Im Allgemeinen, und ich spreche wirklich aus Erfahrung, lassen Krankheit und Tod Gespräche ersterben. Verstockt und verlegen wird herumgedruckst, Rettung in Floskeln gesucht.«
»Und ich begreife nicht, warum«, bestätigte Sourie. »Menschen könnten sich viel Leid ersparen, wenn sie bloß logisch denken würden: Warum finden die meisten einen Sachverhalt, der mit solider Zuverlässigkeit jeden betrifft, düster und deprimierend? Warum reagieren sie mit Ablehnung und Schrecken, als würde sie etwas Kolossales aus dem Nichts anspringen? Der Tod biegt jeden Tag in praller Sonne um die Ecke, damit muss man sich doch auseinandersetzen!«
»Und das tust du«, konstatierte Tessa.
»In der Tat«, bestätigte er.
Halb Franzose, halb Deutscher, war Sourie ein schmaler, kantiger, hochgewachsener Mann mit dunklem Haar, blassen Gesichtszügen und perfekt gerundeten Augenbrauen, die ihn erstaunt und stolz wirken ließen. Irgendwie erinnerte er mich an die Porträts flämischer Meister. Diesseitiger allerdings, auch frecher. Doch in seinem Blick lag etwas ähnlich Flinkes, zugleich Fernes, als würde er wach in die Welt, in Wirklichkeit aber hinter sie schauen und etwas entdeckt haben, das er nicht preisgab. Alle nannten ihn beim Nachnamen – er konnte seinen Vornamen Emmanuel nicht leiden. Manchmal kam er mit dem Fahrrad ins Tobelmann, meist zu Fuß. Schien die Sonne, kam er unter einem weiß-roten Werbeschirm der Sparkasse über die Rheinbrücke spaziert. Regnete es, zog er nicht mal die Kapuze über den Kopf, denn er mochte Regen. Tropfnass kam er an die Bar und bat um ein Handtuch. Das war seine kleinere Marotte. Die größere und irritierende war seine Begeisterung für den Tod, mit der er Zuhörer buchstäblich in die Flucht treiben konnte. Tessa gehörte zu meiner Überraschung nicht dazu, ihre Feststellung forderte ihn vielmehr auf, weiterzusprechen.
»Natürlich: Man kann die Hirnforschung bemühen«, fuhr er also fort. »Man kann anführen, dass Seele und Gedächtnis untrennbar zusammengehören und die Neuronenverbindungen im Gehirn, die für das Gedächtnis zuständig sind, durch den Tod zerstört werden, wodurch auch die Seele nicht weiterleben kann … Aber weiß man es? Ist die Seele wirklich nur die Summe aller Erinnerungen? Wenn du mich fragst: Es gibt auf keinem anderen Feld eine vergleichbare Ratlosigkeit.«
»Es gibt überall Ratlosigkeit«, widersprach ihm Tessa ruhig. »Nicht nur in Sachen Tod. Zum Beispiel auch, was den Kosmos angeht. Erst kürzlich habe ich dazu einen Artikel gelesen. Lasst mich überlegen … Ja, genau: Woraus besteht das Universum – außer Planeten, Sternen, Galaxien, Gas, Staub? Gibt es außerirdisches Leben? Oder: Können Maschinen ein Bewusstsein haben? Also, ich widerspreche dir ausdrücklich, Sourie. Es gibt viel Ratlosigkeit in der Welt!«
»Aber nein«, rief er enthusiastisch. »Das sind alles nur vorläufig ungelöste Fragen. Auf sie wird es Antworten geben, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber um den Tod erklären zu können, muss man sterben. Ich glaube, dass wir Verstorbene vor allem deswegen ehren, weil sie uns diesen Schritt voraus sind: Sie wissen’s jetzt und können es uns nicht mehr erzählen.«
»Wir ehren sie für ihr Leben«, korrigierte Tessa entschieden. »Für ihr Dasein. Ihr Vermächtnis. Nicht für ihren transzendentalen Vorsprung.«
Ihr Blick sprach Bände. An wen war sie da geraten? Was war das für ein Pförtner, mit dem sie das Projekt gegen Einsamkeit hatte besprechen wollen, der sich als Philosoph des Todes entpuppte? Aber Sourie nahm ihre Verwunderung nicht zum Anlass, sich zu erklären, von sich zu erzählen. Etwa von dem Philosophie- und Geschichtsstudium, das er drei Jahre zuvor mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, um dann Portier im Augustinus zu werden, weil er in der Nähe von Menschen sein wollte, die ihre letzte Adresse bezogen hatten. Oder von dem angenehmen Nebeneffekt dieser Tätigkeit: der Zeit für seine Lektüren zum Thema. Er war in Gedanken ganz bei unserem Gespräch, so sehr in seinem Element, dass ihm derlei Erläuterungen völlig belanglos erschienen.
»Hinterbliebene sind mit Trauer beschäftigt, Sourie«, stimmte ich ihr zu und hoffte, es werde ihn an den Anlass für Tessas heutigen Besuch im Pflegeheim erinnern. »Sie freuen sich wirklich nicht darüber, dass der Verstorbene jetzt Einblick in was auch immer hat. Sie trauern.«
Aber Sourie war nicht zu bremsen: »Also, wenn ich mir das Sterben vorstelle, denke ich an die schlimmsten Momente von Krankheit, die ich kenne. Hohes Fieber, Schmerzen. Übelkeit. Ich nehme an, es gibt einen Moment, in dem man sich wünscht, dass es aufhört. Einfach aufhört. Hoffentlich ist dann jemand mit Morphium in der Nähe. Aber danach …« Er machte eine wohlgesetzte Pause. »Danach, das ist der Moment, für den alle Vorstellung versagt. Danach liegt außerhalb jeder Vorstellung.«
Tessa sah ihn erwartungsvoll an.
»Es liegt außerhalb jeder Höllenvorstellung von Verdammnis und ewiger Nacht«, führte er seinen Gedanken aus. »Außerhalb jeder gängigen Trostfantasie wie Licht, Frieden, Erlösung, Paradies, Nachleben, Atomismus, Wiedergeburt …« Er nahm einen Schluck Wein. »Und natürlich außerhalb jeder Idee von Nichts. Außerhalb überhaupt jeder denkbaren Vorstellung. Das Unvorstellbare«, erklärte er feierlich. »Versteht ihr? Das wirklich Un-Vorstellbare.«
Tessa und ich warfen uns einen kurzen Blick zu. Und mussten über so viel Pathos lachen.
»Es ist nicht möglich, dass wir dazu irgendeine Vision, irgendein Hirngespinst haben«, ließ sich Sourie davon nicht aus dem Konzept bringen. »Es ist unvorstellbar. Das macht den Menschen solche Angst. Es entzieht sich jeglicher Kontrolle. Man kann sich nicht vorbereiten. Wir wissen nichts. Absolut nichts. Was erwartet uns? Keine Ahnung. Was glauben wir? Na, jedenfalls nichts, was sich vernünftig herleiten ließe. Welche Seligkeit für die, die sich irgendein Bild davon machen. Aber wenn man klaren Verstandes ist? Dann gibt es kein Bild. Und ist es nicht ärgerlich, dass dieses wunderbare Wort unvorstellbar meist im Zusammenhang mit Dummheit, Verbrechen, Gräueltaten verwendet wird? Jemand ist unvorstellbar dumm. Ein unvorstellbares Verbrechen. Eine unvorstellbare Gräueltat. Nein! Das ist falsch! Es ist grundfalsch. Denn wozu Menschen imstande sind und wie dumm sie sein können, davon haben wir doch wohl sehr genaue Vorstellungen! Unvorstellbar«, schloss er, »dieses Wort sollte exklusiv dem Tod vorbehalten sein. Es gibt nichts anderes Unvorstellbares. Ich bin allerdings auch der Ansicht, dass man über der Vorstellung des Unvorstellbaren irrewerden kann und Ungeübte daher besser die Finger davon lassen sollten. Es kommt so oder so auf alle zu.«
Sein Gesicht war über diesen Vortrag ein wenig errötet, sein Haar in Unordnung geraten. Eine Strähne bedeckte sein rechtes Auge und einen Teil seiner jungenhaften Nase. Tessa und ich ließen seine Worte auf uns wirken, die wie ein Gewitter über uns gebraust waren, hier und da Blätter und Äste von den Bäumen gefegt und unsere Gedanken zu Kartenhäusern gemacht hatten, die den nächsten Windstoß fürchteten. Ich konnte es sehen: Tessa war ebenso beeindruckt und verwirrt, wie ich es gewesen war, als Sourie mir zum ersten Mal mit solcher Inbrunst vom Unvorstellbaren erzählt hatte. Ihr Blick trug denselben Zweifel, den er auch mir bei all seiner Lässigkeit nicht hatte ausreden können: dass etwas nicht stimmte.
Natürlich hatte ich ihn gefragt, warum er sich derart mit dem Tod beschäftigte. Er hatte gelacht. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass ihm diese Frage gestellt worden war. Ich hatte eine Tragödie erwartet. Eine unheilbare Erkrankung. Den Verlust eines Familienmitglieds. Einen Unfall. Etwas in der Art. Doch seine Antwort war eine pragmatische gewesen, die einleuchtend klang, mich aber nie ganz überzeugte: »Es ist die Unabwendbarkeit. Je eher man sie realisiert, desto weniger niederschmetternd ist die Sache.« Tatsächlich wirkte Sourie weder lebensmüde, noch hing er einer romantischen Todessehnsucht an. Er war mit jedem Akkord gegenwärtig und seine Beschäftigung mit dem Ende so unbefangen, dass sie nichts Beunruhigendes in sich trug. Ich jedenfalls war irgendwann dazu übergegangen, sie als seinen Spleen zu betrachten. So, wie manche Leute eisbaden, Alligatoren halten oder Pokémon-Karten sammeln.
Nie wäre mir damals in den Sinn gekommen, über Sourie zu schreiben, überhaupt noch einmal zu schreiben. Das war Tessas Vorschlag. Sie pflanzte mir diese Idee ein, ohne zu ahnen, dass mich erst die Bemerkung einer Fremden davon überzeugen würde, es wirklich zu tun – anders, als Tessa gedacht hatte. Aber es führt kein Weg daran vorbei, Souries Geschichte festzuhalten, so vermessen es bleibt, das Leben eines anderen zu erzählen. Zu enthüllen oder zu verbergen, zu deuten und zu interpretieren, schließlich die Version zu wählen, die Details und Beobachtungen zur größten Wahrscheinlichkeit, zur Wirklichkeit verdichten. Doch ist alles, was wir für wirklich halten, Erzählung. Wir glauben das ganze verdammte Leben erst, wenn es eine Geschichte darüber gibt.
Tessa dachte laut über seine Worte nach. Über Licht. Wärme. Frieden. Über Nachleben und Un-Vorstellbares. Wie sie es vorgestern getan hatte, wie sie es seit Monaten ständig tat. Wohin? Wohin gingen die Toten oder ihre Seelen? Oder gingen sie nirgendwohin, war auf ihrem Sterbebett, in dieser Sekunde einfach Schluss? Konnte man den Tod kennen? War der Anfang – Kosmos, Urknall, schwarze Löcher – nicht ebenso unvorstellbar wie das Ende? Glücklicherweise merkte selbst Sourie, dass sie keine Antworten erwartete. Beide hörten wir ihr einfach zu.
Nach einer Weile nickte sie, die Geste bezog sich auf seine Idee des Projekts gegen Einsamkeit. »Es ist die Endgültigkeit«, sagte sie leise. »Du bist zwar verrückt, Sourie, das steht wohl außer Frage, aber vielleicht ist deine Idee wirklich gut … Nach dem Tod meiner Mutter ging es um meinen Vater. Und jetzt? Um nichts mehr. Es gibt niemanden mehr in diesem Heim, den ich kenne. Es gibt nichts mehr zu tun. Es ist alles erledigt. Und zugleich nichts. Überhaupt nichts.« Sie wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. »Da sind noch so viele andere, und sie alle haben es unmittelbar vor sich.«