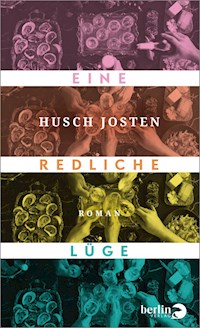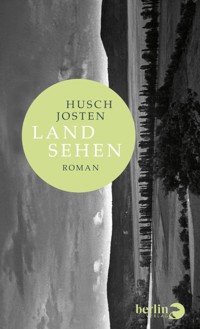Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berlin University Press ein Imprint von Verlagshaus Römerweg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Etwas exzentrisch sind sie alle. Ihr Leben ist bewegt von Bekenntnissen, Botschaften und Neuanfängen auf der Suche nach Glück – das entbehrt nicht der Komik. Im bürgerlichen London zu Zeiten der Finanzkrise leben sie: Lee und Bruno, von Jugend an ein unzertrennliches Neurosengespann; Herold, der gerade als gekündigter glückloser Banker und Exgatte von Lee aus Singapur zurückkehrt; Carl und Hope, Psycho-Esoteriker und Stiefeltern von Bruno, dieser attraktiven Mischung aus Don Juan und Diogenes. Lee, die sich seit Jahren von ihrer wohlhabenden Herkunft voll explosiver Harmonie zu entledigen sucht, kennt er schon aus College-Jahren. Lee Curtin und Bruno Hornyak lernen, ausgelöst durch ein unfreiwillig mitgehörtes Mobiltelefonat, Frau Pfeiffer kennen: ein Lockruf aus einem musealen Stadthaus, wo Aurora Pfeiffer mit Haushälterin Emma lebt. Fast ein Jahrhundert alt, seit 26 Jahren schon ohne Philippe, den französischen Chirurgen, den sie geliebt und betrogen hat. Ihr Keller birgt ein Geheimnis. Einem skurrilen letzten Wunsch von Frau Pfeiffer können sich Lee und Bruno nicht entziehen. Sie beginnen, eine kluge Lebensbotschaft zu verstehen.Nach ihrem ungewöhnlichen Debüt „In Sachen Joseph“ setzt Husch Josten ihre eigensinnige Suche fort: nach dem, was Freundschaft bedeutet und nach der Wahrheit von Gefühlen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Husch Josten
Das Glück von Frau Pfeiffer
Roman
Berlin University Press
Husch Josten Das Glück von Frau Pfeiffer
Erste Auflage im Februar 2012
© Berlin University Press 2012
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat
Christian Döring
Ausstattung und Umschlag
Groothuis, Lohfert, Consorten|glcons.de
eISBN: 978-3-86280-047-6
Für Wilhelm, natürlich
»Ach, du bist jetzt erst am Gepäckband?«
»Baguette ist ausverkauft, ich nehme Ciabatta«
»Eine weiße Jacke. Ich stehe an der Bushaltestelle und winke –
siehst du mich?«
»Das ist mir völlig egal«
»Hallo, ich wollte nur mal hallo sagen«
»Der Anschlag gestern? Ja, ich habe es eben gehört. Schrecklich«
»Genau, Lucie hat ihn betrogen, nicht er sie«
»Ich bin’s«
»Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber!«
»Geben Sie ihr schon mal einen Kaffee und legen Sie alles bereit«
»Leider, leider, wir haben es nicht bekommen, ja …so ist es …«
»Mein Großvater ist gestern gestorben.. nein.. einfach eingeschlafen …«
»Kannst du Brenda mal fragen? Die kennt doch diesen Heilpraktiker«
»Das Stück fängt um … Wieso?«
»Schlechte Zeiten, ja absolut, nicht absehbar«
»Weißt du, ich gehe rein und wieder raus. Alles verkehrt, aber so ist es«
1.
Lee hörte mit. Wann sie genug davon haben würde, konnte sie nicht sagen. Wenn es soweit war, würde das Wissen darum so unerwartet vor ihr stehen wie zwei Wochen zuvor die Gewissheit, dass sie den Telefongesprächen der Passanten zuhören, nein: dass sie sie genau anhören und mitschreiben, dass sie sie verstehen musste. Ein Viertel des Notizbuchs war bereits gefüllt, wenn auch die letzte Seite beschrieben war, dann – vielleicht – würde es reichen, wäre genug gehört. Hiernach würde sie das Babel an Themen und Stimmen, Gesprächsfetzen und Notationen – gleichsam alles –, zu einem einzigen, gewaltigen, irrwitzigen Straßengespräch zusammenfügen. Zu einer Denkschrift dramaturgischer Einseitigkeit, zu einer Geschichte ohne Gegenseite, zum ersten wirklichen Telefon-Buch, entstanden einer beiläufigen Radiomeldung wegen, die für Lee buchstäblich der Tropfen auf den heißen Stein gewesen war: Hunderttausende uralter, bedeutender Felsbilder in Australien seien aufgrund neuer Erdgasfunde in Gefahr, hatte der BBC-Reporter erklärt. Verschiedene Energieunternehmen hätten sich daran gemacht, die Petroglyphen von Murujuga, auch Bibel der Aborigines genannt, zu zerstören. Sicher …, schlug der Reporter nachfolgend einen erstaunlichen Haken, die Welt brauche Energie, schließlich wolle niemand auf seine Heizung verzichten. Man denke nur an den steigenden Bedarf in Asien und die unzuverlässige Lage im Nahen Osten. Doch wir müssen unsere Gewohnheiten überdenken. Der lapidare Schluss hatte den Ausschlag gegeben: So konnte es nicht weitergehen, erkannte Lee. Nicht mit Murujuga in Australien. Nicht mit Reportern und ihren Allgemeinplätzen. Nicht mit den Menschen und ihren Gewohnheiten. Nicht mit den vielen alltäglichen, kaum bedachten Geschehnissen, die eben doch bedenkenswert waren, wenn man erst anfing, sich wirklich mit ihnen zu beschäftigen.
Die Oktobersonne schien fahl und wärmte ihre Füße, dort, auf der Terrasse von Tom’s Deli, wo Lee seit vierzehn Tagen nach Redaktionsschluss saß und zuhörte. Das Café lag an der Westbourne Grove, in ihrer Nachbarschaft, und war zu jeder Tageszeit gut besucht. Morgens gab es englisches Frühstück mit Pfannkuchen, Würstchen und Red Beans. Mittags Pizza, Cottage Pie und Quiches. Nachmittags neben dreißig verschiedenen Teesorten Kressesandwiches, Tartes und warmen Schokoladenpudding. In dem kaum acht Quadratmeter großen Eingangs- und Verkaufsraum mit Stuckdecke, schwerer Eichenholztheke und Deckenventilator, erkannten die Kellnerinnen ohne weiteres, wer einen der zehn Tische im Hinterzimmer oder lediglich Kuchen zum Mitnehmen wünschte. Sie balancierten schaumweiße Milchkaffees, verteilten gestreifte Lutscher an wartende Kinder und stießen sich regelmäßig die Hüften an den roten Kunstlederbänken, die Tom, nach dem das Café benannt war und den es nicht gab, Jahre zuvor am anderen Ende der Stadt aus alten U-Bahnbeständen ersteigert hatte. Wie immer trank Lee schwarzen Kaffee und aß nichts. Ihr Notizbuch lag vor ihr auf dem blauen Keramiktisch, offen, bereit, damit ihr nichts entging von dem, was die Menschen auf der Straße in ihre Telefone sprachen. Sie schrieb alles mit, blendete nichts aus, versäumte nichts, seit mit der Murujuga-Geschichte im Radio – Wir müssen unsere Gewohnheiten überdenken – das Gerede furchterregend wie ein Fallbeil in ihr Bewusstsein gestürzt und nun nicht mehr zu ignorieren war. Worte. Überall Worte. Phrasen. Bekenntnisse. Offenbarungen. Informationsaustausch. Ich bin’s an jeder zweiten Straßenecke. Aber wer wusste schon noch, wer er war, wenn er redete und redete und sich nicht mehr die Zeit nahm, darüber nachzudenken, was ohnehin schon als Lebensaufgabe bezeichnet werden musste? Das Projekt, an dem Lee jetzt arbeitete, hatte im Moment des fallenden Beils deutlich vor ihrem geistigen Auge gestanden; in diesem seltenen, kostbaren Moment von bestechender Klarheit und Sehkraft. Es musste dokumentiert werden. Alles. So wenig der Reporter im Radio und seine Zuhörer tatsächlich Gewohnheiten überdenken würden, so schlicht würde Lee Gewohnheiten festhalten, bleibend, fassbar machen.
Sie schrieb die Sätze so achtlos hintereinander wie sie fielen, so schnell sie gesagt waren und ungeachtet der Menschen, die sie sprachen. Sie schaute kaum mehr auf dabei, weil es zu sehr ablenkte, registrierte lieber Stimmlage und Lautstärke und beschäftigte sich intensiver nur mit ihren ahnungslosen Probanden – fünf Stammgästen bei Tom’s, die sich durch besonders beträchtliches Mobilgesprächsvolumen für ihr Projekt qualifiziert hatten. Einer von ihnen lehnte am Tresen: Miles Costello. Er war jeden Tag da, immer allein, sprach nur mit den Kellnerinnen und telefonierte ansonsten mit temperamentloser, halbdunkler Stimme. Hör zu, Eve, wiederholte er in seinen Apparat. Er trug Jeans und gelbe Turnschuhe, einen schwarzen Rollkragenpullover und, wie gewöhnlich, Hut und Sonnenbrille, hinter der die Haut seiner linken Gesichtshälfte vernarbt und fleischig lila war. Hör zu, Eve, hör doch zu. Weiter sagte er nichts. Eve wollte offenbar auch heute nicht zuhören, und Lee malte sich aus, wie er reagieren würde, spränge sie auf, um ihm sein Telefon vom Ohr zu reißen und ihm zu sagen, dass womöglich er endlich zuhören solle. Stattdessen klappte sie ihr Notizbuch zu und packte es in die Handtasche. Siebenundfünfzig Seiten waren es inzwischen. Siebenundfünfzig Seiten Alles und Nichts. Die Passanten schmissen Lee ihre Leben vor die Füße. Name, Adresse, Familienstand, Pläne, Liebesleben, Arbeitsverhältnis, Kontobewegungen, Gesundheitszustand. Sie ließen nichts aus. Sie nahmen nicht wahr, dass ihnen zugehört wurde. Sie vertrauten auf die Diskretion der Masse.
Der Abend schimmerte, zog die Menschen auf die Straßen und trug den Geruch des Winters in sich. Zwei Jahre war Bruno fort gewesen, so lang wie nie zuvor. Dass er gerade jetzt anreiste, war nur ein Zufall – er hielt nichts von großen Gesten. Trotzdem war Lee gerade jetzt für sein Kommen besonders dankbar. Es war Zeit, aufzubrechen und ihn abzuholen. Sie zog den Schal enger um ihre Schultern, suchte das Portemonnaie in ihrer Tasche. Da hörte sie plötzlich eine ungewöhnliche, eine alte, behäbige, raue Stimme. Sie blickte auf und legte sogleich, möglichst unauffällig, statt des Geldes Stift und Notizbuch wieder auf den Tisch. „Ich bin’s.“ Vor ihr auf dem Bürgersteig, so nah, dass sie ihre Tischplatte hätte berühren können, stand eine dicke Frau um die sechzig mit grauem, zum Knoten aufgestecktem Haar und derbem Gesicht. Sie trug ein hellblaues Kleid mit tiefroten Blumen, ein Basttäschchen aus einer lange vergangenen Ära über ihrem fleischigen Handgelenk, dunkle, ausgetretene Gesundheitsschuhe und an ihrem Ohr einen neuglänzenden Apparat, der dünn wie Esspapier in ihrer Hand lag. „Genau. Ich bin’s“, sagte sie mürrisch, „Emma. Ich habe es mir überlegt: Ich mache es. (…) Nein, nein. Du hast schon Recht. Ich packe nachher meine Tasche und dann gehe ich. Frau Fizer wird es vermutlich nicht bemerken. Sie liegt im Bett wie immer und wird irgendwann nach mir schreien wie immer. (…) Ja, das ist korrekt. Siebenundfünfzig Jahre sind wahrhaftig genug. Ich habe auch noch den Rest von meinem Leben, und sie wird mit ihren hundert Jahren schon irgendwie zurechtkommen. (…) Ach, nein, mach dir keine Mühe. Ich werde höchstens zwei, drei Tage bei dir bleiben. Dann reise ich weiter, danke.“ Damit verschwand sie um die Ecke. Und Minuten später, Zeit, in der Lee überlegte und rechnete, was siebenundfünfzig Jahre bedeuteten, verstand sie, was sie da eigentlich gehört hatte.
Bruno kam mit dem Heathrow Express an der Paddington Station an. Dort, auf dem Bahnsteig, kam es ihm vor, als hätte er Lee am Vortag statt zwei Jahre zuvor zuletzt gesehen. Ihr Gesicht warm, ausgewogen, verlässlich, während sie winkte und ihm entgegenlief. Sie war nicht schön auf den ersten Blick, mehr bewegend. Jemand, den man gern betrachtete, was derjenige auch tun mochte, in dessen Zügen es immer Neues zu entdecken gab. Die weit auseinander stehenden Augen, Brauen, die nicht ganz auf einer Höhe lagen, die Unebenheit auf dem Nasenrücken, winzig, merkwürdig. Ihre langen, dunkelbraunen Haare waren in unerklärlicher Weise, jedenfalls ohne erkennbare Klammern, aufgesteckt. Die Gestalt hager und gehüllt in ein knielanges, raffiniert gewickeltes Kleid aus hellgrauem Jerseystoff, darüber ein schwarzer Schal. Dann stand sie vor ihm. Ihre Augen tiefbraun, aufmerksam und noch unerlöster als früher. Ihre Haut so lächerlich makellos, dass er sich zwanzig Jahre zurück nach Kent ins Sommercamp versetzt fühlte. „Du denkst zu viel“, hatte er sie damals nach dem Mittagessen angesprochen – sie, das einzig vernünftige weibliche Wesen dieser Altersklasse. „Geht das?“ hatte sie mit Verachtung entgegnet und ihn stehen lassen. Sie waren beide fünfzehn Jahre alt gewesen, es war der dritte Tag ihrer Ferien; von da an hatten sie die Tennisturniere, Theaterabende und Kunst-Workshops den anderen überlassen, am See gesessen und geredet. Über Sex in erster Linie; ihn hatte die weibliche Perspektive interessiert. Über ihre Mitschüler, die ihn derweil in allen Variationen im nahe gelegenen Wald praktizierten. Über Brunos esoterische Adoptiveltern Hope und Carl Hornyak, Psychotherapeuten in London mit einer amüsanten Kolumne im Tatler-Magazine und einer Menge prominenter Kunden. Über Lees funktionstüchtige, aus Amerika eingewanderte Familie, die Curtins, für die die Welt so lange in Ordnung war, wie sie an ihr verdienen konnte oder von ihr gebraucht wurde – in beiden Fällen ging es darum, über eben diese Welt nicht nachdenken zu müssen. Über Brunos ursächliche Mutter, wie er sie nannte, deren Adresse seine Adoptiveltern ihm am Morgen seines 14. Geburtstags wie einen Geschenkgutschein überreicht hatten. Und über etliche andere Menschen, die sie in ihrem damals gerade fünfzehnjährigen Leben hatten kommen und gehen sehen – in seinem waren es deutlich mehr als in ihrem.
Lee küsste und umarmte ihn, ließ ihn nicht wieder los, befand, dass er nach Reise und Gepäckabfertigung roch, und ihnen beiden war nicht klar, dass sie einander vermisst hatten. Als sie sich betrachteten, überwältigt, dass sie nichts wussten von ihren jeweiligen Erlebnissen der letzten beiden Jahre und der Fremdheit, die darin lag, entdeckte er die einzige Veränderung, die die Zeit ihrem Gesicht gebracht hatte; es waren die Falten um ihre Mundwinkel, die ihm ausgeprägter erschienen, während Lee die Schatten unter seinen Augen sah und darin erkannte, dass die Suche nach dem Leichtsinn ihn auch in San Francisco nicht hatte schlafen lassen, dass er den Bogen wieder überspannt und dabei seine Gleichgültigkeit zu bewahren gesucht hatte. Bruno liebte Männer und Frauen gleichermaßen, was die Dinge oft kompliziert und Lees Ansicht nach vor allem unübersichtlich machte.
„Wie lange wirst du bleiben?“ wollte sie wissen.
„Eine Weile, wenn es dir recht ist.“ Er reichte ihr seine Zeichenmappe und nahm die beiden Koffer. „Mir ist nach Herbst.“
Sie drückte zur Zustimmung seinen Arm in altmodischer Geste, froh, dass es für eine Zeit lang so sein würde wie früher, als sie zusammengewohnt hatten und ein wortloses Frühstück Stabilität in sich getragen hatte. Ihn nach einem Grund für sein Kommen zu fragen, wäre ihr nicht eingefallen. Er würde ihn nicht nennen.
„Vor vierzehn Tagen“, begann sie im Taxi, es konnte nicht warten, „vor vierzehn Tagen, nach dem Termin vor Gericht, habe ich eine Art Kunstprojekt begonnen …“
Bruno fiel auf, wie achtsam Lee ihre Worte wählte. „Morgens lief eine Radio-Reportage über 30.000 Jahre alte Steinzeichnungen in Australien, die wegen Erdgasbohrungen demoliert werden. Mittags, nach dem Termin vor Gericht, rief meine Mutter an. Ich hatte gerade den Anwalt verabschiedet, da meldete sie sich und wollte tatsächlich wissen, wie es mir geht. Ich habe den historischen Moment also wahrgenommen, stand auf der Straße und antwortete ihr. Aber mitten im Satz habe ich aufgelegt und wusste plötzlich, dass ich dieses Projekt starten muss.“
Die Stadt stürzte auf ihn ein. Fremdartig. Familiär. Sie fuhren durch die Chilworth Street Richtung Bayswater. London – so lange her. Lee sprach weiter: „Ich stand auf der Straße und habe mich entblößt. Ich hätte ebenso gut ein Transparent um meinen Hals hängen können: Frisch geschieden. Er hieß Herold und liebte Flanellunterhosen – es kümmerte niemanden.“
„Du wolltest einen Passanten mit Herolds Unterwäsche bekümmern?“
„Eben nicht. Das war es ja gerade. Genau das. Plötzlich reichte es. Auf einmal war alles klar. Ich habe das Gerede satt. Morgens erzählt dir einer im Radio eine bemerkenswerte Geschichte über Steine in Australien. Kurz darauf telefoniert einer neben dir im Bus und erzählt seiner Freundin, dass er im Bus steht. So etwas wie die Geschichte über Australien hört man alle Tage. Man empört sich angemessen, findet es schade, geht zur Tagesordnung über und erzählt seiner Mutter am Handy, wie die Scheidung gelaufen ist. Keiner denkt mehr nach über das, was er hört oder spricht, Bruno. Das ist kaum auszuhalten, wenn es einem erst einmal bewusst geworden ist. Deswegen habe ich angefangen, einen Sammelband aus Mobilfunkkommunikation zu erstellen, in dem die Banalität alltäglichen Telefonierens auf Papier gebannt wird. Neutral. Wort für Wort.“
„Dass du von australischen Steinen – und mit diesem Land hast du meines Wissens nichts zu tun – auf Mobiltelefone kommst, erscheint dir nicht weiter ungewöhnlich?“ Seine Eindrücke der Rückkehr verwirrend. Die Straßen seiner Heimatstadt vertraut und unbekannt zugleich. Ein Plakat der London Times an einer Bushaltestelle: „Das Ende der Gier.“ Bruno versuchte, sich an Orte und damit verbundene Namen zu erinnern, was nicht gelang; Gesichter in seinem Gedächtnis, deren Stimmen er nicht mehr kannte. Er drehte sich zu Lee. „Jedenfalls solltest du als Schlusswort für dein Bändchen unbedingt Aristoteles nehmen. Maßhalten – mesotes. Das ist langweilig genug. Lee, ich bitte dich: Jeder technische Fortschritt in den letzten hundert Jahren hat dasselbe hervorgerufen. Sobald Technik massentauglich ist, wird sie massenhaft genutzt. Von dir. Von mir. Von allen und von mir aus auch zu viel und zu blöd. So ist es und eine Weile regen sich ein paar Leute darüber auf, danach fahren die auch Zug, fliegen, nutzen Atomkraft oder telefonieren. Das einzige Mittel wäre Maßhalten, aber wer mäßigt sich schon gern? Mit deinem Sammelband würdest du dem Unabänderlichen viel zu viel Raum geben und vor allem deinerseits kein Maß halten – im Moralisieren.“
Damit hatte Lee gerechnet. „Wer sagt, dass es unabänderlich ist? Selbst wenn es so wäre, macht mich das weder zum Feind des Fortschritts noch missionarisch. Ich weiß, dass ich die Telefonate aus dem geschlossenen System meiner Wahrheit heraus aufzeichne, dass die Perspektiven von Falsch und Richtig voneinander abweichen. Aber ich sehe keinen Grund, mich nicht trotzdem mit der Frage zu beschäftigen, warum es so gekommen ist und immer wieder so kommt. Alle reden schneller, als sie denken. Überall.“
„Was spricht dagegen?“
„Alles spricht dagegen, Bruno, alles.“
„Nichts“, widersprach er streng. „Du beklagst die Themenwahl anderer und schon darin liegt ein Urteil. Was versprichst du dir davon? Den Pulitzer-Preis?“
„Darum geht es nicht.“ Sie zögerte. „Da ist noch etwas anderes, darum erzähle ich es überhaupt … Eben, bevor ich zum Bahnhof gefahren bin, habe ich etwas sehr Merkwürdiges gehört. Es lässt mich nicht los.“ Sie reichte ihm ihr Notizbuch. „Hier, lies meinen letzten Eintrag.“
Er streckte die linke Hand nach dem Buch aus, während er mit der rechten die Leselampe über der Rückbank anknipste.
10. Oktober, 5.31 pm:
„Ich bin’s. (…) Genau, ich bin’s, Emma. Ich habe es mir überlegt: Ich mache es. (…) Nein, nein. Du hast schon Recht. Ich packe nachher meine Tasche und dann gehe ich. Frau Fizer wird es vermutlich nicht bemerken. Sie liegt im Bett wie immer und wird irgendwann nach mir schreien wie immer. (…) Ja, das ist korrekt. Siebenundfünfzig Jahre sind wahrhaftig genug. Ich habe auch noch den Rest von meinem Leben, und sie wird mit ihren hundert Jahren schon irgendwie zurechtkommen. (…) Ach, nein, mach dir keine Mühe. Ich werde höchstens zwei, drei Tage bei dir bleiben. Dann reise ich weiter, danke.“
Er las es noch einmal, sie beobachtete ihn dabei. Seine hellbraunen Augen mit den schieferfarbenen Streifen und Sprenkeln, changierend im Licht der Taxibeleuchtung. Er blätterte vor und wieder zurück, überflog auch einige von Lees anderen Gesprächsnotizen.
„Ich glaube, ich muss die alte Frau, diese Frau Fizer, suchen.“
„Ich hatte es befürchtet.“ Bruno lehnte sich zurück. „Du willst eine wildfremde Frau suchen. Sie könnte hier leben, aber auch woanders. Du hast keinen Vornamen und weißt nicht mal um die richtige Schreibweise ihres Nachnamens, denn buchstabiert haben wird diese Emma den Namen ja wohl nicht an ihrem Telefon, richtig? Aber du willst sie suchen.“
„Muss ich das nicht? Im Grunde hätte ich Emma sogar nachlaufen und sie fragen müssen, ob ihre Worte bedeuten, was ich daraus schließe.“
Lee schaute aus dem Wagenfenster. Freitag Abend. Es waren so viele Leute in den Pubs und auf den Bürgersteigen davor wie an jedem Wochenende. Sie feierten ihren Wochenlohn, trafen noch ein paar Kollegen und zögerten den Heimweg hinaus. Am Wegesrand ab und zu vertrauensbildende Werbebanner von Banken, die es seit ein paar Wochen oder gerade einmal Tagen nicht mehr gab.
„Was genau schließt du denn aus ihren Worten?“
„Dass sie eine hundertjährige Frau Fizer sich selbst überlässt, einfach abhaut, das Handtuch schmeißt. Ich hätte ihr nachlaufen sollen, es wäre so leicht gewesen, nicht wahr? Aber ich konnte mich nicht rühren, saß da wie angewurzelt und habe nur gerechnet. Geschätzt hätte ich Emma auf Mitte sechzig, aber sie muss deutlich älter sein.“
Im Vorbeifahren die Rückseite einer Zeitung, die ein Mann auf einer Mauer sitzend las. Der amerikanische Wahlkampf – erste Runde Schlammschlacht, angebliche Verbindungen der Demokraten zu Terroristen. Nicht einmal das konnte die Entfernung, dachte Bruno müde: Das andere fernhalten. Das Land. Seine Denkwürdigkeiten. „Ruf die Polizei an“, sagte er entschieden zu Lee. „Erzähl denen, du hättest das zufällig – und ich betone: zufällig – gehört. Den Rest machen die, ist ja ihr Job.“
59 Ledbury Road. Das Taxi hielt vor dem weißen Haus, in dessen zweitem Stock sich ihre Wohnung befand. Bruno fühlte immer noch die Vibration des langen Flugs in seinen Knochen. Vorbei am Schokoladengeschäft im Erdgeschoss und dessen zartherben Düften, stiegen sie die Treppen hinauf. Keine Stufe fühlte sich echt an, alles unwirklich zwischen den Zeitzonen, Brunos Gehirn wattiert. Er stellte seine Koffer im Flur ab, machte Licht. Die Wände inzwischen weiß gestrichen – früher waren sie sehr bunt gewesen. Grün. Rot. Tiefblau. Im Flur eine neue Kommode, dunkelbraun, schnittig, ein letztes Stück Herold, dachte er. Dieses Möbel also hatte den grünen Schrank vom Flohmarkt abgelöst, auf dem Lee und Bruno damals, noch eine Wohngemeinschaft, Schlüssel und Kaffeetassen, Briefe und Einkaufslisten gelassen hatten. Er ging in die Küche, machte den Kühlschrank auf und wieder zu – er wusste nicht, wonach ihm überhaupt war.
„Die Polizei würde mich auslachen aus genau den Gründen, über die du lachst“, nahm Lee das Gespräch wieder auf. „Wie schreibt sich der Name? Und Sie haben sich sicher nicht verhört? Vielleicht fährt Emma in Ferien? Vielleicht war es nur ein schlechter Scherz? Und Sie haben das notiert?“
Sie lehnten jetzt beide an Lees Küchenzeile, wie früher, Lee zog ihre Schuhe aus, ihre Fußnägel waren dunkelrot lackiert und es kam ihm vor, als sei er nie weggewesen. „Seit der Universität hat sich außer dem Erscheinungsbild deiner Wohnung nichts geändert“, sagte er langsam. „Erinnerst du dich, wie du immer über die erste Seite jedes Lehrbuchs geflucht hast? Aber du hast dir die Devise deines Professors zu eigen gemacht, irgendwo muss man anfangen. Es ging immer darum – anzufangen. Weiß für diese Wohnung ist übrigens gut gewählt, war das Herold?“
„Weiß ist für jede Wohnung gut, denn Weiß ist neutral und simpel. Was ist schlecht daran anzufangen?“
„Wie steht’s mit weitermachen?“
„Das sagst ausgerechnet du?“
„Wer könnte es besser sagen als ich? In deinem Leben geht es immer um erste Seiten, Lee, aber je mehr du davon aufschlägst, desto größer wird deine Ratlosigkeit über Sinn und Zweck all der Themen, mit denen du dich durchs Leben lernst. Aber während ich meine ersten Seiten einfach zuklappe, wenn ich feststelle, dass sie nichts taugen, lässt du sie nicht los. Warum sonst hast du dir dauernd Ratschläge von deiner Familie anhören dürfen? Dass es nicht gut ist, so viel zu grübeln, sich – und ich zitiere – dauernd um sich selbst zu drehen, dass du mehr raus und unter Leute, Freunde finden solltest. Als wäre einer nicht genug. Als wäre ich nicht genug.“ Er setzte sich an den Küchentisch und sah sie vergnügt an. „Du weißt, dass ich es immer für anmaßend gehalten habe, einer Frau solche Empfehlungen zu geben, die weder mit dem Urknall noch der Schöpfungsgeschichte fertig wird. Ich halte dich auch nur für durchschnittlich verschroben, weil du die Verlässlichkeit deiner Gedanken – und mich natürlich – mehr wertschätzt als Dinnerparties und Sportclubs. Aber deine Suche nach Antworten nimmt mit diesem Telefonprojekt eine neue Dimension an. Nimm nicht alles so ernst, Lee, die Themen deiner Mitmenschen mögen dir nicht gefallen, aber du kannst niemandem vorschreiben, worüber er besser reden sollte.“
Lee setzte sich auf die Arbeitsplatte. „Ich habe weitergemacht, du Hinterhoftherapeut. Mit Herold genauso wie mit jedem beschissenen Lehrbuch, das ich angefangen habe und auch wenn es zwischendurch so schlimm war, dass ich vor lauter Lesen und Denken kaum mehr sprechen konnte und Mühe hatte, mich im Supermarkt mit Cornflakes und Milch zu versorgen. Leider beschränkten sich meine Probleme mit Herold nicht auf die Beschaffung von Cornflakes.“
Bruno zog seinen Pullover aus, kämmte seine Haare mit den Fingern und schwieg.
„Du hast mit ihm gesprochen“, stellte sie fest.
„Vor zwei Wochen.“
Lee stand auf, nahm eine Flasche Rotwein aus dem Schrank und reichte sie Bruno zusammen mit dem Korkenzieher. Missmutig. Sie zog zwei Gläser aus dem Stahlregal, das über der Spüle hing. Es gab keinen Grund für die beiden, miteinander zu telefonieren. Bruno hatte mit keiner anderen Reaktion gerechnet. Draußen, irgendwo einen Häuserblock weiter, knatterte ein Motorrad. Laut und satt. Lee stellte die Gläser auf den Tisch, schob das Fenster nach oben, setzte sich auf den Rahmen und zündete sich eine Zigarette an. Verlassen wie ein letztes, verhaktes Blatt an einem Winterbaum saß sie auf dem Fenstersims, ihre Haut fast papieren, der Blick unzufrieden.
„Er ist in Singapur.“ Bruno zog dazu geräuschvoll den Korken aus der Flasche.
„Er ist immer irgendwo.“
„Und sich in der Mitte zu treffen, wäre für dich nicht genug gewesen?“
„Wo? In Saudi Arabien?”
„Du weißt genau, wie ich es gemeint habe.“ Er füllte beide Gläser.
Sie ließ sich lange Zeit mit einer Reaktion. „Wir sollten dir im Gästezimmer einen Platz fürs Malen herrichten. Morgen, nachdem ich das Telefonbuch nach Frau Fizer durchforstet habe, besorge ich Plastikfolie, leihe eine Staffelei und was immer du sonst noch brauchst. Du kannst mir eine Liste schreiben, neben meinem Büro ist ein neuer Laden für Künstlerbedarf – falls du derzeit Künstler bist.“
„Lee.“ Bruno streckte ihr das Glas entgegen wie ein Friedensangebot. „Es kann nicht dein Ernst sein, sie zu suchen. Und ich verstehe auch nicht, was du mit diesem Projekt erreichen willst.“
„Nichts, Bruno. Es geht nicht ums Erreichen.“ Sie nahm das Glas. „Vielleicht hast du Recht. Vielleicht ist tatsächlich egal, worüber wer wo spricht, womit man sein Gehirn beschäftigt – ob mit Computerspielen oder Nagellacknamen, mit Geschichte, Politik, Mathematik oder Pornographie, mit Supermarktpreisen, Rollschuhlaufen oder dem neuerlichen Untergang des Kapitalismus. Wer sollte überhaupt beurteilen, was besser oder gar wertvoller ist? Darum geht es nicht. Und nur nebenbei: Bemessen am Gehalt ist es längst keine Frage mehr. Menschen, die Computerspiele erfinden, verdienen damit ein Vielfaches von Sozialarbeitern, die computersüchtige Jugendliche kurieren. Leute, die Klingeltöne für Mobiltelefone verkaufen, bekommen mehr Geld als Orchestermusiker oder Museumsführer. Ich verdiene in meinem Job als Terminzusammenschreiberin bei diesem Wochenmagazin mehr als ein Rettungssanitäter. Das sagt mir eine Menge über den Geisteszustand meines Arbeitgebers, aber meine Kollegen sehen das möglicherweise völlig anders. Natürlich sind Termine wichtig. Natürlich müssen all diese Termine, die Spaß machen, hinaus in die Welt, damit die Leute hingehen und Geld bezahlen und applaudieren und sich amüsieren und vor Begeisterung in Ohnmacht fallen, um schließlich von einem schlecht bezahlten Rettungssanitäter versorgt zu werden. Über all das lässt sich streiten. Aber nicht streiten lässt sich über die Frage, wieso sich alle Menschen jeden Tag den privaten Müll Fremder anhören müssen, sei er wichtig oder unwichtig. Ich zum Beispiel will davon nichts hören. Die Leute gehen mich nichts an.“
„Du klingst verzweifelt, militant, kurzsichtig und kulturpessimistisch.“
„Verzweifelt? Ja! Durchaus! Über den Zustand der Kommunikation. Militant trifft es überhaupt nicht – ich bin keine fanatische Tierschützerin, die Pelzträger vor dem Modegeschäft mit Farbe beschmiert. Kurzsichtig? Das Gegenteil, Bruno. Und pessimistisch: Ja, aber nicht in deinem Sinne und nur unter Umständen. Und die Umstände sprechen eindeutig für Pessimismus. Warum etwa muss ich heute hören, wie eine Frau eine Hundertjährige sitzen lässt? Ich werde davon in Kenntnis gesetzt, ob ich will oder nicht. Nun lässt es mir keine Ruhe mehr. Habe ich darum gebeten? Möglicherweise stürzt, verdurstet, verhungert, verkotet diese alte Frau in ihrem Bett – habe ich das wissen wollen? Aber nun weiß ich es. Was ist meine Verantwortung?“
„Keine. Ist nicht deine Sache. Und du hast es darauf angelegt, es zu hören, also beschwer dich nicht.“
„Von mir aus. Aber um uns herum befanden sich zu diesem Zeitpunkt bestimmt acht andere Leute – in Hörweite. Was ist mit denen, Bruno? Zufällig aufschnappen und schnell vergessen, ist es das, was man deiner Meinung nach machen sollte, wenn möglicherweise jemand in Gefahr ist?“
„Ich bleibe dabei: ich würde die Polizei anrufen.“
„Und was genau sagen?“
„Was du mir gesagt hast.“
„Mach es“, sagte Lee.
„Wieso ich?“
Sie war siegessicher. „Komm schon, Bruno. Mir zuliebe. Ruf an und erzähl ihnen die Geschichte. Wenn sie versprechen, sich darum zu kümmern, gebe ich Ruhe mit Frau Fizer. Wenn nicht, hilfst du mir, sie zu suchen.“
Das war ganz Lee. Bruno nahm sein Glas und trank einen großen Schluck, öffnete den Kühlschrank und nahm etwas kaltes Huhn von dem Teller, den er zuvor dort gesehen hatte. Noch kauend holte er das Telefon aus dem Flur und wählte 101. Fünfzehn Minuten, zwei Warteschleifen und drei ebenso hilflose wie desinteressierte Ansprechpartner später legte er das Telefon neben die Kaffeemaschine. Seinen Namen zumindest hatten sie sich notiert.
„Schön“, gab er sich geschlagen, während Lee sich eine weitere Zigarette anzündete. „Und ich gebe auch zu, dass es mich verwirrt, mit welcher Leichtigkeit dein Konzept aufgeht … sieht man sich die Seiten deines Notizbuchs an, die du schon gefüllt hast. Trotzdem gefällt es mir nicht, Fremde zu belauschen und der Banalität bei absehbarem Ergebnis so viel Gehör zu schenken und Wertvorstellungen auf andere zu projizieren.“ Er machte eine kurze Pause. Unter keinen Umständen würde er diese alte Frau suchen. „Vor allem aber stört mich, dass du mit all diesen fremden Themen nur dem eigentlichen Thema aus dem Weg gehst. Und ja, ich meine Herold.“
„Mir ist bewusst“, entgegnete Lee unwirsch, „dass schon Mobiltelefonierer verklagt und verurteilt worden sind, weil sich andere von ihnen in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlten. Ich weiß auch, dass das Abendland kulturell untergeht, seit es existiert. Aber nun sieh doch mal hin: Die Menschen reden und reden andauernd und entfernen sich dabei immer weiter voneinander. Sie sind dauernd miteinander verbunden und haben sich nichts zu sagen. Lies es.“ Sie nahm das Notizbuch aus der Tasche zu ihren Füßen und warf es für ihn auf den Tisch. „Lies es und du weißt, was ich meine.“
„Mach eine Partnerschaftsvermittlung auf, Lee“, gab Bruno zurück. „Es wäre menschenfreundlicher, als die Leute aus überheblicher Distanz abzuhören und zu verurteilen.“ Wieder ging er zum Kühlschrank, nun nahm er den Teller mit dem restlichen Huhn und Salat heraus und holte sich eine Gabel.
„Ich will nicht von ihnen profitieren oder irgendwen verkuppeln, verdammt, ich will verstehen, warum die Weitergabe von Schwachsinn so wichtig geworden ist.“
Bruno atmete tief. Die Sache schien ihm aus dem Ruder zu laufen. „Erstens: Ein nicht unerheblicher Teil der mobil telefonierenden Weltbevölkerung kommuniziert nicht schwachsinnig. Zweitens: Es ist nicht möglich, den ganzen Tag über Weltbewegendes, über unlösbare Probleme zu sprechen. Menschen würden daran zerbrechen, wenn sie ihren Geist ständig mit Themen beschäftigen müssten, die sie nicht bewältigen können. Sieh dich an! Du wirst nichts verändern.“
„Ich will nichts verändern. Ich will es verstehen.“
„Aber da ist nichts zu verstehen“, entgegnete er genervt. „Es ist so simpel, wie es aussieht: Menschen telefonieren überall, weil es überall möglich und bezahlbar ist. Sie tun es, weil es bequem ist, ihnen das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein, etwas zu tun zu haben, wichtig zu sein, unentbehrlich zu sein, geliebt zu sein. Es ist ein Ritual: Geht dein Gegenüber im Restaurant zur Toilette, schaust du nicht mehr verlegen in die Speisenkarte, sondern holst dein Handy raus und siehst nach, wer dich inzwischen vermisst hat. Das kannst du störend, unsinnig, dumm finden, aber daran ist nichts zu begreifen, Weltverbesserin.“
Lee saß da, noch auf dem Fensterbrett. Getroffen. Sie warf die Zigarette hinunter, stand auf und schloss das Fenster als wolle sie die Unterhaltung auf diese Weise beenden. Es tat ihm leid, schon während er es ausgesprochen hatte. Gerade erst angekommen. Nach Jahren. Und ausgerechnet dieser Begriff. Das war es, dachte Bruno plötzlich, das war es, was überhaupt am schwersten wog: Dass er Lee – seit sie im Taxi von ihrem Projekt zu erzählen begonnen hatte – mit den Augen ihres Vaters betrachtet, in ihr allein die Soldatin in einem weiteren diffusen und wertlosen Kampf gesehen hatte. Einem längst verlorenen Stellungskampf von Kommunikationsfronten. Weltverbesserin. Lee als Kombattantin gegen die Trivialität, verzweifelt über die Definition des Banalen und verletzt von intimen Details Fremder. Obwohl die Sätze in ihrem Notizbuch eine stattliche Anzahl von Seiten füllten und, derart zusammengefasst und so ungern er es zugab, vermutlich ein aufschlussreiches Dokument der Zeitgeschichte darstellten, hatte er unmöglich mehr zulassen wollen. Nicht unter diesen Umständen, in denen ein Mobiltelefonat – das letzte Telefonat mit Jeff – ihm eine weitere, unerfreuliche Konsequenz seiner Grenzüberschreitungen vor die Füße geworfen und zu seiner sofortigen Abreise aus Amerika geführt hatte.
Er ging zu ihrem Computer. „Also schön“, rief er ihr vom Wohnzimmer aus zu, „du weißt bestimmt, dass zwei Suchanfragen im Internet so viel Energie verbrauchen wie das Kochen einer Tasse Tee.“
„Glaub nicht, dass die Weltverbesserin damit vergessen ist“, rief sie zurück, „und wer will so eine bescheuerte Zahl überhaupt herausgefunden haben?“
„Wissner-Gross. Physiker aus Harvard. Ich habe immer gedacht, solche Dinge werden nur für Leute wie dich erforscht.“
Lee folgte ihm, blieb aber im Türrahmen stehen und sah ihm zu. So, wie er ihr immer gern zugesehen hatte als jemand, dem es zur Hingabe an Engagement und zur Leidenschaft an Pathos fehlte. Theoretisch konnte er dem Gedanken, dass Leben vor allem in schöpferischem Tun seinen Sinn fand, viel abgewinnen. Doch waren seine selbstironischen Versuche als Maler kaum darauf angelegt, als Schöpfung durchzugehen. Bruno gab sich mit bequemen Lösungen zufrieden, favorisierte das Naheliegende und hielt sich von Entscheidungen fern, weil sie für ihn in erster Linie als Feld absehbaren Versagens und Beweis seiner mangelnden Zugehörigkeit zur einen oder anderen Seite taugten. So zumindest hatte er es in all den Jahren zuvor gehalten, damit kokettiert und seine Schwächen gepflegt, bevor er in Amerika mit neuem Namen abgetaucht war, in einer wieder neuen Rolle, die er sammelte wie Bonusmeilen einer Fluglinie und das, obwohl er den Anschein machte, mit seiner Rohfassung im Großen und Ganzen zufrieden zu sein.
Seit sie ihn kannte, hatte sich Bruno beharrlich geweigert, sich irgendwo zu Hause zu fühlen oder eine Kontur anzunehmen, die ihm akzeptabel erschien. Er gewann Begleiter wie Eindrücke, legte sie ab, wenn er genug von ihnen hatte. Und noch immer unterschrieb er, sie sah es an zwei Beispielen in seiner transparenten Zeichenmappe im Flur, jedes Bild mit einem anderen, beliebigen Namen, während ihn seine Handschrift, klein und zackig, stets verriet. Sie öffnete die Mappe, die neben der Wohnzimmertür lehnte und blätterte durch. Verwaschene Landschaften. Diffuse Porträts. Zersplitterte Akte. Eine eigenartige Mischung, nicht bahnbrechend, auch nicht schlecht. Und Lee fragte sich, während sie die Bilder betrachtete, ob seine Skepsis gegenüber ihrem Telefonprojekt nur der Müdigkeit zuzuschreiben war, die er nach der langen Reise zweifellos empfand, oder ob das Amerika der Ära Bush ihn kategorisch hatte werden lassen, was sie nicht überraschen würde.
Er saß an ihrem Computer, versunken in das, was er auf dem Bildschirm las. Die große, spitze Nase im Profil, seine Augen angestrengt, das dunkelblonde Haar zerzaust, der volle Mund in Konzentration verzogen, Schneidezähne auf der Unterlippe. Sie konnte verstehen, dass Frauen und Männer ihm gleichermaßen verfielen – ein kleineres Wort wäre unangemessen für Brunos Wirkung auf viele Menschen. Er strahlte eine elegante Unnahbarkeit aus, spöttischen Charme und Gelassenheit. Gegen alles davon war sie selbst von Anfang an immun gewesen, während seine Suche und seine Unruhe, sein Verständnis von Treue und seine Idee von Freundschaft sie immer fasziniert hatten. Die meisten waren überzeugt, ihn nachhaltig beeindrucken, vielleicht verändern und sein Gefühl gewinnen zu können. Andere waren klüger und legten es erst gar nicht darauf an, die Gleichgültigkeit zu durchbrechen, die Bruno bewahrte. Aber auch letztere stellten ihre Nonchalance bald so zur Schau, dass das zugrundeliegende Bemühen – ihre Sehnsucht nach Ausschließlichkeit, nach Zuneigung und Aufmerksamkeit – offensichtlich wurde. Was folgte, war das übliche Prozedere: Unerreichbarkeit durch Anrufbeantworter, Wechsel der Telefonnummer, in Härtefällen Umzug. Bruno war flexibel, sein Hausrat passte in zwei Kartons oder in zwei Koffer und eine Zeichenmappe. Wie jetzt. Und Lee fragte sich, wen er dieses Mal verlassen oder so weit hinter sich hatte lassen müssen, dass er nach England zurückgekommen war.
Es dauerte lange und beanspruchte wohl die Energie für zwei Kannen Tee, die Listen aus dem Telefonbuch im Internet so zusammenzustellen, dass alle verzeichneten Fizers nach Stadtvierteln sortiert untereinander standen. Den Westen Londons, wo Lee das Telefonat gehört hatte, setzte Bruno an den Anfang. Während er vor dem Bildschirm saß, hörte er sie in der Küche arbeiten und später im Bad duschen und Zähneputzen, die Geräusche ihrer Geschäftigkeit, das Klappern von Geschirr, das Rauschen von Wasser, die Toilettenspülung, das Klacken des Badezimmerschranks, vertraut selbst noch nach Jahren, wohltuend gewöhnlich. Beruhigend. Am Ende, gegen Mitternacht, waren es zweiunddreißig Namen und Adressen in allen Teilen der Stadt, zwölf im näheren Umkreis. Er druckte die Liste aus und betrat ihr Schlafzimmer. Lee war eingeschlafen, das Buch „Mr and Mrs Derdon“ auf der Brust. Sie lag zusammengerollt unter einer schokoladenbraunen Wolldecke, die sehr weich aussah, eine braune Haarsträhne klebte an ihrer Oberlippe, der Rest wie ein Kranz auf dem Kissen. Er legte die Derdons zur Seite und die Liste auf den Nachttisch – immer noch verwirrt, dass sein schlechtes Gewissen ihn erweicht hatte, den Unsinn zu unterstützen. Nun würde er eine alte Frau suchen müssen; Lee würde darauf bestehen und er würde es ihr nicht abschlagen können nach diesem Tag und diesem Gespräch. Sie würden eine verlassene Greisin unter fast acht Millionen Einwohnern suchen, eine Frau, die es womöglich gar nicht gab.