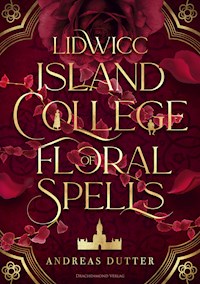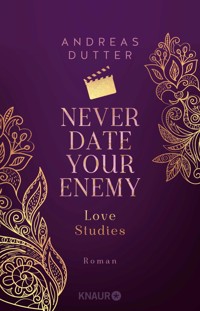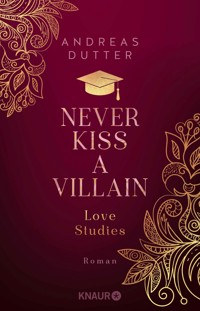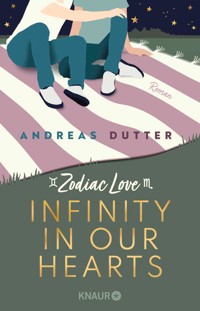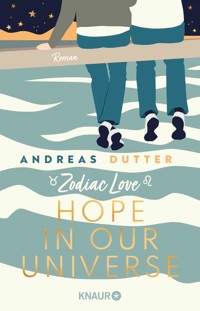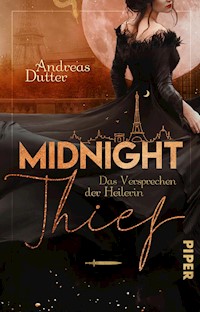10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer, Sonne, Sirtaki: Hier kommt die liebenswerte Familie Karafoulidou Helena Karafoulidou hat es satt: Ihr Chef halst ihr immer mehr Arbeit auf, und ihr Liebesleben liegt sowieso brach. Also trifft sie eine radikale Entscheidung, schmeißt ihren Social-Media-Job und reist von Sylt nach Panorama, einer kleinen Insel im Mittelmeer, wo ihre griechische Verwandtschaft wohnt. Dort trifft sie auf Christos, der eine wunderschöne Taverne führt. Doch die Einheimischen meiden seinen Laden, obwohl das Essen hervorragend ist. Helena wollte sich eigentlich entspannen, stattdessen bietet sie Christos an, seiner Taverne die nötige Publicity zu beschaffen. An einem lauen Sommerabend in der Taverne kommen sich die beiden näher, doch dann taucht Christos' Exfrau in der Taverne auf … Familie, Liebe, gutes Essen und jede Menge Atmosphäre: perfekte Urlaubslektüre für alle Griechenlandfans »Die Idee ist wundervoll und das Buch muss unbedingt in gedruckter Form bei mir einziehen.« Antonia C. Wesseling, Spiegel-Bestsellerautorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eine Taverne zum Verlieben
Der Autor
ANDREAS DUTTER, geboren 1992, lebt in Österreich und hat Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien studiert. Im Social-Media-Bereich unterhält er mit seinem Schreib- und Büchercontent auf Instagram (andreasdutter) oder TikTok (AndreasDutterAutor). Neben Büchern liebt er Serien, Mangas, Kochen und das Meer. Er verbringt viel Zeit in Griechenland und hat das Land abseits vom Tourismus kennengelernt, sodass es zu einer zweiten Heimat geworden ist.
Das Buch
Eine griechische Familie, eine Taverne am Strand und die ganz große LiebeHelena Karafoulidou hat es satt: Ihr Chef halst ihr immer mehr Arbeit auf, und ihr Liebesleben liegt sowieso brach. Also trifft sie eine radikale Entscheidung, schmeißt ihren Social-Media-Job und reist von Sylt nach Panórama, eine kleine Insel im Mittelmeer, wo ihre griechische Verwandtschaft wohnt. Dort trifft sie auf Christos, der eine wunderschöne Taverne führt. Doch die Einheimischen meiden seinen Laden, obwohl das Essen hervorragend ist. Helena wollte sich eigentlich entspannen, stattdessen bietet sie Christos an, seiner Taverne die nötige Publicity zu beschaffen. An einem lauen Sommerabend kommen sich die beiden näher, doch dann taucht Christos’ Exfrau auf …
Andreas Dutter
Eine Taverne zum Verlieben
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Mai 2023© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildungen: Häuser und Restaurant © Igor Tichonow / EyeEm; Himmel, Glitzer, Blumen © FinePic®, MünchenAutorenbild: © Andreas DutterE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-2930-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kapitel eins
Kapitel eins
Es war ein Arbeitstag wie jeder andere. Sven hatte abermals vergessen anzuklopfen, und noch bevor die Tür weit genug offen stand, um ihn zu erkennen, spürte ich seine Präsenz, die meinen Magen jedes Mal aufs Neue verkrampfen ließ. Niemand sonst kam je einfach so in mein Büro.
»Natürlich darfst du eintreten, Sven.« Mit verschränkten Armen lehnte ich mich zurück. Der Bürostuhl quietschte. Genervt wickelte ich eine Strähne meiner braunen Mähne um den Zeigefinger.
Mit einer flinken Handbewegung strich Sven sich über seine schleimige Frisur und lehnte sich an meinen Schreibtisch. Wie erwartet, ignorierte er meine Bemerkung. Als er sich vorbeugte, rutschte ihm seine Brille auf die Nasenspitze, wodurch seine Augen winzig wirkten. Er starrte mich an, ohne etwas zu sagen. Ich wippte mit meinem Fuß und spürte, wie sich Unruhe in mir ausbreitete.
»Sven, was willst du?«
Ein Grinsen umspielte die dünnsten Lippen der Welt. Sein intensives Parfüm drang in meine Nase: der Geruch von Schweiß, umrahmt von einer süßen Karamellnote, darüber WC-Urinstein-Frische, wie ich sie von Bahnhöfen kannte. Das Eau de Klosett der Saison.
»Grandiose Nachrichten, Helena.«
Musste dieser Anzugfritze – niemand trug bei uns einen Anzug – ständig in Rätseln sprechen? Alles an Sven nervte mich. Auf Platz eins meiner Hassliste stand, dass mir seine Vetternwirtschaft zuwider war. Denn so hatte er diesen Job überhaupt bekommen.
Ich biss mir in die Innenseite meiner Wange, um keine folgenschwere Beschimpfung aus meinem breiten Repertoire auf ihn abzufeuern. Dabei hielt ich mich nicht aus Respekt zurück, sondern weil ich diesen Job brauchte. Das Geld.
»Also grandios für mich.« Laute Überheblichkeit, die Waffe der unreflektierten Esel.
Zwei Wimpernschläge lang sah ich mir diesen Stummfilm noch an, dann setzte ich mich wieder an meine Notizen für den wöchentlichen Report über den Erfolg meiner Social-Media-Maßnahmen. Ignoranz funktionierte bei Sven immer. So auch diesmal.
»Du sollst zum Chef kommen. Er will mit dir sprechen.« Svens Stimme überschlug sich vor Glück.
Kurz erstarrte ich, dann linste ich hoch und sah Svens Finger an seinen Lippen, als wollte er sich selbst daran hindern, euphorisch loszukichern. Roch ich da wirklich seinen Schweiß oder eher meinen eigenen? Erst nach ein paar Sekunden bemerkte ich, dass ich die Luft angehalten hatte. Das klang nicht gut, gar nicht gut. Und die Tatsache, dass der Chef mich sprechen wollte, machte mir dabei deutlich weniger Sorgen als Svens begeistertes Grinsen. Obwohl. Nachdem, was letzte Woche passiert war, hatte ich auch so Grund genug, nervös zu sein. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Alles, nur nicht ein Gespräch mit meinem Chef.
»Sag ihm, ich bin gleich da.« Ich sah von meinen Unterlagen auf und warf ihm ein gelassenes Lächeln zu. Zumindest sollte es so wirken.
»Ich werde es weitergeben. Würde dir aber raten, dich zu beeilen.« Sven richtete sich auf und beäugte mich von oben herab.
Seine Handabdrücke am Metall des Tisches verblassten langsam wie eine unliebsame Erinnerung, die ich aus meinem Gedächtnis verdrängte. Die Schritte, mit denen er jetzt mein Büro abging und sich dabei jeden Winkel anschaute, machten den Anschein, als überlege er, wie er den Raum nach meinem Abgang einrichten würde. Raus mit meiner Fotoecke für die Social-Media-Beiträge. Goodbye, Ikea-Bücherregal. Adieu, Aktenschrank, den ich heimlich für meine Süßigkeiten nutzte. Hallo, biedere Einrichtung, die er von seiner Oma klaute, bei der er lebte, nachdem seine Mutter ihn rausgeschmissen hatte. Munkelte man.
»Gibt es noch was?«
»Oh, da gäbe es noch einiges, Helena.«
Irgendwo in meinem Kopf hörte ich meinen Geduldsfaden leise reißen. »Zum Beispiel?«
Svens Blick schweifte ab. »Egal.« Seine Hände rutschten locker in die Taschen seiner Anzughose, perfekte Bundfalte inklusive. Herrgott, vor mir stand ein zweiundzwanzigjähriger Opa!
Schwungvoll erhob ich mich und strich mein senfgelbes Kleid glatt, bei dem ich mir nach der Pizza am Mittag gewünscht hatte, es wäre weniger eng anliegend. Aber was hatte ich von einem Kleid erwartet, das ich online bestellt hatte. Die Größen stimmten nie.
»Dann kannst du gehen.« Meine Hand hob sich, und ich deutete zur Tür, wodurch meine Armbänder aneinanderklirrten.
Als die Tür sich mit einem Klick schloss und ich wieder allein war, atmete ich erleichtert aus. »Arschloch.«
Wenn man bedachte, dass er aus chronischem Kreativitätsmangel sich regelmäßig genötigt sah, meine Ideen als seine eigenen auszugeben, wobei er aufgrund gewisser Kompetenzdefizite dann wieder gern meine Hilfe bei der Umsetzung in Anspruch nahm – ja, wenn man das genauer betrachtete, war es umso rätselhafter, woher er diesen Arroganzüberschuss nahm. Er hatte sich auf meine Kosten ein Fake-Image gebastelt, während der ganze Druck für den Social-Media-Bereich auf mir alleine lag.
Mein Handy vibrierte auf den Tasten meines Laptops.
»Mama«, flüsterte ich.
Mit einer schlimmen Befürchtung im Hinterkopf wischte ich den Sperrbildschirm mit einem Foto der kleinen, idyllischen Insel Panórama, meiner zweiten griechischen Heimat, beiseite und las die Nachricht.
Du hast wieder vergessen, die GEZ zu bezahlen.
Zunächst tippte ich:
Warum hast du sie dann nicht gezahlt, ich sehe nicht fern, sondern du!
Dabei war ich kurz davor, den wütenden, feuerspuckenden und den Teufel-Emoji anzufügen. Ich löschte die Nachricht.
Einatmen.
Ausatmen.
Ich entschied mich für:
Mach ich heute.
Hitze stieg in mir auf, und ich schnappte mir zwei Taschentücher. Ich wischte mir den Schweiß unter den Achseln weg und warf die Tücher in den Mülleimer. Mir wuchs alles über den Kopf. Am liebsten hätte ich mein Gesicht massiert, einen Auftritt als Horrorclown bei meinem Chef konnte ich mir aber leider nicht leisten. Mein Make-up musste sitzen. Vielleicht sollte ich nachlegen, damit meine Wangen nicht verdächtig glühten. Ich legte mir die Hand auf die Brust. Mein Herz raste.
Schluss! Zeit, sich zusammenzureißen. Kleiner Blick in den Handspiegel, etwas Banana-Powder auf die T-Zone, check.
Mit meinem Handy bewaffnet, sauste ich aus meinem Büro und begab mich auf den Walk of Shame zwischen den anderen Tischen im Großraumbüro entlang. Die Blicke meiner Kollegen und Kolleginnen verfolgten mich offen neugierig. Sven war wohl seinem selbst gewählten Informationsauftrag umfassend nachgekommen.
Bilder blitzten in meinem Kopf auf, wie ich mit der obligatorischen Kiste im Arm dieses Gebäude für immer verließ. Wie ich auf der Straße saß, an einer Ecke, gleich neben dem Shoppingcenter, gerade noch so geduldet von der Security, die breitbeinig vor den blitzsauberen Glastüren wachte. Neben mir meine Mama. Du hältst den Becher falsch, so bekommen wir keinen Cent. Schau freundlicher.
Als ich in den Flur einbog und endlich alleine war, ging es mir etwas besser. Noch war nichts verloren, ich konnte es schaffen. Vor dem Büro meines Chefs blieb ich stehen und hob die Hand, bereit, an die Tür zur Hölle zu klopfen. Ich hielt inne, mein Magen grummelte, und mein Hals schmerzte.
Wie in dem einen YouTube-Tutorial massierte ich meinen Hals an zwei Entspannungspunkten und räusperte mich. Wahrscheinlich war alles halb so schlimm. Svens Performance hatte mich nur verunsichert, nichts weiter. Ich stellte mir vor, wie ich gleich wieder aus dem Büro herausstolzieren und mit einem Siegerlächeln an den Starrern vorbeiziehen würde. Bevor ich wusste, was ich tat, hatte meine Hand an die glänzende Stahltür geklopft.
»Herein.«
Wieder spürte ich Blicke. Ich sah nach rechts. Drei Kollegen huschten ins Büro nebenan, die Augen auf mich gerichtet wie gierige Wiesel. Vermutlich wetteten sie, wer meinen Posten und mein Büro bekäme. Und meine Niere. Wenn die wüssten, dass ich nur deshalb ein eigenes Büro hatte, damit niemand mitbekam, wie viel mir der Chef ständig aufhalste. Ganz zu schweigen von den Überstunden. Aber auf Sylt einen Job als Social-Media-Managerin zu bekommen, galt auch 2023 als Herausforderung.
Die Tür quietschte, als ich sie aufschob.
»Guten Tag, Daniel.«
Sein Man Bun lachte mir entgegen, sein Gesicht blieb dem Tablet zugewandt.
»Bitte.« Er deutete auf den selbst gebastelten Hocker aus Paletten.
Das Blut rauschte in meinen Ohren, als ich auf dem Sitzkissen Platz nahm. Da Daniel mich warten ließ, nahm ich sein Büro genauer unter die Lupe. Ein Glastisch mit unzähligen Fingerabdrücken und vier benutzten Kaffeebechern, an einem klebte Lippenstift. Laptop, Extramonitor, Smartphone und ein Extra-Tablet, auf dem er mit einem speziellen Stift zeichnete. Hinter Daniel verschlossene Schränke. Das einzig Farbenfrohe in diesem Raum war ich. Und Daniels Fliege mit Bienenmuster. Das Rascheln seiner Seidenhose durchschnitt die Stille, als er die Beine überschlug und die Hülle des Tablets zuklappte. Ich folgte seinem Blick aus dem riesigen Fenster hin zum Meer, das man in der Ferne erahnte.
»Du solltest mich sprechen?« Ich räusperte mich. »Äh, wolltest mich sprechen, meine ich.« Ich kicherte mit hoher Stimme.
»Helena, was soll ich mit dir machen?« Sein gezwirbelter Schnauzer hing in einem Nasenloch fest, und ich bemühte mich, nicht dorthin zu starren.
»Wegen letzter Woche. Das ist eine Ausnahme gewesen. Normalerweise, ähm …«
»Eine Ausnahme kann der Untergang sein.« Daniel erhob sich, schlenderte um den Glastisch und setzte sich breitbeinig vor mich hin. »Der Shitstorm ist bis heute nicht abgeklungen«, fuhr er fort.
»Es tut mir leid. Das ist, hm.« Wie sollte ich mich erklären? Mein Privatleben musste bei der Arbeit außen vor bleiben. Es wäre unprofessionell, jetzt persönliche, leider sehr wahre Gründe vor ihm auszubreiten. »Ich habe einen schlechten Tag gehabt.«
»Und in einem Monat hast du den wieder?«
Eventuell. Oder morgen.
»Nein.« Meine Stimme versagte, wurde zu einem Krächzen. »Nein, wird nicht wieder vorkommen.«
Es knackte laut, als Daniel seinen Kopf erst nach links und dann nach rechts legte. »Helena, es tut mir leid.«
Er feuerte mich tatsächlich. Vorbei. Ende Gelände. Ein komisches Gefühl beschlich mich, als ich mir vorstellte, was alles an dem Job hing.
»Ich kann nicht darauf hoffen, dass meine Social-Media-Managerin keinen schlechten Tag hat und auf Twitter solche Dinge von sich gibt. Beim nächsten Mal ist Schluss.«
Ich nickte. Moment. Was? Beim nächsten Mal?
»Das heißt, ich bin nicht …« Stopp. Ich durfte ihn nicht auf falsche Gedanken bringen.
»Was?«
»Ich bin nicht in deiner Gunst als Social-Media-Managerin gesunken?« Prima gerettet.
»Deine Fähigkeiten sind top, Helena.«
Ich richtete mich auf. Das hörte ich gerne.
»Aber um den Fauxpas auszugleichen, musst du dich mehr ins Zeug legen für den Kunden. Die nächsten Samstage wirst du auf den Sommer-Events anwesend sein. Storys für Instagram aufnehmen, mit den Leuten quatschen, sie zu TikTok-Tänzen nötigen. Gewinnspiele, alles, um die Leute, die uns folgen, bei Laune zu halten.« Voller Tatendrang trommelte Daniel beim Sprechen auf seine Oberschenkel, sprang auf und plapperte weiter.
Aufgabe um Aufgabe listete er auf, und seine Pläne verloren sich irgendwo in der Unendlichkeit des Universums. Seitdem mein Job sich als sicher herausgestellt hatte, war meine Stimmung nicht gestiegen.
»Verstanden, Helena?«
Ich bejahte, bemüht, freundlich zu wirken.
»Dann kannst du gehen. Einiges noch zu tun für dich. Du hast doch abends nichts vor?« Nein, welche Angestellte hatte denn ein Leben neben der Arbeit?
»Natürlich nicht.«
Mit wenigen Schritten stand ich vor der Schiebetür. Ich sollte mich freuen. Sollte ich?
»Tschüss, Helena.«
»Bis dann.«
Quietsch. Die Tür fiel ins Schloss. Ich lehnte mich mit dem Rücken dagegen, bis mein Handy, das ich verschwitzt in meiner Hand gehalten hatte, mehrmals vibrierte und mich in die Realität zurückholte. Mama.
Wann kommst du nach Hause?
Und eine Nachricht von Mathilda, die ich unter Beste eingespeichert hatte.
Mir geht es nicht überragend, ich schlaf heute bei mir.
Mathilda feuerte gleich eine Forderung hinterher.
Bringst du mir Friesenkekse?
Ich stand da, mit dem Handy in der Hand, und starrte auf diese Zeilen, die ich alle paar Sekunden scharf sehen konnte, bevor sie wieder verschwammen. Irgendwer ging an mir vorbei. Ich konnte nicht sagen, ob rechts oder links. Ich sollte einen Fuß vor den anderen setzen, mit einem siegreichen Lächeln an den Kollegen vorbei in mein Büro.
Die Buchstaben verschwammen wieder. Und irgendwie hatte ich vergessen, Luft zu holen, denn meine Lunge erinnerte mich mit einem schmerzhaften Ziehen daran. Ich gab ihr nicht nach, ich konnte nicht. Wahrscheinlich würde ich so bleiben, bis ich im Stehen erstickte. Würde Sven grinsen, wenn man mich fand? Zusammengerollt vor dem Büro unseres Chefs, in der schlaffen Hand ein Smartphone mit einer Nachricht, in der es um Friesenkekse ging.
Sein schmieriges Lächeln erschien vor meinem inneren Auge abwechselnd mit der Bienenmusterfliege von Daniel. Nein, ich sog tief Luft ein. Und ließ sie wieder entweichen. Atmen, ein und aus.
Wie von selbst drehte ich mich um und starrte auf die glänzende Tür, hinter der ein Mann saß, der mir eben die Arbeit der halben Welt übergekippt hatte wie ein Fass schwarzes Klebezeug über die Pechmarie. Er würde immer so weitermachen, immer weiter, es würde nicht aufhören. Daniel würde nicht aufhören. Was hatte ich mir schon groß erarbeitet, welchen Status hatte ich? Welchen würde ich haben? Meine Hand hob sich wie von selbst, dann schlug sie erneut dreimal gegen den blanken Stahl.
Kapitel zwei
»Was ist los?« Daniel richtete sich die Fliege.
Die Schiebetür stand offen, und aus dem Flur hörte ich wildes Tapsen, gemischt mit Geflüster. Erst sagte ich nichts. Mein Hals fühlte sich ohnehin zu trocken und kratzig an. Allerdings verwandelte sich mein Frust urplötzlich in Lava, die in mir brodelte und hochschoss, als ich ihn da so stehen sah.
»Ich kündige.«
»Was?« Daniel machte einen Schritt auf mich zu.
»Was?«, kam es auch von Sven, der offensichtlich im Flur hinter der Tür stand.
Eine Woge der Erleichterung spülte über mich hinweg und löschte den größten Teil des Feuers. Der Knoten in meiner Brust löste sich, meine Nase kitzelte, und ich merkte, wie sich Tränen ankündigten. Diese Situation wirkte surreal. Daniels irritierter Blick. Meine Worte, die nachhallten. Das lauter werdende Getuschel aus dem Flur.
Passierte das gerade wirklich?
»Helena, was redest du da?«
»Ich kündige.« Die schönsten Worte, die ich je mit ihm gewechselt hatte. Ich rief sie heraus wie eine Frau, die bei einem Heiratsantrag laut »Ja!« schrie.
»Aber wir brauchen dich.«
Toll. Jeder schien mich angeblich zu brauchen, Anerkennung schenkte mir niemand. In unserem Magazin Women of Sylt schrieben wir von Selbstbestimmtheit, und ich bewarb das fleißig. Aber mein eigenes Leben stand dem diametral gegenüber. Wann kümmerte ich mich um mich?
Daniel bemerkte offenbar den Wirrwarr draußen. Er wippte von einem Fuß auf den anderen. »Machen wir die Tür zu und bereden das in aller Ruhe.«
Ich stellte mich ihm breitbeinig in den Weg, so breitbeinig es im engen Kleid ging. »Es gibt nichts zu diskutieren, Daniel.«
»Deine Augen glänzen, und dein Gesicht glüht. Bist du krank?«
»Mir ist es nie besser gegangen.«
»Wegen des Shitstorms. Das wird wieder. Ein paar Samstage mehr und vier, fünf Aktionen.«
Ja, bestimmt. Noch mehr Arbeit für mich. Ohne Hilfe. Ohne anständige Bezahlung. Was brachten mir Gesetze, Überstundenregelungen und Wochenendzuschläge, wenn man gekündigt wurde, forderte man sie ein? Nicht mit mir.
»Nein. Ich kündige.«
»Tja, dann guck mal, wo du bleibst. Bei mir brauchst du nicht angekrochen kommen.«
Aha. So schnell konnte das Wetter in diesem Büro umschlagen.
»Du hast was getan?«
Meine beste Freundin starrte mich an und klopfte danach mit einem Schuh den Sand nach Klingen oder Spritzen ab, ihre feuerroten Haare wippten dabei. Mathilda hatte die Begabung, ihre Phobien vor anderen zu verheimlichen, mich konnte sie aber nicht täuschen. Danach stellte sie ihren Kaffeebecher schief ab, sodass er drohte umzukippen.
Ich packte ihn und drückte ihn tiefer in den Sand.
»Ich fasse es selbst nicht.«
Mathilda sprachlos zu erleben kam mir ähnlich absurd vor wie meine Kündigung. Aber dafür liebte ich sie, weil sie stets mit mir litt. Niemand sonst interessierte sich so ehrlich für mein Leben wie Mathilda, meine Schwester im Geiste.
Das Abendrot funkelte auf dem Meer und bot zusammen mit den schäumenden Wellen einen herrlichen Anblick. Der Wind fuhr mir durch die Haare, und ich strich mir ein paar Strähnen nach hinten, fühlte die vier Ringe oben am rechten Ohr, die mich seit Jahren begleiteten. Aus einer Zeit, in der alles einfacher und besser gewesen war.
Die Wellen rollten mit einem Donnern auf den Sand zu und hinterließen kleine Schaumkronen und Muscheln. Das Spiel des wogenden Wassers unter dem Himmel zog mich in seinen Bann und gönnte mir einen Moment, in dem ich alles andere vergessen durfte. Bis Mathilda sich berufen fühlte, meine kleine mentale Auszeit brutal zu beenden.
»Deine Mutter wird dich umbringen.«
Danke.
»Ich weiß.« Ich vergrub meine Füße im Sand. Wie ich es liebte, die Körnchen zwischen meine Zehen zu spüren, die mich wie ein Peeling sanft kitzelten. »Du solltest dich von mir verabschieden.« Dabei deutete ich an, wie meine Mama mich erwürgte.
»Spinnst du?« Ihre glatten Haare wirbelten umher, als sie sich zu mir beugte. »Was machen wir denn jetzt?« Mathilda knabberte am Nagel ihres Zeigefingers. Ihr Blick verlor sich irgendwo am Horizont, und ich ahnte, wie sie innerlich kämpfte, nicht darüber nachzudenken. »Gehst du Montag noch mal zur Arbeit?«
Ein belustigter Laut zwischen Lachen und Grunzen entfuhr mir, und ich ließ mich zurück in den Sand fallen.
Nachdem ich meinen üblichen Sandengel gemacht hatte, legte ich meinen Kopf auf die Arme. »Ich verbrauche meinen letzten Urlaub. Mit den Überstunden könnte ich bis zur Rente zu Hause bleiben. Mich bringen dort keine zehn griechischen Pferde hin.«
»Gibt es griechische Pferde?«
»Weiß nicht.«
Wir kicherten beide los. Mathilda lachte immer ein bisschen länger als ich, und das verlieh mir stets ein wohlig warmes Gefühl. Denn ihr Lachen war wie ein Sonnenaufgang am Sylter Strand.
»Daniel will mich sowieso nicht sehen. Als ich gegangen bin, hat er mit seinem Freund per Lautsprecher telefoniert.«
»Der Franzose?«
»Ja. Weißt du, was er gesagt hat?« Ich änderte meine Stimmlage. »Diese undankbare ‘ure.«
Mathilda prustete los, und ich spürte, wie ihre Spucke mein Gesicht benetzte.
»Na ja, dann … « Sie wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Kommst du heute besser nicht mehr mit zu mir und kümmerst dich um deine Angelegenheiten und um deine Mama.«
»Wird besser sein. Oh, und noch was!« Mit einem Ruck saß ich aufrecht, trank einen Schluck kalten Kaffee und sah die sommersprossige Nase meiner besten Freundin vor Neugierde zucken. »Du hättest Svens Gesicht sehen müssen. Es hat vor Freude gestrahlt. Bis ich ihm gesagt habe, dass er meine Aufgaben übernimmt. Alle meine Aufgaben. Allein.«
»Soll er?«
»Ich hab’s Daniel vorgeschlagen.«
»Du Füchsin.«
»Danach ist er im Stechschritt Richtung Herrentoilette. Wahrscheinlich, um zu kotzen oder meinen Namen mit Beschimpfungen auf die Trennwände zu schmieren.«
Sand flog durch die Luft, als Mathilda vor Lachen mit den Beinen strampelte. Als Sylterin war ich Sand in allen Ritzen gewohnt, trotzdem aß ich ihn nicht gern zum Abendbrot und drehte schnell den Kopf weg.
Meine Handtasche vibrierte. Ich brauchte gar nicht nachzusehen.
»Roswitha?« Mathilda und ich verstanden uns wie durch Telepathie. Ein Blick genügte, und wir wussten, was die andere dachte.
»Wer sonst? Ich mache mich lieber auf den Weg, sonst ruft meine Mama die Polizei.«
»Oder deinen Vater.«
Ja. Das wäre mal ein Vorwand. Wieder auf den Beinen, nahm ich meine Sneaker und blickte über die Landschaft vor mir. Der Sand glitzerte unter der Sonne wie orangefarbener Puderzucker und mit ihm das Meer in seiner dunklen Pracht. Aber was gaben mir Wellen und Dünen, wenn mein Leben gerade auseinanderbrach?
»Des gibt’s jo net.« Meine Mama verfiel gerne in ihren bayrischen Dialekt, wenn sie sich aufregte. Ich hätte mich am liebsten direkt in der Wohnungstür umgedreht, um zu flüchten. Aber sie hatte keine Sekunde vergeudet und mich aus der Küche heraus überrumpelt.
»Mama, bitte.«
»Jesses, Eleni.« Passend zu meinen Wurzeln nannten mein griechischer Vater sowie seine Familie in Panórama mich oftmals Eleni statt Helena. Meine Mama hatte das irgendwann übernommen.
»Das hättest du ruhig mit mir absprechen können.« Sie klatschte die Hände über dem Kopf zusammen und faltete sie danach über der Brust. »Herrschaftszeiten.«
»Mit dir?«
»Jo, freilich mit mir. Geld wächst net auf Bäumen.«
»Hörst du dir zu?«
Normalerweise behielt ich meine Vorwürfe bei mir. Seitdem sich mein Vater vor Kurzem von ihr getrennt hatte, kämpfte meine Mama mit Depressionen. Leider strapazierte das meine Kraftreserven erheblich. Meine innere Tankanzeige leuchtete rot, und das schon seit Monaten. Ich fand keine Zeit, um die nächste Tankstelle anzufahren. Es musste weitergehen, mit oder ohne Sprit. Ihre Trennung schien mir länger her zu sein als nur ein paar Monate.
Eigentlich stimmte das, denn wenn ich meine Mama musterte, sah ich all die Abende vor mir, in denen sie alleine zu Hause gesessen hatte. Meine Eltern hatten seit Jahren nur noch nebeneinanderher gelebt. An ihrem Daumen erkannte ich die verblasste Narbe, die sie sich nach einem Streit beim Abwaschen zugezogen hatte, als sie wie in Trance ein kaputtes Glas geputzt hatte. Seit dem Kuraufenthalt meines Vaters, dem darauf folgenden Auszug und dem Gemunkel, dass er seitdem eine Jüngere hatte, waren erst einige Monate vergangen. In meinem Herzen fühlte es sich an, als wäre mein Vater seit Jahren weg. Geflüchtet vor seinem alten Leben.
»Na schön, Kind. Wie soll es nun weitergehen? Darüber hast du dir bestimmt keine Gedanken gemacht, oder?«
Ihre Frage holte mich zurück in die Gegenwart. Um Sticheleien war meine Mama nie verlegen. Sie betonte das du mit der ihr typischen Theatralik. Ihre dunkelblonden Wellen wippten über ihrer Schulter auf und ab, als sie sich am Esszimmerstuhl anlehnte.
»Die Miete, die Rechnungen. Das wird hart, Helena.«
Ich spürte regelrecht, wie sich die Zugbrücke zu meiner Emotionenburg von selbst hochzog. Gleich würde sie mit einem dumpfen Rums einrasten und alles dicht machen, mich gegen die Außenwelt abschotten. »Wie wäre es, wenn du dir einen Job suchst?« Ehe ich es ausgesprochen hatte, bereute ich es.
Ihre Lippen lösten sich voneinander. Das Kinn klappte nach unten. In ihren Augen sah ich sofort diesen Opferblick, der im selben Moment wie ein Drache meine Emotionenburg stürmen wollte. Leider war die Zugbrücke noch nicht oben.
»Ach, Mama. Sei nicht böse. Aber habe ich nicht recht?«
»Du brauchst mich nicht als faul darzustellen.«
Nach diesem Satz von ihr stieg in mir das Feuer hoch. Wie ich es hasste, wenn sie mir die Worte im Mund umdrehte.
»Wie du meinst.« Meinen Ärger runterschlucken? Darin war ich Profi. Kopfschüttelnd verschwand ich in meinem Zimmer.
Mit meiner Mama in der Wohnung fühlte ich mich wieder wie ein Teenager. BAMM. Hinter mir die Tür zuzuschmettern verstärkte diesen Effekt nur noch. Ich stöhnte genervt auf und schmiss mich auf mein Bett. Wie eine Wolke fing es mich auf. Was sollte ich jetzt machen?
Mein Blick hing an der bunten Deckenlampe fest, und je mehr ich über die Worte meiner Mama nachdachte, desto lauter wurden sie.
Hatte sie recht?
»Argh.« Ich rollte mich zur Seite und murmelte Beschimpfungen in mein Kissen. Jap. Definitiv frühe Teenagerjahre.
Hierbleiben, mich wie eine Erwachsene benehmen, meinen Job zurückfordern und weitermachen wie gewohnt? Die heutige Übersprunghandlung stillschweigend zusammen mit meiner Würde begraben?
Der nächste Gedanke setzte ein Bild der Bienenmusterkrawatte meines Chefs in meinem Kopf fest, und brennende Wut schwappte in meiner Speiseröhre hoch. Das oder Sodbrennen. Nein. Ich konnte nicht zurück. Nicht nur das. Ich wollte auch endlich diese Selbstbestimmtheit und diese Freiheit, über die ich für das Magazin ständig gepostet hatte. Nicht nur meine Bestimmung, sondern mich selbst finden.
Aber die Rechnungen. Mein Lebenslauf!
Stopp. Ich musste ruhig bleiben und … und … Meine Augenlider wurden so unsäglich schwer. Die heutige Aufregung hatte mich mehr geschlaucht als gedacht. Nur ganz kurz würde ich die Augen schließen.
Ganz, ganz kurz.
Kapitel drei
Ich schreckte hoch und hörte, dass im Wohnzimmer der Fernseher lief. Schlaftrunken tastete ich nach meinem Handy. 22:35 Uhr. Nach unserem Streit und meiner Kündigung war ich erschöpft eingeschlafen. Wie ein Seestern lag ich nun also ausgebreitet in meinem riesigen Bett mit den vielen verschiedenen Kissen, das beinah das gesamte Zimmer ausfüllte. Durch das Fenster leuchteten die Sterne.
Sofort stellte ich mir vor, dass ich am Strand entlanglief und die frische, salzige Luft mich belebte, während das Mondlicht die Schaumkronen der Wellen küsste.
Mit einem Griff unter mein winziges Kissen, das die Form von Sylt hatte und das ich mir selbst bei einem Jahrmarkt erspielt hatte, zog ich die Postkarte meiner Tante Anna aus Griechenland hervor, die vor zwei Tagen angekommen war. Wie alles in ihrem Laden, in dem sie Töpferkreationen verkaufte, hatte sie auch die Karte selbst gebastelt. Ein gemaltes Bild und in Handlettering stand Panórama, die vergessene Insel über Santorini darauf. Viel wichtiger war jedoch der Text auf der Rückseite. Sie fragte nach meinem Wohlbefinden und schrieb, ihr ginge es okay. Ich hatte sofort gewusst, dass irgendetwas nicht stimmte, als ich das gelesen hatte. Anna war die wandelnde Positivität auf zwei Beinen. Das Wort »okay« gab es in ihrem Wortschatz nicht. Doch im Moment hatte ich eigene Probleme.
Die Panik meiner Mama musste sich gelegt haben, sonst hätte sie nicht auf der Couch gesessen und irgendeine Freitagabendshow geguckt. Um die Wogen zu glätten, erhob ich mich in meiner nicht zusammenpassenden Unterwäsche aus dem Bett und quetschte mich an der Vintagekommode und dem verspiegelten Schrank vorbei. Von dort schnappte ich mir ein XXL-Shirt, das ich überwarf. Ich ging ins Wohnzimmer und gesellte mich zu meiner Mama auf die sonnengelbe Couch, die sie ausgesucht hatte. Im Schneidersitz bettete ich meinen Kopf auf ihre Schulter und beobachtete die Z-Promis, wie sie irgendeinen Wettstreit gegen den Moderator gewannen.
Die Pralinen in der Kristallglasschüssel meiner verstorbenen griechischen Oma auf dem Tisch strahlten mir verführerisch entgegen.
Eigentlich sollte ich keine davon essen. Nein, ich sollte lieber etwas Richtiges essen. Unbedingt. Zwei Sekunden später lag eine davon wie durch Zauberhand in meinem Mund.
»Lenchen, hast du es in deinem Job nicht mehr ausgehalten?« Mama machte den Fernseher leiser.
»Malso, ich muff.« Ich schluckte die Praline mit Aprikosenlikör hinunter. »Also, ehrlich gesagt, ist es überstürzt gewesen. Trotzdem bereue ich nichts. Ich fühle mich seit Monaten ausgelaugt.«
Zweiundzwanzig Stunden am Tag vermisste ich es, meine Wohnung für mich zu haben, und sehnte mich nach der Zeit, als Mama noch nicht beschlossen hatte, nach der Trennung hier einzuziehen. In diesem Moment jedoch genoss ich es, sie bei mir zu haben.
»Ach, louloudi mou.«
Eigentlich nannte nur mein Vater mich meine Blume. Früher hatte ich das gehasst, weil mich in der Schule alle Lulu genannt hatten. Abseits der Streitigkeiten meiner Eltern hatten die Erinnerungen an meinen Vater einen leichten rosa Instagramfilter mit Glitzersternchen. Auch, wenn wir in vielen, okay, in fast allen Angelegenheiten unterschiedlicher Meinung waren, hatten wir oft eine schöne Zeit. Doch mit dem Gedanken daran, dass er eine andere hatte, sich eine neue Familie aufbaute, ja, meine Mama eventuell sogar betrogen hatte, schrumpfte mein Respekt ihm gegenüber auf ein Minimum.
Meine Mama breitete ihre Arme aus und umarmte mich. Ein wohliges Gefühl durchströmte mich, diese Geborgenheit, die nur die eigene Mama einem geben konnte. Dazu ihr ausgewaschenes Seidennachthemd mit den Sternen darauf. Sofort fühlte ich mich wieder wie ein Kind. Bald dreißig, und ich lag in den Armen meiner Mama wie ein Baby. Erschießt mich, aber nirgendwo wäre ich lieber gewesen. Außer vielleicht in Jude Laws Armen im kleinen Cottage aus Liebe braucht keine Ferien.
»Es tut mir leid, dass ich Hals über Kopf gekündigt habe. Aber ich hatte den Eindruck, mein Chef hält mich für ein naives Mädchen. Ich habe einen Fehler gemacht, ja. Was er mir jedoch danach aufgebrummt hat, hätte kein Mensch leisten können. Und das weiß er. Er hat es extra gemacht, hat es ausgenutzt, dass ich Angst um meinen Job hatte.« Ich richtete mich auf. »Aber um den Fauxpas auszugleichen, musst du dich mehr ins Zeug legen für den Kunden.« Mit dem Finger als Schnauzbart über der Oberlippe mimte ich meinen Chef nach. Ex-Chef.
Das Schmunzeln meiner Mama vertiefte ihre Grübchen, die sie mir an beiden Wangen vererbt hatte.
»Noch mehr Arbeit? Du bist ohnehin kaum zu Hause.«
»Eben.«
Dass Mathilda und sie auch nicht unschuldig an meiner innerlichen Anspannung waren, sagte ich lieber nicht. Doch der Fakt, dass die beiden ständig meine Hilfe beanspruchten mit Mamas Wutausbrüchen meinem Vater gegenüber oder Mathildas Unselbstständigkeit, zerrte an mir.
»Denk darüber nach, was du machen willst. Niemand steht am Ende deines Lebens da und applaudiert, weil du alles gemacht hast, was andere von dir verlangt haben. Vergiss das nicht.«
Diese Worte flossen in mich wie warmer Honig, süß und wohltuend. Endlich mal keine Vorwürfe, das brauchte ich. Ich spürte, wie in mir etwas nachgab, wie meine Zugbrücke sich wieder Richtung Burggraben senkte. Im selben Moment überkam mich eine Müdigkeit, wie ich sie selten gespürt hatte. Als ob sie seit Monaten darauf gewartet hätte, endlich ihr Recht einzufordern.
»Ich lege mich wieder ins Bett, okay?«
»Ja, ruh dich aus, Schatz.«
Auf dem Weg in mein Zimmer schnappte ich mir noch eine Praline.
»Denk an die GEZ.«
»Ach, Mama!«
Ich schlug die Tür mit dem Fuß zu und verdrückte die letzte Praline für heute. Die Verpackung formte ich zu einem Ball und warf ihn in Richtung des winzigen Mülleimers auf dem Schminktisch. Daneben.
Ich beugte mich hinunter und hob das Bällchen auf. Während ich es wegwarf, entdeckte ich in der offenen Schublade des Tisches mein altes Fotoalbum.
Wie lange hatte ich das nicht mehr durchgeblättert?
Ich knipste die Lichterketten über meinem Bett und die Nachttischlampe an, kuschelte mich in meine Bettdecke und öffnete das Album.
Bilder von mir als Kind in Griechenland zu sehen stimmte mich wehmütig. Seit Jahren hatte ich keinen Fuß mehr in meine zweite Heimat gesetzt. Durch die Eheprobleme meiner Eltern war mir die Lust vergangen, mit ihnen in Griechenland Urlaub zu machen und bei der Familie vorbeizuschauen. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hatte mich mein Job vollends eingespannt. Ab und an gab es noch Pflichtbesuche, weil es sich so gehörte. Die kamen aber nicht mehr an diese Zeit von früher heran, in der sich der Urlaub eher wie ein Nachhausekommen angefühlt hatte.
Bilder vom gemeinsamen Kochen zu Ostern, dem wichtigsten Fest im orthodoxen Griechenland, und vom Lunapark, der Nachtkirmes, wie ich mit meinem Vater im Karussell sitze. Die heißen Sommer, in denen die Sonne alles mit Licht durchflutete, weiße Sandstrände, die einem das Wasser wie einen leuchtenden Teppich zu Füßen legten. Immer mit dabei: Mathilda. Sie gehörte praktisch zur Familie. Es schmerzte bis in meine Eingeweide, dass sie ihre Ängste nicht in den Griff bekam und ich oft genervt von ihr war, denn Mathilda war wie eine Schwester für mich.
Nicht zu vergessen: das Essen. Ich blätterte um. Das vergilbte eingeklebte Rezept meines verstorbenen Opas für seine berühmte Bougatsa. Sein nach Familienrezept selbst gemachter Blätterteig mit Grießpuddingfüllung und Zimt-Puderzucker-Mischung hatte das perfekte Verhältnis von Süße und Würze. Jeder auf der kleinen, quirligen Insel schwärmte davon und hatte mich darum beneidet, direkt an der Quelle zu sitzen. Die Variante mit Spinat- oder Käsefüllung war ebenfalls unerreicht, so wie mein Opa sie zubereitet hatte. Für mich ab und zu mit einem Loukaniko, einem kleinen griechischen Würstchen. An den Wochenenden stand oft die halbe Insel vor seinem Haus und holte sich eine Portion. Er liebte es, alle versammelt zu sehen. Als ob er einen kleinen Bougatsa-Laden betrieben hätte. Nur wäre ihm im Traum nicht eingefallen, dafür Geld zu nehmen. Nein, mein Opa war kein Mensch, der jemals hätte Millionär werden können.
Das Transparentpapier raschelte beim Umblättern. Das nächste Bild versetzte mir einen Stich. Ich erinnerte mich an die Situation, als wäre es gestern gewesen. Auf dem Foto sah ich mich und meinen Opa. Er saß auf einem tausendmal geleimten Holzstuhl, von dem die Farbe abgeblättert war, ich auf seinem Schoß. Selbst an die Worte, die ich meinem Vater kurz zuvor gesagt hatte, konnte ich mich erinnern. »Irgendwann ziehen wir hierher. Das wäre ein Traum. Oder, Papa?«
Oder, Papa? Ich schlug das dicke Album fest zu, sodass mir ein muffiger Windstoß ins Gesicht wehte. Sentimentalität überkam mich, wenn ich sie am wenigsten brauchte. Ein Seufzer entglitt mir, als ich das Fotoalbum umschlang und tiefer in mein Bett sank. Ich versuchte, den Schmerz zu ignorieren, der mir bei dem Gedanken an meinen Vater durch die Brust gefahren war. Er hatte sich meiner Mama gegenüber zu herzlos verhalten.
Die Lichterkette über meinem Bett leuchtete verheißungsvoll wie ein klarer Sommersternenhimmel in Griechenland. Zum wiederholten Male hopste ich aus den Federn. Ein Ruck am Fenstergriff, und die kühle Nachtluft umspielte und beruhigte mich. Ich musste etwas ändern! Nicht nur etwas, sondern alles!
Immer steckte ich zurück und wollte, dass es jedem blendend ging. Aber das musste jetzt ein Ende haben! Was war mit mir? Und meinen Bedürfnissen und Wünschen? Mit einer Hand wischte ich über das Smartphone. Auf einmal wurde ich wieder unsicher. Wollte ich das? Oder war ich erschöpft, überdreht und hatte deshalb fixe Ideen?
Ich öffnete die App.
Was hatte ich zu verlieren? Außerdem hatte mein Vater mich oft gebeten, mich bei der Familie zu melden.
Kapitel vier
Drei. Zwei. Eins.
»Das kannst du nicht machen!«
Ich hatte es geahnt, dass Mathilda so reagieren würde wie meine Mama zuvor beim Frühstück, sobald sie erfuhr, was ich vorhatte. Die Flucht in unser Lieblingscafé südlich von Westerland stellte sich nicht als gelungener Rückzugsort heraus. Selbst die goldenen Sonnenstrahlen, die ihre warmen Hände nach mir streckten und meine Wangen sanft kitzelten, halfen mir nicht, mich wohler zu fühlen.
»Ich liebe dich, Mathilda, aber ich frage dich nicht um Erlaubnis.« Bleib standhaft, Helena, bleib standhaft!
Vielleicht halfen die Sonnenstrahlen oder die Weite des Meeres. Vielleicht spürte ich auch nur den Baileys in meinem Kaffee. Das Korsett um meinen Oberkörper löste sich langsam und ließ mich wieder freier atmen.
Mathilda inspizierte den Boden, als suchte sie etwas Wichtiges. Sie kratzte sich am Kopf und schien dabei ihren Strohhut zu vergessen. Er rutschte herab und landete auf dem Holzgerüst der Terrasse des Strandcafés.
Ich erhob mich aus dem gestreiften Strandkorb und reichte Mathilda ihren Hut, ehe ich mich wieder setzte. Wie oft hatten Mathilda und ich hier gesessen und den Sternenhimmel beobachtet? Aber auch die Dämmerstunden davor brachten mich immer wieder runter. Die Vögelchen, die ihr Lied einstimmten und den Abend einläuteten. Oder ich sah den kleinen Fledermäusen nach, die noch schnell aus ihren Verstecken flitzten, bevor der Himmel sich sein dunkelblaues Kleid anlegte. Ich fand, dass es sich in Strandkörben wunderbar schlummern ließ.
»Danke.« Mathilda riss mich aus meinen Gedanken.
»Schau, der Typ. Der guckt dich die ganze Zeit an.« Vielleicht munterte ich sie damit auf. Müsste ihr Typ sein. Bad-Boy-Material.
Mathilda drehte sich so auffällig zu ihm um, dass ich es bereute, den Mund aufgemacht zu haben. Bad Boy lugte her. Sie hielt dem Blick stand und musterte ihn weiter. Mein Fremdschäm-Level stieg auf Trash-TV-Niveau. Langsam bewegte sich ihr Oberkörper wieder in seine Ausgangsposition. »Unsinn, der hat es auf dich abgesehen.«
»Nein, danke. Kein Interesse.«
»Du und dein eingebildeter Männerfluch wieder.«
»Das ist keine Einbildung.«
Abrupt stand der Bad Boy auf und eilte mit dem Handy am Ohr nach draußen.
»Soll ich dir das mit dem Fluch noch mal erklären?«
»Nein, danke. Ich hab’s kapiert.« Mathilda schmunzelte, bis ihr Gesicht sich wieder verfinsterte. »Und was soll ich ohne dich machen?« Sie spielte mit der Ecke der dunkelroten Speisekarte.
»Hey, ich sterbe nicht. Ich fahre nur ein paar Wochen in den Urlaub. Ich war seit Jahren nicht dort.«
»Kannst du dir das leisten?«
»Ich habe Geld gespart, das reicht erst mal. Weiter will ich mich mit dem Jobthema im Augenblick nicht befassen. Außerdem habe ich eine Karte von Tante Anna bekommen. Ich glaube, sie hat Probleme. Sie hat geschrieben, es geht ihr okay.«
»Was?! ›Okay‹ klingt nicht nach ihr. Wo wir schon bei Anna sind: Jedes Mal, wenn ich an sie denke, kommt mir zuerst diese eine schreckliche Autofahrt in den Sinn.«
Wie könnte ich das vergessen. Sofort hörte ich wieder das röhrende Geräusch des Automotors.
»Ja. Schrecklich. Abgesehen von der Schrottkarre, mit der wir gefahren sind, haben meine Eltern nur gestritten. Und mein Vater hat nie zugegeben, wenn er müde wurde. Und das eklige Autobahnhotel mit den Kakerlaken.«
Ein glockenhelles Lachen entfuhr Mathilda. So sah ich meine beste Freundin gerne.
»Und wie Roswitha während der Fahrt ausgerastet ist. Oh, und weißt du noch, was sie geschrien hat? Wir werden sterben.Auf der Autobahn. In Serbien.« Mathilda machte meine Mama perfekt nach. Immerhin war meine Mama so etwas wie Mathildas Ersatzmama. »Und wie dein Vater und Roswitha sich an der Tankstelle gestritten haben, weil er felsenfest überzeugt war, dass der Tankwart sie beim Umrechnen betrogen hat …«
»Und mein Vater öffnet die Coladose, und alles spritzt heraus.«
Wir prusteten beide laut los, und die Leute um uns herum spähten verstohlen zu uns. Ach ja, meine Eltern hätten eine eigene Sitcom verdient. Diese Erinnerungen mit Mathilda zu teilen, bedeutete mir viel. Wenn ich so darüber nachdachte, dann verstanden wir uns besser als so manche richtige Geschwisterpaare, die ich kannte. Früher war Mathilda mein Halt inmitten meines Familienchaos gewesen. Wie diese standhaften Felsen, die selbst der mächtigen Stärke der Meereswellen trotzten. Doch mit den Jahren hatte sich das gedreht.
Ich nahm einen Schluck Kaffee.
Mathilda musterte mein Heißgetränk. Dann mich. »Deshalb der Baileys. Du hast dir Mut angetrunken.«
Erwischt.
»Hast du etwa Angst gehabt?« Mathilda zog eine Schnute, wie immer, wenn ihr etwas nicht passte.
Keine Antwort, auch eine Antwort.
»Warum? Du kannst mir alles erzählen!«
Ich untersuchte den gesamten kleinen, gusseisernen Tisch und hoffte, dass irgendwo eine Schriftrolle mit einer plausiblen Ausrede lag. Ich fand keine.
»Du, Mama, der Job, Women of Sylt. Mir kommt es vor, als müsste ich für alle funktionieren.«
»Das stimmt nicht.« Mathildas Haut, die sie stets vor der Sonne schützte, rötete sich an den Wangen.
Nein, bitte nicht. Ich wollte nicht im Streit auseinandergehen. »Tut mir leid«, sagte ich schnell.
»Nein, tut es dir nicht. Du meinst das so, Helena.«
»Ja, okay. Ja, meine ich. Mama hängt an mir und schafft es nicht hochzukommen. Und du willst, dass ich bei dir schlafe, dir Sachen vorbeibringe, als wäre ich, na ja.« Ruhig mit den jungen Pferden. Nicht übertreiben.
»Was? Meine Mama?« Mathilda stand auf und packte ihre Tasche.
»Mathilda, warte.«
»Nein.« Sie sah dabei nicht auf.
»Bitte. Ich fliege morgen Abend um halb neun. Lass uns nicht streiten.«
Mathilda drehte sich um. »Tja, Unabhängigkeit verlangt Opfer.«
Warum stellte es für die Welt ein Problem dar, dass ich mich für ein paar Wochen in den Urlaub verabschieden wollte? So ein Drama wegen einer Reise.
Meine Wochenendspaziergänge mit der Sylter Meeresaussicht vermisste ich jetzt schon. Obwohl ich mich auch auf die Strände in Griechenland freute. Selbst heute hatte ich mich wieder vor dem Treffen mit Mathilda im Café bis Munkmarsch durchgeschlagen, um am Ufer entlangzuschlendern. Diese Ruhe. Herrlich.
Dass es auf Sylt kaum noch Geheimplätze gab, erkannte ich auch hier in einer der kleinsten Gemeinden wieder. Zwei Touristinnen neben mir, die Bilder machten. Konnte ich es ihnen verübeln? Die schönen Friesenstilhäuser mit den Reetdächern boten eine tolle Fotokulisse.
Wolken zogen auf und waberten wie lebendige Wesen am Himmel umher. Auf einer freien Bank machte ich es mir gemütlich, zog meine Weste enger und betrachtete das dunkle Wasser.
In meinem Kopf ratterte es, und ich erwischte mich, wie ich mir neue Überschriften für meine winzige Kolumne überlegte.
Wie ich am Flutsaum meine Unabhängigkeit fand.
Okay, diese Story behielt ich lieber für mich. Na ja, war ohnehin nicht mehr mein Job. Schade. Ich hatte meine Aufgaben geliebt. Das Drumherum nicht. Dennoch gab ich nicht auf. Dieses eine Leben gehörte mir, und ich würde mein Ziel, endlich selbstbestimmter zu leben und eine Berufung zu finden, nicht nur einen Job, erreichen. Wie hieß es? Jeder ist seines Glückes Schmied. Dann hoch mit der Schmiedezange. Ich war bereit für das Abenteuer, mich wiederzufinden.