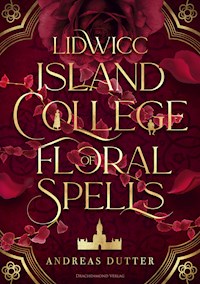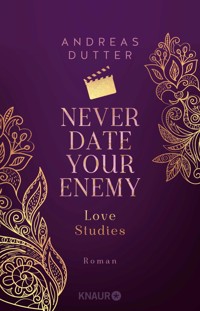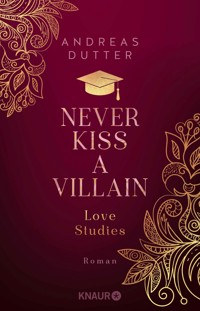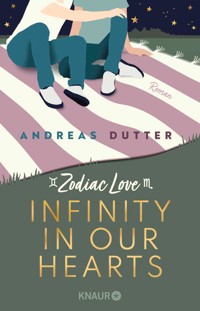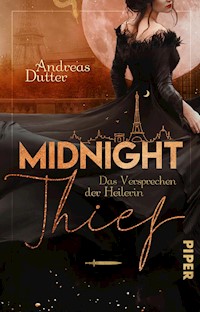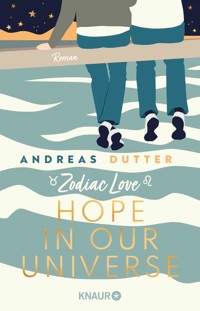
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zodiac Love
- Sprache: Deutsch
Hast du den Mut, deinen Sternen zu folgen? In »Zodiac Love: Hope in Our Universe«, dem zweiten eigenständigen Roman der queeren New-Adult-Reihe »Zodiac Love« von Andreas Dutter, steht Quinn vor großen Entscheidungen. Quinn war schon immer eher zurückhaltend und unsicher. Als er den Star-Astrologie-Kolumnisten Takeru kennenlernt, bringt dieser ihn mit seiner direkten Art ganz schön ins Schwitzen. Er hat ein Auge auf Quinn geworfen, woraus er kein Geheimnis macht. Doch Quinn steht noch vor weiteren Herausforderungen: Nach dem Schlaganfall seines Vaters ist er plötzlich verantwortlich für den Herrenausstatterladen der Familie. Mächtige Kundschaft, die Geheimgesellschaft Emerald Druids, bringt ihn und den Laden in Bedrängnis. Was Quinn nicht ahnt: Takeru verschweigt ein paar wesentliche Details über sich, die Quinn alles kosten könnten … Andreas Dutter ist in der LGBTQIAP+-Community aktiv und auch auf Instagram und TikTok zu finden. Astrologie und inwieweit Sternzeichen das Leben beeinflussen und bei wichtigen Entscheidungen weiterhelfen können, damit beschäftigt er sich in Quinns Geschichte – ein Thema, das ihn schon länger fasziniert. Der Own-Voice-Autor hat sich mit der queeren New-Adult-Reihe »Zodiac Love« selbst einen Traum erfüllt. »Mitreißend, gefühlvoll und bezaubernd erzählt Andreas Dutter die Geschichte von Quinn und Takeru.« (Julia Kuhn, SPIEGEL-Bestsellerautorin)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Andreas Dutter
Zodiac Love
Hope in Our Universe
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Triggerwarnung – Hinweis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Danksagung
Liste sensibler Inhalte / Content Notes
Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Für alle, die sich fragen: Wer bin ich und was will ich eigentlich? Bin ich überhaupt gut genug? (Ja!)
Kapitel 1
Quinn
Auszug aus Astro-Logic-y – My Zodiac Love by Cara Mitsou: Ist Astrologie real? Oder die eigentlich viel wichtigere Frage: Wenn du dich durch die Astrologie mehr mit dir selbst beschäftigst und neue Seiten an dir kennenlernst, dich reflektierst und entwickelst, ist die Antwort dann nicht egal? Und was ist schon real?
Warum kehren wir in unseren Alltag zurück, wenn wir ihn mit hängenden Mundwinkeln empfangen? Warum ändern wir nichts, anstatt uns in einwöchigen Urlauben mal gut zu fühlen?
Zwischen dem Lärm von ratternden Rollwägen, auf denen Koffer polterten, Beeilt-euch-Rufen und monotonen Roboterdurchsagen erkannte ich ohne Probleme genau das: welche Menschen auf dem Weg in den Urlaub waren (und welche nicht). Die Tristesse ihres Lebens verschwand mehr und mehr aus ihren Gesichtern, je näher sie ihrem Gate kamen (außer sie hatten Flugangst) – in freudiger Erwartung darauf, den Urlaub einzuläuten und den Sonnencremeduft möglichst lange auf sich zu tragen. Im Gegensatz dazu die Leute, deren Reise hier ein Ende fand. Ihre Mienen verloren das Strahlen. Mit jeder Sekunde, in der die Mundwinkel weiter nach unten gingen, schienen sie eines zu realisieren: Ich bin wieder zurück und laufe meinen Alltagsproblemen wieder in die Arme.
Über allem waberte die Frage: Warum brechen wir nicht aus?
Oh, und die Frage, warum Felix mich gezwungen hatte, am Boden zu sitzen statt auf den Stühlen im Empfangsbereich.
»Du hörst mir nicht zu.«
Felix’ Anschuldigung hatte ich nichts entgegenzusetzen. Er beugte sich vor und schenkte mir einen skeptischen Blick, der mich zwang, wieder in die Realität einzutauchen.
»Sorry. Was hast du gesagt?« Mit meinen Händen stützte ich mich am dunkelbraunen Boden ab und hob meinen Körper etwas an, um meinen Hintern zu entlasten.
»Ob es okay ist, dass du meine Schicht morgen übernimmst, damit ich mit Owen seine Ankunft zelebrieren kann.«
Zelebrieren bedeutete in Felixsprache: Sex.
»Jaha. Wie oft noch?« Felix und ich hatten das gesamte Jahr von Owens Abwesenheit miteinander verbracht. Genauer gesagt: ein Jahr und drei Monate. Owen war vor Weihnachten nach London gegangen und kam jetzt Mitte März zurück, nachdem er seine Nachfolgerin im Mamdouh Institute of Cognitive Disorders – kurz MICD –, das sich für die Parkinsonforschung einsetzte, eingelernt hatte. Vierhundertsechsundvierzig Tage. Keinen Tag würde ich länger aushalten, Felix dabei zu lauschen, wie er zwischen »Owen verlässt mich«,»Owen und ich hatten Telefonsex« und »Ich vermisse Owen« switchte.
Natürlich verstand ich ihn. Owen und er hatten sich vor über einem Jahr gerade gefunden, da musste Owen seine neue Stelle im MICDin London annehmen, worauf er sein gesamtes Medizinstudium hingearbeitet hatte. Trotzdem waren meine Freundin Nala, Owens beste Freundin Róisín, Felix’ Mitbewohnerin Cara, seine Studienkollegin Yoshiko und ich uns einig: Owens Ankunft war unser aller Segen.
Zum Glück waren die letzten knapp eineinhalb Jahre aber nicht nur geprägt gewesen von Owen-Vermissungsarien. Wir waren als Cork-Gang mehr und mehr zusammengewachsen. Selbst Robin, den Felix damals gekorbt hatte, war ein Teil unserer Gruppe geworden. Vor allem seit er Yoshiko einen Nebenjob im Royal Hotel Cork vermittelt und die beiden sich zu einem unzertrennlichen Team zusammengeschlossen hatten. Wenn ich auf diese eineinhalb Jahre zurückblickte, war ich für eines dankbar: für diese Leute. Unvergessen blieb der Campingtrip, bei dem wir nach drei Stunden wieder nach Hause fuhren, weil wir Angst vor der Dunkelheit im Wald hatten. Oder unser unbezahlter Videodreh für den Imagefilm vom Royal Hotel, dem Arbeitsplatz von Robin. Der hatte damit geendet, dass wir betrunken im Keller des Hotels aufgewacht waren und Felix geglaubt hatte, wir wären in einem Saw-Film.
»So oft, bis ich dir glaube, dass du es nicht sagst, weil du nicht Nein sagen kannst.« Mit diesem Satz riss Felix mich wieder aus meinen Gedanken. Punkt für ihn. Ich war ein schlechter Neinsager.
Ertappt strich ich meinen smaragdgrünen Pulli glatt, unter dem ich ein zu großes, blassrosa Shirt trug, das an allen Enden rausguckte, und zupfte ein paar Flusen von meiner weiten Jeans. Alles in der Hoffnung, mir würde eine plausible Ausrede einfallen. »Hä? Ich kann Nein sagen. Sieh her: Nein, nein, nein.«
Felix rutschte ein Stück vor, und ich überlegte indessen, wie viel Erfolg ich damit hätte, dem Flughafen eine Rechnung zu schicken. Dafür, dass Felix und ich mit unseren Hintern den Boden wischten. »Quinny.«
»Nenn mich nicht so. Du tust wieder einen auf empathischer Fisch, aber nur, weil das dein Sternzeichen ist …«
Felix unterbrach mich mit erhobenem Zeigefinger. »Ah! Ah! Ah! Wie war das?« Jetzt fing er wieder mit seinem Astrologiezeug an. »Du weißt genau, dass das umgangssprachliche Sternzeichen eigentlich das Sonnenzeichen ist. Es gibt an, in welchem Sternbild die Sonne, das Zentrum des Universums, bei unserer Geburt stand. Darüber hinaus zeigt es unsere grundlegendsten Überzeugungen auf.« Felix spulte sein Wissen ab, und ich nahm es mal wieder als Rauschen im Hintergrund wahr, während ich zusah, wie sich zwei Mädchen ihre Nackenkissen für den Flug richteten. »Na, egal. Heute lasse ich dir das durchgehen.« Felix wuschelte durch meine Haare. »Ich liebe deinen Mittelscheitel, aber deine Haare gehören mal wieder geschnitten.« Das sagte Felix nicht zufällig so breit grinsend. Es handelte sich um einen Spruch, den eine Stammkundin mir ungefragt reingedrückt hatte. »Und jetzt gib zu, dass du nicht Nein sagen kannst.«
Mal wieder checkte Felix den Anzeigebildschirm mit den Ankunftszeiten.
»Ich, ähm. Mir wird das zu albern. Erzähl mir lieber, was Owen macht, wenn er wieder in Cork ist.« Das müsste reichlich Futter für Felix sein, um ihn von meinem Neinproblem abzulenken. Vielleicht sagte ich nicht gerne Nein, aber warum auch? Wenn ich ehrlich war, hatte ich kaum etwas anderes in meinem Leben als Dads Herrenausstatterladen, das Murphy’s. Dort arbeitete ich, seitdem ich nicht mehr schulpflichtig war. Oft war ich froh, wenn jemand etwas von mir wollte und sich etwas in meinem Leben tat. Seitdem ich dank Felix in eine größere Gruppe von Leuten gestolpert war, überwog das Gefühl der Einsamkeit nicht mehr, spannend war mein Alltag dennoch nicht.
»Er hat Onlinebewerbungen gehabt. Mit Video und so. Hat ihn nicht überzeugt, oder sie haben abgesagt.« Ähnliches hatte Felix öfter erwähnt, dabei konnte ich mir nicht vorstellen, dass Owen keinen Job fand. »Es tut ihm sicher gut, zu entspannen. Arbeit findet er noch.« Seine Wangen färbten sich rötlich, und er knabberte an seinen Fingernägeln mit dem abgekratzten schwarzen Nagellack.
»Mach nicht auf fürsorglich. Du bist doch happy, dass du ihn öfter um dich hast. Cara tut mir leid. Ihre Chatverläufe werden gefüllt von Auberginen sein.« Das war Felix’ und Caras Emoji für Setz Kopfhörer auf, Sexytime steht an.
Geschockt öffnete Felix den Mund und schlug gegen mein Schienbein, was ihm offensichtlich mehr wehtat als mir. »Wie kannst du so was sagen.« Er rieb sich die Hand. »Das ist eine grauenhafte und absolut wahre Behauptung.« Felix schnaubte belustigt, beugte sich vor und stützte sich lachend auf meinen Beinen ab. »Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich mich freue, dass Ow noch keinen Job hat?«
»Auf jeden Fall.« Ich streichelte Felix’ aschblonde Haare. »Aber wer würde das denn nicht?« Nach meinen einfühlsamen, aufbauenden Worten erhob ich mich. Wieder auf den Beinen, knetete ich meine Seiten, meinen Rücken und meine Schultern durch. »Ich hol mir etwas zu trinken, magst du auch was?«
»Quinn. Dein Vater ist mein Chef, du weißt, was ich verdiene. Ich habe gestern ein Hotelzimmer für Owen und mich gebucht. Wasser ist bis zum Monatsende ein Luxusartikel.« Felix lehnte sich mit verschränkten Armen am Hinterkopf gegen die Wand. »Geh ruhig. Ich verdurste solange, wartend auf meinen besten Freund.«
»Richte ihm schöne Grüße aus.« Im Gehen winkte ich Felix über die Schulter zu und hörte sein scharfes Lufteinziehen, ehe ich mich grinsend umdrehte. »Ich nehme dir, hmm …«, ich ging rückwärts weiter, »ein Wasser mit, okay?«
»Danke, mein Herr. Felix wird das niemals vergessen.«
Dass Felix sich traute, mir das quer durch die Halle hinterherzurufen, freute mich für ihn. Seit einem Jahr verfolgte er konsequent seine Therapie, um seine Vergangenheit in einem konservativen Dorf in Österreich zu verarbeiten, und wir alle merkten seine Veränderung täglich ein Stückchen mehr. Früher hätte er niemals etwas von mir angenommen und sicher nicht durch den Flughafen gebrüllt.
»Was für ein Quatschkopf.« Ich machte kehrt und eilte um die nächste Ecke zum uralten Getränkeautomaten.
Exakt in diesem Augenblick stieß ich gegen jemanden, der zeitgleich um dieselbe Ecke bog. Zwar wich ich instinktiv aus, erwischte den Anzugtypen aber trotzdem seitlich. »Entschul… Ah!« Überrascht war ich zwei Schritte weitergewankt und gegen seinen Koffer gestolpert, den er hinter sich herzog. Der riesige Trolley erwischte mich mit voller Wucht und riss mir den Boden unter den Füßen weg.
Einen halsbrecherischen Stunt über das große Teil später landete ich auf dem Untergrund und war mir hundertprozentig sicher, meinen Hintern völlig zerstört zu haben. »Au.« So gut es ging, ignorierte ich die Blicke der Leute um uns.
»Pass doch auf.« Koffertyp reichte mir seine Hand. Noch etwas benommen vom Schmerz an meinem Steißbein, griff ich danach, ohne ihm richtig ins Gesicht zu sehen.
»Ich?« Hätte ich können, er jedoch auch. »Logischerweise kann keiner von uns beiden um Ecken blinzeln, und meinen Röntgenblick habe ich heute noch nicht aufgesetzt.« Als ich meine Haare richten wollte, fiel mir auf, dass er noch meine Hand hielt, und ich linste in sein Gesicht.
Erst jetzt bemerkte ich, dass er mich abcheckte. Nicht auf eine Ah-okay-wer-ist-das-da-vor-mir-Weise, sondern als würde er überlegen, ob er mich kennt.
»Stimmt, entschuldige.« Irritiert blickte er von mir weg, als suchte er nach etwas. Dabei vergaß er meine Hand, die er immer fester und fester zusammenquetschte.
»Darf ich meine Hand wiederhaben?« Ich nutzte die Zeit und begutachtete seine markanten Wangenknochen, die sich unter der Haut abzeichneten, als er die Lippen zu einem O formte.
»Oh. Ups.« Er ließ seinen Koffer los und kratzte sich am linken Ohr, an dem ein schwarzes, rundes Piercing hing, und von dort aus rutschte seine Hand über seine kurz geschorenen, schwarzen Haare runter zum Nacken. »Sorry.«
Der feste Griff löste sich, und er legte seine Hand an den beigen Anzug. »Wo geht es noch mal schnell zu den Taxis?« Abwechselnd ließ er seinen Kopf nach links, rechts und wieder zurück sausen. »Mein Orientierungssinn und ich werden in diesem Leben kein Team mehr.«
Von seinem Sakko, das er gerade aufknöpfte, blickte ich hinter ihn. Ein Pfeil zeigte leuchtend nach rechts zu den Taxis, und ich fragte mich, wie schlecht ein Mensch sich in dem kompakten zweistöckigen Terminal zurechtfinden konnte. Corks Flughafen war alles, aber kein Labyrinth. Um das hinter mich zu bringen, hob ich meine Hand zum Taxischild.
»Wenn du keine Ahnung hast, sag’s doch. Ich bin im Stress.«
Dieser Typ musste mich für einen Volldeppen halten, anders konnte ich mir nicht erklären, warum er auf seine protzige Armbanduhr deutete, als verstünde ich ihn nicht auch so.
»Stress? Echt? Hätte ich gar nicht bemerkt. Links. Nach links geht es zu den Taxis.« Arschloch.
Den sah ich ohnehin nie wieder, sollte er sich in dem Irrgarten, bestehend aus einem geraden, offensichtlichen Weg mit nur einem Ausgang, verlaufen. Nicht mein Problem. Wenn der in ein echtes Labyrinth kam, wäre er verloren.
»Danke.« Das Danke hörte sich nicht dankbar an, aber damit konnte ich leben.
Grinsend neigte ich meinen Kopf und kämpfte mich durch die Menge weiter zum Getränkeautomaten vor. Durch die Glasfront vor mir erkannte ich Flugzeuge, die beladen wurden, Koffer, die durch die Gegend geschmissen wurden, und eine graue Wolkendecke, die vom nächsten Flieger durchbrochen wurde. Neben mir vernahm ich die typischen Gespräche über die Freude, jemanden wiederzusehen, und Flugangstszenarien, die zwei Freundinnen durchspielten à la »Ich habe keine Angst vorm Fliegen, sondern vorm Abstürzen«.
Von Weitem erblickte ich das Schild am Getränkeautomaten. Außer Betrieb.
Danke fürs nichts.
Ich streckte dem unnützen Ding, das offenbar, seit ich Felix das letzte Mal von hier abgeholt hatte, als er Owen in London besucht hatte, nicht funktionierte – oder schon wieder nicht in Betrieb war – meinen Mittelfinger entgegen und schlenderte in die entgegengesetzte Richtung zum WHSmith, wo die Snacks so viel wie ein Buch kosteten. Drinnen kaufte ich zwei Wasser zum Preis einer Niere und begab mich zurück zu Felix.
»Quinn!«
»Ich bin ja schon da.« Etwas zu lasch warf ich Felix das Wasser zu.
»Nein, nein. Darum geht es nicht. Aber danke.« Felix öffnete den Verschluss und trank, bis die Flasche laut knackte.
Wie ich das hasste, wenn jemand etwas anteaserte und mich dann warten ließ. »Spuck’s aus jetzt.«
Felix setzte ab und deutete auf seine Wangen voller Wasser.
Belustigt schnaubte ich. »Nicht das Wasser. Was du mir sagen willst.«
Das folgende Schluckgeräusch klang ein wenig ungesund, und Felix schraubte die Flasche zu. »Vor ein paar Minuten ist ein bekannter Astrologiekolumnist an mir vorbeigegangen. Wenn Cara das gesehen hätte.« Felix wedelte mit seinen Händen. So schnell, dass seine Finger an die Handflächen klatschten. »Ich lese seine Tweets jeden Tag. Nein, ich meine, ohne Witz, jeden Tag.«
Meine Wasserflasche knackte nun auch, nicht weil ich trank, sondern mich verkrampfte. Bitte, liebes Karma, warum? Ich wettete auf den Laden meines Dads, dass dieser Typ exakt der war, von dem ich dachte, dass er es war. »Hat er einen Anzug getragen? Ein Piercing am Ohr? Einen gigantischen Trolley? Abrasierte Haare?«
»Ja. Woher weißt du das? Hast du ihn gesehen? Hat er Wasser gekauft? Dasselbe, das wir trinken? Oder seid ihr euch auf der Toilette begegnet?« Nach seinem letzten Satz legte ich den Kopf schief, und Felix zuckte zusammen, als verdrängte er eine üble Erinnerung. »Streich das Letzte.«
»Hab ich längst. Nein, er hat mich nach dem Weg gefragt, aber ich habe ihm den falschen gezeigt, weil er mich angerempelt hat und unhöflich gewesen ist.« Jedes meiner Worte sprach ich langsamer als das davor aus. Felix’ Miene verzog sich nämlich mehr und mehr zu einer geschockten Grimasse.
»Angerempelt? Wie Körper an Körper?«
»So funktioniert das meistens.«
»Habt ihr euch berührt?«
»Felix.«
»Haben eure …«
»Felix«, schob ich bestimmter hinterher. »Du brauchst definitiv Owen wieder.«
»Habe ich da meinen Namen gehört?« Diese Stimme würde mich auf ewig verfolgen, nachdem Felix mich täglich mit Videos von ihm überschüttet hatte.
»Ow!« Für Felix’ Verhältnisse glich dieses Ow einem lauten Schrei.
Grinsend wandte ich mich zu Owen, der seine roten Locken unter einer grünen Cap versteckte. Nur eine lugte vorne an dem Loch für die Größeneinstellung raus. Seine blauen Augen erstrahlten beim Anblick von Felix, und auch mir schenkte er eine Sekunde gnädiger Beachtung.
Felix lief zu ihm. Kurz bevor er Owen umarmte, hielt er allerdings einen Moment inne und sah sich um. Ich verstand sofort, dass Felix Angst hatte vor den Reaktionen um uns. Owen anscheinend auch. Er schenkte Felix ein beruhigendes Lächeln. »Wir müssen uns hier nicht um den Hals fallen, wenn du nicht willst. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt.«
Felix unterbrach ihn mit einem Kopfschütteln. »Nein, ich kann das, Ow.« Seine Umarmung war zaghaft, aber entschlossen. »Nichts und niemand kann mich mehr von dir fernhalten.«
Owen drückte ihn dafür umso fester an sich. »Ich habe dich so vermisst. Und du trägst dein Parfüm!«
»Ich dich auch.« Felix verpasste Owen einen Kuss auf die Wange und atmete tief ein. »Du riechst nach dem Birnenparfüm von damals«, wisperte er.
Auch Owen streifte mit den Lippen Felix’ Wange. »Und du nach dem Gucciparfüm, das du im Laden getragen hast.«
»Na klar!«, murmelte Felix. »Das habe ich auch ganz spontan entschieden und nicht schon vor Monaten geplant.«
Die beiden so zu sehen, Felix mit dem glasigen Blick, den er in der Mulde zwischen Owens Nacken und Schulter versteckte, und Owen, der seine rot werdende Nase kräuselte, ließ mich etwas einsam zurück. Es erinnerte mich wieder daran, dass ich mit fast zweiundzwanzig keinen blassen Schimmer hatte, was ich vom Leben wollte. Vom Liebesleben.
»Du.« Zuerst nahm ich dieses Du kaum wahr, eher wie ein Gesprächsfetzen im Hintergrund, der mich nichts anging. Nach und nach fiel mir auf, dass nach diesem Du von niemandem eine Erwiderung kam und es etwas bedrohlich geklungen hatte.
»Du.« Das zweite Du folgte, und da schlussfolgerte ich, es könnte an mich gerichtet sein.
Links von mir registrierte ich den Anzugtypen, der auf mich zustürmte.
»Felix?« Gehetzt tippte ich mit meinem Zeigefinger auf seinen Rücken. »Ich will euch ja nicht stören, aber …«
Ich bekam bloß ein grimmiges Brummen zur Antwort. »Hm?«
»Es ist wichtig.« Mein Finger glich einer Nähmaschine auf höchster Stufe, so hektisch tippte ich gegen Felix’ Körper. »Ihr könnt eure französischen Indiefilmdialoge zu Hause fortführen. Ist das der Astrologietyp? Der, der mit stampfenden Schritten auf uns zueilt?«
»Was?« Felix sah endlich nach vorn. Er sog scharf die Luft ein. »Beim Universum, das ist er.«
»Wer?« Owen verfolgte Felix’ Blick, der sich mehr und mehr von Staunen in Begeisterung wandelte.
»Du!« Okay, das dritte Du. Das war so was wie der internationale Code für: Ich habe ein Problem.
»Los, los, los, ihr traurigen Wasserzeichen, wir müssen hier weg.« Ich schnappte mir Felix und Owen und rannte los.
Zigarettenqualm hing in der Luft. Wie ich diesen kalten Aschenebel hasste. Ich vertrieb die Schwüle mit meiner Hand, bis ich endlich das Fenster erreichte. Die Fensterläden knallten gegen die Hauswand, und ich atmete tief ein.
Nach der Taxifahrt, die Owen mit seiner Autofahrangst mit mehr Würde als gedacht ertragen hatte – er hatte nur Felix’ Hand wund gedrückt und bei jedem Überholmanöver gewimmert –, überkam mich die Einsamkeit. Der Flughafen lag nahe an Cork, und bei jeder Straße, die ich mich meinem Zuhause genähert hatte, hatte sich mein Magen einmal mehr überschlagen. Ich hasste es hier. Bis auf die Tatsache, dass ich den Anzugtypen dank seiner schlechten Orientierung abgehängt hatte und er mich zu Hause nicht heimsuchen konnte.
Vom Nebenzimmer drang nicht nur Zigarettenrauch, sondern auch Tastaturgeklapper in die Wohnküche. Dass der alte Laptop überhaupt noch funktionierte, glich einem Wunder. Dad besaß ihn so lange, dass die weißen Buchstaben der schwarzen Tastatur vom Tippen abgerieben waren. Glücklicherweise konnte er schreiben, ohne auf die Tasten spähen zu müssen. Vertieft in seine Unterlagen, hatte er mein Nachhausekommen nicht bemerkt. Nichts Neues. Ein, zwei Minuten verweilte ich noch am Fenster, ehe ich mir einen Kaffee machen und mit einem Croissant in mein Zimmer verschwinden wollte. Wollte. Wäre da nicht dieses Getuschel aus Dads Zimmer gekommen.
Seit meiner Kindheit praktizierte ich den Trick, den Dad nie durchschaute. Im perfekten Winkel stellte ich mich so zum Spiegel vor Dads immer offen stehendem Zimmer, dass ich ihn darin wie in einem Fernseher mit Goldrahmen betrachtete.
Das Zimmer meines Dads sah aus wie üblich. Auf dem Schreibtisch stapelten sich volle Aschenbecher – wobei er auch gerne Einmachgläser oder Teetassen dazu umfunktionierte –, Akten, Papierkram, leere Tablettenschachteln von Medikamenten gegen Schlafprobleme und Schmerzen. Selbst auf seinem winzigen Bett verteilten sich Rechnungen wie eine zweite Bettdecke. Ich fragte mich oft, was unsere Kundschaft wohl dachte, wie wir lebten. Unser hochwertig und edel eingerichteter Laden stand in völligem Kontrast zu diesem Chaos. Dad achtete auch penibel darauf, dass ich von unserer Wohnung keine Postings online stellte. Nicht, dass ich mein Privatleben online ausbreiten wollte. Aber er bekam schon rote Flecken am Hals, wenn ich Nala ein Bild vom Esstisch schickte. Es könnte ja über Umwege ins Netz geraten.
»Früher geht es nicht.« Mein Dad hockte zwischen all dem Müll und hatte sich das Festnetztelefon ans Ohr geklemmt. Ob er wieder Aufträge verschob? Er nahm mehr und mehr Bestellungen an, dabei kam er bei den Teilen, die er noch selbst schneiderte, nicht mehr hinterher. »Die Druids, die Druids, ich kann’s nicht mehr hören.«
Die Emerald Druids? Richtig, es war März, die neuen Studierenden starteten bald in ihr erstes Semester, und damit stand auch wieder die Ritualnacht gegen Ende April an. Das hatte ich beinah verdrängt. Wie ich diese reiche Bande hasste, die einen auf Elite machten. Früher hatte ich diese Rich Kids vom UCC mit ihren lächerlichen Umhängen nie richtig ernst genommen. Nachdem Felix vor über einem Jahr in eines ihrer Aufnahmerituale geraten war, hatte ich mehr und mehr den Eindruck gewonnen, dass ich sie womöglich doch unterschätzte. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass die Stimme meines Dad nervöser klang, wenn er wie jetzt wegen der Ritualnächte mit ihnen telefonierte. Aufgebrachter. Hatte sich etwas verändert? Oder nahm ich es nur anders wahr? Bisher hatte ich die geheime Verbindung reicher Studierender eher mit gezwungen-genervtem Respekt betrachtet, wenn sie – wie jetzt gerade – mal wieder auf ihre Umhänge für die halbjährlichen Feiern drängten. Wir brauchten ihr Geld und konnten den Auftrag nicht ablehnen, das wusste ich. Aber an der Art, wie Dad jetzt mit ihnen sprach, glaubte ich mit einem Mal zu erkennen, dass vielleicht doch mehr dahintersteckte als ein paar Vögel, die dachten, mit ihrem Geld Unfug machen zu können.
»E-es tut mir leid. Ich weiß. Die Sachen kommen.« Da war sie wieder. Die Furcht in Dads Stimme, die richtig fremd dadurch klang. Er war tatsächlich eingeschüchtert von der Person am anderen Ende der Leitung, und das brachte mich ehrlich gesagt ziemlich ins Grübeln. Bisher hatte ich mir vorgenommen, den Zirkus nicht mitzumachen und die Druids abzuschießen, sobald ich den Laden übernahm. Übernehmen musste. Aber so langsam bekam ich das Gefühl, dass mein Dad mehr als nur Geld in ihnen sah. Konnte ich sie dann so einfach loswerden?
»Ja, ja. Bald. Ich melde mich. Ja, ja, ich mach das. Tschüss. Ja, bye.« Dad legte mit einem lauten Knall auf. Die aggressive Geste wurde von einem Stapel Papier abgefedert.
Kratzend drehte er das Reibrad am Feuerzeug. Bis auf ein paar Funken tat sich nichts. Er seufzte und stieß, mit der Zigarette zwischen den dünnen, rissigen Lippen, genervte Laute aus. Wieder und wieder versuchte er die Zigarette zu entzünden, bis er es aufgab, sie samt Feuerzeug wegwarf und den Kopf in seine Hände stützte. Er rieb sich die Halbglatze, über die er vergeblich seine roten Haare mit dem grauen Ansatz gestrichen hatte. Nun standen sie wirr ab. Kleine ausgebleichte Würmchen. Ewig nicht mehr nachgefärbt.
Die Atmosphäre verdichtete sich, und ich atmete wie durch Gelee. Wann würde sich wieder etwas ändern? Verstohlen blinzelte ich zum Bild meiner Mutter. Oder würde sich nach ihrem Tod nie wieder etwas ändern? Wie gern wäre ich ausgezogen, um mein eigenes Leben zu starten. Mich selbst neu zu erfinden. Am UCC zu studieren. Doch das ging nicht. Der Laden warf nicht genug ab, und ich konnte meinen Dad damit nicht im Stich lassen, denn irgendwann würde das Murphy’s mir gehören. Musste mir gehören.
Mein Dad lehnte sich zurück. Der Stuhl knarzte, und sein Bauch schob sich über den Schreibtischrand. Mit hinter dem Kopf verschränkten Händen verfiel er in eine Art Paralyse. Seine graubraunen Augen, die ich als einziges äußerliches Merkmal von ihm geerbt hatte, starrten an die Wand, wo das uralte Kinderfoto von ihm hing. Manchmal fragte ich mich, was aus der Fröhlichkeit dieses Kindes geworden war. Wohin war das Lächeln vom Foto verschwunden? Gab es das nur noch auf diesem Bild? Aufgehängt, um sich daran zu erinnern? Als hätte der Grauton im Bild die Fotografie verlassen und das Leben meines Vaters eingenommen.
Ein Hustenanfall lenkte meine Aufmerksamkeit wieder zurück zu meinem Dad. Er riss die Schublade neben sich auf und durchforstete sie. Vermutlich auf der Suche nach einem …
In seiner Hand lag ein neues Feuerzeug. Hatte ich es doch geahnt. Kopfschüttelnd schlich ich zurück und hinein in mein Zimmer. Wo es nicht nach Rauch stank. Wo es aufgeräumt war. Wo ich mich geborgen fühlte.
Drinnen stellte ich den Kaffee ab und legte mich auf mein Bett. Die Decke verrutschte dabei, was meine Zeitungsartikel über das britische Königshaus zum Rascheln brachte. Die gesamte Wand neben dem Bett hatte ich damit volltapeziert. Irgendwie faszinierten mich die britischen Royals. Keine Ahnung, warum. Vielleicht konnte ich mich ein wenig mit ihnen identifizieren. Mit dem schönen Schein. Der Firma, seit Ewigkeiten im Familienbesitz, die die nächste Generation übernehmen musste. Als Ire war Royals-Fandom ein solider Grund, gemobbt zu werden. Aber wenn ich mich so seitlich drehte und über Prinz Harrys Wange streichelte, fühlte ich mich gesehen, auch wenn die natürlich noch ein weitaus mühsameres Leben hatten als ich. Der Artikel über Prinzessin Diana, bei dem sie in die Menge lachte, obwohl sie nachweislich oft unglücklich war, stimmte mich jedes Mal traurig. Natürlich betrachtete ich die ganze Royalssache und die Dinge, die Prinz Harry so abzog, sowie einige seiner Ansichten auch angemessen kritisch, aber hey, manchmal war ich eben nicht nur verkopft, sondern Quinn, der sich im Schlaf zu Prinz Harry träumte. Vor allem zu dem Harry, den ich zu Schulzeiten heimlich bewundert hatte, weil er seiner Familie und den Traditionen die Stirn bot. Weil er sich für die einsetzte, die er liebte. Schon damals waren meine Fantasien über die Royals mein Fluchtort gewesen, wenn die Kinder aus meiner Klasse sich über mich lustig gemacht oder mich ignoriert hatten. Über den langweiligen Snob, der sich als Sohn eines Ladeneigentümers ins gemachte Nest setzte. Ha! Als wäre das Murphy’s eine Goldgrube. Die meisten hatten mich aufgrund meiner Eigenheiten gemieden, oder weil ich so unnahbar und langweilig gewirkt hatte. Ich war eben der Junge aus dem alten Herrenausstatterladen, der Prinzessin-Diana-Shirts trug, auf gute Stoffe – die zum Anziehen, nicht die zum Reinziehen – stand und dessen Berufswunsch niemanden interessierte. Ich würde ja ohnehin Dads Laden übernehmen. Und unnahbar? Na gut, um fair zu bleiben: Ich hatte mich etwas isoliert. Schließlich wusste ich, dass ich nach den Pflichtschuljahren alle Kontakte verlieren würde, wenn die anderen für Ausbildung und Studium in die Welt zogen.
Aber egal wie oft ich mich fragte, wo mein Platz war, wen ich liebte, was ich wirklich war – wenn ich die Royals so vor mir sah, mit ihren Liebesdramen und Skandalen, wusste ich eines: Ich wollte jemanden in meinem Leben, der mich mochte, ohne Dramen – vor allem ohne die von Prinz Harry –, ohne Spielchen. Einen Menschen, der mich nahm, wie ich war.
Um meine Sorgen zu verdrängen, hievte ich meinen Körper auf die andere Seite, betrachtete meinen Arbeitsbereich, in dem ich Klamotten schneiderte, die so gar nicht in unseren Herrenausstatterladen passten, und zog die beste Waffe gegen böse Gedanken. Mein Handy. Zuerst überlegte ich, The Crown zu rewatchen, aber das hob ich mir für den Herbst auf.
Es dauerte, bis ich mich in die virtuelle Welt geflüchtet hatte, doch irgendwann verschwammen die Farben im Hintergrund, und es gab nur noch mich und TikTok. Reisen, Menschen, die ihre Träume lebten, die mit ihren Liebsten feierten, und Personen, die exakt wussten, welches Label der queeren Community auf ihre Stirn passte.
Und von alldem hatte ich nichts. Ein Häufchen Nichts.
Meine Lider wogen schwerer, und ich merkte, wie der Schlaf heranschlich, um mich ins Reich der Träume zu ziehen. Dort, wo sich Ich-selbst-Sein so unglaublich leichtfüßig anfühlte. Aber noch wollte ich nicht einschlafen, denn in meinen Gedanken spielte ich eine Szene durch, die kurz davor war, ziemlich hot zu werden. Also hot im Sinne von: Ich heiratete einen Prinzen, und nach der Feier landeten wir in unserem megagroßen Bett, und er trug seine Uniform. Ich war zwar weder ein Fan von Uniformen noch von Vereinen, die Uniformierung verlangten, aber das war ja meine Traumwelt, in der es ruhig oberflächlich sein durfte. Mein Handy leuchtete auf, was ich auch mit geschlossenen Augen mitbekam. Außerdem spürte ich das Vibrieren auf meiner Matratze. Genervt linste ich zum Display. Das hatte ich davon, dass ich mein Handy nicht wie üblich auf meinen Schreibtisch gelegt hatte. Es riss mich aus meinen Einschlafgeschichten. Eigentor.
Ich tastete danach. »Felix?« Meine Stimme klang rau, und ich griff nach der Wasserglasflasche, die neben meinem Bett stand. Während ich trank und das Wasser meinen Hals belebte, las ich die Nachricht.
Hier ist übrigens der Astrotyp, den du verärgert hast.
Felix hatte bestimmt bis jetzt Sex gehabt. Sein breites Grinsen und seine Stimme, die in Dauerschleife »Ich hatte grade Se-he-x« sang, konnte ich mir perfekt vorstellen.
Der Link öffnete sich.
»Takeru Hinode. Astrologiekolumne Hope in Our Universe, täglich auf Twitter und wöchentlich im Astrologieteil AstroCork des Magazins Mayfield & Glanmire«, las ich mir leise vor. »Dreihundertvierundsechzigtausend Leute folgen dem?« Unten erkannte ich noch eine Regenbogenfahne, eine Japanflagge, außerdem das Symbol für das Sternzeichen Löwe und ein Noten-Emoji. Eine Nachricht ploppte auf.
Du antwortest nicht, bist du bei den Bildern angekommen?
Felix, bitteeeee.
Nachdem ich die App gewechselt hatte, erkundete ich Takerus Bilder. Auf dem letzten hielt er ein Avocadosandwich hoch, trug eine grellblaue Anzughose und ein weites, dunkelblaues Shirt aus einem leinenähnlichen Stoff.
Na ja, ist ganz okay. Trotzdem ein Arsch.
Zerstör meine Illusionen nicht.
Was für Illusionen, schmeiß dich lieber an Owen ran. Oder stalkst du wieder Oliver und Hudson auf Insta?
Wahrscheinlich nicht, denn dann hätte er mir die Bilder bestimmt auch wieder weitergeleitet. Oliver und Hudson gehörten zu den Emerald Druids, denen Felix auf diesem Aufnahmeritual begegnet war. Oliver kannte ich nur von diesen Bildern und Erzählungen, Hudson dagegen hatte schon öfter bei uns vorbeigeschaut, sobald wir für die Umhänge länger gebraucht hatten. So oder so hatte ich genug Emerald-Druids-Leute in meinem Arbeitsleben.
Quinn! Jetzt muss ich unseren Chatverlauf löschen.
Ich habe Screenshots und erpresse dich für immer damit.
Hasse dich <3
Same <3
So witzig es in unseren Gesprächen auch klang – dass Felix letztes Jahr mit den Emerald Druids in Kontakt gekommen war, gefiel mir nicht. Zum Glück war er da heil rausgekommen, wobei er mir ruhig früher von seinem Herumgeknutsche mit Oliver hätte erzählen können, und von der Pille, die Hudson ihm verabreicht hatte. Andererseits hatte ich ihm bisher ja auch nicht verraten, dass ich mir wegen dieses Clubs zunehmend Sorgen machte. Oder dass sie meinen Dad offenbar ernsthaft ängstigten. Ohnehin fand ich es ein bisschen kompliziert, zu entscheiden, was ich meinen Leuten erzählen sollte und was besser nicht. Unsere Aufträge mit den Umhängen waren zwar kein Geheimnis in der Gang – konnten sie ja gar nicht sein. Nala wusste durch ihre Arbeit bei uns im Laden davon. Felix, Owen, Yoshiko und Cara hatten es selbst erlebt, und, na ja, der Rest der Clique war nach und nach auch eingeweiht worden. Wir konnten generell nur schwer etwas voreinander verheimlichen. Aber auch wenn das im Grunde total schön war und ich langsam in diese Gruppenzugehörigkeit hineinwuchs … war ich doch bisher die meiste Zeit meines Lebens alleine gewesen und musste mich noch mit diesem Wir-reden-über-alles-Ding anfreunden. Darum erzählte ich ihnen bisher nicht mehr als nötig. Ich wollte sie nicht grundlos beunruhigen oder langweilen. Schon gar nicht, bevor ich nicht herausgefunden hatte, wovor mein Dad sich fürchtete. Und wenn die Druids tatsächlich gefährlicher waren als gedacht? Dann durfte ich sie ohnehin nicht hineinziehen. Nein, ich musste die Lage erst mal alleine klären. Die Druids waren wie eine Familienkrankheit. Das Erbe, das auf meiner Familie lastete, nicht auf Nala und Co.
Hoffentlich würde mir dieses Erbe nicht zu großen Kummer bereiten und ich könnte das bald abhaken.
Kapitel 2
Henry
Hope in Our Universe by Takeru: Kennt ihr diese Menschen, die nicht an Astrologie glauben? Nein? Ich auch nicht, aber falls ihr einen trefft, schickt ihm diese Kolumne. Das wird zwar seine Meinung nicht ändern, aber mir bringt es Reichweite, haha. So, zum heutigen Thema: Stehen meine Planeten gut für einen Neubeginn?
Die Wut brodelte in meinem Magen. Sicherheitshalber drückte ich mir eine Kautablette mit Minzgeschmack aus der Packung, um Sodbrennen vorzubeugen. Ich könnte kotzen, wenn ich an diesen Esel am Flughafen dachte, der mir den falschen Weg gezeigt hatte. Mein Flug hatte ohnehin eine Verzögerung gehabt. Jetzt kam ich verspätet bei meiner Schwester an, die ich seit Ewigkeiten nicht gesehen hatte. Da zählte jede Sekunde.
Neben meinem Ärger war da auch dieses Ziehen im Hinterkopf, wenn ich an den Flughafentypen dachte. Er kam mir bekannt vor. Nur, woher?
Mit dem Taxi fuhr ich an bunten Häuserreihen vorbei. Seit eineinhalb Jahren war ich nicht hier gewesen. Wie lange würde ich bleiben? Vor allem: Gehörte ich noch nach Cork? Wollte ich das überhaupt? Wenn Tokio mich eines gelehrt hatte, dann, dass ich von überall aus arbeiten konnte.
Ich schüttelte die Gedanken ab und nahm die Gegend unter die Lupe. Mein Kopf brauchte ein wenig, bis er die Ruhe Corks fassen konnte. Mein Unterbewusstsein war nach über einem Jahr in der größten Stadt der Welt auf laut, bunt, höher und weiter geprägt. Mehr Menschen, mehr Häuser, mehr Autos und mehr Lärm. Und doch … wie ich das satte Grün vermisst hatte!
Nur das Grau um uns passte nicht. Für meine Ankunft hätte es ruhig besseres Wetter haben können. Wofür hatte ich mich sonst den ganzen Flug über auf Sonnenstrahlen gefreut, die auf dem Fluss funkelten? Als der River Lee auftauchte, schnippte ich sanft gegen das Fenster. »Danke für nichts, Cork«, nuschelte ich in mich hinein.
»Freundchen, in meinem Taxi schlägt niemand gegen die Scheibe.« Die griesgrämige Frau starrte mich über den Rückspiegel mit ihrem Todesblick an. »Diese Anzugleute habe ich gefressen, bevor sie einsteigen.«
»Jaja, Augen auf die Straße.« Wenn die mir auch noch so mies gelaunt kam, würde ich bald explodieren.
»Ich geb dir gleich, Augen auf die Straße. Na, so was haben wir hier ja gerne.« Sie bleckte ihre Zähne und pustete ihren Zigarettenrauch nach hinten.
»Was habt ihr, äh …« Mir stieß es sauer auf, und ich beschloss, es dabei zu belassen. Manchmal wünschte ich mir, die Ratschläge, die ich in meinen Kolumnen gab, auch selbst beherzigen zu können. »Okay, okay.«
»Ts.« Die Abneigung in ihren Augen richtete sich wieder gegen die Straße, und ich sank etwas tiefer in den Sitz. Nicht jeder Kampf muss gekämpft werden. War ja nicht das erste Mal, dass Leute dachten, ich wäre nicht aus Cork. Und da mich das Taxi am Flughafen aufgegabelt hatte, lag es womöglich ausnahmsweise nicht an meinen japanischen Wurzeln. Vermutlich hatte die Frau nach Jahren in diesem Beruf eine solide Grundskepsis gegenüber Menschen entwickelt. Wenn die jeden Tag gemeine, gereizte Leute herumkutschieren musste, konnte ich es ihr nicht verübeln, alle als potenzielle Arschlöcher zu verdächtigen. Trotzdem hatte ich wenig Lust, mich weiter schräg anmachen zu lassen.
»Können Sie mich hier absetzen? Ich laufe das letzte Stück.« Wir hielten an einer Ampel, und die Gelegenheit schien mir günstig. Es war ja wirklich nicht mehr weit.
»Das fällt dir ziemlich früh ein, Junge. Gibt’s ja nicht. Steig aus.« Mit ihrem Kopf deutete sie so hektisch nach draußen, dass ihr die Asche von der Zigarette auf den Schoß fiel. »Guck, was du gemacht hast. Diese Leute bringen mich noch ins Grab.«
»Ich glaub eher, das erledigt die Zigarette, aber danke. Bye.« Rasch stieg ich aus und lief um das Auto herum. Als ich den Kofferraum öffnete, empfingen mich wilde Beschimpfungsarien zum Abschied. Noch bevor es Grün wurde, hatte ich mich auf den Gehsteig gerettet, und sie fuhr mit quietschenden Reifen los. Schade eigentlich, dass ich schon per App bezahlt hatte.
Ich atmete tief ein. Feuchte Flussluft statt Zigarettenqualm. Was für eine gute Idee, zu Fuß um die letzten Ecken bis zum Haus meiner Schwester zu gehen. Diesen Weg fand selbst ich von hier aus wieder.
Ein paar Straßen weiter erklomm ich schließlich mit meinem Koffer die Stufen zur rosa Eingangstür und klopfte an. Drinnen erklangen sofort die lauten Schritte meiner Schwester. Niemand ging so stampfend wie sie, als liefe sie nur auf ihren Fersen.
»Henry!« Mein Name hallte durch den Postschlitz zu mir, und ein Lächeln legte sich auf meine Lippen. In Tokio hatte ich mich Takeru genannt. Mein Pseudonym für meine Sternzeichenkolumne. Wieder Henry zu sein fühlte sich beinahe ungewohnt an – zugleich war Róisíns Stimme, ganz in echt und nicht über Telefon oder Facetime, wie der erste Schluck Kaffee am Morgen, wenn das warme Dunkelbraun die Lippen berührte. Sie war Zuhause. Familie. Egal wie sie mich nannte.
Die Tür schwang auf. »Hen«, schallte es mir laut entgegen.
»Ró«, rief ich ihr nicht weniger peinlich laut zu.
Sie sprang mich an, und ihre Beine umschlangen meinen Körper. »Du bist es wirklich.«
»Wär schlimm, wenn nicht, und du machst das bei einem Fremden.« Ich bemühte mich, meine Schwester zu halten, ohne nach hinten die Stufen runterzufallen. »Bald müssen wir mit dieser Tradition brechen, ich werde alt.«
Róisín betrachtete mich mit einem bösen Funkeln und rutschte an mir hinab. »Niemals.« Das düstere Schimmern verschwand, und zurück blieb ehrliche Freude. »Komm rein! Mam ist auch da.«
Mam? Ich hatte gehofft, mit Ró alleine zu sein und mit ihr den Tag zu verbringen. Es war zwar nicht ungewöhnlich, dass sie Ró besuchte, lieber wäre mir allerdings gewesen, sie wäre in ihrem Vorort Church Bay geblieben.
»Okay, dann auf in den Kampf.« Zusammen mit meinem Koffer schleppte ich mich zur Treppe. Ein Kampf konnte es tatsächlich werden. Der Abschied zwischen Mam und mir, bevor ich nach Tokio aufgebrochen war, hätte besser verlaufen können, und wir hatten das noch nicht geklärt. Ró hatte bestimmt bemerkt, dass ich über Facetime manchmal seltsam abweisend reagierte, sobald wir über Mam sprachen, und vielleicht versuchte sie auf diese Weise, den Frieden zurückzubringen. Deshalb schluckte ich meine Enttäuschung über ihr Kommen runter. Wenigstens am Tag meiner Ankunft wollte ich nicht wieder einen Löwenaufstand machen.
Ich trat in den Hausflur. Keine Ahnung, warum meine Schwester darauf bestand, in ihrer kleinen Wohnung zu bleiben. Es waren drei winzige Zimmer im zweiten Stock eines Hauses, den ihre Vermieterin zu zwei Apartments umgebaut hatte. Was dazu führte, dass sie sich ihr Badezimmer mit einer Frau teilte, die auf der Toilette rauchte.
»Hach, schön, dich wieder hier zu haben.« Rós freudiger Unterton bestätigte mir, dass ich es heute ruhig angehen lassen sollte. »Und jetzt kriech schneller die Treppe hoch.«
Schmunzelnd hievte ich meinen Koffer auf die erste Stufe. Hochkriechen. Seitdem wir klein waren, sagten wir ›die Treppe hochkriechen‹, weil Ró länger als üblich nicht aus der Krabbelphase gekommen war. Große-Bruder-Pflicht Nummer eins: sie damit für immer aufziehen.
»Jaja, mach ich ja.« Machte ich auch. Im Schneckentempo. »Ich wäre schneller, wenn du mir den Koffer abnimmst.«
»Okay. Okay. Komm schon, Mam freut sich auch auf dich. Sie ist extra für dich gekommen.« Ró half mir mit dem Koffer, und wir krochen die knarzenden Stufen mit dem Teppichläufer darüber hoch.
Ich unterdrückte ein Seufzen. Es war nicht so, dass ich meine Mam nicht vermisst hatte. Aber dass sie mich kurz vor meiner Abreise geradezu gedrängt hatte, ein Pseudonym anzunehmen, damit niemand über meine Kolumne auf Ró stieß, nagte noch an mir. Zugegeben, das Pseudonym war ursprünglich meine Idee gewesen. Aber als Schutz für mich. Das war Mam wie immer nicht mal in den Sinn gekommen.
Vielleicht war es deshalb heilsam gewesen, dass ich Zeit in Tokio verbracht hatte. Der Abstand zu meinen Eltern hatte uns gutgetan. Es hatte mir geholfen, mich zu entfalten und meine Kolumne aufzubauen.
Oben an der Treppe bewegte sich etwas. Mam tauchte auf. »Oh, mein Henry.« Ihre sanfte Stimme legte sich wie Honig um mich. Honig, der gleich danach über Feuer erhitzt wurde und sich in meine Haut brannte. »Gebt mir den.«
Sie schnappte sich meinen Koffer, mobilisierte ihre Mutterkräfte – anders konnte ich mir beim besten Willen nicht erklären, woher diese zierliche Elfe diese Power hatte, wenn nicht aus der Magie einer Mutter, die ihren Kindern half – und hob ihn alleine die letzten beiden Stufen hoch. Laut polternd kippte er gegen den Türrahmen des schmalen Flurs in die Küche der Wohnung.
»Hey, Mam.«
Die langen Ärmchen umschlangen mich und drückten mich an sie. Die uralten selbst gebastelten Ohrringe aus Holzperlen schlugen dumpf aneinander. Sie roch nach Rosmarin und Honig. Wie immer. Alles war wie immer. Vertraut und dennoch mit ein wenig Bauchweh. »Wie du mir gefehlt hast, mein Schatz.«
Ich finde, dass du das machen musst. Für deine Schwester!
Ihr Spruch von damals, vor meiner Tokioreise, zuckte durch meinen Körper wie ein Gedankenblitz.
»Ja.« Ich schluckte den Flashback hinunter. Zu gern hätte ich mich fallen lassen, um ihre Herzlichkeit zu genießen.
Die Atmosphäre verdichtete sich. Ich spürte, wie Ró sich hinter mir verkrampfte – war so ein Geschwisterding von uns – und wie meine Mam nicht mehr atmete und sich ein wenig schwerer auf mir anfühlte.
Ich räusperte mich. »Ja, ich dich auch.«
Mam atmete wieder. Ró schlüpfte hinter mir vorbei und sauste Richtung Küche.
»Es riecht nach Pizza?« Ró, bekennende Nicht-Aushalterin-von-unangenehmen-Momenten, klatschte in die Hände und bedeutete uns, in die Küche zu kommen.
»Pizza? Seit wann gibt es bei dir Ungesundes, Mam?« Ich schlängelte mich aus ihrer Umarmung und folgte Ró.
»Das ist Pizza mit Blumenkohlboden, selbst gemachter Tomatensoße, Rucola, Basilikum aus unserem Garten, Kürbisstücken, auf die dein Vater so stolz ist, und ohne Käse.« Sie zählte das auf, als leitete sie mich an, einen Zaubertrank zu brauen. In solchen Dingen war sie sehr genau. Wie auch in ihrem Versuch, bei ihren queeren Kindern alles richtig zu machen. Alles musste sie nach Lehrbuch und zugleich in ihrer verpeilten Art durchziehen. Dass sie dabei auch auf uns indivduell eingehen müsste, bemerkte sie nicht.
»Natürlich.« Ich warf Ró einen belustigten Blick zu, und sie schenkte mir ihr übliches Schulterzucken. Ihre kurzen platinblonden Haare hüpften dabei auf und ab.
»Schon wieder eine neue Frisur?« Das hatte ich auch vermisst. Unsere Neckereien.
Mit ihrem Zeigefinger wickelte sie eine Strähne ihrer glatten Haare auf. »Die langen Blonden waren irgendwie zu bieder für mich.«
»Dabei ist in diesen Farben so viel Gift.« Mam setzte ihren scharfen Ton ein, der ungefähr wie eine friedvolle Lichtelfe klang, die böse wirken wollte.
»Jaja, ich hole mal die Teller.« Aus dem offen stehenden Hängeschrank nahm Ró einen und platzierte ihn auf den beiden, die auf der Arbeitsplatte lagen. Direkt neben Rós geliebte Nasensprays. Einiges änderte sich nie. Indessen schepperte daneben das Besteck aneinander.
»Nächstes Mal kaufe ich dir einen Behälter für dein Besteck. Oder besser gleich neues Besteck, das auch zusammenpasst.« Mam kramte sich durch das Sammelsurium aus Messern, Gabeln und Löffeln.
»Soll ich auch etwas machen?« Ich zog mein Sakko aus und knöpfte das Hemd auf. Wie ich Klamotten nach einem Flug hasste. Irgendwie waren die danach verschwitzt und kalt, aber auch zu warm. Keine Ahnung, eben so, dass ich aus ihnen rauswollte. Nicht zu vergessen der Zigarettengeruch aus dem Taxi.
»Nein, nein, Liebling, mach dich etwas frisch.« Natürlich. Sie wusste, wie ich Flugzeugklamotten verabscheute.
Die Zeit bis zum Essen nutzte ich, um mich umzuziehen und mich zu waschen. Außerdem fand ich endlich eine Minute und konnte meine E-Mails checken. Mein Postfach zu aktualisieren war, seit meine Kolumnen gehypt wurden, beinahe eine Sucht geworden.
Die Mail meiner Redaktion öffnete ich sofort.
Hi, Takeru, anbei findest du die redigierte Version deiner neuen Kolumne. Den Teil mit den negativen Aspekten habe ich gelöscht, das will keiner lesen. Victor wird sich demnächst auch noch mit News melden.
Ein Ziehen waberte durch meinen Magen, und ich presste meine Zähne zusammen. Ruhig bleiben. Nicht heute. Die Leute beim Magazin nahmen sich die letzten Wochen mehr und mehr raus. Ja, sie hatten mir eine Plattform geboten, aber meine Texte auf Social Media hatten den Erfolg gebracht. Musste ich da echt so zu Kreuze kriechen? Und News? Welche News?
Egal. Würde ich noch erfahren. Jetzt nachzudenken brachte ohnehin nichts. Ich nutzte die Zeit, um ein paar Notizen zu machen, in meine Story zu posten, wie der Flug so gewesen war, und wechselte dann in mein Dokument auf dem Handy. Da blinkte die Überschrift für mein nächstes Experiment.
Löwe und … – Wie vertragen sich die beiden Sternzeichen, liebestechnisch natürlich.
Mir fehlte nur noch ein Sonnenzeichen, das ich dafür daten und ausprobieren konnte. Über einen längeren Zeitraum allerdings, keine reinen Bettgeschichten mehr. Davon war ich weg, seit sich ein paar Leute beschwert hatten, sich in meinen Texten wiedererkannt zu haben. Also eine Art experimentelle Beziehung. Welches Zeichen wäre da überhaupt spannend? Vielleicht ein Wasserzeichen? Oder Stier wäre auch nice. Die waren ja eher geerdet, und da konnte es mit mir durchaus ein wenig krachen.
Ich switchte zum nächsten Dokument, in dem meine heutige Kolumne darauf wartete, beendet zu werden: Standen meine Sterne gut für einen Neubeginn?
Der Cursor blinkte im Dokument, und ich tippte – wohl wissend, dass sich bald wieder eine Sehnenscheidenentzündung ankündigte, wenn ich am Handy schrieb – meinen Text ein.
Löwen und ein Neubeginn ist ja so eine Sache. Haben wir kein erdendes oder ausgleichendes Zeichen in unserem Aszendenten oder als Mondzeichen, neigen wir dazu, uns ein wenig zu sehr ins Rampenlicht zu rücken. Das wird uns nachgesagt – sagt der Löwekolumnist im Rampenlicht –, aber wir können auch sehr unsicher sein, wenn …
»Hen?« Ró griff um den Türrahmen ihres kleinen Arbeitszimmers mit meiner kleinen Schlafcouch und schwang sich hinein, und ich schmiss mein Handy auf die Seite. »Magst du noch etwas Chilisoße auf die Pizza, wie früher?«
»Ähm, klar.« Innerhalb einer Sekunde war ich auf den Beinen, und einen Kick später klappte mein Koffer zu, in dem Dinge obenauf lagen, die nichts für Familienmitglieder waren.
Ró funkelte mich wissend an. Ich tat, als hätte ich es nicht gesehen.
»Wolltest du noch was?«
»Tatsächlich. Ja. Meine Freundin Nala und der Freund meines besten Freundes Owen arbeiten bei einem Herrenausstatter, du weißt schon, Murphy’s. Wir treffen sie manchmal dort, damit sie sich nicht langweilen. Kommst du nächstes Mal mit? Würde gerne mit meinem Bruder angeben, der in Tokio gewesen ist.«
Ich unterdrückte ein Seufzen und verkniff mir die Frage, wieso sie mit etwas angeben musste, zu dem ich so komplizierte Gefühle hatte? Ró konnte das nicht verstehen – vor allem natürlich, weil ich es ihr bisher nicht zu erklären versucht hatte. Japan war eine großartige Erfahrung gewesen, trotzdem hatte ich mich dort nie hundertprozentig angenommen gefühlt. Mein Kumpel Takeru und dessen Schwester Yoshiko waren bis zu diesem Zeitpunkt mein einziger Berührungspunkt mit der japanischen Kultur gewesen, weil meine leibliche Mutter zu früh gestorben war, um mir irgendwas nahezubringen. Deshalb war es für mich eine Art kleine Offenbarung gewesen, als ich Yoshi am UCC kennenlernte. Witzige Laune vom Universum eigentlich, dass sie mittlerweile zur Cork-Gang meiner Schwester gehörte. Wir hatten uns von Anfang an extrem gut verstanden, und auch mit ihrem Bruder – auch das so eine Universumslaune, sein Rufname war derselbe wie mein Zweitname! – hatte es echt perfekt gepasst. So perfekt, dass ich keine Sekunde überlegen musste, als er mich gefragt hatte, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm nach Tokio und auf die Suche nach meinen Wurzeln zu gehen. Wir hatten so viel gemeinsam, dass ich es sogar für eine gute Idee hielt, ihm vorzuschlagen, unseren gemeinsamen Namen als Pseudonym für meine Kolumne zu nehmen. Er zum Glück auch. Die Zeit mit Takeru hatte mich ein wenig näher an meine leibliche Mutter gebracht, die bis dahin ein völlig fremdes Wesen für mich gewesen war – auch weil mein Vater mir nie etwas über sie hatte erzählen wollen. In Tokio aber war ich durch die Straßen gewandelt, die ihr bekannt gewesen waren. Hatte Dinge betrachtet, die sie mit ihren Augen gesehen hatte, und das war ein bittersüßes Gefühl gewesen, als würde ein fehlendes Puzzleteil an seinen Platz gesetzt. Aber zugleich war mir dadurch auch erst richtig klar geworden, wie viele weitere Teile dem Bild trotzdem noch fehlten. Eines Tages, bald, musste ich unbedingt dorthin zurück. Um mehr zu erfahren. Mehr zu lernen. Mehr von meiner leiblichen Mutter zu fühlen. Aufzusaugen.
»Henry?« Ró wartete mit verschränkten Armen darauf, dass ich ihre Frage beantwortete.
»Ähm … klar. Kann ich machen.« Auch diesmal behielt ich meine Gedanken über Tokio für mich. Meine Wurzeln waren etwas, womit ich mich auf meine Weise auseinandersetzen musste. Zwar hatte Yoshiko mich erst mal abgelöst und begleitete ihren Bruder noch eine Zeit lang weiter durch Japan, sodass ich unseren Kontakt nicht gleich wieder aufnehmen konnte. Aber sobald die zwei zurück waren, würde ich mich wieder an sie wenden und etwas mehr in die japanische Community von Cork eintauchen.
»Perfekt!« Róisíns Augen strahlten. »Und bei meiner nächsten Schicht mit der Cateringfirma begleitest du mich auch mal, ja? Bald bin ich zum Beispiel im Royal Hotel Cork, da arbeitet auch Robin.« Sie blinzelte mich mit ihrem Dackelblick an.
Um ihren magischen Augen zu entkommen, denen ich in diesem Leben nichts würde abschlagen können, huschte ich nach draußen in den Flur und von dort in die Küche. »Arbeitest du dort noch immer?«
Ró blieb mir auf den Fersen und versuchte, meinen Blick wieder einzufangen. »Ja, ich will schließlich nicht nur auf deine oder Mams und Dads Kosten leben. Und mein Job bei dem Medizinmagazin wirft noch nicht so viel ab. Noch bin ich freie Mitarbeiterin und werde pro Artikel bezahlt. Muss sie erst überzeugen, dass meine Beiträge über OPs von trans Personen langfristig gut ankommen.«
Ein flüchtiger Blick von mir streifte meine Mam, und sie erwiderte ihn scheu, ehe sie sich darauf konzentrierte, den zerbrechlichen Blumenkohlboden der Pizza nicht zu zerstören. Ich hätte meinen Hintern darauf verwettet, dass sie Ró gern finanziell unterstützt hätte, um sie zu entlasten, aber wenn Ró das nicht wollte, mussten wir das anerkennen.
»Wie du meinst. Dann, äh … ist das Catering erst mal eine gute finanzielle Basis. Aber zurück zum Herrenausstatter. Das kommt mir sogar gelegen. Ich brauche ohnehin einen neuen Anzug, ich darf nämlich ein Liveinterview für das Magazin führen. Vergiss aber nicht, sollte mich jemand erkennen, dass du mich Takeru nennst und nicht Henry, ja?«
»Klar, dein Pseudonym ist bei mir sicher.« Hinter meiner Schwester ertappte ich meine Mam, wie sie zusammenzuckte. Ja, sie sollte das ruhig hören.
»Mit wem hast du denn das Interview?« Flink pickte Ró sich ein Blatt vom Rucola und stopfte es sich in den Mund.
»Mit einer bekannten Astrologie-TikTokerin, die ihr erstes Buch veröffentlicht. Astro-Logic-y – My Zodiac Love.« Stolz richtete ich mich auf und trug die Platte zum Tisch.
»Du meinst doch nicht meine Cara Mitsou, oder?« Da klingelte etwas in mir. Stimmt, irgendwann hatte Ró etwas von einer Cara erzählt. Das war also die Astrologie-Cara? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ró hatte damit ja nichts am Hut. Über diese Bekanntschaft würde sie mir definitiv mehr erzählen müssen. Und darüber, was für geheime Superkräfte die anderen Leute ihrer Cork-Gang so hatten.
Hätte ich mich gestern weniger lange mit der Interviewvorbereitung beschäftigt oder mit Ró, die alles über meine Zeit in Japan wissen wollte, hätte ich mich heute vielleicht nicht wie ein nasser Sack gefühlt. Selbst schuld. Im Gehen massierte ich meine Schulter und erreichte das Ende des Campus-Areals des University College of Cork. Von dem vorderen Eingang aus lag das uralte Gebäude des UCC am Ende des Weges, und wieder einmal begeisterte mich das majestätische Steingebäude, das früher ein Kloster gewesen war. Wobei ich auch den Charme der University of Tokyo, der Tōkyō Daigaku, mochte, in der ich Creative-Writing-Seminare besucht hatte. Es hatte sich auch dort geschichtsträchtig und gleichzeitig voller Leben angefühlt. Ich hatte es geliebt, morgens durch das alte Tor zu laufen, das noch diese japanische Tempelarchitektur mit den leicht nach oben gebogenen Dächern aufwies. Nur um dahinter im Campus auf die verschiedensten Gebäude, manche modern, manche älter mit Torbögen und Säulen, zu treffen. Vor allem das Yasuda-Auditorium hatte es mir angetan. Das Gebäude lief mittig hin spitz zu wie ein Dreieck und wirkte mit seinen kleinen, roten Steinen als Fassade völlig einzigartig. Nur in einem gewann das UCC: Hier fühlte ich mich zu Hause.
Der Wind strich über meinen Kopf. Ich musste mich noch daran gewöhnen, ihn so deutlich zu spüren, seit ich mir die Haare, dank des Buzz-Cut-Trends, kurz abrasiert hatte. Von mir aus trieb der Luftzug weiter durch die Jungfernreben, die über die Steinmauer und den Bleiglasfenstern des UCC wuchsen. Ich liebte den Perpendicular-Stil, der auch senkrechter Baustil der Spätgotik oder Tudor-Gotik beziehungsweise viktorianische Gotik genannt wurde. Woher ich das alles wusste? Dank einer Sondervorlesung, die ich mir nur wegen einer Frau angehört hatte, um dann herauszufinden, dass sie vergeben war.
Ich setzte meinen Weg über den sattgrünen Rasen des Innenhofs fort und bestaunte dabei weiter das Gebäude, das wie ein Viereck mit einer offenen Seite um den Hof gebaut worden war. Die irische Luft, die meinen Körper bei jedem Atemzug reinigte und von der Müdigkeit befreite, hatte ich in Tokio wohl am meisten vermisst.
»Ich bin wieder da.« Der Wind trug mein Wispern zu den Gemäuern, die einige Geschichten erzählen konnten.
Danach bog ich nach rechts ab in einen Korridor. Dort befanden sich die uralten Ogham-Grabsteine, die an Metallhalterungen befestigt und mit altirischen Codes beschriftet waren. Langweilig, aber wenigstens auch für Menschen mit unterirdischem Orientierungssinn unverfehlbar. Ich wollte gerade an die Tür des Büros für Besuchende des UCC klopfen, da eilte jemand unter dem Notausgangschild hindurch und rempelte mich an der Schulter an. Liefen mich in Cork nun alle über den Haufen?
»Sorry.« Er hob beschwichtigend die Hände, die glatten blonden Haare fielen ihm in die Stirn, und seine Umhängetasche verrutschte. »Henry?«, stutzte er.
Ich zuckte ein wenig zusammen, als er meinen Namen aussprach. »Hudson?« Das mit meinem Namen musste ich so bald wie möglich korrigieren, bevor es die Runde machte. »Wo wir uns gerade sehen … Nenn mich von jetzt an bitte bei meinem Zweitnamen, Takeru, ja? Habe seit Kurzem eine Astrologiekolumne, die gut ankommt und, ja … Privatsphäre und so.« Es war witzig, bei Hudson etwas über Privatsphäre zu labern, wenn ich daran dachte, wie oft wir früher gefeiert hatten. Damals, als ich noch recht ziellos gewesen war.
»Klar, kein Ding. Junge, tut mir voll leid, bin in Eile. Hab gedacht, du bist tot.« Sein überraschter Blick checkte mich von oben bis unten, während er sich die Haare richtete.
»Nee, ich habe nur eine Auszeit in Tokio genommen und dort kreatives Schreiben weiterstudiert. Und meine Kolumne online bekannter gemacht.« Ich ließ meine Hände langsam in die Taschen meiner hellrosa Stoffhose gleiten.
»Ah, verstehe. Und die läuft gut, ja? Wir sollten uns mal treffen. Quatschen und so.«
»Gerne. Wäre schön, ein wenig an alte Kontakte anzuknüpfen.« Bilder ploppten in meinem Kopf auf. Hudson und ich in einem Club, wir tranken mit zwei Strohhalmen aus einem Eimer Sangria. Cut. Wir hingen über der Kloschüssel und gaben der Welt die Sangria wieder zurück.
»Stimmt. Stimmt.« Hudson wirkte plötzlich weit weg. Er musterte mich, als stünde ich zum Verkauf. Gleich danach schüttelte er den Kopf. »Hey, lass uns das echt machen, ja? Erzähl mir dann mehr von deinem Erfolg. Siehst gut aus.«
Mit diesen Worten lief Hudson weiter. Der Typ war die personifizierte Eile auf zwei Beinen.
Ich besann mich auf mein eigentliches Vorhaben und klopfte endlich an die Bürotür. Eine Frau mit grauem Haar streckte ihren Kopf heraus. »Ja?«
»Poppy?«
»Henry!« Poppys spitz zulaufende Brille rutschte auf die Nasenspitze, bis die Goldkette sie auffing. »Du bist wieder da.« Sie öffnete die Tür nun vollständig. Ihr braunes Kleid, mit dem sie wie aus der Zeit gefallen, aber dennoch passend zum alten UCC-Gebäude wirkte, roch nach dem Rauch von Tausenden Zigaretten.
»Lange nicht gesehen.«
Poppy musterte mich. »Du siehst so erwachsen aus.«
»Tokio hat mir gutgetan.« Auf vielerlei Arten. Es hatte mich näher zu meinen Wurzeln gebracht, aber auch meinem Selbstbewusstsein hatte es nicht geschadet, sich in dieser gigantischen Stadt zu behaupten. Na ja, und dass ich ein wenig berühmt geworden war, trug auch seinen Teil dazu bei.
»Fabulös. Was führt dich hierher?« Poppy neigte den Kopf und warf mir einen skeptischen Blick zu.
»Zuallererst, warum bist du in diesem Büro?« Denn eigentlich hatte ich Poppy nämlich darüber kennengelernt, dass sie mir im Studierendensekretariat bei den Formalitäten für meinen Auslandsaufenthalt geholfen hatte. Außerdem hatte sie sich bei mir ein paar astrologische Ratschläge geholt. Seitdem durfte ich sie statt Ms Gibney Poppy nennen.
»Ich wollte mal eine Abwechslung, bevor ich in Rente gehe.« Sie zuckte mit ihren Schultern.
»Ähm. Okay. Ich wollte ohnehin danach noch zu dir kommen.«
»Was machst du dann hier? Mir unter die Nase reiben, wie bekannt du geworden bist? Ja, ich habe das auch mitbekommen.«
»Fragen, ob es ein paar Broschüren für Schreibseminare gibt. Für meine Schwester.« Eigentlich hatte mich Ró darum nicht gebeten, aber ich dachte mir, es könnte ihr bei ihrem Job im Magazin helfen. »Aber … Wenn du schon mal da bist. Kannst du auch hier am PC nachsehen, ob mein Prüfungspass freigeschaltet ist, ich finde meine Zugangsdaten nicht mehr?« Eigentlich war Poppy dafür nun nicht mehr zuständig, aber wir kannten uns, und sie machte das gerne für mich. Redete ich mir ein. Hätte ich auch eine Mail schreiben können? Ja. Aber so nahm ich wieder ein paar Kontakte auf, und es war persönlicher, war doch nett, oder?
»Aber sicher doch. Eine Minute.« Poppy schloss die Tür hinter sich, und ich warf einen Blick aus dem Fenster zum Innenhof. Dort erblickte ich jemanden.
»Hudson schon wieder«, murmelte ich in mich hinein.
Wie dieser Typ sich umsah … Als hätte er Angst, beobachtet zu werden. Oder suchte er jemanden? Na ja. Ging mich nichts an. Ich hatte genug zu tun.
Seit dem Erfolg meiner Kolumne redete ich mir gerne ein, keine Hilfe beim Schreiben mehr zu brauchen. Aber mein Seminar zum Thema »Populärwissenschaftliches Schreiben« bei meiner alten Lieblingsprofessorin Prof. Gbadamosi zeigte mir zuverlässig, dass ich noch dazulernen konnte – und dass es sinnvoll war, die fehlenden Punkte für meinen Abschluss nachzuholen. Die Tōkyō Daigaku bot fabelhafte Kurse zum kreativen Schreiben an. Doch waren sie eben auf Japanisch und oftmals nicht für meine Kolumnen anwendbar. Zumindest nicht, bevor ich meine Kolumne nicht auch auf Japanisch veröffentlichte und durchstartete.
»Deshalb vergessen Sie alle nicht, dass auch für kürzere, knappere Magazintexte gilt: Show, don’t tell.« Prof. Gbadamosi war eine echte Meisterin des Schreibens. Ihre Veröffentlichungen zum Thema wissenschaftliches Schreiben waren weltweit anerkannt, und manchmal fragten sogar Werbeagenturen sie um Rat. Bevor ich nach Tokio gegangen war, hatte ich so viele ihrer Kurse belegt wie möglich, obwohl ich sie für meinen Prüfungspass gar nicht mehr gebraucht hatte. Dafür bereicherten sie mein Schreiben. Ich sog ihre Lektionen auf wie ein Schwamm, und irgendwann hatte das auch sie bemerkt. Okay, ich war nicht der unauffälligste Student und diskutierte ständig überall mit. Aber das hatte sie an mir geschätzt, sodass wir nach den Seminaren oft miteinander übers Schreiben gesprochen hatten.
»Schreiben Sie alle doch bis zum nächsten Mal eine zweiseitige Arbeit über das Thema ›Show, dont’t tell‹ bei … Tourismusartikeln.« Während sie sprach, packte Gbadamosi ihre Sachen und drückte die überfüllte Tasche mit ihrem Gewicht zu, bis es klick machte.
Ich packte ebenfalls ein und erhob mich. Hinter mir schlugen einige Klappstühle zurück gegen die Lehnen.
»Oh, Mister Kirwan, können Sie noch einen Moment warten?« Gbadamosi hob ihre Hand, als könnte sie mich wie mit einem stillen Zauber festhalten.
»Klar.« Ich wandte mich der Tür zu und erkannte eine rothaarige Frau, die sich durch den Gegenverkehr aus Studierenden in den Saal quetschte.
»Lasst mich durch. Hey. Aua!«, beschwerte sie sich lautstark und drängelte weiter gegen den Strom. Begleitet von unwilligen Protesten, bis sie das Saalinnere erreicht hatte. »Hier bin ich, Kemi.«
Kemi? Sie nannte Gbadamosi beim Vornamen?
»Sehr gut, Scarlett. Darf ich dir Mister Henry Kirwan vorstellen?« Ich sollte dem Lehrpersonal offenbar dringend auch erzählen, dass ich Takeru genannt werden wollte. Ob das an der Uni durchsetzbar war? Ich hatte ehrlich gesagt aber auch nicht damit gerechnet, dass irgendjemand aus dem Lehrkörper Grund haben würde, meinen Vornamen zu nennen. Falsch gedacht, offensichtlich.
»Mister Kirwan, das ist Scarlett. Sie bräuchte etwas Nachhilfe im wissenschaftlichen Schreiben für ihre Abschlussarbeit.« Die kannten sich aber gut, wenn sie sich mit Vornamen ansprachen. Ein wenig überrumpelte sie mich mit ihrem Anliegen, aber noch bevor ich antworten konnte, grätschte Scarlett dazwischen: »Hey, nenn mich einfach Scar. Wäre echt dankbar für Hilfe.«
Kurze Zeit später hatten wir direkt vor dem Saal einen freien Tisch gefunden. Im kahlen Flur liefen immer wieder ein paar Studierende umher, und durch ein offenes Fenster am Ende des Gangs vertrieb ein Lüftchen die Schwüle.