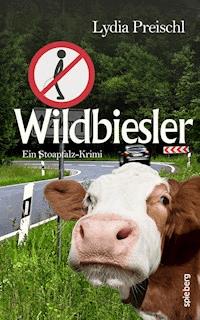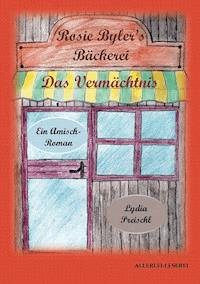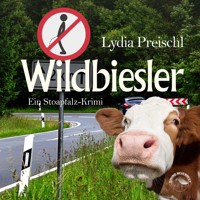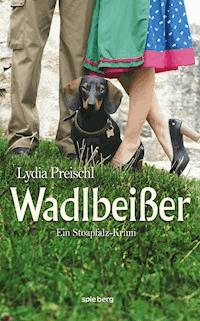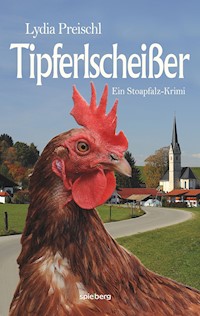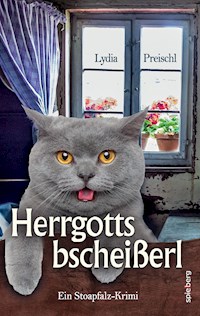Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Krieg hat es nicht wirklich geschafft bis auf den abseits gelegenen Bauernhof der Krämers. Da findet die junge Anne in den letzten Monaten des Krieges einen schwerverletzten Kriegsgefangenen, der aus einem Lager geflohen ist. Trotz aller Gefahren nimmt ihn die Familie auf und pflegt ihn gesund. Nach Kriegsende zieht die gute Tat Anfeindungen, aber auch Vorteile nach sich. David, so heißt der junge Amerikaner, dankt ihnen sein Überleben nicht nur einmal. Er verhilft Anne zu ihrem Glück. Doch bleibt er selbst dabei auf der Strecke? Eine Geschichte voller Emotionen - Angst, Freude, Leid. Das Buch entführt in die dunkelste Zeit deutscher Geschichte – und ist doch so positiv und voller Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Charaktere und Geschehnisse im Roman sind frei erfunden.
Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Kapitel 1
November 1944
Das Schwein grunzte und zeterte herzzerreißend. Das war gefährlich, weil zu laut! Hastig mordete der alte Huber das verzweifelte Tier und endlich herrschte Ruhe, wichtige Ruhe! Schnelles Handeln war vonnöten! Hans, der kräftige Siebzehnjährige packte fachmännisch mit an, zerteilte das tote Tier nach Anweisung des alten Metzgers und zog die groben Fleischteile an Stricken über die Querbalken der Scheune zum Abhängen. Inzwischen wurden die Tröge mit dem noch warmen Saublut beiseite gestellt und zum Blutwursten vorbereitet. Dies war die verhasste Aufgabe Annes. Sie war ein Jahr älter als ihr Bruder Hans und ebenso wie dieser an die harte Arbeit gewöhnt. Nun versenkte sie mit Abscheu ihre Arme bis zu den Ellenbogen in der warmen Brühe, um die Speck-und Fleischteilchen gleichmäßig zu verteilen und eine Gerinnung zu verhindern. Die junge Frau hatte die Ärmel bis über die Oberarme zurückgeschlagen, war aber ansonsten mit mehreren Kleidungsstücken übereinander vor der beißenden Kälte geschützt. Im nächtlichen Frost stieg Dampf vom Trog auf. Immerhin übernahm es die Mutter, die Därme zu reinigen, eine Arbeit, die noch unangenehmer war als das Rühren in der Blutsuppe. Schwarzschlachten war gefährlich, doch überall praktiziert. Der alte Huber kam, wann immer es ihm passte oder er den stattlichen Anteil des Fleisches brauchen konnte, der sein Schweigen und seine Arbeit kostete. Zweimal im Jahr, bei starkem Schneefall oder Starkregen, ging die schaurige Arbeit über die Bühne. Immerhin halfen die auf diese Weise gewonnen Vorräte über die harten Zeiten und die Bauern konnten selbst in den schlimmsten Kriegsjahren gut damit leben. Zudem verirrte sich der Krieg nicht in diese Gegend, zumindest, was die Kämpfe betraf. Dennoch gab es nicht eine Familie, die nicht in irgendeiner Weise vom Geschehen betroffen war.
Auf dem kleinen Bauernhof lebte seit einigen Monaten Annes Tante Ursel, die Schwester ihrer Mutter Helene, zusammen mit ihrer kleinen Tochter Monika. Im Frühsommer 1944 waren sie in München ausgebombt worden und hatten keine andere Zuflucht als diese Einöde hier. Doch sowohl Helene war mit der zusätzlichen Arbeitskraft geholfen als auch Ursel mit der sicheren Unterkunft.
Der Schneesturm legte sich, so dass es Zeit wurde, fertig zu werden. Der Huber tat nicht mehr als er musste, nahm seinen Anteil und marschierte nach Hause, während die Mutter mit den Kindern die harte Arbeit zügig weiter verrichtete.
Anne hatte ihre leidige Aufgabe endlich beendet, als sie ein gedämpfter Aufschrei zusammenfahren ließ. Hastig säuberte sie ihre Arme und eilte nach draußen.
„Was ist denn passiert?“, fragte sie halblaut in die Dunkelheit.
„Mama ist gestürzt. Sie kann nicht mehr auftreten. Ich werde sie in die Küche schaffen. Mach du mal weiter!“, klang Hans’ Antwort raunend zurück.
Anne seufzte. Nun mussten die Pflichten der Mutter auch noch verteilt werden! In dieser Nacht würde an Schlaf nicht zu denken sein!
Wenige Augenblicke später lugte Hans zu ihr in das Waschhaus, wo sie immer noch beschäftigt war. Der matte Schein der Petroleumlampe warf flackernde Schatten an die grob verputzten Wände. Sie waren es gewohnt, mit wenig Licht präzise zu arbeiten.
„Scheint nichts gebrochen zu sein“, informierte er sie. „Sie werkelt drinnen weiter und hilft Tante Ursel. Wir müssen uns beeilen. Sieht so aus, als würde der Mond auch noch herauskommen. Warum nur kann es einmal im Jahr nicht weiter schneien, wenn man’s schon mal brauchen kann?“
„Es schneit nur, wenn man’s nicht gebrauchen kann!“, gab Anne weise zur Antwort. Trotz der widrigen Umstände gelang es, bis zum Morgen alle Spuren der illegalen Tätigkeit zu beseitigen. Irgendwann – es mochte etwa vier oder fünf Uhr gewesen sein – hatten sie es endlich geschafft. Sie wankten todmüde in ihre Zimmer. Anne zog sich bis auf die Unterwäsche aus, verzichtete auf Nachtkleidung und fiel todmüde auf ihren Strohsack. Sie zog die daunengefüllte Zudecke bis über beide Ohren und bewegte sich nicht mehr, um warm zu werden. Nach wenigen Augenblicken war sie schon eingeschlafen. Ihre Kammer lag im Dachgeschoss des kleinen Bauernhauses. Bittere Kälte kroch im Winter durch die Fenster und ließ die Wände bis zum Giebel hinauf gefrieren, im Sommer herrschte eine Bruthitze unter dem Dach, die an Schlaf in den kurzen Nächten kaum denken ließ.
Es war hart, doch Helene weckte Anne bereits am späten Vormittag.
Schlaftrunken rappelte sie sich auf, angefeuert von der ungeduldigen Mutter. Die hatte in einem Krug dampfend heißes Wasser mit heraufgebracht. Es kostete Anne große Überwindung, aus dem warmen Bett zu steigen und sich in der Kälte an der Waschschüssel zu waschen. Entsprechend schnell war sie fertig. Sie zog sich rasch ihre wollende Unterwäsche und noch eine Lage Unterkleider – eine aus dicker Schafwolle hergestellte Strumpfhose und ein ebenso dick gewebter Unterrock – an und knöpfte das bis weit über die Knie reichende Kleid darüber. Eine selbstgestrickte Wolljacke komplettierte die wärmende Winterausstattung. Ihre zierliche Gestalt konnte man unter all den derben Kleidern bestenfalls erahnen. Derart wohlig verpackt ließ sie sich Zeit beim Zähneputzen und dem Flechten ihrer langen blonden Haare. Ihre Trödelei wurde ihr schließlich selbst bewusst und sie beeilte sich nun doch, in die warme Wohnküche zu kommen, wo Ursel am Küchentisch döste, eine Tasse mit heißem Tee in beiden Händen haltend. Monika erging sich darin, Kringel auf ein vergilbtes Blatt Papier zu malen. Hans war nicht zu sehen.
Anne erinnerte sich, dass er gar nicht erst zu Bett gegangen war, sondern sich gleich auf den beschwerlichen Weg hinüber ins Kirchdorf gemacht hatte. Er hatte dem Lehrer, der zugleich die Orgel spielte, versprochen, die Bälge bei der Morgenmesse zu treten. Die Messe begann um sechs Uhr. Anschließend wollte er bei einem Bauern irgendeine Arbeit verrichten, um dann am frühen Nachmittag wieder zurück zu kommen.
Schweigend stellte die Mutter ihr eine Tasse Kaffee hin. Anne schlürfte das munter machende Getränk und spürte, wie die Wärme und das Koffein ihre Lebensgeister anheizten. Kaffee wurde nur bei ganz besonderen Anlässen zubereitet. Manchmal nach dem Schlachten, was Schwerstarbeit für die Frauen darstellte, oder an den hohen Festtagen wie Ostern und Weihnachten.
Ihre Mutter goss sich ihrerseits Tee in einen blechernen Becher und setzte sich zu der Tochter an den Tisch. Wie Anne jetzt erst wahrnahm, humpelte sie stark, hatte auch kein festes Schuhwerk an, nur die übergroßen Pantoffel des Vaters, die die meiste Zeit unbeachtet in der Ecke standen. Ihr Knöchel war deutlich angeschwollen, was man selbst durch den festen Arnikaverband noch erahnen konnte, doch die resolute Frau ließ sich in ihrer täglichen Arbeit nicht beirren.
„Anne, du musst mir einen Gefallen tun!“, begann sie ohne Umschweife. „Deshalb habe ich dich auch schon geweckt.“
Anne schwieg, sie war noch zu müde um zu reden und erwartete die Erklärung ihrer Mutter. Hie und da nippte sie am heißen Kaffee.
„Du kennst doch das Kloster in der Stadt?“ Als Anne nickte, fuhr sie fort. „Du musst dorthin gehen und etwas abliefern.“
„Aber bei dem Wetter?“, wunderte sich Anne mit einem zweifelnden Blick aus dem Fenster. Es stürmte erneut und sogar noch heftiger als in der Nacht.
„Sie brauchen die Sachen. Die Nonnen verlassen sich darauf. Sie versorgen die Flüchtlinge aus dem Osten mit allerlei Dingen und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Du weißt doch, dass ich einmal im Monat etwas hinbringe – und heute ist wieder der Tag.“
Ja, nun erinnerte sich Anne, dass sich ihre Mutter einmal im Monat – bei Wind und Wetter – auf den beschwerlichen Weg machte. Sie wusste auch, dass ihr Bruder ganz und gar nicht erfreut darüber war, er jedoch aus Gehorsam der Mutter gegenüber schwieg. Diese wiederum versuchte, einen Großteil dessen, was sie tatsächlich beförderte, vor ihm zu verbergen.
Helene erzählte weiter. „Ich will nicht, dass Hans allzu viel davon mitkriegt. Er könnte dich ausfragen, wenn du zurück kommst und ich will nicht, dass du ihm viele Lügen auftischen musst. Jedenfalls nicht mehr als nötig.“
Anne verstand nicht und schüttelte den Kopf. „Was meinst du?“
„Hör zu. Wenn ich selber gehen könnte, würde ich es tun, das weißt du. Und Ursel kann nicht gehen, weil sie den Weg nicht kennt. Sie war noch nie da. Und ich möchte dir nicht verschweigen, dass es gefährlich werden kann.“
Anne wiederholte sich: „Was meinst du damit?“ Sie schrieb es ihrer Übermüdung zu, dass sie der Mutter nicht folgen konnte.
„Du nimmst das Rad und den Rucksack. Im Rucksack ist das Fleisch verpackt und ein paar Kleidungsstücke. Das Übrige klemmst du auf den Gepäckträger und die Eier nimmst du vorne in den Radkorb. Ich habe dir schon alles zusammengepackt. Du gehst über den Weg am Mühlbach. Das ist zwar fast doppelt so weit, aber sicherer. Da hast du normalerweise keine Kontrollen zu erwarten.“
„Und was ist, wenn doch?“
„Musst du eigentlich auch nichts befürchten. Sie werden dir die Sachen wegnehmen und für sich selbst verwenden. Es ist mir selbst nie passiert, aber eine Bekannte hat mir davon erzählt.“ Ihre Mutter hielt kurz inne, sah ihre Tochter mit besorgtem Blick an und sprach schließlich weiter. „Ich würde es dir nicht aufbürden, wenn es sich vermeiden ließe.“ Helene wusste sehr wohl, dass es gefährlich war, all die Sachen zu den Nonnen zu transportieren. Es war ganz und gar nicht damit getan, dass jemand sich selbst daran bereichern konnte, vielmehr bestand die Gefahr darin, dass nun bekannt wäre, dass sie verbotenerweise geschlachtet hatten. Das konnte in diesen Zeiten üble Folgen haben!
„Gut, ich mache das schon.“ Irgendwie freute sich Anne auf den Besuch in der Stadt, wo sie seit Monaten nicht mehr gewesen war. Das wenige, was dort besorgt werden musste, holte ihre Mutter alleine. Meistens bei ihren Ausflügen zum Kloster. „Aber was soll ich sagen, wenn sie mich doch erwischen und ausfragen?“
„Du sagst, dass ich krank wäre und du die Hilfe der Nonnen brauchst. Die Sachen wären als Bezahlung gedacht. Diese Ausrede ist mit den Schwestern so vereinbart.“ Helene ahnte in diesem Augenblick, dass es besser gewesen wäre, hätte sie ihre Tochter nicht immer von all dem Unbill der Zeit fern gehalten. Es war nicht Annes Schuld, in ihrem Alter noch so unwissend und unbedarft zu sein.
Wenig später beluden sie das Fahrrad mit den Waren. Anne würde schieben müssen, zumal eine Fahrt auf dem matschigen Untergrund zu unsicher gewesen wäre. Vielleicht ergab es sich auf dem Heimweg.
Schon wollte sie sich auf den Weg machen, doch sie hielt noch einmal inne und wandte sich zu ihrer Mutter um: „Du sagtest eben, ich sollte Hans nicht belügen müssen. Was meinst du damit?“
Ihre Mutter seufzte, überlegte, ob sie antworten sollte, doch sie entschied sich, ihrer Tochter endlich reinen Wein einzuschenken. Sie trug heute das Risiko, also sollte sie auch vorbereitet sein.
„Du wirst vielleicht Dinge sehen, die dir nicht gefallen. Halte dich fern, so gut es geht und verhalte dich unauffällig. Kümmere dich nicht darum. – Und noch etwas: Folge dem Mühlbach bis hinter das Kloster und wende dich dann erst um, so dass du über die Klosterkirche Zugang zum Gebäude findest.“
Ihre Mutter sprach in Rätseln, doch Anne fügte sich. Sie genoss das Vertrauen, dass Helene in sie legte und versprach, all das zu tun, was ihr aufgetragen war.
Im dichten Schneetreiben machte sie sich auf den Weg. Sie trug ihren alten, abgewetzten Mantel und die Fellstiefel ihrer Mutter. Ihren schwarzen Schal hatte sie um Mund und Nase geschlungen, um so wenigstens einen Schutz vor den wild tanzenden Flocken zu haben. Das große, schwarze Kopftuch hatte sie weit ins Gesicht gezogen. Mühsam schob sie das vollbeladene Fahrrad den unwegsamen Pfad entlang, der dem wild plätschernden Mühlbach folgte. Jetzt, da Schnee lag, war der Weg nur zu erahnen, doch das lebhafte Gewässer wies ihr die Richtung in der vom Wind blankpolierten und mit lockerem Neuschnee bedeckten weißen Wüste. Das Wetter war am Tage so wechselhaft wie in der vergangenen Nacht. Gerade eben schneite es noch, nun rissen die Wolken auf und Anne musste ihre Augen bedecken, so sehr blendete sie der weiße, jungfräuliche Neuschnee. Dumm nur, dass der Boden noch nicht ganz durchgefroren und das Geläuf daher weich und matschig war.
Die Stadt lag in einer Senke und es war erstaunlich, wie wenig Schnee dort lag. Ja, sie konnte sogar ein gehöriges Stück des Weges auf dem Fahrrad fahrend zurücklegen, immer darauf bedacht, der wertvollen Ware, die sie beförderte, keinen Schaden zuzufügen.
In dem Maße, in dem sich das Wetter beruhigte, stieg ihre Anspannung. Ruhiges Winterwetter lockte vielleicht auch Kontrollen auf die Straße! Sich nervös umblickend, immer schneller werdend, hielt sie auf die Klostermauern zu. Plötzlich tauchten die braunen Uniformen der Soldaten auf! Unvermittelt, gerade als sie um eine Ecke biegen wollte! Anne erschrak derart, dass ihr trotz der eiskalten Witterung die Hitze ins Gesicht stieg. Mit äußerster Anstrengung blieb sie ruhig und sondierte erst einmal die Lage. Bald stellte sie fest, dass es sich um keine Kontrollen handeln konnte, sondern um Soldaten, die irgendetwas bewachten. Der schmale Pfad, auf dem sie sich befand, wurde zur einen Seite gesäumt vom Bach, an der anderen Seite von einer hohen Steinmauer. Erst jetzt bemerkte sie den Stacheldraht auf dessen Zinne, viele Meter über ihr. Dunkel konnte sie sich daran erinnern, dass diese Umzäunung Bestandteil der Klostermauer war, die ein riesiges Anwesen umgab. Vorsichtig lugte sie um die Ecke. Die beiden Soldaten standen vor einem kleineren Tor, das in die mächtige Mauer eingelassen war, und unterhielten sich. Einer der beiden wurde auf sie aufmerksam. Er hob den Kopf und rief zu ihr herüber: "He, Mädchen! Was treibst du hier? Mach dich vom Acker!" Sie erschrak heftig! Ihr Herz klopfte bis zum Hals! Hastig schob sie weiter, ohne nach links und rechts zu sehen. Nur aus den Augenwinkeln beobachtete sie die Vorgänge links von ihr. In ihr Gedächtnis drängten sich die Bilder ihrer Kindheit, wo an der Stelle des Tores eine dichte Dornenhecke gewachsen war und daneben eine Allee von Wildrosenstauden. Diese waren verschwunden. Stattdessen nahm sie einen Zaun wahr – eigentlich einen inneren und einen äußeren Zaun, die beide über und über mit Stacheldraht versehen waren. Sie hatte sich inzwischen schon wieder ein gutes Stück von den Soldaten entfernt, als trotz ihrer Panik ihre Neugier siegte und sie sich einmal rasch umwandte. Mit einem Blick erkannte sie, dass es sich um ein Lager handelte, dem Anschein nach einem Kriegsgefangenenlager. So unbedarft war sie nun wieder nicht, um nicht zu wissen, dass es solche Lager gab und die Zustände darin nicht zum Besten waren. Schmutzige, gebeugte Gestalten standen in Gruppen zusammen, es sah aus, als wollten sie sich gegenseitig vor der beißenden Kälte schützen. Manche von ihnen hatten Decken über die Schultern gelegt. Im hinteren Teil des ehemaligen Klostergartens standen einige zeltähnliche Gebilde, denen jedoch zum Teil die Wände fehlten. Schutz konnten diese aus Planen und Holzteilen zusammengebundenen Teile weder vor der Kälte noch vor der Nässe bieten. In dem kurzen Augenblick, in dem sie die Szenerie beobachtete, fragte sie sich, wie diese Männer wohl den strengen Winter überleben konnten. Die beiden Wachsoldaten traten einen Schritt in ihre Richtung. Zu weit war sie schon, um noch verstehen zu können, was der eine ihr nachrief, aber augenblicklich stieg derartige Panik in ihr auf, dass sie ihr schweres Fahrrad im Laufschritt voran bewegte und sich hinter die endlich in Sicht kommenden Mauern der trutzigen Klosterkirche flüchtete. Sie atmete erst einmal tief durch und spähte noch einmal um die Ecke, um sicher zu gehen, dass ihr niemand gefolgt war, dann betrat sie das Kloster durch die Sakristei der Kirche. Überrascht stellte sie fest, dass die Tür unverschlossen war. Ihr Fahrrad nahm sie mit hinein. Unschlüssig öffnete sie die hölzerne Verbindungstüre hin zum Kreuzgang des Klosters. An der Pforte schließlich verlangte sie nach Schwester Benedikta, die sofort über den breiten Gang auf sie zugeeilt kam.
Anne musste sich vorstellen, da die alte Nonne sie zuerst nicht erkannte. Dann hellte sich das Gesicht der kleinen rundlichen Frau auf. „Ich wusste, dass deine Mutter uns nicht im Stich lässt, auch wenn ich sie schon vermisst habe. Sag ihr bitte meine besten Genesungswünsche. Erinnere mich daran, dass ich dir ein paar Kräuter mitgebe.“
Als sie der Kirche zustrebten, um das Fahrrad zu entladen, sprach Anne das aus, was sie bewegte.
„Schwester Benedikta! Was geht da draußen vor?“
Die Nonne blieb stehen und wandte sich ihr mit ernster Miene zu. „Hat dir deine Mutter nichts davon erzählt?“
Nein! Ihre Mutter hatte nichts von alledem erzählt und sie selbst war im Schonraum ihres Einödhofes auch nicht auf so etwas vorbereitet worden.
Als Anne den Kopf schüttelte, erklärte Schwester Benedikta endlich: „Seit letztem März gibt es das Kriegsgefangenenlager hier. Es sind Soldaten aus allen Ländern, gegen die wir Krieg führen. Das Problem ist die Unterbringung und die Kälte. Was den Sommer über noch so leidlich funktionierte, ist jetzt eine Katastrophe. Doch der Kommandant wollte nichts davon hören, als wir ihn baten, festere Unterkünfte bauen zu lassen. Und wir dürfen uns nicht mit ihm anlegen, denn noch erlaubt er, dass wir uns um die Kranken kümmern. Auf diese Weise können wir allerlei Sachen einschmuggeln, auch Nahrungsmittel und Kleidung oder warme Decken.“
„Aber es sind doch Feinde?“ Annes Weltbild war geprägt von der allgegenwärtigen Propaganda jener Zeit. Schwester Benediktas Miene verriet leisen Ärger, obwohl sie schon verstand, dass Anne noch nie so etwas wie dieses Lager hier gesehen hatte. „Es sind Menschen, Anne! – Menschen, die Hilfe brauchen!“
Anne senkte schuldbewusst den Kopf. „Ich meinte ja auch nicht, dass man ihnen nicht helfen sollte...“
Benedikta unterbrach sie mit einer Handbewegung. Sie diskutierte nicht weiter über den Wert von Menschen, ob nun Feind oder nicht, sondern erklärte: „Wir im Kloster haben außer unseren Kutten wirklich nichts mehr, was wir noch geben könnten. Deshalb sind wir auf die guten Menschen angewiesen, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. – So wie deine Mutter.“
„Mutter unterstützt also die Kriegsgefangenen und keine Flüchtlinge?“, fragte Anne nun.
„Flüchtlinge kommen durch unsere Stadt schon lange nicht mehr. Seit die Bahnlinie zerstört wurde, sind wir hier zu abgelegen. Früher sind sie mit den Zügen durchgefahren. Aber besonders viele waren es nie, nicht hier bei uns.“ Schwester Benedikta öffnete die gut verpackten Beutel und schmunzelte. „Wenn dein Vater nach Hause kommt, wird er nicht mehr viele Schuhe, Socken oder Pullover vorfinden.“
Anne gab es einen schmerzhaften Stich in der Brust, als sie die Sachen ihres geliebten Vaters erkannte. Eine kurze, aber recht heftige Wut darüber, dass sie für diejenigen bestimmt waren, die gegen ihren Vater kämpften, kroch in ihr hoch. Doch sie beherrschte sich und ging Schwester Benedikta zur Hand.
Sie brachten die Waren in die große Küche des Klosters, wo die Nonne alle Lebensmittel in einem Hohlraum in den dicken Steinmauern versteckte. Ein großes Bild der Muttergottes verdeckte die Öffnung, daneben hing ein ebenso mächtiges und reich geschmücktes Kreuz mit dem Corpus Christi. Anne bekreuzigte sich schnell, so wie sie es gelernt hatte.
Jetzt, am frühen Nachmittag hielt sich niemand in der Küche auf, so brühte die alte Frau Anne und sich selbst eine Kanne mit Tee auf. Während sie geschäftig am Herd werkte, wandte sich Anne dem Fenster zu, um nach dem Wetter zu sehen. Ein paar verirrte Schneeflocken fielen zur Erde. Anne folgte den tänzelnden Flocken mit den Augen, um plötzlich festzustellen, dass sie den Blick auf einen Teil des Lagers frei hatte. Sie befand sich im ersten Stock des Hauptgebäudes und konnte von oben ungehindert dem Treiben zusehen. „Was treiben die denn da?“ Anne war nicht zimperlich, wenn es um die harte und oft auch derbe Arbeit auf dem Hof ging. Das Töten von Tieren zum Zwecke der Ernährung war für sie selbstverständlich, auch mit dem Tod konnte sie umgehen, da ihre beiden Großeltern in ihrem Elternhaus verstorben und aufgebahrt waren. Doch was sie nun zu Gesicht bekam, gepaart mit dem, was sie in den letzten Stunden lernen musste, überstieg ihre Vorstellungskraft. „Was geht da vor?“, wiederholte sie, ihrer Stimme Nachdruck verleihend.
„Komm vom Fenster weg. Sie könnten sonst aufmerksam auf dich werden!“ Schwester Benedikta wollte sie wegziehen, aber Anne konnte ihren Blick nicht abwenden. Dann folgte sie der Warnung der Nonne aber doch und zog sich so weit zurück, dass man sie von außen nicht mehr sehen konnte.
Schwester Benedikta seufzte. „Wir können nichts tun! Wenn wir versuchen, etwas zu unternehmen, dürfen wir nicht mehr hinein. Bedenke, was damit verloren wäre.“
Im Grunde war es eine Schlägerei, die Anne beobachtete, jedoch eine sehr einseitige. Zwei Soldaten hielten einen der Gefangenen fest, während ein dritter gnadenlos mit seinem Gewehr auf den Hilflosen einschlug. Der war bereits in die Knie gegangen, ganz offensichtlich kaum mehr bei Bewusstsein. Keiner der anderen Gefangenen schien sich um die gespenstische Szene zu kümmern. Sie standen weit abseits, bestrebt, keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Nun erkannte Anne, dass ein weiterer Gefangener festgehalten wurde, ohne jedoch geschlagen zu werden. Das Opfer lag inzwischen regungslos am Boden. Anne meinte, in dem weißen Schnee Blutspuren entdecken zu können, doch aus der Entfernung war dies nicht genau auszumachen. Nun hoben sie ihn auf und fesselten ihm die Hände auf dem Rücken. Sie steckten ihn in einen winzigen Verschlag neben der einzigen intakten Bretterbude.
Anne drehte sich zur Nonne um, die – anscheinend im Gebet versunken – mit gesenktem Kopf am Kreuz stand. Stumm beendete Schwester Benedikta ihre Einkehr.
Nachdenklich und erschüttert über das, was sie eben sehen musste, setzte sich Anne wieder an den blankgeschrubbten Küchentisch. Sie schlürfte den heißen Tee, schwieg jedoch. Sie fühlte sich eigenartig erschöpft und hatte das Gefühl, ihren Kopf auf die Tischplatte legen und sofort einschlafen zu müssen. Ihren Blick nach innen gerichtet, leerte sie den Becher. Schwester Benedikta beließ sie in ihren Gedanken und kümmerte sich um die Kleidungsstücke, die Anne mitgebracht und vorhin beiseitegelegt hatte.
Später gingen die beiden Frauen stumm den Weg zurück in die Sakristei.
Die alte Frau umarmte Anne, nachdem sie sie gesegnet hatte und flüsterte ihr dabei ins Ohr. „Der Krieg kann nicht mehr lange dauern. Die Alliierten sind auf dem Vormarsch, vielleicht noch ein paar Wochen, vielleicht noch zwei oder drei Monate. – Sag es deiner Mutter, aber sonst niemanden – vor allem nicht deinem Bruder. Er meint es nicht böse, aber er ist ein Kind seiner Zeit!“ Anne nickte. Die Nachricht freute sie einerseits, andererseits war sie sich sicher, dass der Bursche, dessen Schicksal ihr pausenlos im Kopfe herumging, das Kriegsende wohl kaum mehr erleben würde.
Sie verstand, was die Nonne mit der Warnung über ihren Bruder meinte. Hans war begeisterter Hitler-Anhänger. Mit Hingabe übte er Exerzieren und Drill in den Sommerlagern und – als Höhepunkt von allem – hob er die Hand zum Hitlergruß bei einer organisierten Fahrt nach München, wo er den Führer leibhaftig zu Gesicht bekam.
Als Anne später zu Hause in der warmen Küche saß, fragte sie ihre Mutter: „Wie konntest du das Monat für Monat mit ansehen, ohne uns etwas davon zu erzählen?“ Sie massierte ihre Füße, die auf dem weiten Weg zu Eisklumpen geworden waren und sah ihre Mutter vorwurfsvoll an.
„Je weniger davon wissen, desto besser. Es ist verboten, was wir tun und ich wollte meine Familie damit nicht in Gefahr bringen. Heute konnte ich nicht anders. Die Alternative wäre gewesen, nichts für diese Leute zu tun. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen.“
Anne nickte verständig. „Das kann ich nachvollziehen. – Ich hoffe nur, dass es Papa nicht so ergeht, wie diesen Soldaten dort.“
„Wer weiß das schon!“ Bedrückt senkte Helene den Kopf. Es war so schwer, mit einer Familie zurande zu kommen, die Sorgen zu ertragen und jeden Tag aufs Neue aufzustehen und sich durchzukämpfen. „Der letzte Brief kam vor vier Monaten. In dieser Zeit kann viel passiert sein.“
In der Familie wurde nicht viel darüber gesprochen. Zu sehr schmerzte die Abwesenheit des Vaters, der schon so viele Jahre Soldat war.
„Denkst du, Papa ist in Gefangenschaft geraten?“, bohrte Anne weiter.
„Ich weiß es nicht. Immerhin besser, als wenn er tot wäre. Ich hoffe, dass nicht jedes Lager so schlimm ist, wie dieses hier.“ Helene mochte nicht darüber nachdenken. Sie hatte in ihrem Leben schon viel zu viel Elend gesehen und nun überriss sie erneut, wie fern von alledem ihre Kinder hier aufgewachsen waren. Wenn sie Hans betrachtete, der inzwischen einen Kopf größer als sie selber war und feurige Reden auf seinen Helden hielt, gab sie sich selbst die Schuld daran, dass er dem Führer so bedingungslos folgte. Und Anne schien ihr bei aller Selbstständigkeit und allem Fleiß zu naiv zu sein, um die Welt um sie herum wirklich verstehen zu können. Ihre Kinder kannten nicht viel mehr als die Arbeit auf dem Hof, die Dorfschule, in die sie früher gingen, die Kirche, die gleich daneben stand, und den weiten Weg dorthin und wieder zurück. Hans zumindest arbeitete öfters auf verschiedenen Bauernhöfen der Umgebung und ersetzte die Burschen und Männer, die im Krieg waren, aber Anne kam kaum noch aus dem Haus. Und Helene erkannte zum zweiten Mal an diesem Tag, dass sie Anne zu lange ferngehalten hatte von den schlimmen Dingen, die in der Welt vorgingen. Immerhin war ihr der Reichsarbeitsdienst erspart geblieben, weil sie – Helene – längere Zeit krank gewesen war und Anne deshalb zu Hause bleiben konnte.
Die Arbeit auf dem Hof ging weiter. Der Winter war früh hereingebrochen, was bedeutete, dass die letzten Arbeiten im Freien schnellstens zu erledigen waren. Das Holz war rar geworden, zumal auch der Sommer kalt und regnerisch gewesen war, so dass die Holzarbeit an erster Stelle stand – kein leichtes Unterfangen für drei Frauen und einen Jungen, der zwar kräftig und fleißig war, aber eben noch kein Mann. Und nun fiel auch noch die Mutter aus. Also mühten sich Hans, Ursel und Anne im schweren Unterholz, Reisig und Fallholz zu sammeln und kleinere Bäume abzuholzen, auf den Karren zu laden und heimwärts zu transportieren.
Im Grunde genommen war diese Arbeit Anne lieber als zu Hause den Brotteig zu kneten und zu backen. Was die Sache unangenehm machte, war das unleidliche Wesen ihres Bruders, der sie herumkommandierte, ständig vom tollen Soldatenleben sprach und großspurige Naziparolen von sich gab. Hans gefiel sich in der Rolle des Familienoberhauptes und was er sich gegenüber der Mutter nicht herauszunehmen wagte, versuchte er bei der Schwester gleich doppelt.
„Ich kann es kaum erwarten, endlich Soldat zu werden. Dann wären wir mit den Amis und Russen gleich fertig“, tönte er gerade, während Anne bei sich dachte, dass ihrem Bruder der Gang zum Kloster durchaus gut täte. Aber selbst dafür würde er wohl noch eine Erklärung haben.
Sie schüttelte sich widerwillig, so als ob sie den Ballast ihrer Seele auf diese Weise loswerden könnte und unterbrach den Redefluss des Bruders kurzerhand.
„Ich gehe hinauf auf den Hohlweg, da liegt immer was herum. Vielleicht gehst du noch rüber ins Spitalholz. Da ist es so unwegsam, das schaffe ich nicht.“
Anne wusste, dass sie ihn bei seinem Stolz packen musste und prompt ging er ihr in die Falle. „Klar, ist zu schwer für dich!“
Sie hatten noch ein wenig Platz auf dem Karren, den sie ausnutzen wollten. Ursel war schon früher hinunter gestiegen, mit einer Kiepe Tannenzapfen auf dem Rücken, um nach Helene und der Arbeit auf dem Hof zu sehen.
Kapitel 2
Hohe Tannen und Fichten säumten das Hochholz mit nur wenig Buschwerk darunter. Jetzt lag stellenweise frischer, weißer Schnee auf dem dunklen Waldboden. Nach etwa einer halben Stunde mühseliger Arbeit - die vereisten Zweige und Äste hatten ihre Handschuhe durchnässt - erlaubte sich Anne eine Pause. Inzwischen war sie bis ganz ans Ende des Hohlweges gestoßen und hielt zielstrebig auf ihren erklärten Lieblingsplatz aus Kindertagen zu. In gemütlicheren Zeiten war sie mit ihrem Großvater hier herauf gestiegen, um Pilze mit ihm zu suchen. Er führte sie stets an die Plätze mit den leckeren Waldfrüchten heran und ließ diese vom kleinen Mädchen stolz finden. Wenn sie nicht mehr konnte, setzte er sie hier ab und sie spielte, dass sie eine Prinzessin aus dem Märchen wäre und auf einen verwunschenen Prinzen wartete, oder einen Frosch oder ein Reh, so genau wusste sie das nicht mehr. Kulisse dazu war die riesige Wurzel eines vor Urzeiten umgefallenen Baumes, die ihr weitverzweigtes Geäst fingergleich in die Höhe des Waldes streckte. Darunter hatte sich eine Kuhle im aufgerissenen Waldboden aufgetan, die – von den mächtigen Pranken der Wurzel geschützt – ihren Unterschlupf bildete. In den Sommern ihrer Kindheit war dieses Loch mit weichem Moos ausgepolstert. Nun war Gestrüpp darüber gewuchert, das in diesem strengen Winter zur Wetterseite hin mit Schnee verweht war. Anne war noch einige Schritte von diesem magischen Ort entfernt, aber irgendetwas war anders. Sie war noch dabei, sich zu überlegen, was hier nicht stimmte, als sie von weitem Geschrei hörte. Da sie annahm, dass es ihr Bruder war, der nach ihr rief, ignorierte sie das Gebrüll. So setzte sie ihr Reisigpaket ab, ging langsam zu ihrer Wurzel und zerrte in ihren Erinnerungen gefangen an dem Gestrüpp, das sich über der Kuhle verfangen hatte.
Immer noch überlegte sie, was an der Szene störte. Einer inneren Eingebung folgend mühte sie sich, diese Stelle freizulegen – so widersinnig dies in diesem Augenblick auch sein mochte, vereistes Gestrüpp nur so zum Spaß wegzureißen.
Sie erschrak derart heftig, dass ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Spucke weg blieb! Sie vergaß zu schreien oder wegzulaufen, stand einfach nur zu Tode geängstigt wie einbetoniert! Vor ihr lag ein menschliches Wesen! Was von der Kleidung noch übrig war, deutete darauf hin, dass es sich um einen Soldaten handeln musste. Anne war sich sicher, dass sie vor einer Leiche stand, als die Kreatur plötzlich die Augen öffnete. In dem schmutzigen Gesicht trat das Weiß der Augen beinahe gespenstisch hervor. Dennoch verflog ihre Angst augenblicklich. Nach den ersten Schrecksekunden erkannte sie, dass von diesem zerfledderten Bündel keine Gefahr mehr ausgehen konnte. Neugierig trat sie näher heran, ohne darüber nachzudenken, dass noch Kameraden des Unbekannten in der Nähe sein konnten. Nun drangen auch die Rufe wieder in ihr Bewusstsein. Es war die Stimme ihres Bruders, der sich zu nähern schien und sie begann nun doch, sich unbehaglich zu fühlen. Rasch, wie aus innerem Zwang heraus, legte sie die Zweige wieder zurück und hob ihr Bündel Reisig wieder an. So schnell es der tückische Boden zuließ, stolperte sie zu ihm hinunter. „Wo bleibst du denn? Es wird bald finster und wir müssen mit dem Karren noch aus dem Wald hinaus.“
Anne fügte sich widerspruchslos. Was ihr eben widerfahren war, schien so irreal, so unmöglich zu sein, dass sie geneigt war, an eine Erscheinung oder ein Trugbild ihres Gehirnes zu glauben. In Gedanken versunken zerrte sie mit ihrem Bruder den schweren Karren über tiefe Furten heimwärts. Gerade eben hatten sie ihr unförmiges Gefährt in den Hof geschleift, als die Nachbarin vom mehreren Steinwürfen entfernten Hof, der näher am Dorf als ihr eigener lag, atemlos angelaufen kam. Sie war eine kleine, dicke Frau, die immer und stets nur in ihrer Schürze unterwegs war. Selbst an einem eiskalten Tag wie heute, trug sie die Schürze über einer Strickjacke und einem an vielen Stellen fadenscheinigen knöchellangen Flanellrock.
„Stellt euch vor, aus dem Lager sind heute zwei Soldaten geflohen.“
Helene trat humpelnd hinzu und wickelte sich bei dem Anblick der leichtgeschürzten Nachbarin fester in ihre Jacke. „Woher weißt du das?“, fragte sie misstrauisch.
„Fritz hat es mit nach Hause gebracht“, Fritz war ihr Mann, der kriegsuntauglich im Heimatschutz diente, „zwei Wachposten sollen bei der Flucht mitgeholfen haben. Die sind natürlich gleich weg gekommen.“
Weg gekommen bedeutete entweder Ostfront oder eines dieser Gefängnisse, von denen keiner etwas Genaues wusste oder wissen wollte und woraus niemals jemand wieder zurückkehrte. Anne befand sich immer noch – aufgewühlt von ihrem surrealen Erlebnis - in ihren eigenen Gedanken verstrickt, gesellte sich aber dennoch zu den beiden Frauen.
Hanna, die Nachbarin schlug einen verschwörerischen Ton an, als sie weiter sprach: „Aber wie unsicher es jetzt geworden ist! Die kommen einfach in unsere Häuser und bringen uns um! Ihr werdet schon sehen!“
Helene seufzte. Sie mochte die Nachbarin nicht und machte keinen Hehl daraus.
„Wie sicher war es denn die letzten fünf Jahre? Wir sind im Krieg, was erwartest du da?“ Sie erkannte, dass ihr Ton zu hart gewesen war und es ein Fehler sein konnte, einen Heimatschutzmann gegen sich aufzubringen. „Aber danke, dass du uns Bescheid gesagt hast. Wir werden aufpassen!“
„Das ist doch selbstverständlich unter Nachbarn!“ Die Entgegnung Hannas klang schnippisch und sie hatte sicher noch eine Antwort auf den Lippen, als sich Anne, auf die niemand während der Unterhaltung geachtet hatte, unmittelbar neben ihr heftig übergab.
„Um Himmels Willen Kind! Was ist denn mit dir los?“ Helene legte sogleich die Hand auf die Stirn ihrer Tochter, die sich tatsächlich heiß anfühlte.
„Das ist sicher der Scharlach!“, mutmaßte Hanna mit greller Stimme dazwischen, sofort einige Schritte zurückweichend. „Da muss sie Wochen in Quarantäne!“
„Ich weiß nicht. Mir ist so schlecht!“ Anne hatte der Erzählung mit wachsender Bestürzung zugehört, bis ihr Magen rebellierte. Sie war nicht krank, in ihr arbeitete noch der Schrecken, vor allem nun, da sie wusste, dass sie keiner Täuschung aufgesessen war und einen der Flüchtlinge gerade entdeckt hatte! Sie wusste nicht, was ihr mehr zu schaffen machte: Die Tatsache, dass sie einem Angriff von ihm entgangen war – was hörte man nicht alles über die brutalen Feinde - oder der Gedanke, dass er schwer verletzt dort oben lag. Noch eine Idee setzte sich in ihr fest: In welcher Gefahr mochte sie wirklich gewesen sein? Wo war der Zweite? Hatte sie es nur den Rufen ihres Bruders zu verdanken, dass sie noch am Leben war? Prompt gaben ihre Knie wieder nach und sie hing schwer in der Schulter des Bruders, der sie ins Haus brachte.
Wenig später lag sie im Bett, diesmal im Schlafzimmer der Eltern, da dieses an die Küche grenzte und ein wenig mitbeheizt werden konnte.
Helene brachte ihr heißen Tee und ließ sich auf einem Stuhl nieder, den sie sich herangezogen hatte.
Es war undenkbar für Anne, dieses Erlebnis für sich zu behalten! „Ich habe einen der beiden da oben gesehen. Er lag versteckt unter der großen Wurzel – du weißt schon, welche – und ... ich dachte zuerst, er wäre tot. Aber er hat sich bewegt und die Augen aufgemacht!“
Helene fuhr augenblicklich der Schock in die Glieder. „Was hätte dir passieren können, Kind! Warum hast du nicht gerufen! Hat Hans denn nichts mitbekommen?“
„Beruhige dich Mama, so gefährlich war es nicht. Er war allein. Da war kein Zweiter. Ich glaube, der hat ihn einfach liegen gelassen, weil er nicht mehr weiter konnte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie der aussieht. Vollkommen verdreckt und erschöpft.“
„Wir müssen es melden. Wer weiß, wo der Zweite herumläuft.“
„Wenn du es meldest, dann bringen sie sie um, das weißt du doch. Hättest du mich nicht zu den Nonnen geschickt, wüsste ich es nicht. Aber jetzt weiß ich es. Kannst du denn wieder froh werden, wenn du am Tod eines Menschen schuld bist?“ Anne widersprach vehement und aus tiefster Überzeugung. Da war kein zweiter Soldat gewesen! Dessen war sie sich nun, nachdem sie länger darüber nachdachte, gewiss. Abgesehen davon hatte sie noch die Bilder ihres Besuches im Kloster vor Augen.
„Und was sollen wir deiner Meinung nach tun? Vielleicht holt ihn der andere ab! Vielleicht kommen sie zu uns! Wer weiß, was die mit uns machen?“ Helene hatte die Verantwortung über die Menschen in ihrem Haus, sie musste so denken! Deutlich erkannte sie aber auch, dass Anne dem ganz und gar nicht folgen konnte! Helene versuchte es noch einmal: „Anne, es ist besser, sich nicht einzumischen. Wir müssen es keinem sagen, gut, aber wir können auch nichts tun.“
„Doch...“
„...Nein!“ Helene erkannte die Gedanken ihrer Tochter und verwahrte sich dagegen. „Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie einen feindlichen Soldaten bei uns finden? Sie würden uns alle erschießen – oder noch schlimmer: In so ein Lager bringen! Denk doch auch an die anderen! Und vergiss nicht: Es ist ein Feind! Dein Vater kämpft gegen diese Leute!“
Anne setzte sich auf. Ihre Übelkeit und das Fieber waren dem Schrecken zuzuschreiben und sie fühlte sich schon wieder besser – und kämpferischer.
„Wenn ich die Landkarte ansehe, auf der Hans immer die Truppenbewegungen beobachtet, dann sehe ich auch Feinde. Namen von Armeen, Buchstaben, Zahlen, aber keine Gesichter. Und wenn ich die Bilder dort...“, sie zeigte auf die Fotogalerie an der Schlafzimmerwand, „... sehe, dann denke ich an Papa und die anderen, die ich kenne, und die im Krieg kämpfen oder schon tot sind. Aber wenn ich am Fenster des Klosters stehe und hinunterschaue, dann sehe ich einen Mann, der mit dem Gewehr zusammengeschlagen wird, bis er blutend am Boden liegt, mehr tot als lebendig und schließlich in einen Verschlag gepfercht wird! Wenn wir diesem Soldaten da oben helfen, dann haben wir etwas getan! Wir haben nicht weggesehen!“
Je mehr Anne redete, desto mehr Argumente fielen ihr ein und desto unmöglicher wurde es ihr, nichts zu tun.
„Es geht nicht!“, bekräftige Helene erneut und stand auf, um ihrer Rede Nachdruck zu verleihen. „Das hier sind nicht die romantischen Vorstellungen deiner Schundromane, die du immer verschlingst. Das ist die Wirklichkeit. Und die ist gefährlich! Da gibt es für uns nichts zu tun! – Außer zu Fritz zu gehen, und ihm alles zu erzählen!“
„Mama, es ist unerträglich für mich, wenn wir ihn da liegen lassen. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Du hast nicht gesehen, in welch erbärmlichem Zustand er sich befand!“
Sie stieg aus dem Bett und begann, sich anzukleiden. Helene stand an der Tür, die Arme verschränkt, hinderte sie aber nicht an ihrem Tun. Nun rief sie Ursel in den Raum. Hans war nicht zu sehen. Offenbar lud er das Holz ab. In knappen Worten berichtete sie ihrer Schwester, was vorgefallen war und endete mit den Worten: „Anne will, dass wir ihn herholen. In das Kloster ist es zu weit und wenn er noch lebt, schaffen wir es höchstens bis hierher mit ihm. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.“
Überraschenderweise nickte Ursel sofort. „Ich bin dabei. Aber Hans....“
Sie hatte Recht. Der Bursche würde nicht davor zurückschrecken, den Fremden und damit unbewusst auch seine eigene Familie zu verraten. Helene runzelte die Stirn wie sie es immer tat, wenn sie über etwas nachbrütete. Was sagte Hanna eben noch: Hoffentlich hat das Kind nicht den Scharlach erwischt. Da müsste sie Wochen in Quarantäne!
„Hanna sagte etwas von Quarantäne und Scharlach. Ich hasse es, etwas Derartiges zu tun, aber wenn wir behaupten, dass du, Anne, Scharlach hättest, dann könnten wir diesen Raum hier in ein Quarantänezimmer umfunktionieren. Außer der Pflegekraft dürfte keiner herein.“
„Ja, das ist eine gute Idee!“ Anne war sofort Feuer und Flamme.
„Stell es dir nur nicht so toll vor. Es ist kalt hier drin und du wirst dich tagelang hier aufhalten müssen. Wir wissen nicht, in welchem Zustand wir ihn vorfinden. Aber vielleicht haben wir ja Glück und wir finden ihn überhaupt nicht mehr!“
Helene wusste, dass dieser Zusatz mehr als zynisch klang, aber genau das spiegelte ihre Gefühle wider. Sie hatte nicht das leichtfertige Wesen ihrer Tochter und auch schon ein wenig mehr im Leben gesehen, als diese. Sie musste an ihre Familie denken und an deren Sicherheit. Sich einen Fremden ins Haus zu holen, nicht wissend, ob dieser nicht vielleicht gewalttätig war und ihnen allen den Garaus machte, gehörte sicher nicht dazu! Von der Bedrohung durch die eigenen Leute, falls er entdeckt würde, ganz zu schweigen. Trotz ihrer Bedenken besprachen sie den Plan weiter und kamen darin überein, dass Ursel und Anne in aller gebotener Vorsicht in der Nacht hinaufsteigen mussten zum Hohlweg und zu Annes Wurzel, um den Fremden herunter zu holen – sofern es noch etwas zu holen gab. Helene fügte sich endlich, wenn auch unter Protest. Sie war praktisch veranlagt und hatte nicht ausgesprochen, was letztlich zu ihrer Zustimmung zu dem Unterfangen geführt hatte: Wenn es stimmte, dass der Krieg bald zu Ende war, wäre es sicher kein schlechter Zug, einem der Feinde und damit einem Angehörigen der Siegermacht Herberge gegeben zu haben.
Kapitel 3
Sie gingen einen Bogen. Gut, dass Anne sich hier auskannte wie in ihrer Westentasche! Die dunkle Nacht jedoch empfanden sie als große Bedrohung. Hinter jedem Baum, hinter jedem Strauch konnte ein Bösewicht stecken! Oder Wald- und sonstige Geister trieben ihr Unwesen. In wenigen Tagen war Luzia-Tag. Jeder wusste, was die Luzier, jene sagenumwobene Hexe, die nichts mit der Heiligen gemein hatte, mit ihren Opfern trieb!
Kurz gesagt: Sie fürchteten sich zu Tode, als sie den recht weiten Weg bergan stiegen, sich immer wieder umblickend und nach allen Seiten absichernd. Was bei Tage und direktem Wege eine dreiviertel Stunde dauerte, brauchte nun fast zwei Stunden, bis sie endlich oben angekommen waren. Sie lauerten noch einige Minuten, bis sie, mit großen Prügeln bewaffnet, zu der Wurzel hinüber schlichen, um nach dem Rechten zu sehen.
Er lag noch da. Bewegungslos, ohne Leben.
Tapfer streckte Ursel die Hand nach dem Bündel aus, geschützt von Anne, die mit erhobenem Stock hinter ihr stand und ihr in beinahe rührender Manier Rückendeckung gab. Ursel wich alarmiert einen Schritt zurück, als er stöhnte und seinen Arm bewegte. Aber beide erkannten sehr schnell, dass er zwar noch lebte, sicherlich jedoch zu keiner gefährlichen Reaktion mehr fähig war.
„Seien Sie ganz ruhig!“, gebot Anne flüsternd, als sie ihn mit vereinten Kräften aus der Kuhle zerrten. Er war durchnässt und eiskalt. Helene meinte später, er hätte keine halbe Stunde mehr in dem Eisbunker überlebt, dann wäre er wohl erfroren.
Sie warfen ihre Holzstöcke beiseite, versuchten wohlüberlegt die Spuren ihres nächtlichen Treibens zu verwischen, indem sie das Gestrüpp an die ursprüngliche Stelle zurückzerrten und schleppten ihn, zwischen sich geschultert in der pechschwarzen Nacht zu Tal. Glücklicherweise begann es zu schneien, leicht zuerst, dann aber sich zu einem regelrechten Schneesturm auswachsend. Der Neuschnee würde ihre Spuren gänzlich verwischen.
Vorsichtig näherten sie sich dem Haus, schwer atmend vor Kälte und Anstrengung. Nun kam das Schwierigste an ihrem Unterfangen. Hans durfte unter keinen Umständen geweckt werden! Wenigstens war seine Schlafkammer praktisch auf der anderen Seite im ersten Stock des Hauses, doch auf dem Flur durften sie nicht das geringste Geräusch verursachen!
Ursel hob das Gesicht des Verletzten, der seit geraumer Zeit wie ein Mehlsack zwischen ihnen hing und keiner Regung mehr nachgab. Sie bedeutete ihm eindringlich, dass er unter keinen Umständen ein Geräusch machen durfte, hob den Zeigefinder vor ihre Lippen und flüsterte warnend: „Nazi!“
Das Wort riss in ihm Erinnerungen auf. Er nickte kaum merklich und hielt sich daran. Unter Aufbietung all seiner Kräfte, gelang es ihm, nicht vor Schmerzen zu brüllen, als sie ihn ins Haus und durch den Flur zerrten, hinein in das Zimmer wo sie ihn endlich auf dem Bett, das Helene mit einer alten Pferdedecke geschützt hatte, abladen konnten. Im fahlen Licht einer Öllampe zogen sie ihm die verdreckten und verlausten Kleider vom Leibe. Helene wusch ihn mit Ursels Hilfe rasch, kleidete ihn in einen der Pyjamas ihres Mannes und beseitigte schließlich die Lumpen, indem sie sie im Ofen in der Küche verbrannte. Sie kontrollierte sogar die Asche, ob nicht unbrennbare Abzeichen oder dergleichen zurück geblieben waren. Seine Soldatenmarke vergrub sie draußen am Rande des Misthaufens, durch eine Blechdose geschützt, noch vor Sonnenaufgang.
Mehr konnten sie im Moment nicht für ihn tun. Zum einen war es zu dunkel, zum anderen war das Haus zu hellhörig, um eine Behandlung und die damit verbundenen Geräusche riskieren zu können. Ihr fremder Gast lag in dem sauberen Bett und schlief erschöpft einem unsicheren Morgen entgegen.
Anne döste mehr schlecht als recht in zwei Wolldecken gehüllt auf dem alten Ohrensessel, den die Mutter vom Dachboden geholt und ins Zimmer gestellt hatte. Ihr Nacken schmerzte, als sie in der Morgendämmerung schließlich erwachte. Irritiert sah sie sich um, bis sie nach wenigen Augenblicken endgültig wach war. Im Haus war es noch ruhig und im Zimmer eiskalt. Zwar trug sie ihre dicken Winterkleider, doch hatte es über Nacht in das Zimmer gefroren. Eisblumen schillerten im frühen Morgenlicht in der Fensternische.
Annes erster Blick galt ihm. Sie erschrak. Was im Dämmerlicht der Petroleumlampe wie Schattenspiele auf seinem Gesicht aussah, waren nun bei Licht betrachtet dunkle, blauschwarze Blutergüsse und schlecht verheilte Platzwunden an Stirn, Schläfe und um die Augen. Sie näherte sich ihm vorsichtig, wollte ihn wecken, bevor es im Haus betriebsam wurde, um nicht durch eine unbedachte Regung seinerseits Hans auf den Plan zu rufen.
Noch bevor sie ihn berühren konnte, schlug er die Augen auf, das linke, lädierte, war fast zugeschwollen. Erschrocken über den wohl unverhofften Anblick des jungen Mädchens zuckte er zusammen, um sogleich schmerzvoll aufzustöhnen und aus einem Reflex heraus seine linke Schulter mit der anderen Hand zu halten.
„Schsch!“ Anne hielt sich rasch den Finger vor die Lippen.
Er nickte verständig und murmelte: „Nazi?!“ Es klang wie eine Frage und sie stimmte mit einem Wimpernschlag zu.
Vorsichtig zog sie seine Hand von der Schulter. Jetzt erst bemerkte sie, dass der grobe Stoff des Kleidungsstückes am Rücken mit Blut durchtränkt war und auch das Kissen Blutspuren aufwies. Seinem angestrengten Gesichtsausdruck entnahm sie, dass er große Schmerzen haben musste.