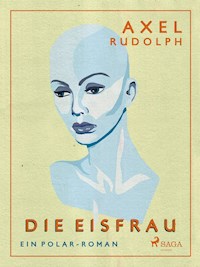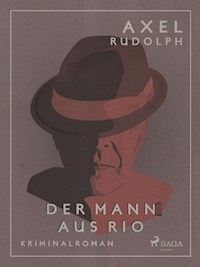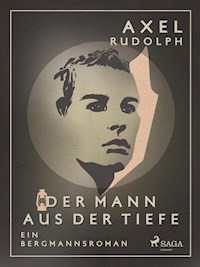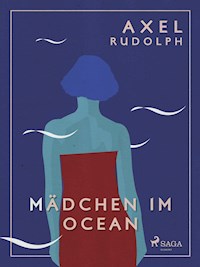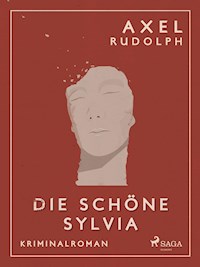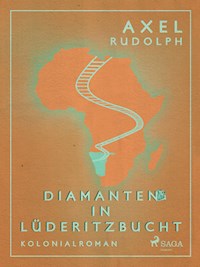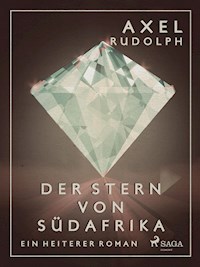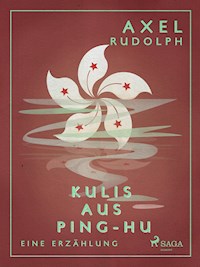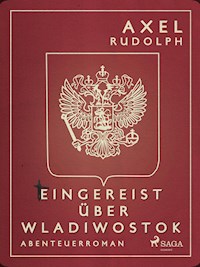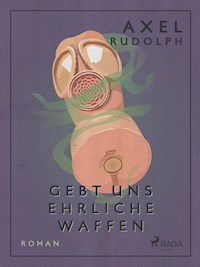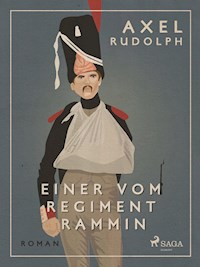
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
12. August 1759, mitten im Siebenjährigen Krieg. Fritz Peetz ist preußischer Grenadier im Regiment Rammin und zieht mit seinen Kameraden in die Schlacht bei Kunersdorf. Im Kampf verwundet rettet sich Peetz in das Haus eines alten Schäfers und wird von diesem notdürftig verarztet. Seinen anfänglichen Plan, nach vier Kriegsjahren endlich zu seiner Familie nach Berlin zurückzukehren und sich dort zu erholen, gibt er auf, als nach einer russischen Gegenattacke plötzlich die restlichen preußischen Soldaten vom Schlachtfeld fliehen und in die Hütte strömen. Er erfährt, dass er einer der wenigen Überlebenden seines Regiments ist. Tapfer und mit verwundetem Arm versucht er, sich zu dem, was von seiner Truppe übriggeblieben ist, zurück zu schleppen. Als er auf halbem Wege mit dem Gewehr im Arm zusammenbricht, wird er von einer Kutsche, die den gefallen geglaubten General Seydlitz transportiert, mitgenommen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Rudolph
Einer vom Regiment Rammin
Roman
Saga
1. Kapitel
„Ho! Ho! Lestwitz hat die Neese pläng!“ höhnen die Grenadiere vom Regiment Rammin, ihre Ladestöcke in die heißen Gewehrläufe stoßend.
„Macht’s besser, wenn ihr könnt!“ Die vom Regiment Lestwitz haben pulvergeschwärzte, verzerrte Gesichter. Trotz der geschlossenen Formation ein trauriger Zug, der da aus dem weißen Schleier hervorquillt, der die Schlucht deckt. In Fetzen hängende Gamaschen, besudelte Röcke, pfeifende Lungen, unter blutigen Notverbänden müde, verdrossene Gesichter. Rückwärts! Rückwärts! Retraite!
„Paß auf, Karl, jetzt kommen wir dran!“ ruft der Grenadier Fritz Peetz seinem Nebenmann zu. Da hebt auch schon der Kapitän von Münchow seinen Sponton.
„Vorwärts — marsch!“
Hinunter in die Schlucht in die milchdicken Schwaden. Ist’s Nebel? Ist’s Pulverdampf? „Ick fühl mir wie in Himmel!“ sagt der Grenadier Peetz, da stolpern seine langen Beine über einen Körper am Boden, und ein Fluchwort entfliegt ihm, das ihn bestimmt aus dem Paradies ausgeschlossen hätte, wenn diese weißen Wolken wirklich der Himmel wären.
„Lücken schließen! Ordnung, Kerls!“
Es scheinen viel solcher stiller Körper hier in der Schlucht zu liegen. Fritz Peetz sieht, wie die geschlossenen Glieder sich hier und da lösen, gamaschenbekleidete Grenadierbeine über Hindernisse hinwegsteigen.
Sonst kann er nicht viel sehen von der Schlacht, und auch das Sprechen fällt nicht leicht. Der Pulverschleim, der erstickend sich in die Kehle drängt, läßt selbst die frechste Berliner Schnauze verstummen.
Einen Abhang hinauf stolpern die Beine. Für einen Augenblick zerreißt der Schleier. Rechts und links exakt im Gleichschritt vorrückende Bataillone, hohe Blechmützen, geschwungene Spontons, gefällte Bajonette. Das Kalbfell rasselt.
Da brüllt die Schlucht auf. Rollende Salven fegen vom Hügelrand herunter. Moskowitische Kartätschen schlagen in die Glieder. Fünf Schritt vor Fritz Peetz bricht der Kapitän von Münchow zusammen. Sein Sponton pflanzt sich in das Erdreich wie eine Fahnenstange, von der das Tuch gerissen.
Vorwärts, Grenadiere!
Der Atem stöhnt. Wie ein Hammerwerk pocht das Herz unter der geflickten Montur. Plötzlich greift Fritz Peetz jäh nach seinem rechten Unterarm.
„Gott steh mir bei!“
„Fritze wird fromm!“ lacht mitten im Rollen der Salven sein Nebenmann. Im nächsten Augenblick schlägt er selber lang vornüber. Die Hintermänner treten Fritz Peetz in Hacken und Kniekehlen, unaufhaltsam drängt das zweite Glied nach. Das Gewehr unter den Arm geklemmt, die Linke krampfhaft auf den blutenden, brennenden Unterarm gepreßt, fühlt er sich weiter vorwärts gestoßen. Karl, sein Nebenmann, ist weg, aber die Lücke hat sich sofort geschlossen. Nicht einmal Platz zum Umsinken ist da.
„Vorwärts! Zur Attacke!“ brüllt irgendwo die heisere Stimme eines Offiziers. Der Sturmmarsch der Tambours geht unter in neuem Krachen und Donnern vom Hügelrand her. Fritz Peetz wird es schwarz vor den Augen, die Beine knicken ihm plötzlich ein, und — auf einmal ist auch Platz rings um ihn. Die Kartätschensalven haben die Reihen gelichtet. Das zweite Glied ist bereits in das erste aufgerückt, um die Lücken auszufüllen. Fritz Peetz begreift das nicht. Er sieht nur, daß auf einmal niemand mehr hinter ihm ist, daß er zurücktaumeln kann — — —
Wie ist er eigentlich zurück durch die Schlucht gekommen? Schwarzgrüne, flimmernde Schleier vor den Augen, mit wankenden Knien, die jeden Augenblick über Leichen und Monturstücke taumeln, ein wahnsinniges Beißen und Brennen im Arm! Auf einmal steht er jedenfalls wieder jenseits der Schlucht, sieht sich um, — —
Bilder, oft genug gesehen in den letzten Jahren: Vorrückende Bataillone, Peletonfeuer, Schwadronen, des Einhauens harrend, Bombardiers und Stückknechte, reiterlos über das Feld jagende Gäule, umherspritzende, schreiende Adjutanten, bunte Flecken im Gras, langausgestreckt oder zusammengekrümmt, Blessierte, die sich rückwärts schleppen, auf einem fernen Hügel ein Gleißen und Blinken goldbetreßter Generaluniformen, vor ihnen ein zartgebauter Mann, undeutlich erkennbar und doch jedem bekannt in seinem einfachen blauen Waffenrock —
Nichts Besonderes bietet dieses Bild für Fritz Peetz. Die Generale und Obristen, die Adjutanten und Ordonnanzen da oben auf dem Hügel mögen mit angehaltenem Atem dem Gang der Schlacht folgen, in dem Vorrücken und Weichen der Bataillone die Weltgeschichte über das Land schreiten sehen, — der Grenadier Peetz interessiert sich viel mehr für das, was in seiner nächsten Nähe ist: nämlich ein von einer Stückkugel getroffener Gaul, der plötzlich wild um sich zu schlagen beginnt.
„Menagier dich, verdammtet Aast!“ Fritz tut einen Seitensprung, um von den Hufen nicht getroffen zu werden, und fühlt dabei wieder einen neuen, heftigeren Schmerz im Arm.
Blessiert! Auch nichts Besonderes. Es humpeln genug Gestalten über das Feld. Man braucht ihnen nur zu folgen, um zum Feldscher zu finden. Der Grenadier Peetz schneidet eine finstere Grimasse bei dem Gedanken. Zum Feldscher — das heißt, stundenlang liegen und warten zwischen jämmerlich schreienden Blessierten. Warten, warten, bis man ihm endlich im Arm herumwühlt, die Kugel herausholt. Sapperlot, das ist zum Kotzen! Man wird ja schlapp und krank von all dem Gewinsel und Geheule, das einem da die Ohren malträtiert, bevor man drankommt!
Fritz Peetz hat, wie die meisten seiner Kameraden, recht wenig Respekt vor der Kunst des Feldschers. Er ist der Ansicht, daß man eine Kugel, wenn sie nicht grade im Knochen steckt, ebensogut mit den Fingern herausklauben kann wie in dem schmerzenden Arm zu schneiden und zu stechen. Ein tüchtiger Verband darum, ein bißchen Ruhe — und mit Gottes Hilfe wird die Sache schon werden.
Während die meisten der aus der Schlacht zurückhumpelnden Blessierten sich nach links wenden, wo in einer Talsenkung die Feldschere ihr Strohhotel aufgeschlagen haben, hält Fritz Peetz sich nach rechts, schwankt, vor Schmerzen immer leise vor sich hin schimpfend, durch einen Hohlweg, klettert wieder einen kleinen Hügelabhang hinauf und findet sich an einem grasüberwucherten, desolaten Feldweg, an dessen Ende eine Gruppe armseliger Katendächer und ein hölzerner Kirchturm über das Gelände lugen.
Fernab donnert die Schlacht. Ein Pikett Husaren jagt in Karriere vom Dorf her gegen das Oderbruch hin. Ein Troßwagen, von Menschen und Pferden verlassen, steckt auf dem Weg, bis an die Radnabe im aufgeweichten Erdreich. In dem dürftigen Gras an der Böschung kauert ein Bauernjunge und starrt mit offenem Munde nach dem grausigen Pulverdampf da vorne.
Auch der Grenadier Peetz wendet einen Augenblick sein Gesicht dorthin. Viel sehen kann man nicht. Die Bodenwellen verdecken jetzt die formierten Bataillons und Schwadronen. Aber jenseits der infamen Nebelschlucht blitzen plötzlich Blechhauben aus den weißen Schwaden auf, verworrenes, wildes Getöse dringt herüber, eine zerfetzte Preußenfahne hüpft empor, recht wie ein Adler, der zur Sonne fliegt. Viktoria! Die Grenadiere haben den Hügelrand genommen und die Moskowiter zum Teufel gejagt.
„Na also!“ brummt Fritz Peetz befriedigt. „Viktoria! Da kann ich ja in Ruhe …“ Er tritt einen Schritt seitwärts und stößt mit dem Knie gegen die Schulter des glotzenden Bauernjungen. „Heda, Bursch! Ist im Dorf da drüben noch Platz? Sind viel Blessierte da?“
„Blessierte? Nein.“ Der Junge starrt mit stumpfer Angst den blutüberströmten Rockärmel des Grenadiers an. „Ich … ich hab keinen gesehen.“
„Dann wird ja wohl ein Unterkommen sein. Wie heißet das Dorf?“
Wieder ein staunendes Starren. Ist doch gar seltsam, daß man nicht weiß, wie das Dorf sich nennt. Das wissen doch alle hier in der Gegend und braucht keiner Schulmeister oder Bakel dazu, sich diese Kenntnis zu erwerben. Fritz Peetz muß seine Frage noch einmal wiederholen, bevor der Junge sich von seinem Staunen erholt und die Zähne voneinander bringt.
„Kunersdorf.“
*
Fritz Peetz hat Glück. Die erste Kate am Eingang des Dorfes, an deren Tür er rüttelt, tut sich ihm auf. Der Mann, der sie bewohnt, ist ein Schäfer.
Ein Schäfer versteht mehr als ein Feldscher, — philosophiert Fritz Peetz und läßt sich, die Schmerzen verbeißend, von dem Mann den Rockärmel auftrennen, duldet es auch mit zusammengebissenen Zähnen, daß der Alte mit einem höchst ungeigneten Messer in der Wunde herumwühlt, bis er richtig die Bleikugel herausgefischt hat. Die Prozedur schmerzt viel mehr, als es die geschickte Hand des Feldschers getan haben würde, aber was tut nicht alles der Glaube! Fritz Peetz läßt sich dankbar den Arm zu einem unförmigen Wulst verbinden und streckt sich auf die Strohschütte aus, die ihm der Schäfer anweist. Zehn Minuten später schnarcht er schon.
Als ihn nach einigen Stunden die Schmerzen im Arm wieder wach machen, schnuppert seine Nase begierig durch die Stube. Auf dem Tisch steht eine Schüssel mit Leinöl. Der Schäfer schneidet eben dicke Brotscheiben ab.
„Bleib Er liegen!“ brummt der Alte, als Fritz einen vergeblichen Versuch macht aufzustehen. „Ich bring Ihm die Schüssel.“
Gemeinsam stippen sie die Brotstücke in das Öl. Fritz Peetz grunzt vor Behagen. Mit der Sattheit kommt auch das Interesse für die Außenwelt zurück. Das kleine Fenster hat der Schäfer mit einem dünnen Tuch verhangen, aber man hört deutlich das ferne Grollen der Schlacht und ab und zu ein näheres, heftigeres Stampfen, Knirschen und Rollen. Troßkolonnen scheinen draußen durch die Dorfstraße zu ziehen.
„Wie stehet die Bataille?“
„In Gottes Hand,“ sagt der alte Schäfer trocken. „Eß Er und ruh Er aus! Das Kriegführen ist nur für Gesunde.“
*
Wieder liegt Fritz lang ausgestreckt auf dem Stroh. Der Arm schmerzt ganz verteufelt. Man muß etwas finden, um die Gedanken abzulenken. Sein Blick wandert an dem Monturrock herab. Nicht nur der Ärmel ist aufgeschnitten, auch die ganze rechte Seite des Rockes ist entzwei. Das längst fadenscheinige Gewebe muß sich aufgetrennt haben bei den raschen Messerschnitten des Schäfers. Fritz faßt mit der gesunden Hand in die innere Rocktasche und zieht ihren Inhalt heraus. Ist alles noch da! Die silberne Tabatiere, die er in Gotha erbeutet hat unter dem zurückgelassenen Gepäck der Franzosen. Das Gesangbuch, das ihm die Mutter Peetzin beim Ausmarsch zugesteckt hat und in dem die österreichische Kugel von Leuthen stecken geblieben ist. Der Brief, den die Feldpost ihm ins Lager von Hochkirch gebracht hat. Ja, dieser Brief von Schwester Dorothea ist so recht geeignet, einen von den Schmerzen in dem infamen Arm abzulenken. Fritz Peetz faltet das Papier auseinander und beginnt es zu studieren, obwohl er längst weiß, was darinnen steht.
„Liebwerter Bruder!
Tue dir zu wissen, daß Vater und Mutter alleweile gesund und wohlauf seien und mir aufgetragen haben, dich schön zu grüßen und zu fragen, ob der Krieg bald aus ist. Es ist ein Kurier gekommen und hat die Nachricht gebracht von der großen Victoria von Leuthen. Ist auch Victoria geschossen worden und haben alle kräftig Hurrah und Vivat geschrieen, aber ganz wohl ist uns dabei nit gewesen, lieber Bruder, alldieweil das Leben immer teurer und schwerer wird hier in Berlin trotz eurer Gloire. Für Ein Thaler Preußisch bekommet man nur noch das, so man früher für vier Groschen kaufen konnte. Vater ist auch übel daran, denn die fremden Zuckersieder, so in die Fabrique des Herrn Wesely gekommen sind, schmälern ihm sein Verdienst. Es herrschet große Noth unter den Leuten und auch bitteres Weh. Denn es gibt kaum ein Haus hier in der Spandauerstraße, so nicht einen Sohn oder Bruder bei der Armée hat. Herr Euler meint, daß es hohe Zeit wäre, daß der König wieder nach Berlin käme und ich stimme ihm darin von ganzem Herzen bei. Das Victoriaschießen bessert nit viel an unserer Noth und machet die Toten auch nit lebendig. Nun bin ich mit meinem Briefe fertig und hoffe, daß er dich, herzlieber Bruder Fritz, bei guter Gesundheit antreffen wird und daß du recht bald nach Hause kommst.
Deine dich herzlich liebende Schwester Dorothea.“
*
Ja, der Brief bringt einen auf andere Gedanken. Fritz Peetz kratzt sich unter heftigem Nachdenken die Bartstoppeln am Kinn. Ein Stolz auf die Schwester erfüllt ihn jedesmal, wenn er den Brief liest. Er ist vor Fibel und Bakel wahrhaftig auch nicht ausgerissen, und wenn er dem Schulmeister, dem ehrsamen Gottlieb Kühnebrecht, auch manchen infamen Streich gespielt, so hat er doch das Lesen und Schreiben gelernt. Aber einen so wohlgesetzten Brief wie Schwester Dorothea würde er kaum zustande bringen. Nun, das macht der Umgang, den das Schwesterchen hat. Seitdem sie in Charlottenburg im Hause des Herrn Professor Euler aufwartet, hat sie gelernt, wie eine Demoiselle zu sprechen und zu schreiben.
Aber was sie schreibt — ja, da steckt der Haken! Fritz Peetz kratzt sich das Kinn immer heftiger und nachdrücklicher. Das meiste ist natürlich unsinniges Geschwätze. Was auch versteht das Weibervolk vom Krieg! Der König kann doch keinen Frieden machen, wenn die Kaiserin nicht will! Aber sonst — Schwester Dorothea ist nicht kleinmütig und wehleidig. Es muß wahrlich nicht zum Besten stehen in Berlin, wenn sie so schreibt. Wäre auch wirklich ganz gut, wenn man einmal wieder zu Hause nach dem Rechten sehen könnte.
Und das ist der Punkt, an dem Fritz Peetz’ Gedanken hängen bleiben. Ist das so unmöglich? Er hat eine Blessur erhalten in der Schlacht. Vier Wochen wird’s mindestens dauern, bis der Arm wieder heil ist und er den Kuhfuß hantieren kann. Der Feldscher würde ihn für diese Zeit in ein Lazarett schicken. Nach Berlin wohl schwerlich, aber — kann man nicht Feldscher und Korporal einen langen Marsch pfeifen und selber nach Berlin gehen? Die Straßen sind voll von Deserteuren und Marodeuren, seitdem der König mit dem Kantonement nicht mehr auskommt, sondern Überläufer und allerlei Gesindel in die Armee einstellen muß, Leute, die bei der ersten Bataille davonlaufen und sich verdrücken, sobald sie dem Korporalstock entwetzen können. Da wird niemand einen ehrlich blessierten Grenadier aufhalten, wenn er seine Wunde in der Heimat auskurieren will.
„Das Kriegführen ist nur für Gesunde,“ hat vorhin der kluge Schäfer gesagt, und das ist wirklich so. Mit einem zerschossenen Arm ist man zu nichts nütze, weder beim Exerzieren noch in der Bataille.
„Au! Sapperlot!“ Fritz läßt den Brief aus der Hand fallen und greift wieder mit schmerzverzerrtem Gesicht nach seinem Arm. Es tut wieder scheußlich weh. Aber das Stechen geht schnell vorüber, und die Schmerzensgrimasse weicht einem listig zufriedenen Ausdruck. Der Grenadier Peetz ist entschlossen, in Anbetracht seiner Blessur, nach vier Kriegsjahren einmal wieder in die Heimat zurückzukehren.
*
Der Abend ist gekommen, aber die kleine Stube des Schäfers ist trotzdem hell. Nicht die Abendsonne ist es, die ihren glühenden Schein durch das kleine Fenster wirft. Dörfer und Bäume stehen da draußen in Flammen. Wie eine dunkle Woge wälzt sich der Krieg über Kunersdorf herein. Pferdegetrampel, Wagenrollen, scheltende, fluchende Stimmen, heisere Kommandorufe. Die Dorfstraße donnert es entlang, Kolonnen, Schwadronen, Bataillone.
Fäuste hämmern gegen die Tür. Ein Schwall von Menschen quillt herein, erfüllt im Nu die Stube mit Schlachtfeldgeruch. Soldaten, blutüberströmt, auf müde Kameraden gestützt, todmüde, todwunde Männer ohne Waffen und Gewehr. Zerrissene, beschmutzte Uniformen, wutverzerrte Gesichter.
„Hier ist Platz!“ Der Schäfer wird förmlich an die Wand gedrängt und übersehen. Der Krieg nimmt sich sein Recht. „Hierher, Heinrich! Sehet zu, daß ihr Stroh findet! Schnell! Schnell!“
Neue Elendsgestalten drängen durch die Tür, sinken stöhnend auf den Fußboden, wo grade noch ein Plätzchen ist. Der alte Schäfer aber, der vorher, als die Schlacht tobte, seine Tür verschlossen und nicht einmal hinausgeguckt hatte, öffnet sie jetzt weit und nimmt die Wunden und Kranken auf, die hereindrängen wie seine Schafe in die bergende Hürde.
„Heda, Kamerad!“ Fritz Peetz zupft einen baumlangen Grenadier vom Regiment Braunschweig — Bevern am Rockschoß. „Kann er mir sagen, wie die Bataille steht?“
„Sie steht überhaupt nicht mehr, Gott sei’s geklagt!“ antwortet der Soldat, einen todwunden Kameraden behutsam auf den Boden bettend. „Die ganze Armée ist vernichtet! Der General Seydlitz gefallen, — —“
„Der König auch!“ stöhnt einer der Blessierten. „Ich sah ihn mit seinem Gaul stürzen!“
„Die verteufelte Schlucht!“ schreit ein Dritter, im Fieber die Fäuste ballend. „Fünf Regimenter sind darin verblutet!“
Fritz Peetz macht ein dummes Gesicht. „Weiß Er was vom Regiment Rammin, Kamerad?“
„Wird nicht viel übrig sein vom Regiment Rammin,“ erwidert der von Bevern rauh. „Alles hin! Fahnen! Kanonen!!“
„Teufel! Wie bei Hochkirch?“
„Schlimmer, Kamerad, schlimmer! Sag’s Ihm ja: Vernichtet sind wir! Die Armée ist auf der Flucht! Der König …“
Draußen heult die Panik. Kanoniers peitschen wild die Pferde mitten in die fliehenden Massen. Geheul, Flüche, Wehgeschrei. Der Bevern-Grenadier beugt sich nieder und streckt dem blessierten Kameraden die Tatze hin. „Mach’s gut, Heinrich!“ Gläserne Augen in wachsgelbem Antlitz. Der Tod starrt verständnislos die ausgestreckte Hand an.
„Bist besser dran als wir!“ Der Grenadier wendet sich ab und steigt über die Verwundeten am Boden zur Tür. „Können uns jetzt die Zunge aus dem Hals laufen!“
*
Ein Ächzen und ein lautes Schimpfwort lassen den alten Schäfer, der ruhig und bedachtsam seine blutigen Gäste verbindet, aufsehen. Der Grenadier Fritz Peetz hat sich von seinem Strohlager aufgerappelt und steht auf schwankenden Beinen mit bleichem Gesicht da.
„Wo … wo ist mein Gewehr?“
Fieber — denkt der Alte und faßt ihn an der Schulter, um ihn niederzudrücken. Aber, so elend und schlapp Fritz auch ist, er steht wie ein Baum gegen die Hände des alten Mannes. Ärgerlich gibt der Schäfer seinen Versuch auf.
„Wohin will Er denn?“
„Zum Regiment Rammin natürlich.“ Es liegt in Fritz Peetz’ Worten ein ganz ähnliches Erstaunen wie heute morgen in dem selbstverständlichen, verwunderten „Kunersdorf“ des Dorfjungen. Wohin? Kann ein Mensch jetzt danach fragen, jetzt, wo es auf jeden einzelnen ankommt?
*
Steigende Gäule, verwirrt durcheinander rennende Menschen auf der Dorfstraße. Keine Soldaten mehr, nur Menschen, kopflose, von der Panik ergriffene Menschen. Flammen zucken durch das Dunkel. Bis zum Letzten angespannte Disziplin und Tapferkeit zerbricht in Heulen und kopfloser Flucht durch die Nacht.
„Steht! Fahnenflüchtiges Gesindel! Steht! Zu mir!“
Eine Silberschärpe blinkt. Ein Major, barhäuptig, den Degen in der Faust, wirft sich mitten auf der Straße dem Schwall entgegen. Verzerrt sein Gesicht, aus dem Kopf hervorquellend seine Augen. Disziplin, eingefleischtes Gehorchen zwingt die Panik unter sich. Ein Häuflein von Grenadieren, Füsilieren, Musketieren hält inne in der wahnsinnigen Flucht, sammelt sich zähneklappernd, stumpfblickend um den Major.
Neue Flutwelle, neue Massen branden in das Dorf, schwemmen den Major und sein Häuflein zurück gegen die Hauswände, reißen die kaum Gebändigten weiter mit sich durch die Nacht. Im Rollen und Brausen der Panik verhallt der Pistolenschuß, mit dem der verzweifelte Major von Greiner seinem Leben ein Ende setzt …
*
Fritz Peetz hat sein Gewehr zwischen die Schulter und den rechten Arm geklemmt. Mit der gesunden Linken kämpft er sich durch den Wirrwarr, quer über die Dorfstraße, bis er den Feldweg erreicht. Von hier ist er gekommen. Diesen Weg muß er zurückgehen, bis er die Stelle erreicht, wo das Regiment …
Ins Nichts geschleudert jeder Gedanke daran, ob das Regiment noch dort sein kann, wo er es verlassen. Versunken Dorotheas Brief, Berlin, die Eltern. Nur eins noch da, ein Wissen und Wollen, aus Urinstinkten hervorgebrochen: Ich muß zu meinem Regiment!
Da ist der Abhang, da der Hohlweg, durch den er gekommen. Die Panik wälzt sich drüben durch Kunersdorf. Hier ist nächtliche Stille. Nur der Geschützdonner grollt noch drüben von den Hügelketten her durch die Nacht. Fritz Peetz geht und geht, bis die Nacht noch schwärzer wird vor seinen Augen, die Knie zu zittern beginnen. Vornüber schwankt er, hat noch ein vages Bewußtsein: Nur nicht auf den blessierten Arm fallen! — dreht sich mit einer letzten Kraftanstrengung seitwärts und schlägt lang hin.
*
Die Pferde eines Proviantwagens scheuen jäh vor dem Körper, der da zuckend am Boden liegt. Der Fahrer reißt die Zügel zurück, der Schein der Blendlaterne fällt auf Fritz Peetz, der mühsam zum Schutz gegen die Pferdehufe die Linke vors Gesicht hebt.
„Drüber weg!“ schreit der Musketier, der neben dem Fahrer sitzt, und will die Peitsche schwingen. Eine Maulschelle von rückwärts läßt ihn fast vom Sitz taumeln.
„Ein Blessierter, der sein Gewehr im Arm hat!“ sagt eine ruhige Männerstimme aus dem Wagen. „Schmeiß’ Er den malhonetten Kerl da vom Bock, Fahrer, und nehm’ Er den Blessierten mit. Ist Platz für uns beide im Wagen!“
Die Stimme schwankt. Mit bleichem Gesicht streckt sich der einzige Insasse des Wagens wieder aus auf den kargen Wolldecken, während der Fahrer und der plötzlich kleinlaut gewordene Musketier abspringen und den Verwundeten aufladen.
Fritz Peetz merkt nichts mehr davon. Als sie ihn hochheben, verläßt ihn der letzte Rest von Bewußtsein. Er sieht nicht den im Mondlicht matt blinkenden Küraß des Mannes, der neben ihm im Wagen liegt und bei jedem Rumpler auf dem dunklen Weg krampfhaft die Zähne zusammenbeißt. Er merkt nichts von dem Dahinjagen über Stock und Stein, fort von dem vom Chaos durchtobten Kunersdorf, aus dessen Strohdächern plötzlich die grelle Lohe schießt.
„Halt! Wer da!“ Eine Husarenvedette sperrt mit gezücktem Pistol die Landstraße. Grimmige, gepichte Schnauzbartgesichter, entschlossen, jeden Deserteur über den Haufen zu schießen. Der Fahrer, ein Kürassier vom Regiment Rochow, hält nur um ein Weniges seine Gäule an.
„Platz da, Husaren! Wir haben einen Blessierten im Wagen! Den General Seydlitz!“
2. Kapitel
„J’ai gagné mon procès!“
Aus Spitzen und schwerer Seide streckt sich die Alabasterhand der Gräfin Dißkau entzückt dem Hofrat zum Kuß entgegen. „Sind Sie sicher, daß die Fama nicht übertreibt, mein lieber Wackenitz?“
„Kein Gerücht, verehrungswürdigste Gräfin, Gewißheit. Dresden ist über.“
„Und der König von Preußen?“
„Hat seit der Affaire von Kunersdorf den Mut verloren. Minister Finckenstein hat durch einen königlichen Kurier Instruktions empfangen, die von entscheidender Bedeutung sein müssen. Man sagt, daß der König die Regierung seinem Bruder Heinrich übertragen haben soll.“
„Man sagt!“ Die schöne Gräfin Dißkau verzieht ein wenig den Mund. „Dresden ist also in den Händen der Österreicher?“
Der Hofrat Wackenitz verbeugt sich. „Graf Schmettau, der preußische Kommandant von Dresden, hat die Stadt dem General der Kaiserin und Königin übergeben. Auf Befehl seines Königs, der das Nutzlose einer Verteidigung wohl einsehen mochte.“
„So wird der entsetzliche Krieg nunmehro zu Ende sein,“ sagt von dem kleinen, mit rosafarbenem Damast bezogenen Sofa eine vollklingende, tiefe Männerstimme. Die Gräfin Dißkau nickt ihr zu. Ihre Augen leuchten.
„Kunersdorf, Maxen, Dresden! Ja, mein Freund, das ist das Ende für Friedrich. Für mich aber der Anfang! Seine Majestät, der polnische König August III., wird wieder in seine sächsische Hauptstadt einziehen. Dresden wird wieder der Mittelpunkt des Glanzes werden. Und ich …“
„Man sagt, daß Mademoiselle von Osterau sich in der unmittelbaren Umgebung des Königs von Sachsen befinde,“ wirft der Hofrat Wackenitz vorsichtig ein. Die schöne Dißkau lächelt verächtlich.
„Mag sie, lieber Hofrat! Die Osterau kann August III. nicht mehr bedeuten als — andere. Ich aber werde zurückkehren mit einem Gewinn, den niemand sonst dem König zu bieten hat.“ Ihre ringgeschmückte Hand hebt leicht einen Band in die Höhe, der auf dem zierlichen Spieltischchen liegt. „Ich darf das Werk, das Sie mir gewidmet haben, liebster Euler, doch S. Majestät, dem König August vorlegen?“
Der Astronom Bernhard Euler nickt bedächtig. „Es ist Ihnen zugeeignet, Gräfin. Verfügen Sie darüber nach Belieben.“
„Dank, mein Freund!“ Tief tauchen die schönen Augen in den Blick des Gelehrten. „König August ist ein Freund der Wissenschaften. Er wird nicht zögern, Sie an seinen Hof zu berufen. Ein Arbeitsfeld wird sich Ihnen eröffnen, wie es Ihre Phantasie nie erträumt. Denken Sie an die Mittel, die König August dem Herrn von Klettenberg für sein Laboratorium zur Verfügung gestellt hat!“
Bernhard Eulers Gesicht verfinstert sich. „Ich bin kein Alchimist und Goldmacher, gnädigste Gräfin. Die Bahnen der Gestirne …“
„Ich weiß, ich weiß, Bester. Wie können Sie denken, daß ich Sie vergleichen will mit einem Scharlatan! Sagen sie selber, Hofrat Wackenitz: Wird der König jemals unseren verehrten Professor anerkennen? Hat er ihn und seine Arbeit jemals protegiert?“
„Hm.“ Der Hofrat zieht die Schultern hoch. „Seine Majestät haben ja wohl in den letzten Jahren anderes zu bedenken gehabt als die Wissenschaften.“
„Der Krieg!“ Bernhard Euler steht auf und ballt unwillkürlich die Fäuste. „Geld, Blut und Menschen für den Krieg! Alle Mittel des Staates, Hekatomben von Menschenleben! Um eine Chimäre! Um den Ruhm! Ich hasse den Krieg!“
Stark und laut klingen die Worte, so daß der Hofrat Wackenitz zusammenzuckt und unwillkürlich einen ängstlichen Blick nach der Tür wirft. Die schöne Gräfin Dißkau aber schwebt dicht an den Gelehrten heran. Vertraulich, schmeichelnd legt sie ihre Hand auf seine Schulter.
„Der Krieg wird zu Ende sein, mein Freund. Von diesen Schlägen wird sich der König von Preußen nicht mehr erholen. Friede wird sein, glanzvoller Friede. Und wir, mein Freund —, wir werden in Dresden beisammen bleiben. Gehen Sie jetzt, lieber Euler! Gehen Sie, Hofrat, und nehmen Sie die Versicherung mit, daß ich mich Ihrer in Dresden erinnern werde.“
Tiefe, chevalereske Verbeugung. Die beiden Herren küssen der Gräfin Dißkau die Hand und ziehen sich zurück. Draußen, im Vorgemach, verbeugen sie sich noch einmal höflich gegeneinander, bieten sich beflissen den Vortritt an. Hinter dem Professor Euler, der festen Schrittes, erhobenen Hauptes die Treppe hinuntersteigt, tänzeln die vorsichtigen Schritte des Hofrats. Ein verkniffenes, spöttisches Lächeln hat der Herr von Wackenitz auf den Lippen. Kein Zweifel, der da vor ihm hat manches voraus. Eine kräftige, männliche Gestalt, neben der sein eigener, gekrümmter Rücken eine etwas trübe Rolle spielt. Professor Euler hat einen Stein im Brett bei der schönen Dißkau. Wäre unklug, sich das zu verschweigen. Aber, ah! — Er ist zu steif, zu gelassen! Man könnte ihn in einen preußischen Grenadierrock stecken, den Professor Euler! Schöne Frauen aber wollen den Reiz, den sie ausstrahlen, sich widerspiegeln sehen in sehnsuchtfiebernden Augen, wollen umworben, angebetet sein. Mag der Herr Euler vorläufig den Vortritt haben. Immer sich beugen, niemals brechen! Auf die Dauer wird die geschmeidige Hofkunst, die Galanterie und Flatterie doch den Sieg davontragen über den allzu kräftigen, allzu ruhigen Gelehrten! Auf die Dauer wird sie seiner doch müde werden — die wunderschöne Gräfin Dißkau!
*
Das ist also die schöne Gräfin Dißkau! Weiland ein Stern des sächsischen Hofes, auserkorene Nachfolgerin ihrer Mutter, der allmächtigen Favoritin Augusts des Starken, Kurfürsten von Sachsen und Königs von Polen.
Generale und Minister haben sich vor ihr verbeugt, als sie noch eine Vierzehnjährige war. Denn jedermann wußte, daß eine Bitte an die Mutter am sichersten durch die Tochter ging. Ehrgeiz, fast an Größenwahn grenzendes Geltungsbedürfnis haben sich damals in ihr Herz eingenistet. Leonore von Dißkau, die Vierzehnjährige, hatte damals schon am Hof zu Dresden ihre kleine „Partei“, war entschlossen, eines Tages die eigene Mutter in der Gunst des Königs zu verdrängen.
Aber die Tage, da die Gräfin Dißkau, Leonorens Mutter, die diamantenen Rosen Augusts des Starken stolz an ihrem Busen trug, schwanden. Sie sank in Bedeutungslosigkeit zurück wie die Königsmarck, die Kosel, die Kessel, die Lubomirska, die Esterle, die Denhof. Wie all die großen und kleinen Pompadours am Hof Augusts des Starken.
Noch bevor der Staatsminister Graf Brühl seine Ränke spann zwischen Dresden, Wien, Paris und Petersburg, noch bevor der Preußenaar bei Kesselsdorf seine Fänge wies, starb die einstige Favoritin Augusts des Starken in der Einsamkeit, und Leonore, ihre Tochter, wuchs fern von Dresden in dem für ihre Begriffe öden, langweiligen Berlin auf.
Sie reifte zu einer Frau heran, deren Schönheit die der Mutter überstrahlte. Aus der ehrgeizigen, herrschsüchtigen Vierzehnjährigen ist eine erfahrene, diplomatische Dame geworden. Aber in ihrem Herzen brennt immer noch unbefriedigte Sehnsucht nach Geltung und Macht.
Könige halten nicht immer, was Kronprinzen versprechen. Man sieht es an diesem Friedrich von Preußen. Ein Fürst der Philosophen schien er werden zu wollen, ein geistreicher, schöngeistiger Herrscher, von dem die Welt einen üppigen, medicäischen Hof erwartete. Die gestürzte Gräfin Dißkau selbst hatte keine bessere Hoffnung gewußt, als sich in das Land des geistvollen Herrn von Rheinsberg zurückzuziehen. Und dieser Mann stand nun schon jahrelang im Felde. Rheinsberg lag verödet. In Berlin und Potsdam dröhnten die Paradeschritte der Bataillone.
Auch in Dresden ist alles anders gekommen. Der Kurprinz hatte sich seinerzeit mit Unwillen und Verachtung von der zügellosen Genußsucht Augusts des Starken abgewendet. Am Hofe Augusts III. und seiner streng katholischen Gemahlin schien kein Platz zu sein für Favoritinnen und Günstlinge. Nun, dieser selbe August III. zappelt seit Jahren in den Händen des allmächtigen Brühl, deckt die schandbare Verschwendungssucht dieses