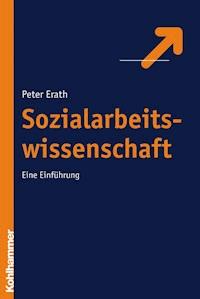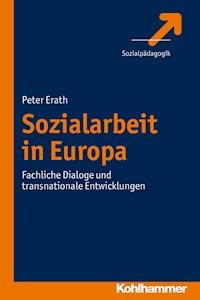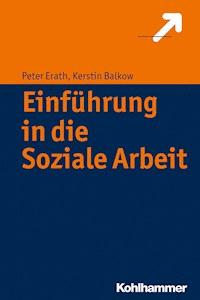
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band bietet die seit Langem geforderte umfassende Einführung in eine Soziale Arbeit, die sich heute nicht nur als unverzichtbare Praxis und anschlussfähige Profession, sondern auch als wissenschaftliche Disziplin und anerkanntes Lehrgebiet präsentiert. Die Darstellung eröffnet einen fundierten Einblick in die Praxis der Sozialen Arbeit und das breite Spektrum ihrer Arbeits- und Anwendungsfelder. Es folgt eine systematische Einführung in die wissenschaftlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit. Das Buch widmet sich darüber hinaus dem Studium der Sozialen Arbeit und skizziert die Grundzüge einer Profession Soziale Arbeit. Auf diese Weise wird nicht nur eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu einer reflexiven Praxis möglich, zugleich kann ein öffentliches Bild entstehen, das dazu beiträgt, die grundlegenden Intentionen der Sozialen Arbeit als Intervention, Prävention und Gesellschaftskritik glaubhaft zu kommunizieren und zum Wohle aller nutzbar zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 947
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Erath, Kerstin Balkow
Soziale Arbeit
Eine Einführung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-028727-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-028728-0
epub: ISBN 978-3-17-028729-7
mobi: ISBN 978-3-17-028730-3
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort
Wer dieses Buch zur Hand nimmt, hat sich meist schon dafür entschieden, mit dem Studium der Sozialen Arbeit zu beginnen. Wir glauben, dass der Beruf „Sozialarbeiter/in“ eine gute Wahl darstellt, weil die damit verbundene Tätigkeit in einem Feld stattfindet, das aufgrund seiner historischen Entwicklung und seiner spezifischen Eigenart noch sehr wenig durch enge Vorgaben und Regulierungen, straffe Führungssysteme oder rigide Ergebnisvorgaben besetzt ist. Eine Tätigkeit im Bereich der Sozialen Arbeit eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich als ganze Person mit den eigenen Qualitäten einzubringen, etwa als Drogenberater/ -in, als professionelle/r Begleiter/in von Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen, als Leiter/in eines Sozialdienstes, als Qualitätsbeauftragte/r oder Sozialarbeitswissenschaftler/in etc.
Gerade weil es sich bei der Sozialen Arbeit um eine sehr komplexe Tätigkeit handelt, die nicht nur ein vielfältiges konzeptionelles und methodisches Wissen voraussetzt, sondern auch die Fähigkeit zum eigenständigen wissenschaftlichen Denken und Arbeiten, sind die gestellten Anforderungen sehr hoch. Aufgrund der Fülle der mit den verschiedenen Aufgaben verbundenen Themenstellungen und Diskurse ist unser Buch in vier Teile gegliedert: Teil I identifiziert und systematisiert unterschiedliche Problemstellungen und diskutiert vorhandene Lösungsvorschläge im Bereich der „Praxis“. Teil II mit dem Untertitel „Wissenschaft“ liefert das erforderliche wissenschaftliche Grundwissen, welches die (meta)theoretischen Voraussetzungen dafür bietet, um Soziale Arbeit als Ganzes beobachten und verstehen zu können. Teil III führt dann die grundlegenden Anforderungen auf, die an das „Studium“ der Sozialen Arbeit gestellt werden müssen. Teil IV mit dem Titel „Profession“ skizziert schließlich die Diskurse, die geführt werden müssen, um die Soziale Arbeit gegenüber ihrer Klientel und der Gesellschaft entsprechend klar zu positionieren und sich von frei-gemeinnützigen Tätigkeiten genügend profiliert abzusetzen.
Natürlich sind ein Autor und eine Autorin nicht annähernd in der Lage, neben dem üblichen Lehr- und Forschungsbetrieb ein so umfängliches Werk in einem angemessenen Zeitraum fertigzustellen. Unser besonderer Dank gilt daher insbesondere Devi Erath für die Beratung bei methodologischen Fragen, Markus Rossa für wichtige Beiträge zur Professionsentwicklung, Philipp Huslig-Haupt für die Federführung im Bereich der Literaturrecherchen, Jutta Harrer für zeitaufwändige Hilfen bei der Manuskriptgestaltung und Rosalie Müller für weitere Unterstützungsleistungen.
Für Geduld, Unterstützung und aufmunternde Worte sei unseren beiden Ehepartnern Beatrix Erath und Gunnar Balkow unendlich gedankt!
Peter Erath und Kerstin Balkow
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Teil I Soziale Arbeit als Praxis
1 Aufgaben, Ziele und Strategien der Sozialen Arbeit
1.1 Soziale Arbeit als historisch vermittelte Praxis des Helfens
1.2 Strategien der Sozialen Arbeit
1.3 Funktionen der Sozialen Arbeit
1.4 Zur Realisierung der drei Strategien der Sozialen Arbeit
2 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Methoden der Sozialen Arbeit
2.1 Kinder- und Jugendhilfe
2.2 Erziehungs- und Familienhilfe
2.3 Erwachsenenbildung
2.4 Altenhilfe
2.5 Gefährdetenhilfe/Resozialisierung
2.6 Gesundheit/Rehabilitation
2.7 Armut und Ausgrenzung
2.8 Interkulturelle/Internationale Soziale Arbeit
2.9 Sozialraumorientierte Soziale Arbeit
2.10 Sozialwirtschaft
3 Personales und fachliches Handeln in der Sozialen Arbeit
3.1 Soziale Arbeit als personale Praxis: Persönlichkeit und Kompetenzprofil
3.2 Soziale Arbeit als fachliche Praxis: Arbeitshilfen und Handlungskonzepte
3.3 Soziale Arbeit als personal verantwortete und fachlich begründete Praxis
4 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit
4.1 Soziale Arbeit im Welfare Mix
4.2 Soziale Arbeit als Praxis des „Förderns und Forderns“ im aktivierenden Sozialstaat
4.3 Soziale Arbeit als administrative Praxis im Neuen Steuerungsmodell
4.4 Soziale Arbeit als verbandliche Praxis im Wohlfahrts- pluralismus
4.5 Soziale Arbeit als organisationale Praxis: Qualitäts- management
4.6 Praxis zwischen Ideal-Selbst und konkreten Arbeitsbedingungen
5 Soziale Arbeit als mündige Praxis
5.1 Soziale Arbeit als reflektierte Praxis
5.2 Soziale Arbeit als reflexive Praxis
5.3 Soziale Arbeit als diversitäre Praxis
5.4 Soziale Arbeit als interprofessionelle Praxis
6 Soziale Arbeit als zukunftsfähige Praxis
Teil II Soziale Arbeit als Wissenschaft
7 Soziale Arbeit und Wissenschaft
7.1 Warum braucht Soziale Arbeit Wissenschaft?
7.2 Was ist Wissenschaft?
7.3 Ist die Soziale Arbeit bereits wissenschaftsfähig?
7.4 Zusammenfassung und Bewertung
8 Gegenstand der Sozialarbeitswissenschaft und Typus
8.1 Terminologische Klärungen
8.2 Soziale Arbeit als transdisziplinäre Wissenschaft
8.3 Soziale Arbeit als disziplinäre Einheit
8.4 Interdisziplinarität der Sozialarbeitswissenschaft
8.5 Zusammenfassung und Bewertung
9 Das Programm der Wissenschaft der Sozialen Arbeit
9.1 Theoriebildung: Entwicklung konkurrierender Theorien und Modelle
9.2 Forschung: Empirische Überprüfung von Theorien
9.3 Konsistenzprüfung: Sicherung des Wissensbestands der Disziplin
9.4 Wissenstransfer: Entwicklung von Empfehlungen zur Gestaltung der Praxis
9.5 Anschlussfähigkeit: Wissenschaftlicher Austausch und konsistente Lehre
9.6 Zusammenfassung und Bewertung
10 Hermeneutische Sozialarbeitswissenschaft
10.1 Das Paradigma: Helfen als Verstehen und Begleiten
10.2 Hermeneutische Theorien der Sozialen Arbeit
10.3 Modelle der hermeneutischen Sozialen Arbeit
10.4 Hermeneutische Methoden und Techniken
10.5 Zusammenfassung und Bewertung
11 Normative Sozialarbeitswissenschaft
11.1 Das Paradigma: Helfen als Normieren und Aufbauen
11.2 Normative Theorien der Sozialen Arbeit
11.3 Normative Modelle der Sozialen Arbeit
11.4 Normative Methoden und Techniken
11.5 Zusammenfassung und Bewertung
12 Empirische Sozialarbeitswissenschaft
12.1 Das Paradigma: Helfen als Diagnostizieren und Intervenieren
12.2 Empirische Theorien der Sozialen Arbeit
12.3 Modelle der empirischen Sozialarbeitswissenschaft
12.4 Empirische Methoden und Techniken
12.5 Zusammenfassung und Bewertung
13 Kritische Sozialarbeitswissenschaft
13.1 Das Paradigma: Helfen als Kritisieren und Emanzipieren
13.2 Kritische Theorien der Sozialen Arbeit
13.3 Modelle der Kritischen Sozialen Arbeit
13.4 Kritische Methoden und Techniken
13.5 Zusammenfassung und Bewertung
14 Systemisch-konstruktivistische Sozialarbeitswissenschaft
14.1 Das Paradigma: Helfen als Irritieren und Konstruieren
14.2 Systemisch-konstruktivistische Theorien der Sozialen Arbeit
14.3 Systemisch-konstruktivistische Modelle
14.4 Systemisch-konstruktivistische Methoden und Techniken
14.5 Zusammenfassung und Bewertung
15 Sozial-ökologische Sozialarbeitswissenschaft
15.1 Paradigma: Helfen als Bilanzieren und Befähigen
15.2 Theorien der sozialökologischen Sozialen Arbeit
15.3 Modelle der sozialökologischen Sozialen Arbeit
15.4 Sozial-ökologische Methoden und Techniken
15.5 Zusammenfassung und Bewertung
16 Forschung in der Sozialen Arbeit
16.1 Entwicklung und Stand der Sozialarbeitsforschung
16.2 Empirisch-quantitative Sozialarbeitsforschung
16.3 Empirisch-qualitative Sozialarbeitsforschung
16.4 Theoretische Sozialarbeitsforschung
16.5 Praxisforschung
Teil III Studium
17 Der Studiengang Soziale Arbeit
17.1 Die Akademisierung der Sozialen Arbeit
17.2 Die Bologna-Reform
17.3 Die neuen Studienabschlüsse
17.4 Wichtige Aspekte bei der Studienwahl
18 Lehr- und Beteiligungsformen an Hochschulen
18.1 Akademisches Lehren und Lernen
18.2 Praktisches Lehren und Lernen
19 Selbststudium, wissenschaftliches Arbeiten, studentische Forschung
19.1 Regeln des wissenschaftliches Arbeitens und Forschens
19.2 Anleitung zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten
19.3 Hinweise für die Durchführung empirischer Arbeiten
19.4 Einige Tipps für angehende Sozialarbeitswissenschaftler/innen
20 Soziale Arbeit als akademische Tätigkeit
Teil IV Soziale Arbeit als Profession
21 Vom Beruf zur Profession
21.1 Stadien der Verberuflichung der Sozialen Arbeit
21.2 Versuche zur professionstheoretischen Bestimmung Sozialer Arbeit
21.3 Soziale Arbeit als „postmoderne“ Profession
21.4 Professionalisierung durch Akademisierung und Selbstorganisation
22 Soziale Arbeit als berufliche Tätigkeit – Positionen und Aufgaben
22.1 Schwierigkeiten bei der Personalentwicklung und Karriereplanung
22.2 Positionen, Aufgaben und Fallbeispiele
22.3 Personalentwicklung als Zukunftsaufgabe
23 Die Profession und ihre Klientel
23.1 Soziale Arbeit als schützende Profession: der Klient/ die Klientin
23.2 Soziale Arbeit als ausführende Profession: der Proband/ die Probandin
23.3 Soziale Arbeit als gestaltende Profession: der Adressat/ die Adressatin
23.4 Soziale Arbeit als Dienstleistung: der Nutzer/die Nutzerin
23.5 Soziale Arbeit als Geschäft: der Kunde/die Kundin
23.6 Soziale Arbeit als rechtliche Praxis: der/die Leistungs- berechtigte
23.7 Soziale Arbeit als politische Praxis: der Bürger/die Bürgerin
23.8 Soziale Arbeit als verständigungsorientiertes Handeln
24 Profession und frei-gemeinnützige Tätigkeit
24.1 Vom Ehrenamt zur frei-gemeinnützigen Tätigkeit
24.2 Die (zunehmend) freiwillige Gesellschaft – Zur Datenlage
24.3 Frei-gemeinnützige Tätigkeit im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen
24.4 Funktionen frei-gemeinnütziger Tätigkeiten
24.5 Soziale Arbeit und Freiwilligen(mit)arbeit
24.6 Freiwilligenmanagement
25 Profession und Öffentlichkeit
25.1 Selbst- und Fremdbild der Profession
25.2 Grundprobleme der öffentlichen Darstellung
25.3 Soziale Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
25.4 Die Herausforderung an die Profession: Arbeiten am komplexen Bild
26 Soziale Arbeit als etablierte und anschlussfähige Profession
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einführung
Ausgangspunkt
Die hier vorgelegte Einführung in die Soziale Arbeit will die Leser/innen1 dabei unterstützen, sich einen Überblick über den Stand der Diskussion in allen wichtigen Bereichen der Sozialen Arbeit zu verschaffen. Ausgangsprämisse ist, dass die gegenwärtige und möglicherweise auch zukünftige Gesellschaft nur dann noch dazu bereit ist, eine über Steuergeld finanzierte Praxis der psychosozialen Hilfen aufrechtzuerhalten, wenn die Soziale Arbeit sich ihrerseits dazu verpflichtet, sich kontinuierlich zu verbessern. Geschehen kann dies jedoch nur, wenn die dafür Verantwortlichen bereit sind, Soziale Arbeit vierfach zu unterscheiden, nämlich als
1. Praxis, welche autonom agiert und sich zunächst pragmatisch etabliert;
2. Wissenschaft, die dabei hilft, gängige Programme durch Theoriebildung und Forschung zu reflektieren und zu legitimieren;
3. Studium, welches allein auf Dauer den Zugang zur entsprechenden Tätigkeit eröffnet sowie
4. Profession, die erst die Voraussetzung dafür bietet, dass fachliche und ethische Standards entwickelt und flächendeckend umgesetzt werden können (siehe Abb. 1).
Abb. 1: Soziale Arbeit als Praxis, Profession, Wissenschaft und Studium
Zielsetzung des Buches
Die hier vorliegende Darstellung will den Leser/innen einen Überblick über die verschiedenen Fachdebatten geben und zugleich einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Sozialarbeitswissenschaft leisten. Dazu gilt es,
1. Soziale Arbeit als unverzichtbare, komplexe und zukunftsfähige Praxis einer modernen bzw. postmodernen Gesellschaft zu kennzeichnen und zu begründen;
2. Soziale Arbeit als eine Wissenschaft zu konstituieren, die in der Lage ist, vorhandene Paradigmen, Theorien und Modelle systematisch einzuordnen, auf ihre Relevanz zu befragen und die Ergebnisse der Sozialarbeitsforschung umfassend darzulegen und methodenkritisch zu diskutieren;
3. die seitens der Studierenden erforderlichen Bedingungen für den Einstieg in das Studium der Sozialen Arbeit sowie die Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Weiterqualifizierung zu benennen und zu charakterisieren;
4. die in der derzeitigen Diskussion herausragenden professionstheoretischen Fragen zu identifizieren und die dahinter liegenden Argumentationsmuster zu befragen, zu durchdenken und zu diskutieren.
Gerade für Studierende und Praktiker/innen der Sozialen Arbeit ist die Kenntnis der verschiedenen Argumentationen und Positionen vor allem deshalb von großem Nutzen, weil sie damit sowohl einen Einblick und Vorausblick in die mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängenden fachlichen Debatten erhalten als auch eine Einführung in den Diskussionstand ihrer professionellen „Community“. Sich darin auszukennen und kompetent zu bewegen, ist eine Grundvoraussetzung für die bewusste und kompetente Aufnahme und Durchführung einer Tätigkeit im Bereich der Sozialen Arbeit!
Aufbau des Buches
Diese Einführung in die Soziale Arbeit ist in vier Teile gegliedert:
Teil I Soziale Arbeit als Praxis
Im ersten Teil erfolgt eine Einführung in den Bereich „Soziale Arbeit als Praxis“. Dabei geht es zunächst darum zu zeigen, dass sich Soziale Arbeit zuallererst als Praxis konstituiert und etabliert hat. Die Ziele und Aufgaben der Sozialen Arbeit, die im ersten Kapitel dargestellt werden, sind Folge einer historischen Entwicklung, die dazu geführt hat, dass heute insbesondere drei Intentionen mit der Sozialen Arbeit verbunden werden: Intervention, Prävention, Gesellschaftskritik (Kap. 1). Wie bedeutend der Beitrag der Sozialen Arbeit in modernen Gesellschaften geworden ist, soll im zweiten Kapitel dargelegt werden. Denn in den letzten 30 Jahren hat sich eine kontinuierliche Ausweitung ihrer Arbeitsfelder und Zielgruppen vollzogen, sodass man sagen kann: Soziale Arbeit ist in allen sozialen Bereichen der Gesellschaft zu einer unverzichtbaren Mitspielerin geworden (Kap. 2). Welche Voraussetzungen Sozialarbeiter/innen mitbringen müssen, um im Rahmen dieser ständig steigenden Anforderungen fachlich fundiert und personal verantwortlich handeln zu können, wird im dritten Kapitel beschrieben. Zentrale Kompetenzen, wie z. B. die Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz werden beschrieben und wichtige Konzepte für fachliches und methodisches Handeln als Grundlage für gute Praxis vorgestellt (Kap. 3). Über die Voraussetzungen und Bedingungen sozialarbeiterischen Handelns informiert das vierte Kapitel. Denn Soziale Arbeit ist eingebunden in rechtliche, wohlfahrtsstaatliche, ökonomische etc. Bedingungen, die es zur Kenntnis zu nehmen und im Rahmen von Qualitätsmanagementsystemen im Sinne der Ziele und Aufgaben der Sozialen Arbeit umzusetzen gilt (Kap. 4). Natürlich kann die Soziale Arbeit ihre komplexen Aufgaben nicht einfach erledigen und abhaken. Die jeweiligen Zielsetzungen müssen aufgrund der konkreten Umstände häufig verändert und eingeschlagene Wege umgelenkt werden. Sozialarbeiter/innen kommen also nicht ohne eine ständige Reflexion ihrer Praxis aus. Dies schließt auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Professionen ein (Kap. 5).
Zusammenfassend kann also im letzten Kapitel dieses Teils formuliert werden: Gute Praxis kann dann entstehen, wenn sich die Soziale Arbeit ihrer Stärken als Praxis bewusst ist. Sie muss ihren historischen Wurzeln treu bleiben und zunächst vor allem pragmatisch und konkret vor Ort handeln. Dieses Handeln muss aber eng an den Interessen der Klienten und Klientinnen orientiert bleiben und daher im Dialog mit dem Ziel erfolgen, diese dabei zu unterstützen, zu autonomen und verantwortungsbewussten Subjekten ihres eigenen Lebens zu werden (Kap. 6).
Teil II Soziale Arbeit als Wissenschaft
Im zweiten Teil erfolgt eine Einführung in den Bereich der „Wissenschaft der Sozialen Arbeit“. Dabei geht es zunächst darum zu zeigen, dass Soziale Arbeit sich nicht nur als Praxis oder Profession verstehen darf, sondern sich auch ganz explizit als Wissenschaft konstituieren muss. Denn die Anschlussfähigkeit an das Wissenschaftssystem erlaubt der Sozialen Arbeit, ihre eigene Reflexionsfähigkeit zu vertiefen und damit ihre gesellschaftliche Anerkennung zu steigern (Kap. 7). Das daran anschließende Kapitel befasst sich mit der Überlegung, wie die Sozialarbeitswissenschaft im Gefüge der bereits existierenden Wissenschaften zu denken ist und inwiefern sie sowohl als disziplinäre Einheit wie auch als interdisziplinäre Wissenschaft entworfen werden kann (Kap. 8). Ein nächstes Kapitel setzt sich dann mit der Frage auseinander, in welche Richtung sich die Sozialarbeitswissenschaft programmatisch entwickeln muss, um Anschluss an die allgemeine Wissenschaftsentwicklung zu gewinnen und welche Fragestellungen es zu beantworten gilt: Theoriebildung, Forschung, Konsistenzprüfung, Wissenstransfer, Lehre (Kap. 9). In den sich daran anschließenden Kapiteln 10 bis 15 werden die verschiedenen erkenntnistheoretischen Zugänge vorgestellt: die hermeneutische Theorie, welche die Soziale Arbeit als eine Synthese von Verstehens- und psychosozialen Unterstützungsleistungen konstruiert (Kap. 10), die normative Theorie, die der Sozialen Arbeit den Auftrag der Normensetzung und Wertevermittlung erteilt (Kap. 11), die empirische Theorie, die Soziale Arbeit am Ideal der technisch optimalen Intervention ausrichtet (Kap. 12), die kritische Theorie, die der Sozialen Arbeit die Aufgabe der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse zuweist (Kap. 13), die systemisch-konstruktivistische Theorie, die von der Unmöglichkeit von Interventionen ausgeht (Kap. 14) und die sozialökologische Theorie, die Soziale Arbeit als Vermittlungsarbeit zwischen Subjekt und dessen Umwelt begreift (Kap. 15). Alle sechs Theoriestränge werden zunächst bezüglich ihrer Kernaussagen kurz charakterisiert, daran schließen sich dann jeweils die Darstellung wichtiger zeitgenössischer Theorien, Modelle sowie exemplarisch ausgewählter Methoden und Techniken an. Das diesen Teil abschließende Kapitel bietet schließlich einen Überblick über den Stand der Sozialarbeitsforschung. Unterschiedliche Forschungstypen werden präsentiert und anhand von Beispielen kurz veranschaulicht und diskutiert (Kap. 16).
Teil III Soziale Arbeit als Studium
Im dritten Teil erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Fragestellungen rund um das Thema: „Studium der Sozialen Arbeit“. Dazu erfolgt zunächst eine Einführung in die Besonderheiten des Studiengangs sowie in die modular aufgebaute Studienstruktur. Diese muss vor dem Hintergrund der Vorgaben der Bologna-Erklärung, die im Jahr 1999 von 29 europäischen Bildungsministern und Bildungsministerinnen unterschrieben worden ist, interpretiert und verstanden werden (Kap. 17). Es folgt dann eine Einführung in die Traditionen und Gepflogenheiten akademischen Lehrens und Lernens sowie in die Verfahren zur Steuerung und Umsetzung der praktischen Studienanteile. Daraus resultieren wichtige Tipps für Studierende zur Gestaltung des Praktikums (Kap. 18). Das anschließende Kapitel führt dann in die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens ein, gibt Anleitungen zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten und erläutert und konkretisiert Grundsätze bei der Entwicklung von Forschungsdesigns sowie von Master- und Promotionsarbeiten (Kap. 19). Im abschließenden Kapitel wird noch einmal thesenartig zusammengefasst, was von zukünftigen Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen erwartet wird und warum heute ein Studium und die ständige Weiterbildung zu unverzichtbaren Voraussetzungen dieser Tätigkeit geworden sind (Kap. 20).
Teil IV Soziale Arbeit als Profession
Im vierten Teil findet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Themenbereich „Soziale Arbeit als Profession“ statt. Dazu erfolgt zunächst eine kurze historische Einführung in die verschiedenen Stadien der Verberuflichung der Sozialen Arbeit, in ausgewählte Professionstheorien und deren Grundproblematik. Schließlich werden noch einige Bedingungen formuliert, die Voraussetzung dafür sind, dass die Soziale Arbeit als anerkannte Profession gelten kann (Kap. 21). Daran anschließend werden Fragen der Berufseinmündung und Karriereentwicklung behandelt. Dabei werden anhand von Fallgeschichten mögliche berufliche Positionen im Bereich der Sozialen Arbeit aufgezeigt und die Frage diskutiert, was in den Organisationen geschehen muss, um auch noch zukünftig genügend Interessentinnen und Interessenten für dieses Berufsfeld gewinnen zu können (Kap. 22). Dass die Soziale Arbeit sehr unterschiedliche Begriffe für die Benennung der Personen, mit denen sie es zu tun hat, verwendet und welche Konsequenzen dies jeweils für die praktische Arbeit hat, wird im folgenden Kapitel dargestellt. Die teilweise häufig unbedachte Verwendung von Begriffen wie Klient/in, Adressat/in, Proband/in, Nutzer/in, Kunde/Kundin, Leistungsberechtigte/r etc. lässt darauf schließen, dass die Organisationen aufgerufen sind, hier Entscheidungen bei der Verhältnisbestimmung zu treffen, die für alle bindend sind und Orientierung geben (Kap. 23). Danach wird der Zusammenhang zwischen Ehrenamt und Profession im Bereich der Sozialen Arbeit thematisiert. Dabei geht es vor allem darum zu zeigen, dass die Soziale Arbeit die vielfältigen Veränderungen im Bewusstsein, im Bereich der Motivation, der Erwartungen etc. von „frei-gemeinnützig Tätigen“ zur Kenntnis nimmt und Strategien entwickelt, um das gegenseitige Verhältnis zum Vorteil aller Klienten und Klientinnen zu gestalten (Kap. 24). Ähnliches gilt für das Verhältnis zur Öffentlichkeit: Hier gilt es sich darüber im Klaren zu werden, welches Bild Soziale Arbeit nach außen vermitteln möchte und welche Strategien dazu beitragen können, sie angemessen zu repräsentieren. Momentan zumindest bietet die Soziale Arbeit ein eher uneinheitliches Bild, das zu Nachteilen in der öffentlichen Wahrnehmung und Bewertung führen muss (Kap. 25). Abschließend stellt sich dann noch einmal die Frage, was geschehen kann, um die Soziale Arbeit als Profession zu etablieren. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die notwendige Anerkennung durch andere Personen und Teilsysteme der Gesellschaft. Diese wird möglich, wenn es der Sozialen Arbeit stärker als bislang gelingt, ihre Anschlussfähigkeit unter Beweis zu stellen: an die konkrete Aufgabe, an methodische Entwicklungen, an organisationale Bedingungen, an Wissenschaft, an andere Professionen sowie an berufsständisch-gewerkschaftliche und internationale Entwicklungen (Kap. 26).
1 Der/die Verfasser/in haben sich in diesem Buch um eine genderneutrale Schreibweise bemüht. Ebenso wichtig war ihnen jedoch auch eine klare und verständliche Sprache. Insofern bitten wir für die dadurch manchmal notwendigen Kompromisse um Verständnis.
TEIL I SOZIALE ARBEIT ALS PRAXIS
1 AUFGABEN, ZIELE UND STRATEGIEN DER SOZIALEN ARBEIT
Fragt man die Bürger/innen nach den Tätigkeiten von Sozialarbeiter/innen, so erhält man in der Regel eher vage Antworten. Fragt man sie aber nach deren Bedeutung, dann können sich die meisten eine Gesellschaft ohne diese nicht vorstellen. Nicht immer wird dies so spektakulär ausgedrückt, wie im folgenden Zitat:
„Wer Sozialarbeiter wird, der ist, denke ich mir, ein Mensch, der anderen helfen will, der seinen Teil zu einer besseren Welt beitragen will. Sozialarbeiter sehen nur Elend, werden die halbe Zeit beschimpft und bedroht – nicht selten von denen, denen sie helfen wollen – und sind schlecht bezahlt. Darüber hinaus ist, was sie machen, ja sowieso verkehrt. Wer, der noch alle Tassen im Schrank hat, will Sozialarbeiter werden? Glücklicherweise gibt es immer noch Idealisten, die das wollen, denn gebraucht werden sie ja schon, diese Fußmatten der Gesellschaft.“ (http://britblog.blog.de/2010/01/24/sozialarbeiter-tun-leid-7863612/)
Damit zeigt sich, dass der Sozialen Arbeit offensichtlich ein unverzichtbarer Stellenwert in dieser Gesellschaft zukommt, nicht aber unbedingt allen klar ist, worin deren spezifische Aufgabe besteht. Dabei ist die Frage doch so einfach zu beantworten. Man muss sich dazu nur mit vier eng miteinander verbundenen Fragen auseinandersetzen, die wie folgt lauten:
1. Wer hat die Soziale Arbeit begründet?
2. Wie ist sie entstanden und was hat sie schließlich so bedeutsam werden lassen?
3. Was macht ihre aktuelle historische Gestalt aus?
4. Inwiefern lassen sich grundlegende Strukturen erkennen?
Diese und andere grundsätzliche Fragen sollen in diesem Kapitel behandelt werden. Dazu wird in einem ersten Unterkapitel dargestellt, wie Soziale Arbeit entstanden ist, wie sie sich historisch entwickelt hat und welche Aufgaben sie sich heute stellt (Kap. 1.1). Daran anschließend werden vor dem Hintergrund historischer Vergleiche die grundlegenden Strategien dargestellt und systematisiert, denen sich die Soziale Arbeit verpflichtet sieht. Es handelt sich dabei um drei unabhängige und miteinander zusammenhängenden Aspekte: den der Intervention, der Prävention und den der Gesellschaftskritik (Kap. 1.2). Ob sich die Soziale Arbeit darauf beschränken kann, ihre systemeigenen Strategien umzusetzen oder ob ihr nicht noch weitere oder ganz andere gesellschaftliche Funktionen zukommen müssen, wird im darauffolgenden Teilkapitel diskutiert. Hier ergeben sich unterschiedliche Perspektiven aus soziologischer, politikwissenschaftlicher und ethischer Sicht. Die Soziale Arbeit muss sich bewusst sein, dass von diesen Theorien nicht nur wichtige Hinweise kommen, sondern auch die Gefahr der „Instrumentalisierung“ ausgeht, die dazu führen könnte, dass sie ihren eigentlichen Auftrag verfehlt (Kap. 1.3). Abschließend wird dann anhand eines praktischen Beispiels, der Arbeit in einem Frauenhaus, zu verdeutlichen versucht, wie die professionseigenen Strategien konkret umgesetzt werden können. Die Organisationen der Sozialen Arbeit müssen dazu innerbetriebliche Strukturen schaffen, die es ihnen erlauben, sowohl konzeptionell (ganzheitlich) zu denken als auch arbeitsteilig und differenziert (im Sinne der drei Strategien) zu handeln (Kap. 1.4).
1.1 Soziale Arbeit als historisch vermittelte Praxis des Helfens
Um die Frage zu beantworten, wer die Soziale Arbeit erstmalig entwickelt und begründet hat, ist es nicht nötig, mit den alten Griechen oder frühen Christen etc. zu beginnen, wie dies in vielen Einleitungen geschieht (siehe z. B. Engelke et al. 2014). Denn dazu bietet uns das hermeneutische Denken eine überraschend einfache Antwort. Nach Wilhelm Dilthey, einem der Begründer dieser Denkrichtung, ist es „das Leben selbst“, das soziale und kulturelle Bewegungen auslöst und etabliert, denn „jede Lebensäußerung hat eine Bedeutung, sofern sie als ein Zeichen etwas ausdrückt, als ein Ausdruck auf etwas hinweist, das dem Leben angehört“ (Dilthey 1979, S. 234). Einfacher formuliert: Wenn der Mensch, wenn das Leben die Soziale Arbeit nicht bräuchte, dann gäbe es sie auch nicht bereits schon so lange. Da es sie aber offensichtlich gibt, lässt sich ihr tieferer Sinn rückblickend erschließen: Soziale Arbeit ist eine historische Weiterentwicklung einfacher und natürlicher Formen des menschlichen Helfens, des gebenden Miteinanders etc. und somit eine „kulturelle Objektivation“, die es zu erschließen, zu verstehen und zeitgemäß zu interpretieren gilt.
Betrachtet man die Geschichte und die jeweilige Bedeutung der Sozialen Arbeit bzw. ihrer Vorläufer/innen aus dieser Perspektive, so lassen sich bis zum heutigen Tag mindestens sechs Entwicklungsstadien erkennen (Marburger 1981, S. 46 ff.):
(1) Noch im Mittelalter (6. bis 15. Jahrhundert) waren die Armen ein notwendiger Stand im Gefüge der damaligen, auf das Jenseits gerichteten sozialen Ordnung. Die Existenz dieses „Bettelstands“ ermöglichte es den Gläubigen (und das waren damals alle Menschen), gottgefällig zu leben. Denn das Almosengeben war „neben Beten und Fasten eine Möglichkeit der ‚satisfactio‘, der Genugtuung für begangene Sünden, sowie eine religiöse Pflicht eines jeden Christen“ (ebd., S. 48). Die Armen erhielten ihre besondere Bedeutung somit als Empfänger/innen der Almosen, die den Geber/innen dabei helfen konnten, dem göttlichen Jenseits näherzukommen.
(2) Erst zu Beginn der Neuzeit, also etwa seit dem 16. Jahrhundert, entwickelten nicht nur die allmählich sich konstituierende Handwerkerschaft, sondern auch z. B. die Vertreter/innen des Pietismus und des Calvinismus eine kritische Einstellung gegenüber dem Bettelwesen. Bettler/innen baten ihrer Ansicht nach nicht aus echter Bedürftigkeit um ein Almosen, sondern aus fehlendem Arbeitswillen oder schlicht aus Faulheit.
„Aus der gottgewollten und gottgefälligen Armut wurde (…) ein negativ zu sanktionierendes, individuelles Versagen, wodurch der einzelne jetzt (…) aufgrund der ihm unterstellten Arbeitsscheuigkeit vor Gott und der Welt schuldig wird.“ (Nowicki, in: Marburger 1981, S. 49)
Ziel der Armenpflege oder Armenfürsorge war von nun an die Beseitigung des Bettels durch Arbeit in Werk- und Zuchthäusern. Gleichzeitig sollten die Kinder der Armen in Waisenhäusern und Schulen zur Arbeit erzogen und damit früh auf ihren Stand als arbeitende Arme vorbereitet werden.
(3) Nachdem der Staat sich im Rahmen der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts zunehmend aus der Armenfürsorge zurückgezogen hatte, entstanden freie gesellschaftliche Hilfsorganisationen, die nach Unabhängigkeit vom Staat strebten, „da sie, getragen von der ‚christlichen Barmherzigkeit‘, den Strafcharakter öffentlicher Fürsorge aufheben und durch Erziehungsbemühungen ersetzen wollten“ (Vahsen 1975, in: ebd., S. 54). Erst als mit der zunehmenden Proletarisierung dieser Bevölkerungsgruppen bestimmte soziale Phänomene wie z. B. Verwahrlosung, Kriminalität und frühe Invalidität unter den Kindern und Jugendlichen bedeutsamer wurden, griff der Staat – mit dem Mittel der Fürsorgeerziehung – stärker ein. Die Armen waren jetzt zu einem Problem der öffentlichen Ordnung geworden und mussten erzogen bzw. gebändigt werden!
(4) Die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelnde sozialpädagogische (Reform)Bewegung konzentrierte sich dann unter dem Begriff der „Jugendwohlfahrt“ noch stärker auf die Diskussion präventiver Maßnahmen im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sozialpädagogische Institutionen sollten neben die Familie und Schule treten und den damit entstehenden Bereich der Jugendhilfe als eigenständigen Bereich nicht nur auf Krankheit, sondern auch auf die Gesunderhaltung der Jugend ausrichten (Nohl 1965, S. 45). Als „dritte Säule“ des Erziehungssystems sollte sie für die gesellschaftliche und staatliche Erziehung außerhalb der Schulen und Familien zuständig sein (Bäumer 1981/1929).
(5) Nach der Katastrophe des Dritten Reichs wurde dann in den 1960er Jahren der Ruf nach einer sozialpädagogischen Durchdringung aller Lebensalter und Lebenslagen laut. Im Rahmen der Emanzipationsbewegung begann sich schließlich der Gedanke festzusetzen, dass nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern alle Menschen einer stetigen „kritischen Bewusstseinsbildung“ bedürfen. Eine „Sozialpädagogik der Lebensalter“ (Böhnisch 2012) sollte jetzt dazu beitragen, dass alle Altersgruppen Hilfen bei der Lebensbewältigung und Lebensgestaltung erhalten.
(6) Erst seit den 1980er Jahren wurde – parallel dazu – insbesondere unter dem Einfluss sozialökologischer und konstruktivistischer Theorien der Sozialen Arbeit, deutlich, dass sich eine Einheit der sozialen Hilfen unter dem Bezugspunkt der „sozialen Integration“ nicht mehr herstellen lässt. Denn, wie will die Sozialpädagogik in einer (post)modernen Gesellschaft einem „gesellschaftlichem Mandat Geltung verschaffen“, ohne in Gefahr zu geraten, „daß sich die AdressatInnen von ihren Angeboten abwenden beziehungsweise von diesen nicht mehr erreicht werden, weil sich die Bildungs-, Hilfe- und Unterstützungsleistungen allzu konträr zu den Lebensstilen und -entwürfen artikulieren“ (Thole/Cloos 2000, S. 290). Unsere heutige Gesellschaft benötigt offensichtlich eine Soziale Arbeit, die die Menschen nicht mehr auf einheitliche Normen hin verpflichtet, wie z. B. Ehestand, Familie, (Lebens-)Beruf etc., sondern dynamische Hilfen zur Verfügung stellt, die den Einzelnen auch die Chance geben, einen eigenen Weg zu gehen und trotzdem gegen alle möglichen Risiken und Wechselfälle des Lebens abgesichert zu sein.
Insbesondere Zacher (im Anschluss an Kaufmann 1982) hat die wachsende Bedeutung der Sozialen Arbeit für die moderne Gesellschaft damit begründet, dass sie zum unverzichtbaren Teil des Sozialstaats geworden sei (Zacher 1992, S. 362). Demnach interveniert der Sozialstaat nicht nur rechtlich (Recht für die sozial Schwächeren) und ökonomisch (Umverteilung wirtschaftlicher Mittel), sondern sehr stark auch in Form von sozialarbeiterischen (und pädagogischen) Dienstleistungen. Sozialarbeiter/innen dienen demnach „ohne eine andere Eigengesetzlichkeit dem ‚Sozialen‘“, sie arbeiten in der „‚Intimsphäre‘ des Sozialstaats“ (ebd., S. 363 f.) und setzen dort die sozialstaatlichen Ziele um.
„Aber in der Mitte des ‚Sozialen‘, wo der Mensch mit dem Menschen das ‚Soziale‘ bewirkt, herrscht Unmittelbarkeit. Daß dort Autonomie der Sozialarbeit notwendig ist, ist für Politik und Gesellschaft nicht nur Schranke, sondern mehr noch Vorwand, sich aus der Verantwortung zu lösen und zwischen sich und der Sozialarbeit einen Grenzwald an Vorbehalten wachsen zu lassen“ (Zacher 1992, S. 364).
Aufgabe der Sozialarbeit ist es demnach, die für den Sozialstaat wichtige dienstleistende Intervention zu erbringen, insofern die anvisierten Ziele demokratisch legitimiert und ethisch vertretbar sind:
„Solche Defizite können dadurch kompensiert werden, daß den Betroffenen oder den Menschen, die für sie Verantwortung tragen oder übernehmen, die Kompetenz vermittelt wird, den Nachteil selbst zu mindern oder auszugleichen. Solche Defizite können aber auch dadurch kompensiert werden, daß der Nachteil der Betroffenen durch Dienste gemindert oder ausgeglichen wird. Wann das eine oder das andere richtig ist, ergibt sich aus der Sache, Situation und Potenzialen. In der Regel werden beide Weisen der Intervention zusammenwirken müssen, um ein Optimum an Kompensation zu leisten. Genau darum geht es bei dem Thema ‚Sozialarbeit‘“ (Zacher 1992, S. 375).
Die hier vorgenommene wohlfahrtspolitische Zuordnung beinhaltet natürlich für die Soziale Arbeit die Gefahr der Funktionalisierung, wie sie insbesondere von Mollenhauer (1964) geäußert wurde. Allerdings zeigt das Beispiel der nordischen Länder, dass zwischen Sozialarbeit und Sozialstaat nicht nur Konkurrenz und gegenseitiges Dominanzstreben herrschen müssen, sondern es auch zu einer Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil kommen kann (Schönig 2006). Und auch wenn dies möglicherweise zu einer Ausweitung und zur heutigen Unübersichtlichkeit der Hilfen für Menschen geführt hat, gibt es zu dieser aktuellen, geschichtlich entstandenen und aus dem Leben der Menschen heraus begründeten Form einer angebots- und dienstleistungsorientierten Sozialen Arbeit in einer Gesellschaft, die den Einzelnen ein Optimum an Freiheit verspricht, derzeit keine Alternative. Was nicht ausschließt, dass sich das Leben weiterentwickeln und die Soziale Arbeit irgendwann in der Zukunft eine neue Gestalt annehmen wird.
1.2 Strategien der Sozialen Arbeit
1.2.1 Klassische Strategien des Helfens
Wie aber lässt sich erklären, warum die „professionelle“ Soziale Arbeit im modernen Sozialstaat eine so große Rolle spielt? Nach Niklas Luhmann (1973) hängt dies mit der Eigenart der modernen Gesellschaft zusammen, einer Gesellschaftsform, die in besonderem Maße auf Organisationen und Professionen angewiesen ist. Daher gibt es seiner Ansicht nach professionelle Formen des Helfens erst seit Beginn des 20. Jahrhundert. Zuvor lassen sich zwei andere Strategien des Helfens unterscheiden:
(1) In der archaischen Gesellschaft, in der die Menschen in Gruppen und Stämmen zusammenlebten, kann Hilfe – aufgrund der Reziprozität der Lagen – noch gegenseitig erfolgen. So helfen die Helfenden in dieser Hilfeform, die Luhmann durch den Begriff der „Dehnung der Dankbarkeit“ charakterisiert, vor allem deshalb, weil hier Hilfe als „Dankespflichten“ für Geschenke, Einladungen oder bereits erhaltene Hilfeleistungen erwartet werden (Luhmann 1973, S. 26). Dankbarkeit zeigt sich damit als Gegenseitigkeit, so wie wir sie heute noch im Rahmen der Nachbarschaftshilfe praktizieren. Nachbarn danken sich für gegenseitige Hilfeleistungen nicht etwa durch Geld- oder Sachleistungen (das würde unter Umständen die „gute“ Nachbarschaft gerade zerstören), sondern durch die „stillschweigende“ Zusage zukünftiger Gegenleistungen.
(2) In der hochkultivierten Stände- bzw. Klassengesellschaft ist dann die Gleichwertigkeit der Lagen nicht mehr gegeben. Jetzt differenziert sich eine neue Hilfeform („Ausbeutung der Mildtätigen“) heraus, bei der die Helfer/innen in Form einer Spende oder Gabe helfen. Demnach liegt Helfen jetzt nicht mehr im ureigensten (Selbst-)Interesse der Helfenden, sondern zumindest teilweise in ihrer altruistischer Haltung, eine Haltung, die aus Sicht der Helfenden lediglich (durch Dankesbezeugungen) honoriert, aber nicht mehr reziprok vergolten werden kann. Helfen wird jetzt zur „guten Tat“, zur Tugend stilisiert, von der sowohl die Spender, die Hilfe ermöglichen, als auch die Helfenden (in Form des Priesters, des Arztes etc.), die die Hilfe umsetzen, gleichermaßen durch Statusgewinn profitieren (Luhmann 1973, S. 29 ff.).
Beide Hilfeformen genügen aber nach Luhmann nicht mehr den Anforderungen der modernen Gesellschaft des beginnenden 20. Jahrhunderts, die durch Rationalität, Effizienz und der Suche nach Sicherheit geprägt ist. Hilfe muss nun, damit sie effektiv ist, erwartbar sein (der/die Schuldner/in muss wissen, dass es Schuldnerberatung gibt) und sie muss vor allem zeitnah geleistet werden (der/die Schuldnerberater/in muss (fast) jederzeit zur Verfügung stehen, um effiziente Hilfe leisten zu können). Denn jede Verzögerung im Hilfeablauf könnte dazu führen, dass das Funktionieren der Gesellschaft in Gefahr gerät. Damit diese Voraussetzungen gegeben sind, muss Hilfe organisiert und standardisiert werden: Eine neue Profession, und damit ein Ausbildungssystem, eine Bezugswissenschaft etc. müssen geschaffen und neue Organisationen müssen gebildet werden, die sich ausschließlich dieser Aufgabe widmen.
Luhmann hat allerdings auch darauf hingewiesen, dass mit der Einführung dieser neuen Form des Helfens die alten nicht überflüssig geworden sind (ebd., S. 37): Nachbarn sollen sich weiter gegenseitig helfen und Reiche sollen weiter für wohltätige Zwecke spenden. Nur ist er der Ansicht, dass sich die moderne Gesellschaft nicht mehr auf diese Formen allein verlassen kann, sondern dass es einer neuen, neutralen, von persönlichen Motiven unabhängigen Hilfeform bedarf. Einer Sozialen Arbeit also, deren Leistung darin besteht, die Existenz der modernen, individualisierten und funktionsorientierten Gesellschaft im Bereich der vielfältigen und unvorhersehbaren „Wechselfälle des Lebens“ (Zacher 1992) zu sichern und die Menschen in unterschiedlichsten Problemlagen mit unterschiedlichsten Biografien so zu unterstützen, dass sie wieder autonom leben und sich in die Gesellschaft (re)inkludieren können.
1.2.2 Die modernen Strategien: Intervention, Prävention und Gesellschaftskritik
Auch wenn Luhmann aus seiner soziologischen Sicht heraus die Erwartbarkeit und schnelle Verfügbarkeit der Hilfe als besonders wichtige Leistung der Sozialen Arbeit für die Gesellschaft betrachtet, so stellt sich doch die Frage, ob sich darin die Intentionen der Sozialen Arbeit selbst vollständig widerspiegeln. Ein Blick in die Geschichte der Sozialen Arbeit zeigt, dass beinahe zeitgleich drei keinesfalls miteinander konkurrierende Strategien zur Bearbeitung sozialer Probleme innerhalb der Sozialen Arbeit entwickelt wurden:
(1) Intervention
Die erste Strategie der nach Luhmann erwartbaren und möglichst zeitnahen Hilfe, die der „Intervention“, zielt darauf ab, soziale Probleme so konkret und zügig wie möglich zu lösen. Eine solche Form der Hilfe wurde vor allem durch die Begründer/innen der modernen Sozialarbeit an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wie z. B. Alice Salomon (1926) gefordert und entwickelt. Die zentrale Methode, die für die Sozialarbeiter/innen lange im Zentrum aller Aktivitäten stand, war das „Case Work“: Klienten und Klientinnen sollten im Rahmen eines zunehmend differenzierter strukturierten Arbeitsprozesses (Anamnese, Diagnose, Intervention, Evaluation) dabei begleitet werden, ihre sozialen Probleme, orientiert am Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“, zu bearbeiten und schließlich zu lösen. Die Theoretisierung und Evaluierung dieser Methode hat dann zu einer Ausdifferenzierung in weitere Modelle, wie z. B. dem Case Management, der Verhaltensorientierten Beratung, der Aufgabenzentrierten Sozialarbeit etc. geführt.
(2) Prävention
Aus der zunehmenden Kenntnis der gesellschaftliche Probleme unmittelbar auslösenden sozialen Bedingungen heraus (heute oftmals als Risikofaktoren bezeichnet) entwickelte sich eine zweite Strategie: die der „Prävention“. Diese Strategie ist insbesondere dem Einfluss der „sozialpädagogischen Bewegung“ des späten 19. Jahrhunderts auf die Soziale Arbeit geschuldet, für die Herman Nohl folgendes konstatiert:
„Die Arbeit der öffentlichen Jugendhilfe und insbesondere der Jugendämter ist, soweit ich sehe, erwachsen aus der Hilfe gegen den einzelnen Notfall, der allerdings so massenhaft auftrat, dass dem Fürsorger der Charakter der Individualhilfe zu verschwinden drohte. Es muss aber immer erst ein Unglück passiert sein, das die Jugendhilfe danach wieder gutzumachen sucht. Hier liegt meines Erachtens der schwere Konstruktionsfehler im Aufbau der ganzen Arbeit. Worauf alles ankäme wäre: der Arbeit der Jugendhilfe eine positive Wendung zu geben, die das Jugendamt zu einem selbstständigen Organ der Volkserziehung machte, dessen große Aufgabe natürlich auch das Heilen aufgebrochener Schäden wäre, dessen vorangehende, primäre Leistung aber eine aufbauende Arbeit an unserer Jugend – soweit sie nicht in der Schule stattfindet – im Zusammenhang unserer gesamten Volksbildung ist“ (Nohl 1965, S. 45).
Demnach muss offensichtlich eine sich ihrer moralischen Pflichten bewusste Soziale Arbeit ihr praktisches Wissen um die Ursachen sozialer Probleme auch dazu nutzen, Methoden und Verfahren vorzuschlagen und durchzuführen, die dazu beitragen können, soziale Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen.
Präventionsarbeit spielt heute in vielen Bereichen der Pädagogik, Sozialarbeit, Medizin, Gesundheit etc. eine wichtige Rolle. Der Begriff steht dabei für alle Bemühungen, Probleme dadurch frühzeitig zu verhindern, dass die Ursachen für die Entstehung dieser Probleme beseitigt oder zumindest verringert werden. Dabei geht es vor allem darum, Risikofaktoren zu beeinflussen, „zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keine manifesten Symptome feststellbar sind, die sich jedoch einstellen würden, wenn nichts unternommen wird“ (Heinrichs et al. 2008, S. 10, siehe dazu Kap. 10.3.4).
(3) Gesellschaftskritik
Da wo interventive und präventive Maßnahmen nicht ausreichen, um die Ursachen sozialer Probleme zu erfassen, bleibt als weitere logische Möglichkeit nur übrig, im Rahmen einer umfassende „Gesellschaftskritik“ die gesellschaftlichen Strukturen auf ihre problemauslösende oder -verstärkende Funktion zu hinterfragen. Solche Ursachen können sein: Armut, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit, Exklusion etc. So waren z. B. bereits die Vertreter/innen der „schottischen Schule der Soziologie“ des 18. Jahrhunderts der Ansicht, dass soziale Probleme durch die „kranke Gesellschaft“ verursacht würden und es somit strategisch sinnvoll sein könnte, die Gesellschaft zu beeinflussen bzw. zu verändern (Soydan 1999, S. 16). Insbesondere Klaus Mollenhauer hat dann diese Strategie in den 1960er Jahren entwickelt und vertreten:
„Die Sozialpädagogik ist nicht nur gleichzeitig mit der industriellen und bürgerlichen Gesellschaft entstanden, sondern sie hängt auch der Art nach eng mit dieser zusammen, denn sie sieht sich dem Werden einer Gesellschaft gegenüber, deren Unvollkommenheiten dem Sozialpädagogen unmittelbar als materielle und psychische Ausbeutung, Benachteiligung und Beschädigung, Unterdrückung und Disziplinierung von Menschen entgegentreten. Das aber bedingt, dass der sozialpädagogischen Tätigkeit immer auch ein sozialpolitischer Gedankengang innewohnt. (…) Die sozialpädagogische Erziehungsrichtung nimmt daher nie nur den direkten Weg auf den einzelnen zu, sondern schließt die Absicht zur Veränderung der Erziehungsbedingungen (Stadtteilarbeit, Gemeinwesenarbeit, politische Aktion) mit ein. Das enge Verhältnis zwischen Sozialpädagogik, Institutionenkritik, Sozialstaatsproblematik und ökonomischen Problemen hat hier seinen Grund“ (Mollenhauer 1964, S. 293 f.).
Moderne Verfahren und Methoden zur Umsetzung der Strategie der Gesellschaftskritik treten heute vor allem z. B. im Bereich der feministischen oder antirassistischen Sozialen Arbeit, im Bereich der Solidarökonomie oder der Sozialraumarbeit auf (siehe dazu v. a. Kap. 13).
Abbildung 2 zeigt noch einmal das Zusammenspiel der drei Intentionen der Sozialen Arbeit. Wichtig ist, dass dabei der „Gesellschaftskritik“ eine doppelte Aufgabe zukommt. Zum einen bildet sie eine unverzichtbare Strategie der Sozialen Arbeit, zum anderen kann ihre Perspektive auch dazu genutzt werden, die beiden anderen Strategien einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.
Abb. 2: Soziale Arbeit als Intervention, Prävention und Gesellschaftskritik
1.3 Funktionen der Sozialen Arbeit
Die drei dargestellten (selbstgesetzten) Strategien der Sozialen Arbeit wurden natürlich im Laufe der Geschichte zunehmend ausdifferenziert, theoretisiert und reflektiert und haben auch bei Soziologen/Soziologinnen, Politiker/innen und Bürger/innen zu einer lang andauernden Auseinandersetzung darüber geführt, was eigentlich die (von außen feststellbare) gesamtgesellschaftliche Aufgabe (die gesellschaftliche Funktion) der Sozialen Arbeit ist. Da in diesem Streit bislang keine Einigung erzielt werden konnte (siehe dazu Bommes/Scherr 1996), können wir heute zwischen fünf möglichen unterschiedlichen Funktionszuschreibungen unterscheiden: einer streng auf konkrete Hilfeleistungen fokussierten (1), einer generalisierten, Hilfe und Prävention verbindenden (2), einer gesellschaftskritischen (3), einer alle Strategien übergreifenden, ganzheitlich-integrationistischen (4) und einer offenen, dezisionistischen (willkürlichen), d. h. von den jeweiligen Sozialarbeiter/innen mehr oder weniger willkürlich bestimmten Funktion (5):
(1) Insbesondere zwei wichtige Vertreter der konstruktivistisch-systemtheoretischen Sozialarbeitswissenschaft, Niklas Luhmann (1973) und Dirk Baecker (1994), sind der Ansicht, dass sich die Soziale Arbeit, um in der modernen Gesellschaft anerkannt zu sein, auf eine ganz spezifische Funktion, nämlich die der sozialen Hilfe, beschränken müsse. Dabei muss ihrer Ansicht nach die Selbstbeschränkung so weit gehen, dass
• sie nur da tätig werden soll und darf, wo sie sich sicher ist, dass eine Intervention auch erfolgreich durchgeführt werden kann. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn klar definierte und wissenschaftlich erprobte Programme (oder Konzepte) vorhanden sind, die dann zum Einsatz gebracht werden können. In allen anderen (und insbesondere in komplexen) Fällen muss auf eine Intervention verzichtet und darauf vertraut werden, dass Nicht-Professionelle, wie z. B. Nachbarn, Ehrenamtliche etc., eine unspezifische Hilfe leisten. Denn während man von Professionellen Effektivität und Effizienz erwartet, wird den Nicht-Professionellen das Scheitern einer Hilfehandlung nicht als Fehler zugerechnet;
• sie sich in keinem Falle mit Problemen befassen darf, für die sie keine Expertise besitzt, wie z. B. mit solchen der Gesellschafts- oder Wirtschaftsstruktur. Denn für diese Fragen sind andere Teilsysteme der Gesellschaft verantwortlich und kompetent. Die Soziale Arbeit würde ihren gesellschaftlichen Auftrag, der ihr erst ihre Existenzberechtigung gibt, überschreiten, wenn sie sich hier einmischen würde.
Deutlich wird dabei: Luhmann und Baecker wollen der Sozialen Arbeit einen festen Platz in Gesellschaft und Wissenschaft zuweisen und damit die Statusunsicherheit vieler Sozialarbeiter/innen gegenüber anderen Berufen beenden. Diese Spezialisierung führt allerdings dazu, dass die beiden anderen Strategien von anderen Professionen erbracht werden müssen. Ihrer Ansicht nach sollte man die Prävention den Pädagogen/Pädagoginnen und Lehrer/innen und die Fragen der Gesellschaftskritik den Politiker/innen und den politisch interessierten Bürger/innen überlassen.
(2) Michael Bommes und Albert Scherr (1996), die die Soziale Arbeit ebenfalls aus einer soziologischen Perspektive betrachtet und bewertet haben, halten das Niveau des professionellen und wissenschaftlichen Denkens und Handelns im Bereich der Sozialen Arbeit für unbefriedigend. Sie glauben jedoch im Gegensatz zu Luhmann und Baecker nicht daran, dass man dies ändern könnte, da die Ursachen dafür ihrer Ansicht nach vor allem in der theoretisch und praktisch nicht bewältigten „diffusen Allzuständigkeit“ der Sozialen Arbeit (ebd., S. 93, Ferchhoff 1993, S. 708) liegt. Weil sozialpädagogische und sozialarbeiterische Aufgaben nicht voneinander getrennt, sondern vermischt werden müssen, kann sich hier „keine singuläre wissenschaftliche Theorie der Sozialen Arbeit“ (Bommes/Scherr 1996, S. 93) entwickeln und kann folglich auch keine klare berufliche Identität geschaffen werden. Der Begriff der Sozialen Arbeit wird dementsprechend zu einem „historisch etablierten Einheitsetikett für heterogene Praktiken“, „deren Zusammenhang nur noch darin besteht, daß sie als Soziale Arbeit die berufliche Ausbildung zum Sozialarbeiter/Sozialpädagogen voraussetzen“ (ebd.).
Nach Bommes/Scherr lässt sich offensichtlich das Dilemma der Sozialen Arbeit nicht lösen: Sie muss den sozialen Problemen (um der Sache willen) offen entgegentreten. Damit aber lässt sie zu viele Strategien zu und muss die daraus resultierende methodische Unbestimmtheit mit dem Makel der „Semi-Profession“ in Kauf nehmen, was zu einer deutlichen Abwertung gegenüber anderen Berufen, wie z. B. Arzt, Anwältin etc., führt, deren Aufgaben sich eindeutig beschreiben und von anderen Berufen abgrenzen lassen.
(3) Insbesondere Giesecke (1973) und Mollenhauer (1964) haben der Sozialarbeit/Sozialpädagogik vor allem die Funktion der „Gesellschaftskritik“ zugewiesen. Nach Mollenhauer (1964, S. 291 ff.) lässt sich deren die Struktur und Funktion durch vier Grundprobleme kennzeichnen:
• „Die Sozialpädagogik ist nicht nur gleichzeitig mit der industriellen und bürgerlichen Gesellschaft entstanden, sondern sie hängt auch der Art nach eng mit dieser zusammen“ (ebd., S. 293). Insofern ist die sozialpädagogische Tätigkeit nicht von sozialpolitischen Fragestellungen zu trennen. „Die sozialpädagogische Erziehungsrichtung nimmt daher nie nur den direkten Weg auf den einzelnen zu, sondern schließt die Absicht zur Veränderung der Erziehungsbedingungen (Stadtteilarbeit, Gemeinwesenarbeit, politische Aktion) mit ein (…) Das enge Verhältnis zwischen Sozialpädagogik, Institutionenkritik, Sozialstaatsproblematik und ökonomischen Problemen hat hier seinen Grund“ (ebd., S. 294).
• „Die sozialpädagogische Praxis geschieht in einem Spannungsfeld zwischen dem als normal Geltenden und den vielen Formen von Abweichungen bis hin zur juristisch definierten Kriminalität.“ Da sich für eine kritische Sozialpädagogik jedoch hinter dem Normalitätsbegriff gesellschaftliche Ideologien über „das Normale“, „Gesunde“, „Richtige“ etc. verbergen, kann dieser nicht als Ausgangspunkt für sozialpädagogische Interventionen herangezogen werden. Will die Sozialpädagogik nicht zur Agentin des Staates werden, darf sie nur dort intervenieren, „wo die physische Existenz des jungen Menschen in Mitleidenschaft gezogen wird (…) oder eindeutig beschreibbare psychische Schäden (im Sinne einer Beeinträchtigung der Autonomie und Initiative, P. E.) auftreten“ (Mollenhauer 1964, S. 295).
• Offensichtlich kann die Sozialpädagogik ihre Prinzipien nicht klar angeben. Allgemein kann formuliert werden, dass sie insbesondere da tätig wird, wo Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, „ohne deren Befriedigung nur eine deprivierte Existenz möglich ist“ (ebd., S. 296).
• Aufgrund der Erbringung der Hilfeleistungen durch freie Träger besteht die Gefahr einer „Minderung demokratischer Kontroll-Möglichkeiten, besonders der demokratisch legitimierten Jugendämter“ (ebd.).
Aufgrund der Komplexität des Gegenstandes erscheint auch für Mollenhauer eine Gesamttheorie der Sozialpädagogik/Sozialarbeit nicht möglich. Er schlägt dagegen vor, eine „Mehrzahl von Theorien anzustreben, die sich je nach dem Handlungsobjekt des Erziehungshandelns“ (ebd., S. 297) unterscheiden.
Insgesamt kommt Mollenhauer aufgrund seiner Analyse zu einer wenig schmeichelhaften Analyse: der durch die Problematik des doppelten Mandats geprägten Situation der Sozialarbeiter/innen:
„Einerseits ist er abhängiger Agent einer Institution, die an einem relativ starren System von Problem- und Lösungsklassifikationen festhält, er kann aber andererseits innerhalb dieser Institutionen keine stabile Berufstätigkeit aufbauen, da seine tägliche Praxis ihn mit den originären Problemen der Lebenswelt des Klienten konfrontiert, denen gegenüber die institutionalisierten Klassifikationen als dysfunktional erscheinen“ (ebd., S. 299).
(4) Eine Sozialarbeitswissenschaftlerin, die sich vehement für die Verklammerung der drei oben dargestellten Strategien der Intervention, Prävention und Gesellschaftskritik einsetzt, ist Silvia Staub-Bernasconi. Ihrer Ansicht nach besteht die Aufgabe der Sozialen Arbeit gerade darin
„(…) Dinge und Ideen miteinander in Verbringung (zu) bringen, die in unseren Gesellschaften und ihren öffentlichen Diskursen meist säuberlich getrennt sind, ja in der Regel als schlechthin unvereinbar gelten: Es ist die Verknüpfung von Nähe und Distanz, von Privat-, Intimbereich- und Öffentlichkeits- inklusive Rechtsbereich, von Obhut, Schutz und Freiheit, von individueller Sicherheit und struktureller Gerechtigkeit – kurz: von Liebe oder Fürsorglichkeit und Macht (Senett)“ (Staub-Bernasconi 1995, S. 16).
Um dies einzulösen, muss die Sozialarbeit aus der Bescheidenheit und Binnenorientierung herauszufinden:
„Die strukturelle Chance dieser Profession sehe ich darin, dass sie das extrem schwierige Verhältnis zwischen menschlicher Bedürfniserfüllung, menschlichem Lernen und sozialen Organisationsformen in ihrem eigenen Problem- und Arbeitsfeld konkret kennenlernen und sich die Aufgabe stellen kann, in diesem Bereich alte und neue Lösungsformen zu erproben. Die kulturelle Chance dieser Profession ist die, dass sie das Verhältnis von Liebe und Macht theoretisch reflektieren und so zu Vorstellungen wissender, befreiender wie verpflichtender Liebe und Macht – im Unterschied zu blinder, bedrängender, grenzenloser, erststickender, kurz, behindernder Liebe gelangen müsste“ (ebd., S. 18).
Staub-Bernasconi gelingt es damit in beeindruckender Weise, die Gesamtaufgabe der Sozialen Arbeit zu benennen, ohne allerdings eine Lösung für die Frage anzubieten, wie sich daraus eine feste berufliche Position ableiten ließe. Staub-Bernasconi setzt offensichtlich auf Sozialarbeiter/innen, die als Personen (bereits) genügend kompetent und selbstbewusst sind, um sich in einer komplexen Welt – zum Wohle der eigenen Klientel – methodisch offen und generalistisch ausgerichtet durchsetzen zu können.
(5) Eine angesichts der derzeitigen Lage der Sozialen Arbeit ganz radikale Konsequenz zieht der Sozialarbeitswissenschaftler Heiko Kleve. Seiner Ansicht nach hat es in postmodernen Gesellschaften, die durch Ambivalenz und Uneindeutigkeit gekennzeichnet sind, keinen Sinn mehr, der Sozialarbeit eine konkrete Funktion zuzuweisen. Im Gegenteil, „die Postmoderne erlaubt es, aus der modernen Not der sozialarbeiterischen Identitätsproblematik eine postmoderne Tugend der sozialarbeiterischen Identität der Identitätslosigkeit zu machen“ (Kleve 2003, S. 120).
Grund für diese Eigenschaftslosigkeit ist nach Kleve ein doppelter Generalismus. So ist die Sozialarbeit „universell generalistisch“, weil sie viele Zielgruppen teilweise über ganze Lebensphasen hinweg begleitet, „spezialisiert generalistisch“ ist sie, weil sie sich mit Hilfe ihrer Organisationen auf unterschiedliche Arbeitsgebiete und Zielgruppenorientierungen begrenzt, im konkreten methodischen Arbeiten dann aber einen „ganzheitlichen Ansatz“ favorisiert.
„Aufgrund ihrer spezialisiert-generalistischen Orientierung steht die Sozialarbeit fast zwangsläufig zwischen vielen Stühlen, handelt sie sich vielfältige Ambivalenzen ein, ist sie mit den widersprüchlichen System- und Lebenswelten der Menschen konfrontiert. Genau daraus resultiert ihre fragmentierte Identität, pointiert ausgedrückt: ihre Identität der Identitätslosigkeit. Daraus erwachsen auch ihre sozialen Funktionen, die man als vermittelnde, transversale Funktionen bezeichnen kann“ (ebd., S. 122).
Sozialarbeiter/innen müssen demnach in einer ausdifferenzierten Gesellschaft zwischen den verschiedenen Fachsprachen vermitteln, sie sind „Kommunikationsvirtuosen“ (ebd., S. 122 im Anschluss an Münch), sie überspringen Professions- und Disziplingrenzen, sie generieren „ein Spezialwissen zweiter Ordnung“ (ebd., S. 123) und erweisen sich so als „Trendsetter“ künftiger Professionsentwicklungen, „weil Probleme, die andere Professionen gerade zu sehen beginnen, der Sozialarbeit schon lange vertraut sind“ (Knoll, in: ebd., S. 123).
Mit dieser Argumentation appelliert Kleve an das Selbstbewusstsein und den Stolz der Sozialarbeiter/innen. Sie sollen offensichtlich auf die klassischen Insignien, die für eine anerkannte gesellschaftliche Position wichtig sind, verzichten und zu „Lebens- und Berufskünstlern“ werden, die sich einer konstruktivistischen Denkweise verschreiben und sich an den daraus resultierenden Methoden ausrichten (siehe dazu Kap. 14.2.3).
Abbildung 3 zeigt noch einmal zusammenfassend die verschiedenen Positionen im Streit um die gesellschaftliche Funktion der Sozialen Arbeit. Grundsätzlich gilt: Alle dargestellten Funktionszuschreibungen sind vor allem aus drei Gründen heraus mit Vorsicht zu betrachten:
• Funktionszuschreibungen sind in der Regel interessengeleitet: Während es den einen darum geht, der Sozialen Arbeit möglichst viele Kompetenzen und ein hohes gesellschaftliches Ansehen zuzuschreiben, geht es anderen darum, die Soziale Arbeit möglichst klein zu halten. Dahinter stehen dann zumeist politische und professionspolitische Interessen.
• Funktionszuschreibungen bergen für die Soziale Arbeit die Gefahr in sich, instrumentalisiert und für fremde Zwecke eingesetzt zu werden. So soll die Soziale Arbeit z. B. Jugendliche ruhig halten bzw. beschäftigen, ohne dass dafür etwa die notwendigen Voraussetzungen wie z. B. Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen werden.
• Unterschiedliche Funktionszuschreibungen (z. B. spezialistisch vs. generalistisch) werden meist als Dilemma oder Konflikt aufgefasst – so als ob es darum gehen müsse, sich zwischen den verschiedenen Funktionen zu entscheiden!
Abb. 3: Unterschiedliche Funktionsbeschreibungen der Sozialen Arbeit
Die Gefahr, die in allen Zuschreibungen liegt, ist die, dass sich die Soziale Arbeit auf diese Weise fremdbestimmen lässt und dadurch Schaden erleidet. Viel wichtiger für sie wäre es deshalb, die eigene Agenda voranzutreiben, über konkrete Leistungen und Ergebnisse auf sich aufmerksam zu machen und sich dementsprechend gesellschaftlich zu positionieren. Selbstüberschätzung ist hier genauso fehl am Platz, wie Selbstunterschätzung.
So hat etwa die Debatte um die Frage, warum sich Jugendliche zum Dschihadismus hinwenden und bereit sind, dem IS beizutreten, die Erwartung entstehen lassen, dass das Problem durch ein Mehr an Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen, die der Hoffnungslosigkeit in den Vorstädten durch Hilfeangebote entgegentreten, gelöst werden könnte. Gerade in diesem Fall muss die Soziale Arbeit aber bereit dazu sein, den zu hoch gesteckten Erwartungen entgegenzutreten und darauf hinweisen, dass solche Probleme vielfältigste Ursachen haben und auch entsprechend systemisch bekämpft werden müssen, auch wenn es verlockend erscheint, in dieser Situation als Retterin herbeigerufen zu werden.
1.4 Zur Realisierung der drei Strategien der Sozialen Arbeit
Wenn die Soziale Arbeit ihrer eigenen Bestimmung treu bleiben will (und das sollte sie, andernfalls kann keine authentische und qualifizierte Praxis entstehen), dann muss sie ihre drei Strategien – Intervention, Prävention und Gesellschaftskritik – theoretisch begründen, empirisch überprüfen, deren konkrete Umsetzung aber der jeweiligen Praxis überlassen. Denn ganz pragmatisch betrachtet müssen schon aus Gründen der Effizienz und Effektivität viele Fragen vor Ort entschieden werden:
Wenn sich z. B. Sozialarbeiter/innen besser dafür eignen, Schüler/innen zu „coachen“, Berufswahlunterricht zu erteilen oder Maßnahmen der Schuldenprävention, der Sexualerziehung etc. in Schulen durchzuführen, einfach deshalb, weil sie die entsprechenden (Beratungs-)Erfahrungen mitbringen, lösungsoffene Zugänge verfolgen und damit ihre Botschaften auf Schüler/innen authentischer und damit besser wirken, dann kann dies zur Folge haben, dass ein neues Arbeitsfeld (wie z. B. Schulsozialarbeit) entsteht, das von den Schulen zunehmend ernst genommen wird. Andere Arbeitsfelder können dagegen abgegeben bzw. aufgegeben werden, wenn sich herausstellt, dass neue oder andere Berufsgruppen geeignetere Qualifikationen mitbringen, wie etwa im Bereich der Kindertagesstätten, wo das neue Berufsbild des/der „Erziehers/Erzieherin in früher Kindheit“ mit Sicherheit dazu führen wird, dass auf Dauer keine Sozialarbeiter/innen mehr dort tätig sein werden etc.
Wichtig ist hier zu erkennen: Die Soziale Arbeit ist nicht nur passive Auftragnehmerin von Funktionszuschreibungen einer jeweils historisch vorfindlichen Gesellschaft. Sie kann deshalb nicht einfach Befehle ausführen, sondern sie muss immer wieder prüfen, ob sie für deren Umsetzung zuständig und kompetent genug ist und ob sie damit ihren drei Strategien gleichermaßen verpflichtet bleiben kann:
• der Intervention, die darauf abzielt, Problemlagen so schnell wie möglich zu beseitigen;
• der Prävention, die dazu da ist, bestimmte Gruppen vor zukünftigen Problemlagen zu schützen; und
• der Gesellschaftskritik, die dazu dient, in der Praxis gewonnene Einsichten über die Entstehung und Bearbeitung von Problemlagen auf die Frage hin zu überprüfen, ob nicht auch strukturelle und/oder materielle Gründe zur Problemverschärfung beitragen.
Alle drei Strategien können natürlich niemals von einer Person allein gleichzeitig umgesetzt werden, sondern müssen arbeitsteilig bearbeitet werden. Voraussetzung dafür ist jedoch eine ganzheitliche Sichtweise, die konzeptionell abgebildet und dann im Rahmen der jeweiligen organisationalen Strukturen abgearbeitet wird. Die fachliche Qualität zum Beispiel eines Frauenhauses hängt also vor allem davon ab, ob und inwiefern die in dieser Einrichtung tätigen Sozialarbeiterinnen die Strategien der Intervention, Prävention und Gesellschaftskritik so gegeneinander abwägen und umsetzen, dass sie insgesamt der Bedeutung und Ernsthaftigkeit des Problems vor Ort gerecht werden können. Frauenhauskonzepte (wie alle anderen Konzepte auch) müssen also breit angelegt und so offen bleiben, dass sie genügend variabel sind, um den spezifischen Belangen Rechnung tragen zu können. An den nachstehend dargestellten Schwerpunktsetzungen des Frauenhauses Osnabrück kann man gut erkennen, wie eine Organisation alle drei Strategien der Sozialen Arbeit übernehmen und umsetzen kann:
Konzeptionelle Schwerpunkte der Arbeit im Frauenhaus Osnabrück:
Arbeit mit Frauen
1. Problembezogene Hilfen: Einzel- und Gruppengespräche, Gezielte Beratung zur psychischen Unterstützung,Beratung zur Sicherung der materiellen Existenz (Unterhalts- und Leistungsansprüche, Wohnraumbeschaffung usw.), Beratung in Fragen der Berufstätigkeit, Ausbildung, Umschulung bzw. Vermittlung entsprechender institutioneller Kontakte, rechtliche Informationen zu Problemen von Trennung und Scheidung, Beratung bei Konflikten zwischen Müttern und Kindern, allgemeine Fragen der Erziehung bzw. Therapie, Vermittlung von Therapieangeboten, z. B. bei Sucht oder schweren psychischen Problemen.
2. Praktische Hilfen: Abholen von Frauen und Kindern ins Frauenhaus von einem vereinbarten Treffpunkt, schützende Begleitung der Frauen zu ihren Wohnungen, um Kinder, Dokumente, Gegenstände des persönlichen Bedarfs herauszuholen, Begleitung der Frauen zu Behörden, Gerichten, Anwälten usw., Hilfen zum Aufbau einer neuen Existenz.
3. Arbeit mit Kindern: Betreuung der Kleinkinder bei Bedarf, Schularbeitenhilfe, Einzelbetreuung, gezielte Freizeitangebote, Zusammenarbeit mit Schulen, Freizeiteinrichtungen, Gruppenangebote für Vorschul- und Schulkinder, Kontakt zu pädagogischen/therapeutischen Einrichtungen, schützende Begleitung im Bedarfsfall.
4. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen: Kontakte und Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen und Behörden (z. B. andere Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Mädchenhaus, Jugend- und Sozialamt, psychologische Beratungsstellen, Ärzte, Krankenhäuser, Polizei usw.). Diese Kontakte finden im Einverständnis oder mit Wissen der Betroffenen statt.
5. Nachgehende Beratung und Hilfen für ehemalige Bewohnerinnen: Weitergehende Beratungs- und Hilfeangebote für die Zeit nach dem Frauenhausaufenthalt, praktische Hilfen auch in Form von Einzel- und Gruppengesprächen.
6. Öffentlichkeitsarbeit: Um gesellschaftliche Veränderungen im Sinne der von Gewalt betroffenen Frauen zu erreichen, ist die Öffentlichkeitsarbeit ein notwendiger und wichtiger Aufgabenbereich der Frauenhausarbeit.
Wir wollen auf die in allen Lebensbereichen so selbstverständlich akzeptierte Benachteiligung von Frauen hinweisen und den Zusammenhang zwischen der strukturellen und der privaten Gewalt herstellen. Wir wollen das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern aufzeigen, das in der körperlichen Gewalt von Männern gegen Frauen lediglich einen besonders krassen Ausdruck findet. Für diese Tatsache sensibel zu machen, auf Verständnis, Bewusstsein- und Verhaltensänderung hinzuwirken, ist das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit des Frauenhauses. Ebenso wichtig ist es auch, über Grundsätze, die Arbeitsweise und die Situation des Frauenhauses aufzuklären, sowie über die Lebensbedingungen der im Frauenhaus lebenden Frauen.
Grundlage der Hilfe ist in erster Linie der menschliche und gewaltfreie Stil des Hauses und das solidarische Verhalten zwischen den dort lebenden und arbeitenden Frauen. (http://www.frauenhaus-os.de/downloads/Arbeitskonzept.pdf)
Intern gilt es dann, die jeweiligen Aufgabenstellungen bestimmten fachlich kompetenten Personen zuzuweisen. Aus diesem Grund kann keine Organisation der Sozialen Arbeit auf die Darstellung von spezifischen Zielsetzungen und methodischen Arbeitsansätzen im Rahmen von schriftlich auszuarbeitenden Einrichtungskonzepten verzichten. Geschulte Leser/innen erkennen beim Lesen solcher Konzepte recht schnell, wie eine Einrichtung sich ausrichtet und welche Schwerpunktsetzungen im Bereich von Intervention, Prävention und Gesellschaftskritik erfolgen. Da sich die Soziale Arbeit immer an der Situation der konkreten Adressaten/Adressatinnen orientierten muss, gibt es keine Folien und standardisierten Verfahren, sondern nur Orientierungen, die im Rahmen von Leitbildern und Konzeptionen zu verdeutlichen sind. Gemessen werden kann die Qualität der Arbeit dann daran, inwiefern diese Schwerpunktsetzungen konzeptionell erfasst und adressatinnen- und sozialraumgerecht plausibilisiert werden können. Denn Soziale Arbeit ist, wie später noch gezeigt werden soll, eine „reflexive Praxis“ (siehe Kap. 5.2). Eine solche setzt grundsätzlich sowohl konzeptionell-methodische Entscheidungen auf der organisationalen als auch konkret-situative Entscheidungen auf der Seite der Verantwortlichen voraus.
2 ARBEITSFELDER, ZIELGRUPPEN UND METHODEN DER SOZIALEN ARBEIT
Die im ersten Kapitel aufgestellte Behauptung, dass die Soziale Arbeit einen wichtigen Beitrag für die moderne Gesellschaft leistet, lässt sich leicht belegen, wenn man einen Blick auf die einzelnen Handlungsfelder der Sozialen Arbeit wirft. Bis in die Gegenwart hinein wurden und werden ständig neue Aufgaben entdeckt und übernommen. Auf diese Weise kommen ständig neue Handlungsfelder hinzu, für die die Präsenz von Sozialarbeiter/innen als unverzichtbar angesehen wird. Dabei fällt eine Einteilung der verschiedenen Handlungsfelder nicht leicht, da das gesamte Feld der Sozialen Arbeit nicht einheitlich konstruiert, sondern historisch zufällig entstanden ist und die dabei verwendeten Begriffe unterschiedlichen Systematiken entsprechen. Trotzdem soll im Folgenden ein Einblick in die Vielfalt der Handlungsfelder gegeben werden. Dies fordert die Profession heraus und bietet zugleich einen großen Vorteil: die Sozialarbeiter/innen erhalten somit die Möglichkeit, sich im Laufe ihrer beruflichen Karriere anhand sich verändernder Interessen und Präferenzen immer wieder neu zu orientieren.
Die folgende Darstellung der Handlungsfelder folgt klassischen Einteilungen, wie sie u. a. von Chassé/Wensierski (2008), Heimgartner (2009), Bieker/Floerecke (2011) sowie Thole (2012) vorgelegt worden sind. Vorgestellt werden die Bereiche Kinder- und Jugendhilfe (Kap. 2.1), Erziehungs- und Familienhilfe (Kap. 2.2), Erwachsenenbildung (Kap. 2.3), Altenhilfe (Kap. 2.4), Gefährdetenhilfe/Resozialisierung (Kap. 2.5), Gesundheit/Rehabilitation (Kap. 2.6), Armut und Ausgrenzung (Kap. 2.7), Interkulturelle/Internationale Soziale Arbeit (Kap. 2.8), Sozialraumorientierte Soziale Arbeit (Kap. 2.9) sowie Sozialwirtschaft (Kap. 2.10). Jeder Bereich wird zunächst überblicksartig beschrieben, dann werden die einzelnen konkreten Arbeitsfelder, Tätigkeitsbereiche und Zielgruppen zur besseren Übersicht tabellarisch dargestellt. Danach werden die mit den Bereichen verbundenen Anforderungen an die Sozialarbeiter/innen, die dort tätig sein wollen, präzisiert. Abschließend werden dann noch wichtige und aktuelle Literaturhinweise gegeben. Die Darstellung versteht sich insgesamt als ein Versuch, Orientierung und Klarheit zu schaffen, wobei die vorgenommenen Einteilungen aber weder als absolut noch als abschließend zu verstehen sind.
2.1 Kinder- und Jugendhilfe
(1) Grundsätzliches
Um die Vielfalt und Bandbreite der hier vorhandenen Arbeitsfelder hervorzuheben, soll im Folgenden im Anschluss an Chassé/Wensierski (2008) eine Trennung zwischen der „Kinder- und Jugendhilfe“ und den „Hilfen zur Erziehung“ (Kap. 2.2) vorgenommen werden (anders: Struck/Schröer 2015). Dabei werden „die Erziehungshilfen als Hilfen bei Problemen des Aufwachsens unterschieden von der Kinder- und Jugendarbeit als allgemeiner Sozialisationshilfe“ (Chassé/Wensierski 2008, S. 14).
Unter Kinder- und Jugendhilfe (siehe Abb. 4) lassen sich demnach alle die Arbeitsbereiche subsumieren, die Kinder und Jugendlichen bei ihrer Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und zum Erwerb sozialer und personaler Kompetenzen beitragen.
Abb. 4: Arbeitsfelder, Angebotsformen und Methoden der Kinder- und Jugendhilfe
Durch die Erschließung von Handlungs- und Aneignungsräumen sollen Kinder und Jugendliche in ihrer Gesamtentwicklung gefördert werden. Daher sind die Angebote prinzipiell an alle Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren ohne spezielle Problemlagen gerichtet, wobei sich die meisten Angebote an Sechs- bis 18jährige richten, meist freiwilliger Natur sind und von freien Trägern angeboten werden (Heimgartner 2009, S. 208 ff.). Die rechtliche Grundlage dazu bildet das achte Sozialgesetzbuch.
(2) Anforderungen
Aufgabe der Sozialarbeiter/innen in diesem Arbeitsfeld ist es, die Entwicklungsbedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen zu erkennen, stabilisierende und unterstützende Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die jeweiligen Handlungsspielräume zu vergrößern und wichtige Anliegen hör- bzw. sichtbar zu machen. Dazu zählt auch die Aufgabe, Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die eine eigenständige Lebensbewältigung ermöglichen. Zu den konkreten Anforderungen dabei zählt, mit der Vielfalt und Offenheit des Feldes umgehen zu können. Spontaneität ist ebenso gefragt wie Offenheit im methodischen Handeln und konzeptionellen Arbeiten. Dabei muss ein Mittelweg zwischen pädagogischem Auftrag und Selbstverwaltung gefunden werden. Die vorfindlichen jugendlichen Lebenswelten müssen akzeptiert und kulturelle Gegensätze ausgehalten werden. Außerdem muss es den dort Tätigen trotz meist begrenzter finanzieller und struktureller Ressourcen gelingen, attraktive Projekte zu entwickeln und durchzuführen (Wensierski 2008, S. 43 ff.). Da knapp 50% der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe freiwillige und/oder offene Angebote sind, ist es eine besondere Herausforderung, sie so zu konzipieren, dass diese für Kinder und Jugendliche attraktiv sind und damit auch tatsächlich von ihnen genutzt werden (Deinet 2011, S. 57 ff.). Darüber hinaus muss nicht nur zu den Jugendlichen, sondern auch zu Schulen, Kooperationspartnern, Ehrenamtlichen, Verbänden etc. ein Zugang gefunden und gepflegt werden (Wensierski 2008, S. 43 ff.). Dies setzt Kooperationsfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Verhandlungsstärke seitens der Professionellen voraus.
(3) Weiterführende Informationen
Links:
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe: http://www.agj.de
Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder und Jugendeinrichtungen e. V.: http://www.offene-jugendarbeit.info
Deutscher Bundesjugendring: http://www.dbjr.de
Die Landesjugendringe: http://www.landesjugendring.de
Handbücher:
Deinet, U./Sturzenhecker, B. (Hrsg.) (2005): Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Henschel, A. (2008): Jugendhilfe und Schule: Handbuch für eine gelingende Kooperation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Jordan, E./Maykus S./ Stuckstätte, E. (2012): Kinder- und Jugendhilfe. Einführung in Geschichte und Handlungsfelder, Organisationsformen und gesellschaftliche Problemlagen. 3. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.
Zeitschriften:
Unsere Jugend, Reinhardt Verlag, erscheint zehnmal jährlich
Deutsche Jugend, Julius Beltz Verlag, erscheint elfmal jährlich
2.2 Erziehungs- und Familienhilfe
(1) Grundsätzliches
Nach dem achten Sozialgesetzbuch werden Hilfen zur Erziehung dann notwendig, wenn Probleme des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen entstehen. Dabei handelt es sich um öffentliche Aufgaben zur Erziehung und Bildung ebenso wie um die Ausübung des staatlichen Wächteramtes (Struck/Schröer 2015, S. 804). Übergeordnete Ziele der Hilfen zur Erziehung sind in § 1 (3) SGB VIII festgelegt. Sie dienen der Förderung der Entwicklung, dem Abbau und der Vermeidung von Benachteiligung, der Unterstützung von Erziehungsberechtigten, dem Schutz vor Gefahren und der Schaffung positiver Lebensbedingungen (siehe Abb. 5). Die primäre Zuständigkeit liegt auf der kommunalen Ebene, eine zentrale Rolle spielt dabei das Jugendamt. Die Leistungen werden jedoch in der Regel von anderen Trägern, z. B. der freien Wohlfahrtspflege erbracht (Stuck/Schröer 2015, S. 804 ff.).
Abb. 5: Arbeitsfelder, Angebotsformen und Methoden der Erziehungs- und Familienhilfe
(2) Anforderungen
Die Erziehungs- und Familienhilfe findet in besonderem Maße im Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle statt. Gerade in diesem Kontext ist es wichtig, dass Fachkräfte in der Lage sind, tragfähige Arbeitsbeziehungen aufzubauen, die einem hohen fachlichen und methodischen Standard genügen. Dazu bedarf es einer empathischen, wertschätzenden Haltung gegenüber dem Klientel, die Fähigkeit, Hilfen so zu gestalten, dass dadurch keine Selbsthilfepotenziale verbaut werden, strategisches, langfristiges Denken sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in multi- und interdisziplinären Teams. Fachliche und methodische Kompetenzen werden vor allem im Bereich der Gesprächsführung und Beratung benötigt, umfassende Rechtskenntnisse sind unabdingbar, ebenso wie theoretische Kenntnisse über Kindheits- und Jugendverläufe (Gissel-Palkovich 2011, S. 100 ff., Trede 2011, S. 132).
(3) Weiterführende Informationen
Links:
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz: http://www.bag-jugendschutz.de
Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe: http://www.jugendhilfeportal.de
Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen: http://www.igfh.de
Handbücher:
Britsch, V. (2001): Handbuch Erziehungshilfen. Münster: Voltum.
Macsenaere, M. (Hrsg.) (2014): Handbuch der Hilfen zur Erziehung. Freiburg i. Br.: Lambertus.
Zeitschriften:
Forum Erziehungshilfe herausgegeben von der internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen, erscheint fünfmal jährlich