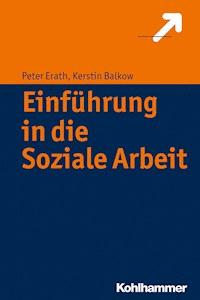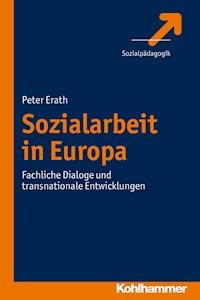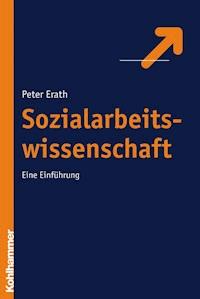
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer heute ein Studium der Sozialen Arbeit aufnimmt, empfindet das Fach oft als unübersichtlich und ohne disziplinären Kern. Ein Überblick über die theoretischen, konzeptionellen und methodischen Grundannahmen fällt ebenso schwer wie die Orientierung hinsichtlich der später zugänglichen Berufsfelder. Ziel dieser Einführung ist es, das (auch im Rahmen der aktuellen Studienpläne) als relevant geltende theoretische und berufsspezifische Wissen der Sozialen Arbeit systematisch aufzubereiten und zu diskutieren. Auf diese Weise eröffnet das Buch nicht nur einen Zugang zu den wichtigsten Fragestellungen und Fachperspektiven der Sozialen Arbeit; es schafft zugleich auch Klarheit angesichts immer komplexerer Handlungsfelder und einer Fülle darauf bezogener Handlungsformen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2006
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wer heute ein Studium der Sozialen Arbeit aufnimmt, empfindet das Fach oft als unübersichtlich und ohne disziplinären Kern. Ein Überblick über die theoretischen, konzeptionellen und methodischen Grundannahmen fällt ebenso schwer wie die Orientierung hinsichtlich der später zugänglichen Berufsfelder. Ziel dieser Einführung ist es, das (auch im Rahmen der aktuellen Studienpläne) als relevant geltende theoretische und berufsspezifische Wissen der Sozialen Arbeit systematisch aufzubereiten und zu diskutieren. Auf diese Weise eröffnet das Buch nicht nur einen Zugang zu den wichtigsten Fragestellungen und Fachperspektiven der Sozialen Arbeit; es schafft zugleich auch Klarheit angesichts immer komplexerer Handlungsfelder und einer Fülle darauf bezogener Handlungsformen.
Prof. Dr. Peter Erath lehrt Theorien der Sozialen Arbeit an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Peter Erath
Sozialarbeitswissenschaft
Eine Einführung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Alle Rechte vorbehalten © 2006 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart
Printed in Germany 978-3-17-019478-6
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-022879-5
epub:
978-3-17-027702-1
mobi:
978-3-17-027703-8
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einführung
1 Begründung der Sozialarbeitswissenschaft
1.1 Sozialarbeit als Praxis und Wissenschaft
1.2 Metatheorie der Sozialarbeitswissenschaft
1.3 Die Sozialarbeitswissenschaft und ihre Bezugsdisziplinen
1.3.1 Sozialarbeitswissenschaft und Soziologie
1.3.2 Sozialarbeitswissenschaft und Psychologie
1.3.3 Sozialarbeitswissenschaft und (Sozial-)Pädagogik
1.3.4 Sozialarbeitswissenschaft und Politikwissenschaft
1.4 Interdisziplinarität der Sozialarbeitswissenschaft
1.5 Zusammenfassung
2 Methodologie der Sozialarbeitswissenschaft
2.1 Sozialarbeitswissenschaft als Sozialwissenschaft
2.1.1 Die hermeneutische Wissenschaftsperspektive
2.1.2 Die kritisch-rationale Wissenschaftsperspektive
2.1.3 Die kritische Wissenschaftsperspektive
2.2 Das Programm der Sozialarbeitswissenschaft
2.3 Das Theorie-Praxis-Problem
2.4 Forschung in der Sozialarbeitswissenschaft
2.5 Sozialarbeitswissenschaft und Theorienreichweite
2.6 Zusammenfassung
3 Dilemmata der Sozialarbeitswissenschaft
3.1 Unbestimmbarkeit
3.2 Fehlende Integrationskraft
3.3 Unklares (doppeltes) Mandat
3.4 Technologiedefizit
3.5 Effizienzverdacht
3.6 Denken und Handeln angesichts von Dilemmata
3.7 Zusammenfassung
4 Theorien der Sozialarbeitswissenschaft
4.1 Alltags- bzw. lebensweltorientierte Soziale Arbeit (Thiersch)
4.1.1 Grundlagen
4.1.2 Ansatz
4.1.3 Methodisches Handeln
4.1.4 Weiterentwicklungen
4.1.5 Bewertung
4.2 Sozialarbeit als „Soziale Hilfe“ (Baecker)
4.2.1 Grundlagen
4.2.2 Ansatz
4.2.3 Methodisches Handeln
4.2.4 Bewertung
4.3 Systemisch-prozessuale Soziale Arbeit (Staub-Bernasconi)
4.3.1 Grundlagen
4.3.2 Ansatz
4.3.3 Arbeitsweisen
4.3.4 Methodisches Handeln
4.3.5 Weiterentwicklungen
4.3.6 Bewertung
4.4 Ökosoziale Sozialarbeit (Wendt)
4.4.1 Grundlagen
4.4.2 Ansatz
4.4.3 Aufgabenbereiche
4.4.4 Methodisches Handeln
4.4.5 Bewertung
4.5 Zusammenfassung
5 Professionstheorien der Sozialarbeitswissenschaft
5.1 Der Sozialarbeiter als stellvertretender Lebenslagen- und Lebenswelthermeneut (Ferchhoff)
5.2 Sozialarbeit als stellvertretende Deutung und typologisches Fallverstehen (Haupert/Kraimer)
5.3 Sozialarbeit als dienstleistungsorientiertes Professionshandeln (Dewe/Otto)
5.4 Sozialarbeiter als „agents of change“ (Freire)
5.5 Sozialarbeit als „bescheidene“ Profession (Müller)
5.6 Soziale Arbeit als „postmoderne“ Profession (Kleve)
5.7 Das handlungstheoretisch ausgerichtete Professionsverständnis (M. Heiner)
5.8 Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession (Staub-Bernasconi)
5.9 Zusammenfassung
6 Modelle der Sozialarbeitswissenschaft
6.1 Aufgabenzentrierte Sozialarbeit (task-centred social work)
6.2 Verhaltensorientierte Sozialarbeit (behavioural social work)
6.3 Krisenintervention
6.4 Unterstützungsmanagement Life Model
6.5 Systemische Sozialarbeit
6.6 Case Management
6.7 Zielorientierte Gruppenarbeit
6.8 Empowerment
6.9 Streetwork/Aufsuchende Sozialarbeit
6.10 Arbeitsprinzip: Gemeinwesenarbeit/Sozialraumorientierung
6.11 Anti-oppressive practice
6.12 Zusammenfassung
7 Sozialarbeitswissenschaftliche Handlungskonzepte
7.1 ASPIRE: Ein Grundschema für professionelles Handeln in sozialen Situationen (Sutton)
7.2 Das Konzept der Problemlösung „kritischer Ereignisse“ (Possehl)
7.3 Das Handlungskonzept des „sozialpädagogischen Könnens“ (Müller)
7.4 Handlungsebenen und -prinzipien in der Fallarbeit (Michel-Schwartze)
7.5 Ein Rahmenmodell methodischen Handelns (Meinhold)
7.6 Ein „Werkzeugkasten“ für methodisches Handeln (von Spiegel)
7.7 13 Arbeitsprinzipien methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit (Heiner)
7.8 Zusammenfassung
8 Bezugswissenschaftliche Methoden und Techniken
8.1 Psychologische Methoden und Techniken
8.1.1 Kommunikation
8.1.2 Beratung
8.1.3 Coaching
8.1.4 Verhandeln und Konfliktmanagement
8.1.5 Mediation
8.1.6 Training
8.1.7 Rollenspiel
8.2 Pädagogik/Sozialpädagogik
8.2.1 Sozialpädagogische Beratung
8.2.2 Nachgehende Betreuung
8.2.3 Didaktik
8.2.4 Methoden der Jugend- und Erwachsenenbildung
8.3 Soziologie
8.3.1 Netzwerkanalyse
8.3.2 Netzwerkorientierte Interventionen
8.3.3 Sozialplanung
8.3.4 Methoden der empirischen Sozialforschung
8.4 Politikwissenschaft
8.4.1 Politische Bildung
8.4.2 Politikfeldanalyse
8.4.3 Lobbying
8.5 Zusammenfassung
9 Professionelle Reflexionsinstrumente
9.1 Supervision
9.2 Berufsethik
9.3 Evidenzbasierung
9.4 Konzeptionelles Denken
9.5 Risikobewertung und Risikomanagement
9.6 Dokumentation und Aktenführung
9.7 Evaluation
9.8 Zusammenfassung
10 Zukünftige Problemstellungen der Sozialarbeitswissenschaft
10.1 Unmarked spaces in der Sozialarbeitswissenschaft
10.2 Europäisierung und Internationalisierung
10.3 Zusammenfassung
Vorwort
Dieses Buch setzt sich zum Ziel, die vielfältigen theoretischen Ansätze, Modelle, Handlungskonzepte und Methoden im Bereich der Sozialarbeitswissenschaft zu strukturieren und zu systematisieren und dadurch das gesamte Wissen und Denken im Bereich der Sozialarbeit insbesondere für Studierende durchsichtig und verstehbar zu machen. Natürlich stellt dieses Buch damit auch einen Akt der Selbstvergewisserung dar. Wer über die letzten zwei Jahrzehnte die Entwicklung der theoretischen Debatte in diesem Bereich insbesondere auch aus einer europäischen und internationalen Perspektive verfolgt hat, der kommt nicht umhin, Stellung zu beziehen.
Allen, die dazu beigetragen haben, dass dieses „Projekt“ gelungen ist, sei herzlich gedankt, insbesondere Ria Puhl für die Anregung zum Verfassen dieses Buches, Horst Sing für die vielen wertvollen Gespräche und Diskussionen und der Kollegin Anneliese Mayr sowie dem Kollegen Stefan Schieren für wichtige Literaturhinweise. Meinen Mitarbeiterinnen Birgit Braun-Dümmer, Sabine Hodek, Eva Sandner und Norbert Eszlinger danke ich für die ausdauernde Unterstützung bei einzelnen Teilrecherchen sowie für die kritische Durcharbeitung der verschiedenen Manuskriptfassungen und die vielen Hinweise und Verbesserungsvorschläge. Marina Tsoi und Barbara Zille danke ich für die sorgfältige Gestaltung des Manuskripts.
Natürlich kommt ein Buch mit dem für manche immer noch nicht genügend „wissenschaftswürdigen“ Titel „Sozialarbeitswissenschaft“ nicht ohne Verbündete aus. Mein besonderer Dank gilt hier Angelika Kulinski für die entscheidenden Ratschläge nach Beendigung des Manuskripts und dem Kohlhammer-Verlag für das Wagnis der Manuskriptannahme.
Ohne die ausdauernde Unterstützung durch meine Frau Beatrix wäre dieses Buch sicherlich niemals endgültig fertiggestellt worden und schließlich erschienen. Ihr widme ich dieses Buch.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Die verschiedenen Felder der Ideengeschichte der Sozialarbeit
25
Abbildung 2:
Die Grundzüge der Argumentation von Saint-Simon
27
Abbildung 3:
Der dialektische Pfad des Wissens
28
Abbildung 4:
Grundelemente sozialarbeiterischerProfessionskompetenz
123
Abbildung 5:
Theoretisch-empirische Grundlagen des Fallverstehens in der Sozialarbeit
124
Abbildung 6:
Der Kreislauf im ASPIRE-Modell
178
Abbildung 7:
Handlungsprinzipien nach Michel-Schwartze
186
Abbildung 8:
Modell für das Erstellen eines Programms
211
Abbildung 9:
Der Policy-Zyklus
221
Abbildung 10:
Konzeptionelles Management
235
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:
Gegenüberstellung strukturierender Differenzen Wissenschaft und Praxis
56
Tabelle 2:
Die Problemkarte
101
Tabelle 3:
Die Ressourcen- und Machtquellenkarte
103
Tabelle 4:
Wissensformen als Antworten auf die W-Fragen von Wissenschaft und Technologie, nach den fünf Phasen einer rationalen Handlung
105
Tabelle 5:
Professionalisierungskonzepte
119
Tabelle 6:
Entwurf eines Modells beruflichen Handelns auf empirischer Basis
135
Tabelle 7:
Das Krisenmodell von Golan
149
Tabelle 8:
Schritte im Case Managementkonzept
158
Tabelle 9:
Hilfematrix nach Müller
183
Tabelle 10:
Struktur des Werkzeugkastens
189
Tabelle 11:
Erschließungsfragen zu einzelnen Arbeitsschritten
194
Tabelle 12:
Übersicht über den Einsatz verschiedener Methoden
213
Tabelle 13:
Quantitative versus qualitative Methoden
218
Tabelle 14:
Unterschiedliche Daten- und Auswertungsmethoden
219
Tabelle 15:
Skala zur Einschätzung des Risikos „Gewalttätigkeit“
236
Einführung*
Die gegenwärtige Situation: Unbehagen mit der Theoriebildung im Bereich der Sozialen Arbeit
Das Niveau des professionellen und wissenschaftlichen Denkens und Handelns im Bereich der Sozialen Arbeit wird heute von vielen Beteiligten als unbefriedigend empfunden. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Sie liegen aber nicht nur im (vermeintlichen) Desinteresse der Praxis an Theorie, dem dünnen Netz an überwiegend sozialpädagogisch und damit disziplinär eher einseitig ausgerichteten universitären Lehrstühlen oder den strukturellen Schwächen des Fachhochschulsystems, sondern vor allem in der theoretisch und praktisch nicht bewältigten „diffusen Allzuständigkeit“ der Sozialen Arbeit. (so z. B. Bommes/Scherr 1996, S. 93, Ferchhoff 1993, S. 708)
Dieser ungeklärten Zuständigkeit zufolge erscheint es – so die Argumentation von Bommes/Scherr – außergewöhnlich schwierig, „eine singuläre wissenschaftliche Theorie der Sozialen Arbeit“ (Bommes/Scherr 1996, S. 93) zu entwickeln. Gelingt dies aber nicht, stellt sich die Frage, ob es sich beim Begriff der Sozialen Arbeit lediglich um ein historisch etabliertes Einheitsetikett für heterogene Praktiken handelt, „deren Zusammenhang nur noch darin besteht, daß sie als Soziale Arbeit die berufliche Ausbildung zum Sozialarbeiter/Sozialpädagogen voraussetzen“. (ebd.)
Will man sich nicht mit einer solch orientierungsschwachen weil theorielosen Beschreibung der Sozialen Arbeit zufrieden geben, so gilt es, sie nicht tätigkeitsspezifisch, sondern formal zu bestimmen. Bommes/Scherr schlagen dazu vor, Soziale Arbeit bezüglich ihrer gesellschaftlichen Funktion zu begrenzen. Eine Möglichkeit dazu bietet ihrer Ansicht nach die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Im Rahmen dieser Theorie sind Individuen „zu ihrer psychischen und physischen Selbsterhaltung darauf angewiesen, am Kommunikationsprozeß sozialer Systeme teilzunehmen“, und setzen alle Funktionssysteme „eine bestimmte Selbstdisziplinierung der Individuen zu erwartungsstabilen Personen voraus und sehen Möglichkeiten der Exklusion von Individuen vor“. (ebd., S. 103) Da wo dies geschieht und wo Exklusion aus wichtigen Teilsystemen der Gesellschaft Exklusionsrisiken vom Einzelnen nicht mehr bewältigt werden können, werden wohlfahrtsstaatliche Interventionen erforderlich.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!