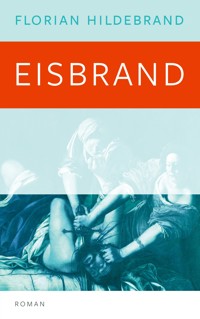
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber die Vergangenheit nicht mit uns«, heißt es in Wes Andersons Film "Magnolia". Davon handelt die Geschichte. Ein Liebespaar verbringt zwei leidenschaftliche, turbulente Jahre miteinander. Es endet im Desaster, die Phantasmen zerspringen. Für jeden beginnt ein eigener, durchwachsener Lebensroman. Nach zwei Jahrzehnten begegnen sie sich wieder und stellen sich ihrer Vergangenheit. Sie müssen erkennen: was sie für ihre Erinnerung hielten, war ein Konstrukt, mit dem sie einigermaßen zurechtkamen. In Rede und Gegenrede verschwimmen die Grenzen zwischen Fakt und Behauptung, Lüge und Missverständnis, Verantwortung und Verrat. Am Ende wissen sie weniger denn je, was sich damals tatsächlich zugetragen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZUM BUCH:
»Wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber die Vergangenheit nicht mit uns.« (Wes Anderson, Magnolia).
Wir sind, was das Vergangene aus uns gemacht hat. Ein Liebespaar verbringt zwei leidenschaftliche, turbulente Jahre miteinander. Es endet im Desaster, die Phantasmen zerspringen. Für jeden beginnt ein eigener durchwachsener Lebensroman. Nach zwei Jahrzehnten stehen sie plötzlich wieder voreinander und stellen sich ihrer Vergangenheit. Sie erkennen: was sie in Erinnerung behielten, war ein Konstrukt, mit dem sie halbwegs zurechtkamen. In Rede und Gegenrede verschwimmen die Grenzen zwischen Fakt und Behauptung, Lüge und Missverständnis, Verantwortung und Verrat. Am Ende wissen sie kaum mehr, was sich damals tatsächlich zugetragen hat. Aber eins ist gewiss: Es ist der Schmutz, durch den das Leben zu sich findet.
FLORIAN HILDEBRAND, Germanist und Soziologe, war lange Jahre Wissenschaftsautor für die ARD, insbesondere den BR. Nach Der Bucklige von Mossul ist Eisbrand sein zweites belletristisches Buch.
Dank an MB, die Ferne, an E+S, ohne die alles keinen Sinn hätte, und an UO, schon deswegen.
There is a crack in everything, that’s how the light gets in.Leonard Cohen
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
1
»Du willst ohne los?«
»Schauen wir, was passiert.«
Er sah mich prüfend an und streckte mir den Gurt mit der Sicherheitsleine entgegen.
»Du weißt, ich darf dich so nicht gehen lassen.«
Ich nickte. Er schien zu ahnen, dass ich die Routinekontrolle übernahm, aber vielleicht anderes vorhatte.
»Soll jemand mitgehen?«
»Carlos.«
»Schon gut.«
Wenn die Sonne schien, streckten sich ihr eisige Kristalle entgegen. Trat ich auf das raue Glitzerfell, zerknirschte es wie Schlacke. Überfegt vom unaufhörlichen Wind glänzte die weite Schneeebene bis zum Horizont und schob sich unter das kalte Blau des Himmels. Mittendrin stand auf langen Stelzfüßen Neumayer III, als wolle die deutsche Antarktisstation mit dem eisigen Untergrund so wenig wie möglich zu tun haben.
Im Augenblick hatte mich allerdings eine milchdichte Nebelwand gefangen genommen. Sie verschluckte die schwarze Führungsleine, die sich aus der Station von Stock zu Stock bis hinüber zum Gewächshaus hangelte. Zu sehen war von ihr nur die nächste Armlänge vor mir.
Das Whiteout holte mich aus einer Welt überschießender Orientierung. Es sackte jede Linie ein, Baum, Straße, Haus oder Horizont. Das Auge verlor die Linien von oben und unten, senkrecht und waagrecht, vorn und hinten, die Innenohrschnecke taumelte und flüchtete sich in Illusionen. Ich sah eine Stufe, trat hinunter und fiel hin. Es war bretteben. Mir wurde übel.
Hinter mir das Ungetüm von Forschungsstation war verschwunden, nicht mal als dunkler Hintergrund zu erkennen.
Ich stand still. Jede Bewegung nahm mir das Innenohr übel. Der Schwerkraft war ihre Selbstsicherheit genommen. Mein Magen hob sich. Rasch langte ich nach der Führungsleine, riss an ihr, musste sie hart durch die Handschuhe spüren. Nur grifffeste Materie sicherte das Gefühl für Ort und Richtung.
Ich solle mich jetzt anseilen, sagte Carlos, Chef vom Dienst der Station nachdrücklich. Der Karabiner am Sicherheitsgurt klackte um die Führungsschnur und schrappte vor bis zum nächsten Aluminiumstock, vor der Öse klinkte ich ihn aus und dahinter wieder ein. Das harte Klack Klack suggerierte im völlig Gesichtslosen einen Hauch Sicherheit. Für das notleidende Gleichgewicht hielt ich die Leine fest am Handschuh.
Nähme ich den Karabiner nur für einen Augenblick von der Führungsschnur und träte einen Schritt zur Seite, ginge ich sofort verloren, in Greifweite der Station.
Also los. Ich stand inmitten der weißen Wand, und sie blendete mich grell. Sie wallte nicht einmal, wenn ich mit ausgestreckten Händen in ihr herumfuhr. Ich zurrte an der Führungsleine, spürte wohltuenden Widerstand und schritt voran. Meine Füße verschwanden knieabwärts im Nebel, doch das Knirschen des Schnees unter den Stiefeln beruhigte. Nach und nach löste sich die Anspannung, ich schritt sicherer aus, schloss die Augen, mir wurde leichter, ich hob förmlich ab, erst zaghaft, angespannt, eine Gestalt Chagalls, driftete leichtsinnig, walzerte schlingernd an der schwarzen Leine. Müssen und Sollen, Pflicht und Schuld hatten sch von mir gelöst.
Es waren wenige hundert Meter von der Station bis zum Gewächshaus, an klaren Tagen eine Sache von Minuten. Im Whiteout jedoch dehnte sich die Zeit. Indem ich ging, kam ich nicht voran. Im letzten Jahr hatte ich einige Nackenschläge einstecken müssen. Seither trieb ich wie ein Blatt im Wasser. Niemandem wollte ich etwas beweisen, keine Entscheidung mir aufnötigen lassen. Die Einladung zur Neumayer-Station in der Antarktis kam gerade recht. Mich der kontinentweiten Eiswüste auszusetzen, der grellen Finsternis, leerte mich vielleicht so weit, dass ich das innere Gerüst entdeckte, das mich zusammenhielt.
Ich zog am Sicherungsgurt. Die Führungsleine schnarrte leise vom Endlichen zum Unendlichen. Wenn ich voranschritt, gelangte ich vielleicht an den Rand des Lebens. Ich war ratlos und grundlos unzufrieden. Die Leere sollte mich produktiv machen, mir die Orientierung nehmen, damit ich sie wieder gewänne. Als Amundsen und seine Leute auf dem Weg zum Südpol von der Route abgekommen waren, gingen sie absichtlich im Kreis, um sich nicht zu verirren. Das Ziel käme mit dem Gehen in Sicht. Die Reepschnur folgte dem Willen dessen, der ihr nachging, oder einer Sehnsucht, die sich ihrer nicht bewusst war.
Mit Absicht bewegte ich mich im Whiteout, um an den von verlässlichen Normen und Naturgesetzen eingehegten Horizont zu gelangen. Je besser ich die Regeln verstand, desto deutlicher zeichneten sich ihre Grenzen ab. Im Makroskopischen beschrieb die Physik die Gesetze der Materie auf nachvollziehbare Weise. Wenn es allerdings ins Subatomare der Quanten ging, jener winzigen Energieeinheiten, ging alles Verlässliche verloren und sogar das Gespinst von Ursache und Wirkung, nach dessen Regeln alle Welt rotierte. Solange ich an der Reepschnur zog, knarrte sie beruhigend in den Ösen. Ließ ich sie los, verlor das Allernächste seine Gewissheit.
Das Verlangen nach Verlässlichkeit hatte den Prozess der Zivilisation vorangetrieben und Übersichtlichkeit und Sicherheit produziert, gleichzeitig neue Verunsicherung nach sich gezogen. Die Naturwissenschaften machten die Welt berechenbar. Je mehr Rätsel sie ihr nahmen, desto mehr neue legten sie frei. Inzwischen jagte die Katze der Aufklärung dem eigenen Schwanz hinterher, und der alte Faust stieß an die Innenschale seines Schädels.
Gerne stand ich vor den riesigen Maschinen, die der gewitzte Schweizer Jean Tinguely zusammengeschraubt hatte. Sie ratterten, schepperten und klingelten mit enormer Gestik vor sich hin, ohne etwas zu produzieren. Nur sich zu genügen, nicht äußerem Verlangen.
Mir kam es darauf an, bei all der Schulterklopferei, mit der sich die Menschen ihre Verunsicherung gegenseitig aus dem Leib zu stauben suchten, genau jenes Schwanken zu spüren, das mich durchs Leben begleitete und das den aufrechten Gang überhaupt erst fühlbar machte.
Entscheidend war, mit klammem Mut ins dicke Weiße zu treten, um am anderen Ende an einem überraschenden Ort herauszukommen.
Carlos misstraute mir zu Recht. Ich gehörte nicht zu den Teamplayern, die in weltabgewandten Stationen wie der Neumayer konzentriert ihren Dienst versahen. Es waren kompetente Menschen, handverlesen für ihre Aufgabe. Ihr Dienst war durch nichts infrage zu stellen. Schon gar nicht durch das, was sie erbohrten, maßen, aufzeichneten, filtrierten. Weitab vom Pumpen der Zivilisation waren sie die ernsthaftesten Zeugen für die Niederlage derer, die sie entsandt hatten. Alles schlug sich auf dem Leichentuch des siebten Kontinents nieder. Ruß der in den Buschfeuern Australiens verkohlten Koalas und der brennenden Primaten Amazoniens, Plastikmüll abgesunken in die Mägen von Fischen und Vögeln, Abgase aus Industrieschloten und Autos, Dioxin von Feldern und Sümpfen.
Die Forschenden sprachen über die Ergebnisse ihrer Messreihen und Niederschlagsprofile in aller Deutlichkeit, durchdrungen von der Überzeugung, wonach die tanzenden Besen der überbordenden Zivilisation all den Dreck schon wieder zusammenkehren würden. Ich war einst in die Welt entlassen worden mit beträchtlicher Skepsis, was die Vertrauenswürdigkeit meiner Spezies betraf. Sie ließ mich auch später nicht los und ich sie nicht. Seit ich in wissenschaftsnahen Bereichen herumstrich, fand ich Lücken gerade dort, wo gewöhnlich Erkenntniszuwachs und Lösungskompetenz gefeiert wurden. Bei meinen Grenzgängen ließ ich mich zwischen den Außenposten der Gewissheit hin- und hertreiben.
Damit war nicht an ein Ende zu kommen. Ich richtete mich halbwegs darin ein, bequem wurde es nie. Arved Fuchs zog vor gut dreißig Jahren einen Schlitten bis zum Südpol, den die USA bereits seit Jahrzehnten besetzt hielten. Eine Qual, tauglich allenfalls zum Selbstbeweis. Mich lockte so ein unsichtbarer geologischer Punkt nicht. Ich setzte mich lieber der Unbestimmtheit eines Whiteouts aus und wartete ab, wie es auf mich wirken würde.
Fürs Erste hatte ich mich in die Führungsleine eingeklinkt und tat nun Schritt auf Schritt. Es stand mir frei, mich irgendwo abzuhängen und treiben zu lassen. Wenn mich dann Wahnsinn und Erschöpfung ergriffen, bekäme ich die Antwort auf jene Zumutungen, deretwegen ich hier war.
Es wäre ein Ausweg.
Vielleicht bliebe ich aber auch eingeklinkt bis zum Gewächshaus.
2
»Frau Terwag?«
Meine Gruppe begann auseinanderzulaufen. Ich schaute mich um. Ein kleinerer, älterer, kompakter Mann kam stracks und mit leuchtenden Augen auf mich zu, als habe er die Abwechslung herbeigesehnt. im Schlepptau offenbar seine Frau, eher gehetzt als interessiert.
»Bitte?«
»Erinnern Sie sich an mich?« Ich hatte für das Gesicht nicht sofort Ort und Zeit.
»Sie haben als Studentin bei mir gearbeitet. Vanessa Terwag, nicht wahr?«
»Ja...?«
»Stadtplanung München.«
Im alten Hochhaus, nahe dem Viktualienmarkt.
»Ich erinnere mich, Herr ...«
Der Name ging unter. Eine Frau aus meiner Gruppe platzte mit einer Essenseinladung für den Abend dazwischen. Ich musste an mich halten, die Kundin nicht unwirsch abzuweisen. Derlei Annäherungen mochte ich nicht; bei Pasta und Primitivo stellte sich oft genug heraus, dass ich den Paaren die eheliche Langeweile vertreiben oder eine Privatvorlesung halten sollte. Zum Dank gaben sie mir ihre leise Verachtung für eine promovierte Kunsthistorikerin zu verstehen, die sich nicht zu schade für derlei Führungen war.
Dieses Mal sagte ich zu. Weniger wegen der vorlauten Frau als ihres Ehemanns, eines zurückhaltenden älteren Herrn mit verstrubbeltem Schnauzer. Er war mir während des Rundgangs mit anregenden Bemerkungen aufgefallen, während seine Frau ihn kleinzureden versuchte. Von ihm ging die diskrete Anziehungskraft eines altmodischen Bildungsbürgers aus.
»Verzeihung, Herr ..., wir sind unterbrochen worden. Wollen wir einen Kaffee trinken? Ich habe in einer Stunde die nächste Führung.«
Wir setzten uns zwischen eloxiertes Aluminium und korinthische Gipssäulen, die noch weniger nach Paestum gehörten als der Sphinx nach Las Vegas.
Er hatte in seiner Abteilung Werkstudenten eingestellt. Ich war bei ihm beschäftigt, über zwanzig Jahre war das jetzt her, und hatte Robert dazu geholt. Keine glückliche Idee. Wir entfernten uns gerade voneinander. Robert war meist schlecht gelaunt, wenn er mich sah. Aber er ließ mich nicht los. Irgendwie war er gefangen in seiner Unentschiedenheit. Ich litt unter den wechselnden Stimmungen.
Noch schliefen wir miteinander. Er besaß ein gewisses Naturtalent, ohne sich dessen bewusst zu sein, jedenfalls nach den Jungs zu urteilen, die zuvor angeberisch in mir herumgestochert hatten.
Er konnte nicht genug von mir kriegen. Es fühlte sich gut an, ihn zu reizen, bis er sich kaum noch zurückhalten konnte. Doch irritierte mich, wie er förmlich in mich hineinkriechen wollte. Wir zerrten an den Stellen, wo wir uns ineinander verhakt hatten.
Der Stadtplanungsdirektor erzählte wichtig, was er von Robert so alles erfahren hatte. Sie waren sich vor einiger Zeit in einer Ausstellung über den Weg gelaufen, Robert wirkte auf ihn immer noch wie ein unbekümmerter Junge, der die Dinge nehme, wie sie ihm zufielen. Er schwebe über Grund, um sich nicht an den Steinen der Wirklichkeit zu stoßen. Ich fragte nach. Ja, verheiratet sei er, ob gewesen oder noch, wisse er nicht, zwei Kinder habe er beiläufig erwähnt. Es stach leise. Natürlich, ihm fiel immer alles zu.
Ich musste los, der Stadtdirektor verabschiedete sich enttäuscht über die Kürze der Abwechslung, ich nahm die nächste Gruppe in Kauf.
Robert hatte mich damals fast das Leben gekostet. Jetzt war er wie eine Kröte aus dem mit Wasserlinse bedeckten Teich der Erinnerung hochgeploppt und hockte in der Mitte auf einem besonnten Schwimmblatt, als sei es eigens für ihn gewachsen. Ich mochte an ihn denken, und gleichzeitig widerstrebte es mir. Wir waren wie Kinder übermütig um uns spritzend ins Meer gerannt, hatten darin herumgetobt, dann war es stürmisch geworden, die Wogen warfen uns hart ans Ufer.
Robert war der Grund, warum ich nach Italien ausgewichen war. Dachte ich an ihn und nicht nur in der Nacht, war ich um den Schlaf gebracht. Bis heute bekam ich nicht zusammen, was mich dazu getrieben hatte, mir diesen Mann als Schicksal auszusuchen.
Das Abendessen mit dem Ehepaar gelang insoweit, als der Elias-Canetti-Bart sich als Spezialist für alte Grabmäler in Rom entpuppte. Er fotografierte sie kantenscharf schwarzweiß und schattenlos. Keines schien ihm unzugänglich. Mit seinem Objektiv grub er sie an Stellen aus, die zu finden man schon ziemlich gewitzt sein musste.
Ich rechnete ihn zu diesen stillen Spezialisten, die alles ihrer Leidenschaft unterwarfen und sich damit den Ruf eines enzyklopädischen Fachmenschen erwarben. Jedes ihrer Objekte konnten sie endlos kommentieren. Wenn sie veröffentlichten, wurden es Standardwerke mit begrenzter Öffentlichkeit, aber jahrzehntelanger Referenz. Ihre Ehefrauen zerfielen in Fremdstolz und Eifersucht. Für ihre Kinder waren sie ein Kuchen, den sie anschneiden, aber nicht essen durften.
Nachdem ich an dem Tag zwei weitere Gruppen in Paestum niedergeredet hatte, kehrte ich zu meiner Gastfamilie nach Neapel zurück. Mein Zimmer empfing mich mit der kalten Feierlichkeit des italienischen Faschismus. In der Giebelmitte über dem oval geschliffenen Spiegel des Kleiderschranks saßen Rutenbündel und Axt. Gegenüber trumpfte voluminös eine Anrichte mit marmornen Säulchen und kühler Steinplatte auf. Im nachmittäglichen Dämmerlicht der geschlossenen Fensterläden wirkten die Möbel wie schläfrig hingelagerte Bisons, die dem einstigen Donnern ihrer Hufe nachlauschten.
Der Stadtdirektor hatte in seiner unbekümmerten Mitteilsamkeit die Kröte aus dem Teichgrund nach oben gescheucht. Da blinzelte sie nun in die Nachmittagssonne und war in ihrem Warzenkleid nicht mehr dazu zu bewegen, wieder zwischen die Wasserlinse abzutauchen.
Robert – ein paar Jahre älter als ich – hatte mich aus dem Kokon herausgeklopft, dem Thomas Bernhard letztlich entronnen war, indem er ihn sich gefügig machte, und mich in eine disparate studentische Gesellschaft bugsiert. Zwar war ich mit meiner Familie wie ein Schlossfräulein aufgewachsen, aber in der großen Universität des Nachbarlandes fühlte ich mich wie ein Provinzei. Wenigstens hatte uns mein Vater, da war er unerbittlich, Dialekt zu sprechen ausgetrieben. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, wenn ich den Mund aufmachte, hörten die werten Mitstudierenden die heraus gebackene Landpomeranze im Lodenmantel.
Das Institut, in dem ich Robert begegnete, war noch nicht vom Massenbetrieb aufgeschwemmt. Das akademische Personal pflegte lockerdirekte Kontakte mit den Studierenden, man ging gemeinsam auf fachliche Exkursion, zum trinkfesten Kegeln, auf Kneipentour und zum Stammtisch. Jährlich fuhren die Semester gemeinsam zum Skifahren.
Robert suchte Geselligkeit genauso wie geistige Nahrung. Waren wir allein miteinander, sank seine Spannung rasch, außer wir schlugen die Schenkel umeinander. Er hatte eine unstillbare Rastlosigkeit in sich. Er musste in die Kneipe, ins Kino, ins Jazzlokal, ins Theater, in jedem Fall hinaus, wo er etwas aufnehmen konnte. Er suchte meine Nähe, um aus ihr auszubrechen. Ich sollte ihn bei allem begleiten, aber wonach er verlangte, lag immer außerhalb meiner Reichweite. Ich kam wie sein Sancho Pansa mit, nörgelnd, unverzichtbar.
Begegnet waren wir uns in der Hauptvorlesung, der Piazza des Instituts. Suchend stand er vor den Sitzreihen, ein finster dreinblickender Lockenkopf in Jeans und knittrigem Hemd. Der Hörsaal war gestrichen voll, es gab kaum freie Plätze. Er drängelte sich bis zu mir durch, setzte sich neben mich und warf ungeschickt meine Wasserflasche um, sodass sie unter den Tisch rollte.
»Origineller geht’s nicht?«, maulte ich ihn an.
Er langte nach der Flasche, stellte sie mir mit Aplomb hin, murmelte etwas Unverständliches und beachtete mich nicht weiter. Das hielt ihn aber einige Tage später nicht ab – wir waren zu mehreren beim Baden –, sich neben mich zu stellen, die ich mich gerade zum Sonnenbaden ausgestreckt hatte, mich von oben bis unten zu begutachten und nach einem gemeinsamen Kaffee zu fragen. Seine Begleiterin, eine langschmale Dunkle mit großen traurigen Augen schaute bestürzt.
Er erschien in meiner Schwabinger WG, in der Hand einen Strauß handgepflückter Sommerblumen aus dem Englischen Garten. Ich war verblüfft von der altmodische Attitüde. Auf meinem Plattenteller lief eine kongolesische Messe, und als das Kyrie begann, geriet er aus dem Häuschen. Wir tranken Tee, dann lockte ich ihn pflichtschuldig in die Kiste. Er hätte sich damit wohl Zeit gelassen. Auf seine Pubertätsfrage, wie viele Männer ich vor ihm gehabt habe, antwortete ich »siebzehn«. Ich war neunzehn. Er schnappte nach Luft. Ich fragte mich, wie naiv man in seinem Alter sein konnte.
Für einen Bafög-Studenten war er einen Tick zu üppig ausgestattet. Er bewohnte ein geräumiges Zimmer in einer Fünfer-WG direkt hinter der Universität und fuhr ein altes VW-Cabrio. Seine Arbeiten schrieb er auf einer elektronischen Schreibmaschine. Die Hemden, die er trug, stammten vom Schneider. Ich konnte ihm wenigstens die Monogramme austreiben.
Er war süchtig nach dem Leben. Nacheinander hatte er bereits drei Fürsorgeeinrichtungen absolviert, zuerst einen Haushalt von Muttergänsen mit misstrauisch gereckten Hälsen und anschließend das Militär. Luft zum Atmen hatte er sich verdient. Die Frauen umschwirrten ihn aber weiter argwöhnisch, als ob das Junge draußen nicht allein zurechtkommen sollte. In der Tat hatte er noch eine Unschuld an sich, die es mir leicht machte, ihn aber von Grausamkeiten nicht abhielt. Etwa die, aus der Soldatenzeit eine schwangere Frau mitzubringen und auf elterliches Geheiß zu ehelichen. Kaum war seine Mutter gestorben, verließ er Frau und Sohn.
Vor uns lag eine Zeit, in der wir kaum die Füße auf die Erde bekamen. Es war für mich mit nichts, was ich bis dahin erlebte hatte, vergleichbar. Selbst als Esmeraldo verschwand.
3
In einer Eignungsprüfung, ich war Anfang zwanzig und hatte gerade die Militärzeit hinter mir, sollte ich aus dem Satz »Ich ging durch die belebte Stadt, als ...« eine kleine Geschichte ableiten. »... meine Frau verschwand«, ergänzte ich und beschrieb eine verzweifelte Suche in London. Ich wurde trotzdem genommen. Mein Ausbilder erzählte mir später, er habe sich über die Geschichte gewundert, sagte aber nicht warum.
Inzwischen wusste ich es.
Den Sommer verbrachten wir in einem Ferienhaus auf Korsika. Das Mobiliar war abgewohnt, die bekieste Terrasse dagegen eine mondäne Geste. Groß wie ein Hubschrauberlandeplatz erlaubte sie uns einen großzügigen Blick über die Siedlung und den mäßig bevölkerten Strand. Von dort waren wir in ein paar Minuten am Wasser. Mein alter Urlaubstraum, vor dem Frühstück aus dem Schlafzimmerfenster springen und ins Meer hinunterrennen. Ein paar Dutzend betagte und zurückhaltende Bungalows lagen um unser Haus am Hang verstreut unter alten Kiefern, jeder abgeschirmt vom Nachbarn. Neben der Siedlung rauschte ein Bach über glatt polierte Felsblöcke in eine Lagune am Strand.
Die Sensationen im Ort endeten an einem mittelgroßen, in die Jahre gekommenen Hotel mit Swimmingpool und Minigolfanlage; keine Läden, Tennisplätze, Restaurants, Golfplätze, nichts von touristischem Belang. Von der Hauptstraße weit oberhalb bog man im Dorf Sainte Lucie auf eine durchlöcherte Teerstraße ab und rumpelte hinunter bis zu einem Parkplatz oberhalb des Meeres, dann war Schluss. Der Ort nannte sich Olmuccio und kannte weder Tagesgäste noch Durchgangsverkehr.
Wir waren in Korsika, das Rennrad hatte ich pflichtgemäß dabei, und jeden Morgen nach dem Schwimmen schnaufte ich damit eine halbe Stunde hinauf zum Bäcker in Sainte Lucie. Wenn ich wiederkam, hatte meine Frau Lea Adele und Paula mit Glück aus den Betten gescheucht, damit sie das Frühstück in der Loggia deckten. Danach floss der Tag träge aus wie Honig. Solange die Mädchen klein waren, flügelten wir, wenn überhaupt aus, sobald die Hitze nachließ. Im nächsten Ort das Fischlokal und das Freiluftkino, der Bach weiter oben mit Kaskaden und klaren Gumpen, eine uralte Fluchtburg schon fast in den Bergen, ein genuesischer Wachturm, alles rasch erreichbar. Später auch der Kletterpark in den Bergen.
Jedes Jahr die Eroberung des Gleichen. Familien schaffen sich Rituale, daraus Geschichte und Erinnerung wachsen, die wiederum das Zusammenleben stabilisieren. Ich war eigentlich nicht dafür geschaffen, doch von Lea lernte ich den Wert von Traditionen.
»Robbi, heute hole ich die Croissants, wenn du nichts dagegen hast.«
Ich hatte etwas dagegen. Die morgendliche Anstrengung auf dem Sattel hinterließ für den Rest des Tages eine wohlige Mattigkeit. Ich maulte, um das Privileg aufzuwerten, und überließ Lea das Colnago.
Nach einer Stunde war Lea noch nicht zurück. Nach einer weiteren setzte ich die Kinder ins Auto und fuhr langsam die Strecke hinauf nach Sainte Lucie ab. Im Ort erinnerte man sich an sie, natürlich, die schlanke dunkelhaarige Mittdreißigerin mit den großen Augen und südländischen Zügen auf einem roten Rennrad, Französin, als die sie angesprochen wurde.
»Ah, Madame, der Gemahl heute verschlafen?« Weiter war dem Bäcker nichts aufgefallen.
Ich neige nicht zur Panik, Lea ging manchmal spontan ihren Einfällen nach; denkbar, wenn auch ungewohnt, dass sie Gefallen an Schweiß und Muskeldruck gefunden und die Runde länger angelegt hatte. Ihr Handy war im Schlafzimmer liegen geblieben. Wir kontrollierten die Umgebung, nahmen abgelegenere Strecken mit, damit Lea uns umso strahlender auf der Terrasse erwartete.
In der Hitze des Nachmittags gingen wir die Straße noch einmal zu Fuß ab; vielleicht war ich beim ersten Mal zu oberflächlich und gierig auf den schnellen Fund gewesen. Von Olmuccio wand sie sich unübersichtlich durch Obstgärten und Olivenhaine, Tierweiden und Weinterrassen, Eukalyptushaine und Brachen hinauf. Wir nahmen uns einen breiten Streifen beiderseits des Asphalts vor. Vielleicht war sie müde geworden, hatte sich an einen Schafstall gesetzt und war eingeschlafen. Obwohl ich sie bisher nicht so entspannt erlebt hatte.
Ich stachelte die Kinder zu einem Wettsuchen an. Wir fragten Menschen, die uns begegneten. Es kribbelte durch meinen Körper. Dass das steile Gelände neben der Straße unbequem zu begehen war, hielt die wachsende Nervosität vorerst nieder. Wir hörten auf, als es dämmerte. Ich mochte die Kinder nicht aus den Augen verlieren. In Sainte Lucie setzten wir uns ins Café des Bäckers. Er fragte höflich, obwohl er die Antwort sehen konnte. Die Kinder hatten sich Knie und Unterschenkel im Gestrüpp aufgeschürft, die Haare hingen ihnen wirr ums Gesicht. Ich bestand auf Eisbecher für sie; sie hätten gerne darauf verzichtet, um möglichst schnell die Mama zu Hause in die Arme zu schließen. Inzwischen hatte sie es mit ihrer Radtour doch etwas übertrieben, war längst zu Hause und machte sich ihrerseits Gedanken. Ich rief ihr Handy an.
Adele wurde wütend, was dachte sich die Mama, Paula verfiel ins Schweigen, schneckte sich ein, ahnte mit ihren fünf Jahren, dass das, was hier geschah, über die Allmacht von Mama und Papa hinausging. Kinder besitzen, bevor die Schule sie mit der Sensation des Wissens überwältigt, ein Organ dafür, was in der Luft liegt, aber für den von der Kausalität eingeschränkten Verstand der Erwachsenen nicht fassbar ist. Altes Wittern des sprachlosen Homo erectus. Sie haben noch nicht die Worte, und Erwachsene überschreiben ihnen mit rationaler Welterklärung das feine Sensorium.
Am Abend lief ich mit Paula auf den Schultern den Strand entlang, sie wollte Ausschau halten. Selbst mit den schaukelnden zerkratzten Beinchen neben meinem Kopf konnte ich die aufsteigende Ratlosigkeit kaum niederhalten. Hat der Verstand erst mal seinen Vorrat an beruhigenden Erklärungen aufgebraucht, flattern die Befürchtungen wie Fledermäuse vor dem verschlossenen Flugloch herum.
Lea hatte sich entfernt, ohne sich zu erklären. Ich war überrascht und wie benommen. Ich war im Irrtum zu meinen, die Kraft, die ich durch meine Familie spürte, sei allein meine eigene. Ich fühlte mich hilflos und schämte mich. Jetzt sollte ich entschlossen zeigen, gerade vor den Kindern, doch Leas Abwesenheit schwächte mich, und das kränkte. Außerdem keimte tief unten Panik.
Im abendlichen Hotel – konnte Lea nicht einfach im Bikini am beleuchteten Pool liegen mit einem Glas Rosé in der Hand und einer geflöteten Ausrede – erfuhren wir von der einzigen Klinik der Umgebung in Porto Vecchio. Dort war sie nicht eingeliefert. Auf der Polizeiwache gab man sich beruhigend, die paar Separatisten, die sich die Insel als Kuriosität halte, nähmen schon lange keine Geiseln mehr, Touristen schon gar nicht; entführt werde allenfalls zwischen den famiglie. Der Beamte vertröstete uns mit Routine und der Überlegenheit des Nichtbetroffenen auf die nächsten Stunden, höchstens Tage. Innerhalb von achtundvierzig Stunden erkläre sich die Abwesenheit vermisster Personen von selbst.
Er fragte mit einem Seitenblick auf die zerzausten Kinder nach querelle und deutete die Möglichkeit eines Seitensprungs an. Das wäre mir nicht eingefallen. Ich schüttelte den Kopf, er murmelte etwas wie »bei so was kommt es dann heraus« zu seinem Kollegen. Am Ende nötigte ich ihm wenigstens eine Vermisstenanzeige ab und er mir das Versprechen, nicht dreimal täglich die Dienststelle zu behelligen. Nun war es amtlich, polizeilich besiegelt: Lea war verschwunden.
Meine Synapsen feuerten wahllos ins Dunkle; sie wollten Erwiderung, Widerruf, Widerstand, einfach einen Gegen-Stand. Sie verweigerten sich dem Nichtwissen, der Spekulation, der Leere, der erschreckenden Fülle des Möglichen.
Den frühen Homo kränkte es, die allgewaltige Umwelt nicht zu durchschauen. Um die unberechenbaren Mächte einzudämmen, zivilisierte er seine Umwelt. Er sammelte Kenntnisse über Umstände, Abläufe und Wahrscheinlichkeiten in der Natur, speicherte Erfahrungen, Ursachen und Wirkungen. So wich langsam die panische Furcht wachsendem Vorwissen, das sich nach und nach in das neuronale Netz einwob.
Hätte ich demzufolge Lea halbwegs zutreffend eingeschätzt, sollte mich ihr beiläufig hingeworfener, aber entschlossener Wunsch, zum Bäcker zu radeln, alarmiert haben. In ihr atmete ein Luftgeist, bei Tennis und Badminton war sie der Ball, nicht der Schläger, wendeleicht wechselten ihre Entschlüsse. Dass sie jedoch mit Lust zur Qual gegen die mitunter deftig ansteigende Küstenstraße anschwitzen würde, noch dazu auf aufgeschürftem Asphalt, kam meinen Erfahrungen mit ihr nicht gerade entgegen. Allerdings sollte ich mich auch daran erinnern, dass sie leichtfüßig wie eine Bergziege am Fels kletterte, ohne zu ermüden oder sich über auslaugende Anstiege zu beschweren.
Ich hätte trotzdem stutzig werden können. Sie brach nicht einfach aus ihren Gewohnheiten aus. Kapriziös war sie vor allem an der Oberfläche, ein Luftballon, der im Wind tanzte, aber mit reißfester Leine im Boden verankert war. Ohne Ankündigung ganztägig wegzubleiben kam für sie schon wegen der Kinder nicht infrage. Und wenn, ließ sie gewiss nicht ihr Telefon im Schlafzimmer liegen. Etwas musste also ihren Morgenausflug durchkreuzt haben.
Solange Adele und Paula Fragen stellten und Vorschläge machten, hielt ich die Fahne der Zuversicht hoch. Kinder stecken so unmittelbar in den Abläufen des Lebens, dass es mir manchmal schwerfiel, ihnen zu erklären, wie tief das Absurde sich gegen die streng genormte menschliche Welt behauptete. Sie wussten noch wenig und nahmen deshalb zuversichtlich an, dass die Welt sinnhaft, zumindest zweckvoll sei. Indem ich sie darin unterstützte, suchte ich mich auch selbst aufzurichten.
Auf meiner Seite des Bettes hielt ich eine übersichtliche Unordnung, bei Lea sah es anders herum aus. Mir widerstrebte, in ihrem Telefon zu stöbern, überhaupt meine Nase in Dinge zu stecken, die sie für sich behielt. Sie tauschte sich unbefangen aus und strengte sich nicht an, Blößen zu vermeiden. Geheimniskrämerei lag ihr gar nicht, selbst ihre Geburtstagsüberraschungen konnte sie kaum beschweigen, ohne vorher zu platzen. Wenn ich sie nicht ausfragte, dann auch aus Selbstschutz. Ich hatte nichts Wesentliches zu verbergen, mochte aber nicht über alle Trivialitäten Rechenschaft ablegen. Das hinderte sie allerdings nicht daran, über mein berufliches Leben mehr wissen zu wollen als es zu sagen gab.
Jetzt musste ich an ihre Sachen. Ich bemühte mich, sie wie Beweisstücke zu behandeln. Lektüre, Notizbuch, Kulturbeutel, sie reiste mit geringem Aufwand, umso genauer nahm ich jedes Stück ins Verhör. Ihre Unterwäsche baumelte höhnisch vor mir und zeigte mir erneut ihre Freude, den Körper angemessen auszustellen. Ich fand nichts Befremdliches.
Blieb das Smartphone als Fundgrube. Vielleicht würden ihre Fingerabdrücke darauf noch gebraucht. Vom Bildschirm meines Geräts zog ich die Schutzfolie ab und klebte sie auf ihr Telefon. Erwartungsvoll und widerwillig betrat ich die in Apps ausgelagerte Intimsphäre. Ich klickte mich durch Mails, Fotos, WhatsApps und Kontaktlisten. Gelegentliche Beschwerden über Unzulänglichkeiten ihres Ehemanns, seine Rechthaberei, die Launen und die Sorge, dass er zu großzügig mit Geld umging.
Auffallend allerdings, was sich unter der Adresse von Esther angehäuft hatte. Leas engste Freundin hatte nach der Uni eine Stelle in Paris angetreten, dort einen Patrick geheiratet und mit ihm zwei Kinder bekommen. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich weder sie noch ihre Familie je gesehen hatte. Das Paar war nicht auf unserer Hochzeit gewesen und hatte uns auch danach nicht besucht. Wir sie auch nicht. WhatsApp-Bilder bekam ich nur zur Geburt ihrer Kinder zu sehen. Lea war zweimal allein nach Paris gefahren und jedes Mal angeregt zurückgekehrt, wobei sie meinem Gefühl nach mindestens so sehr erfrischt hatte, dem Alltagstrott zu entkommen wie die Freundin wiederzusehen.
Lea schien mit Esther unterschiedlich zu telefonieren. Erst ging es ein paar Mal in kurzen Abständen hin und her, dann ruhte der Kontakt wieder für Monate. Kurz vor der Abreise nach Korsika riefen sie sich mehrmals an, das letzte Mal vorgestern von Olmuccio aus. Lea hatte uns angekündigt, dass Esther und ihre Familie vielleicht zu uns stoßen würde. In unserem kleinen Haus wäre es etwas eng geworden. Ich hatte vorgeschlagen, die Familie möge ein Haus nebenan mieten, aber Lea mochte Gedränge im Nest. Ob die vier nun kommen würden, war mir zur Stunde nicht klar. Jedenfalls müsste ich morgen als Erstes Esther anrufen. Ich war auf den Besuch dieser Familie gerade nicht versessen. Aber Esther war die engste Vertraute Leas und konnte sicher einiges zu ihrem Verbleib beitragen. Außerdem würden ihre Kinder unsere Mädchen ablenken, ich könnte Patricks Französisch für Behörden in Anspruch nehmen und auf diese Weise das flatternde Herz beruhigen.
Falls sich bis dahin nicht alles aufklärte.
Sonst müsste ich morgen eine Menge Leute anrufen, Familie, Freunde und Leas Verlag. Ich fürchtete schon jetzt ewig dieselben besorgten Fragen und Ratschläge und Ermunterungen, die aus dem Mund von Nichtbetroffenen so aufopfernd und optimistisch gemeint waren, während ich nicht wusste, wie ich mir und den Kindern alles erklären sollte.
Die Mädchen mochten sich nicht in ihr Zimmer verziehen, obwohl sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnten. Schräg hingen sie über dem abgewetzten Sofa; dort hatten sie die Tür zur Loggia im Auge. Morgen besorge sie die Croissants, sagte Adele unvermittelt, auf die Mutter sei kein Verlass. Kinder in ihrem Alter erwartete alle Tage eine Welt wie eine Wundertüte. Aber was die Eltern anging, waren sie stockkonservativ. Der Vater war nervös und nicht bei der Sache, das kannten sie bereits, und nie war etwas Schlimmes gefolgt. Mich mit den Croissants zu trösten, war für Adele ein Versprechen, dass alles wieder ins Lot komme. Die Mutter war beiden Kindern immer nahe und geheimnislos, warum also sollte sie nicht morgen früh wieder da sein, zumal ihr nach allem, was sie heute gehört hatten, nichts zugestoßen sein konnte. Adele gab sich alle Mühe, Verantwortung zu zeigen und wach zu bleiben. Paula hatte der Schlaf übermannt, die Sorge hatte sie an ihre zusammengezogenen Brauen delegiert.
Ich schickte die beiden ins Bett. Vorher redeten wir noch darüber, wie Lea wohl ins Haus komme, wenn alle schliefen. Es kostete mich Mühe, gegen Befürchtungen anzureden, die ich selbst teilte. Ich mochte ihr Zimmer nicht verlassen. Mir graute, draußen von meinen Gedanken traktiert zu werden. Die Vorstellung, allein vor dem gemeinsamen Bett zu stehen, schnürte mir die Kehle zu. Würde Lea nie mehr neben mir liegen, nie mehr unter der Decke nach meiner Hand suchen, nie mehr »Bääärchen« grummelnd auf mich rutschen? Würde ihre betriebsame Stimme nie mehr das Haus füllen? Ein Nie mehr folgte dem anderen, und die ganze Mühle der Selbstberuhigung, die ich tagsüber für die Kinder drehte, musste ich auch jetzt in Betrieb halten, damit ich nicht anfing zu heulen.
In der Loggia betäubte ich mich mit Wein. Kaum war ich im Schlafzimmer, sprang mich aus den Ecken die Nacht an und versprach, mich auf Trab zu halten. Ich legte mich aufs Bett. Wartete. Auf dem groben Rauputz der Wände hatte sich Kiefernstaub abgelegt. Die Decke hielt eine Art untergezogenes Knochengerüst, in der Mitte längs das Brustbein und zu beiden Seite sechs Rippen, dunkel gebeizt. Ich fuhr mit den Augen an den Balken entlang von einer Seite zur anderen, immer wieder, bis ich nur noch Gitterstäbe sah, die langsam und schwer auf mich sanken, dazwischen weiß das Leere, Offene, Ungewisse, es redete mich an, lauerte, forderte heraus, stellte Fragen, spottete, wieso ich lag, während doch alles zu tun war.
Ich hatte noch nie so viel an Lea gedacht, jetzt, wo sie weg war. Als wir uns das erste Mal begegneten, schwebte sie genussvoll in der Welt, festgemacht am Haus ihrer Familie. Die Menschen, mit denen sie sich umgab, mochten an ihr den begrenzten Eigenwillen des Luftballons. Auch wenn sie es manchmal anstrengend fanden, dass er ständig in Bewegung war. Die Richtungswechsel kamen unerwartet und oft grundlos: auflandig, ablandig, böig, scherwindig, windstill.
Daran änderte auch nichts, als sie mit Adele schwanger wurde. Kaum war das Mädchen auf der Welt, legte sie ohne Kindbett-Blues eine verblüffend geradlinige mütterliche Umsicht an den Tag, ohne dass ihr jugendliches Ungestüm verschwand. Von Stund an standen die Kinder im Mittelpunkt ihres Kosmos, da mochte in ihrer Umgebung flittern und locken was wollte. Sie wirkte anfänglich angestrengt, aber auf eine Weise, die sie tief befriedigte, und erstmal hatte alles abgelegt, was ihr vorher wichtig gewesen war. Lea war eine Frau ohne Geheimnisse.
Sie blieb kontinuierlich sichtbar, wollte das und trat entsprechend auf. Etwas wie eine Nebenliebe war im genetischen Plan ihres Lebens nicht vorgesehen und schon gar nicht, dafür die Kinder auch nur vorübergehend außer Acht zu lassen. Nicht vorstellbar, dass sie ein Leben hinter unserem Rücken führte und dann unangekündigt die Seite wechselte.
Natürlich konnte ich mich irren. Vielleicht hatte ich unsere Ehe anfangs in einen Rahmen vom Glück der ersten Stunde gezwängt und acht Jahre darin festgehalten, während die Leinwand an Spannung verlor, die Farbigkeit an Leuchtkraft und der Inhalt an Überraschung. Leas Abwesenheit zwang mich dazu, in den Rückspiegel zu sehen. Die Deckenbalken, in sich leicht krumm, wahrscheinlich aus hiesigen Steineichen geschlagen, nötigten meinem Hirn Disziplin auf. Aber das Gedankenkarussell fuhr quer darüber hinweg. Für das Rad kamen nur Teerstraßen infrage, und die waren von Touristen und Einheimischen zumindest tagsüber genug frequentiert, sodass Lea, wäre sie gestürzt … Ich versuchte mit meinem Verstand die fantasierende Angst einzukeilen. Aber die Drastik der möglichen Zufälle überwältigte mich. Sie könnte an einem der alten Kilometersteine mit dem Pedal hängen geblieben und in den Straßengraben gefallen sein, lag jetzt mit gebrochenen Knochen an einem Baum und wartete darauf entdeckt zu werden. Eine junge, sportliche Frau brach sich so schnell nichts, aber wenn sie mit dem unbehelmten Kopf aufgeschlagen war … Ich musste mich bremsen, um nicht sofort alle geteerten Straßen der Umgebung im Dunklen noch ein Mal abzufahren, Reifenspuren zu suchen und nach ihr zu rufen. Wenigstens würde es die Unruhe in Zaum halten. Ich müsste nicht eine unendlich sich ziehende Zeit darauf warten, dass uns eine, oder schlimmer, weiterhin keine Nachricht erreichte.
Morgen also in jedem Fall eine neue Suche, gleich in der Frühe nach dem Telefonieren. Die Stimmen der Kinder könnten die Mutter aus der Ohnmacht wecken. Vielleicht blieben sie aber lieber im Haus, warteten auf Lea, denn wer weggefahren war, musste wiederkommen; so war es immer gewesen.
Ich hätte ihr das Colnago nicht geben sollen. Sie war schon zu Hause damit gelegentlich zum Einkaufen gefahren, zu meinem Missvergnügen, denn der alte Renner in metallischem Kirschrot und edler Ausstattung aus den späten Sechzigern war gefährdet. Hier in Korsika vielleicht noch nicht. Da fuhren alle Altersklassen, allen voran die betagteren in werbeübersätem Dress und dürr wie Gottesanbeterinnen neueste Carbon-Technik und, unsäglich, elektrisch.
Schlankes, braunes Bein an weißer Hose dekorierte den roten Renner und umgekehrt; sie wusste es. Das mochte Notgeile verleiten. Mit praller Gier und ungelenktem Tatendrang überholten sie Lea im Pick-up, passten sie hinter einer Kurve ab und zerrten sie ins Auto. In einem verlassenen Schafstall in den Bergen taten sie es dann und ließen sie liegen oder, noch entsetzlicher, erwürgten sie. Sie bliebe auf ewig verschollen, wenn uns nicht ein Zufall gegen alle Wahrscheinlichkeit zu Hilfe käme. Letzteres, um das Äußerste zu denken, damit es mir real erspart bliebe.
Etwas milder fiel die Fantasie von der empörenden Willkür der Erpressung aus. Schulden saßen jemandem im Nacken. Wäre es planungssichere Geldgier, würde er sich wahrscheinlich nicht bei uns bedienen. Wir waren nicht mit einem verspiegelten SUV-Saurier in einem der Edelresorts im Norden abgestiegen. Olmuccio besaß mit seinen alten Ferienhäusern und der miserablen Zufahrtsstraße eine gewisse Immunabwehr gegen korsische Profi-Kriminalität.
Aber die wäre beruhigender als eine übereilte Aktion. Sie konnte teuer werden, aber Lea am Leben lassen. Einem Lehrer, früherem Mitschüler von mir, war vor vielen Jahren die dreizehnjährige Tochter entführt worden. Der Täter versteckte sie in einer eigens gezimmerten Kiste im Waldboden. Zu einer Geldübergabe kam es nie. Das Mädchen war vorher erstickt; er hatte die Luftzufuhr falsch berechnet. Das Versteck wurde Jahre später entdeckt, der Fall bis heute nicht aufgeklärt.
Mir wrangen sich die Hirnwindungen bei dem Gedanken, wie Täterstress, Dummheit und Murkserei ein Verbrechen verderben konnten, das nach krimineller Logik Chancen hatte zu gelingen. Fehler konnten immerhin der Polizei in die Hände spielen.
Die Gedanken trampelten sich Pfade in alle Richtungen. Hatte ich ein Zeichen von Lea an der Straße, in einem der angrenzenden Felder und Gärten übersehen? War der Bäcker nicht eine Spur zu knurrig gewesen, hätte ich ihn mir genauer vornehmen müssen? Warum hatte mich die Polizei so schnell abserviert? Müssten die Behörden nicht akkurater agieren, gerade auf einer Ferieninsel, die den Einheimischen viel Geld einbrachte? War von denjenigen, die wir befragten, jemand nervös gewesen? Vielleicht hatte ich in meiner Fahrigkeit nicht zugehört oder das korsische Italofranzösisch falsch verstanden.
Die Angst genoss es, mich fühlen zu lassen, wie ausgesetzt ich ihr war. Selbstsicher wusste sie, niemand würde mir beispringen, und nutzte die Gelegenheit, sich für alte Verdrängungen zu rächen. Schließlich hatte ich zwei Kinder, denen ich das Schlimmste ersparen, aber auch die väterliche Angst einhegen wollte. Ich neigte nicht zur Hysterie, eher im Gegenteil. Andererseits war ich mit dergleichen nie konfrontiert worden. Was für eine Chance also, dem Vater jetzt den Verstand zu rauben und richtig einzuheizen.
So schreckhaft Lea einerseits sein konnte, was die Kinder ging, so beherzt schritt sie an anderer Stelle zur Tat. Ich wünschte sie mir herbei, ihren unverschnörkelten Pragmatismus, mir beim Suchen zu helfen. Ich brauchte Ideen, andere Perspektiven, wollte beim Grübeln nicht immer in die gleichen Gleise rutschen.
Weiter unten grillten sie, angeschickerte Lachsalven stoben herauf. Machten sie sich schon lustig über den tumben Familienvater, dem die Frau weggelaufen war?
Vor dem Schlafzimmer hörte ich die nackten Füße der Kinder tappen, sie wollten nicht verpassen, wenn plötzlich die gläserne Loggiatür am Boden schrappte, Lea käme herein und erzählte eine aufregende Geschichte. Ich lag auf dem Bett, vor dem Fenster taten die allnächtlichen Geräusche unerträglich harmlos. Kiefernzweige schlugen aneinander und knisterten sich die Tageshitze aus den Nadeln. In den Bäumen piepte es winzig. Auf der Terrasse ließ die flüchtige Tageshitze den Kies knacken. Entfernt rollte das Meer gegen den Strand, als wolle es das Land unablässig daran erinnern, woher es einst gekommen war. Ich stellte meine Ohren scharf, ob es nicht gerade versuchte, einen schweren Körper den Sand hinaufzuschieben und alle Erklärungen mit sich zurückzunehmen.
Neben mir unberührt das hingeworfene Nacht-T-Shirt mit dem Aufdruck Birth of The Blues, einem Titel von Ziggy Elman. Der Mond zwängte sich durch die Ritzen der Jalousien halbhell herein, zitierte hämisch den Abend gestern, als Lea und ich noch lange in der Loggia saßen. Sie plauderte vor sich hin, und ich spürte, sie redete sich in eine enttäuschte Distanz. Ich wartete darauf, dass sich endlich das Gewitter entlade. Ich wälzte mich auf dem Nagelbett meiner Gedanken, stand endlich auf, ging ins Bad und fand überraschend Schlaftabletten, die weder ich noch, wie ich glaubte, Lea je nehmen würde.
Die Kinder waren wieder auf der Couch im Wohnzimmer eingeschlafen. Ich hob sie auf und trug sie in ihr Zimmer. Vor der Loggia zog der Mond einen zittrig hellen Strich über die fadendünne Dünung. Ich dachte an Arnold Böcklins Villa am Meer, die dunkle Gestalt am Ufer, Esmeraldo fiel mir ein, der verschwunden war, wie es Lea bitte bitte nicht geschehen sollte.
Die Unruhe ließ mich nicht los, ich zog die Badehose an und lief mit einem Frotteetuch ans Wasser. Als wolle es mit dem verlassenen Ehemann nichts zu tun haben, hatte es sich zurückgezogen. Ich stieg hinein, ließ mich fallen und schwamm hinter der Mondlinie her. Hatte jemand sie umgebracht? Ich patrouillierte mit den Augen das Ufer entlang bis zum Felsen, der den Badestrand begrenzte, schwamm hin und darum herum und weiter bis zum genuesischen Wachturm. Ich erwartete nichts, es ging um das Ausschließen.
Lea tanzte gerne mit ihren Lebensgeistern, bis sie genug hatte und sie dann wegdrückte wie die Katzenmutter ihre Jungen. Manchmal irritierend schroff. Sie zweifelte nicht an sich und beobachtete sich nicht. Es würde ihr nicht in den Sinn kommen, sich auf ein falsches Leben einzulassen und von da aus nach einem richtigen zu suchen. Was sie für sich tun konnte, tat sie; was sie nicht schaffte, ließ sie und vermisste es nicht. Sie bedauerte nicht, suchte nicht nach Entschuldigung. Wenn sie merkte, dass sie auf Kritik, Widerstand stieß, entschuldigte sie sich nicht, sondern wechselte diskussionslos den Kurs. Sie lebte und fragte nicht warum. Auf eine traumwandlerische Art hatte sie ihr Leben in der Hand und ergab sich ihm, wenn es sich richtig anfühlte.
Demonstrativ befestigte sie den Knaus-Ogino-Kalender am Küchenschrank und trug gewissenhaft die Daten ein. Anfangs. Sie wurde wie geplant schwanger und durfte sicher sein. Ich hatte sie um Adele gebeten. Trotzdem, jetzt kam es zum Schwur. Machte der Kerl tatsächlich ernst und gab sein ungebundenes Leben auf? Sie wollte mit dem Kind keinesfalls allein sein. Nach dem Test kam sie nicht gleich nach Hause, sondern Stunden später. Leicht angetrunken, vorerst das letzte Mal, warf sie mir heulend ein Buch auf den Tisch »Ich werde Vater«. Ich begriff nicht gleich. Ich hatte sie ermutigt, sie hatte sich getraut, warum der Auftritt?
Jeder verteilte seine Ängste auf eigene Weise. Lea spürte festen Untergrund unter den Füßen, wo er mir manchmal schwankte. Und umgekehrt. Im Gebirge schritt sie ohne zu zögern auf schmalsten Graten, über die ich nur rittlings hoppelnd kam. Unversicherte Kletterstellen überkrabbelte sie leichtfüßig wie eine Spinne und hangelte sich an ausgesetzten Eisenstiegen hoch, als hätte sie statt hunderte zwei Meter Abgrund unter sich.
Die saugende Tiefe machte ihr anderswo zu schaffen. Ans Meer trat sie mit Respekt, es wollte nach ihr greifen, unter der Oberfläche zuckten dunkle Schattenwesen herbei, wollten sie in grausige Tiefen ziehen. Der Wellengang zerrte gefährlich an ihren Fesseln; er drohte, sie mit Gischt durcheinander zu wirbeln, nahm ihr für einen Moment die Luft. Schwammen wir gemeinsam weiter hinaus, robbte sie auf meinen Rücken, krähte fröhlich »Der Knabe auf dem Delfin!« und paddelte unbeschwert mit.
Die Gier des Meeres saugte viel mehr an ihr als je der Sex. Mir schien sie eine sich selbst kontrollierende Hormonabfuhr zu betreiben. Ihre Höhepunkte ließ sie wie kleine Tischfeuerwerke abknattern, um danach etwas verschämt lachend zur Tagesordnung überzugehen. Überhaupt manövrierte sie sich weiträumig an so etwas wie Chaos vorbei, für die Lust an der Hingabe, die alles fahren ließ, fehlten ihr Mut und Antrieb. Alkohol trank sie bis an den Rand eines Schwipses. Mehr brauchte sie nicht und fürchtete sie vielleicht. Wofür sie heute in Enthusiasmus entflammte, war morgen vergessen. Jemand wie Lea hüpfte wie ein Korken auf den Wellen und wurde immer, immer an den Strand gespült.
Ich schwamm zurück, sah schon von weitem meine Kinder am Strand stehen und beeilte mich.
»Papa!«
Ich durfte sie nicht allein lassen, jetzt schon gar nicht. Es beruhigte sie, dass ich Lea am Strand gesucht hatte.
Auf dem Weg zum Haus kroch mir endlich die Müdigkeit die Glieder hoch. Doch kaum im Bett sprang die Gedankenmühle erneut an. Worüber hatten wir gestern Abend gesprochen? Ich hätte in sie dringen sollen. Sie war leicht zu öffnen. Wir kannten uns gerade ein paar Wochen, ich hatte Gegner in ihrer Familie, und die heizten ihr ordentlich ein. Mittags rief sie mich im Büro an.
Ich fragte »wie geht’s?«
Sie antwortete im dreigestrichenen Cis:
»Guhut!«
»Und wirklich?«
Übergangslos heulte sie los.
Ihr Glissando gestern Abend in der Loggia schien mir das Angebot zu enthalten, ich möge ansprechen, was ihr nicht leicht fiel. Ich mochte uns, mir den Abend nicht erschweren. Gewöhnlich machte sie es mir leicht und schimpfte, wenn sie in Not war und Veränderung anstand. Leider erkannte ich das zu spät. Ich ließ mich von ihren Anwürfen beleidigen, anstatt um den Tisch zu gehen und sie wortlos in die Arme zu schließen. Und nun allein im korsischen Bett fiel mir auf: Sie musste erst verschwinden, ehe ich sie vor mein inneres Auge treten ließ, ihren Worten nachhörte, mich nach ihren Gesetzen befragte.
»Du fehlst«, hatte mir früher mal eine Freundin am Telefon gesagt. »Mir« kam nicht vor, als ob es zu verbindlich klinge. Ich fehlte wie der Kaffeebecher, der nicht an seinem Platz stand. Lea war fort und ließ mich den Unterschied fühlen, wenn das »mir« fehlte.
Mir graute vor dem kommenden Tag am Telefon, all die Fragen, die besorgten Versprechen, das beteuerte Mitleid, die klugen Ratschläge, das vernünftige Unbeteiligtsein. Vor allem vor der Uhr, deren Zeiger Faser um Faser vom Rettungsseil abschnitt. Im Sekundentakt zipp … zipp … zipp … zipp ...
Das Telefon klingelte; ich hatte es erwartet. Die Polizei bat uns ins Revier. Es war nach Mitternacht. Die Kinder waren sofort wach, aber nicht dazu zu bewegen, das Ferienhaus zu verlassen, die Mama konnte jeden Moment vor uns stehen. Sie schrieben ihr einen Zettel und hefteten ihn an die Loggiatür.
Wir irrten in der merkwürdig vernebelten Stadt herum, als wäre es November. Ich fand die Polizeistation eine Weile nicht. Als wir dort schließlich anlangten, stießen wir auf einen Menschenauflauf und kamen kaum bis zur Theke durch. Ich musste mich regelrecht einkrallen, um nicht beiseite gedrückt zu werden. Die Schreibtische dahinter waren unbesetzt; ein Dienstapparat klingelte, niemand erschien um abzunehmen. Schließlich kam jemand und machte sich an einem der hinteren Schreibtische zu schaffen. Eine Polizistin, sie war in Uniform und hatte die Pillbox einer Stewardess auf. Ohne die Menge zu beachten, setzte sie sich an einen Computer. Ich rief nach ihr, sie sah ungeduldig auf. Es war Lea.
»Einer nach dem anderen.«
Das kam nicht infrage. Ich wollte sie zur Rede stellen. Sie stand auf und strich an der Paspelierung ihrer Hose entlang. In gemessenem Tempo wandte sie sich zur Theke, tauchte vor mir ab und holte aus einem unsichtbaren Fach ein Bündel Formulare hervor.
»Nicht drängeln, messieur dames,«, rief sie den Umstehenden zu, wedelte mit ihren Vordrucken und setzte sich wieder. Ein anderes Telefon läutete, sie stand auf, ging daran vorbei, ohne es zu beachten, und verkündete:
»Heute ist hier pünktlich Schluss.«
4
Wie immer: hinten dran. Ich hatte eine Menschentraube vor mir, keine Chance auf einen der vorderen Plätze, geschweige denn auf die Wohnung. Einige Leute kannte ich vage. Ich drängelte mich vor und sah Robert, den Arm um die Hüfte einer Frau gelegt. Ich trat näher, sein Blick auf mich war wie auf einen Gegenstand, und indem er mich fixierte, sagte er zu seiner Begleiterin:
»Besorgst du den Möbelwagen?«
Da schälte sich der kleine Stadtdirektor zwischen falschen korinthischen Säulen hervor, er rollte mit den Augen und und raunte mir zu:
»Vanessa, wenn ich Sie nicht hätte. Bis heute Abend noch einen Bezirk? Ihr Freund …«
Ja, mein Freund. Der Stadtdirektor knuffte mich, ich war überrascht von der anbiedernden kameradschaftlichen Geste, ich wachte auf. Bleischwer lag ich auf dem Laken, leichter Schweiß bis zu den Zehen. Um mich herum stand die ganze verdammte Vergangenheit wie um eine Leiche, Robert in seiner hellblauen Jeans, Esmeraldo wie immer unergründlich lächelnd, Jonas, der träge an seinem Schreibtisch lehnte und dem man den Prof nicht abnahm, so jungenhaft sah er mit seinen langen Haaren aus.
Er hatte mich zur Pulthöhe des Hörsaals hoch gestubst. Danach war es richtig losgegangen. Vor allem mit Robert. Er wirkte so gelassen. Damit stärkte er mir das Rückgrat, die erstickende Umklammerung meiner Heimatstadt zu sprengen. Ich las Thomas Bernhard, vor allem die »Auslöschung«, bis ich meinen Ekel nicht mehr ausstehen konnte. Nach meinem Zusammenbruch dann keine Zeile mehr.
Zusammenbruch. Das Wort las sich so, als ob eine Naturkatastrophe sich über einen hermachte. So redeten sie bei mir zu Hause über 1945, eine Überschwemmung, die das Mörder-Reich aus den Angeln gehoben und fortgerissen hatte.
In Wahrheit war ich im Steilflug abgestürzt. Mit dem Risiko eines Genickbruchs. Für meine Verhältnisse war ich viel zu hoch geflogen. Mein Lebensfunken muss ziemlich widerstandsfähig sein.
Die Zeit ist ein spitzer Kreis.
Ich stand im nachthemdlangen T-Shirt am hohen Fenster meines Zimmers und schaute auf die Straße hinunter. Für den frühen Morgen lärmte es unten schon vernehmlich. Der Tabaccaio gegenüber, krumm geworden an seinem Stand unter der Außentreppe, schob seinen frisch bestückten Zeitungsständer heraus, den Kopf schräg zum Himmel gerichtet. Missbilligend. Mit dem Zeigefinger rieb er am Nasensteg wie immer ein nicht vorhandenes Tröpfchen fort. Später würde ich wie jeden Tag hinübergehen, die Repubblica kaufen und zu ihm sagen:
»Direttore, zu welchem Teufel geht die Welt heute?«
Er grinst nicht, sondern antwortet mit einem zurecht gelegten Satz. Ein, zwei Zeitungen hat er bereits gelesen, der Mann verkauft nichts, was er nicht kennt. Er würde der dottoressa nicht eine Antwort geben, die sie in den Kommentarspalten selbst lesen kann. Ab Mittag möchte er nur von Stammkunden, am liebsten aber gar nicht in seiner Lektüre gestört werden.
Meine Gastfamilie blies in der Frühe einen gehörigen Lärm auf, um die Geister der Nacht aus dem letzten Winkel der Riesenhöhle zu vertreiben. In den ersten Monaten war ich noch wütend geworden. Sie nahmen Miete, aber keine Rücksicht. Später redete ich mir ein, es war wohl ihre Art, mich in die Familie einzubeziehen. Würden sie auf Zehenspitzen durch die Wohnung hasten, käme ich mir höflich auf Abstand gehalten vor. Aber heute störte mich der Krach wieder. Es nützte auch nichts, ihnen mit Lärm zu antworten, denn wenn ich aufstand, waren sie längst fort.
Ich hatte in Paestum führen wollen, und dazu brauchte ich eine Bleibe in Neapel. Ich strich durch Wohnviertel, die mir gefielen, und fragte in Vomero den Tabaccaio nach einer Unterkunft. Mir sagte das Quartier zu, die Mietshäuser waren hoch und alt, gut erhalten, die Straße halbwegs erträglich im Lärm, und gesäumt von ansehnlichen Geschäften.
Der Alte zwängte sich aus seinem Kabuff, begutachtete mich von oben bis unten, schnaufte, während er an einem oder anderen Körperteil hängen blieb, und wanderte dann mit den Augen an der Fassade gegenüber nach oben, nannte Namen und Stockwerk. Zum Dank brachten ihm die Schiaparellis immer zum Wochenanfang Pasta über die Straße. Wahrscheinlich hatten sie es schon davor getan. Die Familie betrieb ein kleines Tiefbauunternehmen und hatte der Stadt den Bau von Abwasserkanälen in einer Gegend berechnet, für die die Erschließung erst geplant war.
Der Tabaccaio wusste alles über das Viertel. Ich hatte ihn im Verdacht, dass er nur zum Schein Zeitungen und Tabak verkaufte, viel einträglicher aber von seinem Wissen lebte. Ich revanchierte mich bei ihm für die Zimmervermittlung mit einer Summe, für die ich mich genierte, als ich mehr über ihn erfuhr. Er lachte, als ich ihn darauf ansprach, und schenkte mir eine frische Repubblica. Manchmal raunte er mir eine seiner Geschichten wie die von den Schiaparellis zu. Dabei lächelte er, aber nur so weit, dass ich die Lücken zwischen seinen Backenzähnen sah. Er paffte indische Beedis und hustete nach jeder länger als er sie rauchte.
Abends taten mir nach den Führungen die Füße manchmal so weh, dass ich bei ihm Anlauf für die steinernen Stufen vier Stockwerke hoch nahm.
Ich durfte es als Ehre nehmen, niemand sonst erzählte mir so etwas, nicht einer Frau und schon gleich nicht der Fremden aus dem Norden. Auch die Schiaparellis nicht, sie hatten Respekt, aber misstrauten mir, ich hatte Kontakte zu den städtischen Autoritäten.
Seit meinem ersten Tagbemühte ich mich um sie mit kleinen, alltäglichen Ritualen, mit allen fünf. Ich wollte abends ein Stück weit heimkommen. Wer keine Familie hat, sucht sich die Traditionen anderswo. Sehr empfänglich waren sie nicht dafür, die Schiaparellis, nur für die Geschenke.
Jetzt tappte ich barfüßig zum hallenartigen Bad mit der eigentümlichen Ahnung, die Familie bald zu verlassen. Ich hatte dafür keinen konkreten Anlass. Doch saß mir der Stadtdirektor im Nacken und wollte die alten Sachen loswerden. Er hielt sie mir hin und gab nicht auf. Ich bekam ihn nicht mehr aus meinem Hirn, und etwas hinderte mich, es zu wollen.
Während ich meinen Gedanken nachhing, wurde mir immer deutlicher: Ich war darauf vorbereitet. Als hätte ich den Stadtdirektor herbeizitiert, damit er endlich seine Botschaft loswürde. Obwohl ich bestimmt lange nicht mehr an ihn gedacht hatte.
Ich will nicht sagen, dass mir die Routine die Laune bei meiner Arbeit verdarb, jedenfalls nicht durchweg. Sie kam mir entgegen, wenn ich mit dem Kopf anderweitig beschäftigt war. In der Regel jedoch langweilte das Einerlei, vor allem in Neapel, wo meine Klientel Paestum und Pompeji erklärt bekommen wollte, nichts sonst.
Angefangen hatte ich in Rom, und da lief es zum Glück etwas anders.
Der Start war mühsam. Niemand hatte auf mich gewartet, die Konkurrenz reagierte giftig: Eine dottoressa hielt ihr die eigene Berufsbefähigung vor Augen. Die Villa Massimo, eine deutsche Kultureinrichtung, half mir ein wenig auf die Sprünge, einige Kolleginnen zu Hause empfahlen mich. Im ersten Jahr hatte ich weniger Lire als die rumänischen Bettler an der Piazza Barberini. Die Kundschaft wuchs langsam wie eine Schildkröte. Ich blieb auf Kurs und erwarb mir in kleinen Schritten einen Ruf. Ich war aus der allerersten Not, da besuchten mich meine Eltern und ließen sich führen. Selbst der Brust meines altphilologischen Vaters entrang sich am Ende ein Lob, nachdem ihn seine Frau in die Seite gestoßen hatte. Ich war stolz, gekränkt und amüsiert.
Solange ich wenig verdiente, sammelten sich wache und interessierte Leute hinter mir. Später war es umgekehrt. Die Besucher stolperten mit dem Handy vor der Nase hinter mir drein und sahen und hörten nichts. Am meisten mochte ich private Führungen mit zwei bis vier Kunden.
Neulich kam jemand von Napoli Sotterranea auf mich zu und wollte mich anheuern, Besucher durch die Höhlen und Zisternen Neapels zu lotsen. Es hatte nichts mit meinem Kunstangebot zu tun. Sie brauchten mehr Guides, um die Nachfrage zu bewältigen. Der Massenandrang in den engen Tunneln wurde langsam beängstigend. Dabei konnte man im Prinzip hunderte Kilometer weit durch die unterirdischen Kanäle, Gänge und Höhlen laufen. Aber es war wie an der Adria: Alle, Führer und Geführte, marschierten eng gedrängt zwei-, dreihundert Meter durch dieselben Tunnel, als ob sie sich in der neapolitanischen Unterwelt fürchten müssten.
Früher hatte sich da unten tatsächlich einiges abgespielt: Pest und Cholera, Schmuggel, Mafia, Flucht vor Verfolgung, Luftschutz und resistenza. Kunst fand dort unten beim besten Willen nicht statt, zu sehen gab es nur die Hohlform einer ausgeräumten Renaissancekirche und Kritzeleien von Leuten, die vor den alliierten Bombern hierher geflüchtet waren.
Ich lehnte ab, hatte sowieso schon mit den Agenturen zu kämpfen, die mir meine Gruppen ständig überbuchen wollten.
Immer wieder kamen sie mit »Willst du nicht mal was Anderes machen?« Sie meinten Dolce Vita, die Filmstadt Cinecitta, Mussolini, »den Duce«, und die Abgründe des Vatikans, solche Sachen. Ich ließ mir lieber selbst etwas einfallen. Es war leicht, ich musste nur auf Fragen aus meinen Gruppen achten. In Rom bot ich ›Auf den Spuren Pasolinis‹ an, den ewig saftigen Prügel der Stadt samt Lido di Ostia. Ich ließ keine Details aus; die Führung wurde ein Renner, sogar international, und ich aalte mich in der ganz gewiss nicht oberstudienrätlichen Kundschaft.
Gut ging auch ›Ein Tag faschistische Architektur‹, das Mausoleo Ossario Garibaldino auf dem Gianicolo zum Beispiel oder die Piazza Augusto Imperatore. Glatzen und Springerstiefel marschierten nicht mit, dafür gelegentlich den Schädel weit hochrasierte ältere Herrenmenschen mit Verdachtsmomenten, sie flüsterten sich lediglich sardonisch grinsend gegenseitig Bemerkungen ins Ohr. Am Ende verabschiedeten sie sich formvollendet, manche gar mit angedeutetem Handkuss und gaben großzügig Trinkgeld. Was vielleicht auch an meiner Erscheinung lag, blonde Locken und einsachtzig groß.
Wenn mir eine Gruppe so gar nicht gefiel, dachte ich an eine abgelegene romanische Kirche in der Toskana. Ich war mit Robert am Haus des Mesners, um den Schlüssel zu holen. Er schaute mich von oben bis unten an und kam zielstrebig mit uns in den Kirchenraum. Die Augen fest auf mein T-Shirt gerichtet, unter dem sich ungehalten mein Busen bewegte, deutete er wahlweise nach links und rechts und warf die Etiketten »quattrocento«, »seicento«, »settecento« aus. Nach solch beneidenswerter Maulfaulheit war mir gelegentlich auch, wenn Kunden meine Professionalität mit Gequatsche strapazierten. Oder auch, wenn sie mich ständig unterbrachen, um mich zu korrigieren, und sich dabei auf die Autorität ihrer Kunstführer beriefen.
Ich gehörte nicht zu den Guides, die Menschen um sich haben mussten, um sich selbst reden zu hören.
Meine Gruppen durften damit rechnen, gefüttert, aber nicht gemästet zu werden. Das verlangte Entschiedenheit und Selbstkontrolle, wenn ich vor ihnen stand. Zwei, drei Mal täglich neunzig Minuten bis zwei Stunden das Thema halten, dabei nichts Wesentliches vergessen, sich nicht ablenken lassen und gleichzeitig die Zuhörer im Auge behalten, ohne den Faden zu verlieren. Alles schaut auf dich, nichts geschieht ohne dich. Routine hilft, es bleibt immer Konzentration, die Adrenalin ausstößt, und bei Irritationen von außen stressig wird. Vor meinen früheren Lehrern habe ich inzwischen Respekt.
Einige Kunden fanden, es sei im Preis inbegriffen, mir Geheimtipps für Restaurants, Bars oder Nachtclubs zu entsteißen und Pikantes über mein Leben in Rom zu erfahren:
»Wie schwierig ist es als ausländische Frau allein in so einer Stadt?«, das waren so Versuchsballons, die ich ziehen ließ wie Einladungen zu abendlichen Essen in Touristenrestaurants.
Anderen Versuchungen erlag ich eher. Am Obelisk auf dem Petersplatz wartete eine Gruppe auf mich. Überragt von einer ins Auge fallenden Erscheinung, wenige Jahre älter als ich, schlank, groß, mit glattem weißblonden Pony, hinter die Ohren gesteckt, breites Lächeln mit sehr regelmäßigen Zähnen und eine Zurückhaltung, die sich ihrer platzbeherrschenden Ausstrahlung sicher sein konnte. Als ich dazu stieß, erzählte sie den Umstehenden gerade, wie sehr sie das Leid der wilden römischen Hunde ergriff.
»Bevor eine christliche Kirche gebaut wurde«, mischte ich mich ein, »stand hier der Circus des Nero.«
Ein Mann unterbrach mich.
»Für Wagenrennen?«
»Nicht nur. Nero hat hier auch Gladiatoren gegen Löwen und andere wilde Tiere kämpfen lassen.«
Der Mann: »Auch gegen Molosser Hunde?«
Ich nickte dem Korreferenten dankbar zu. In diesem Augenblick lief eine römische Bracke quer über den Platz, die Nase vorgereckt, Rücken und Schwanz in einer Linie wie aufgespießt. Die Weißblonde sah dem Tier nach, als sei es in letzter Sekunde dem neronischen Circus entronnen.
»Oh nein, diese Verbrecher!«
Vielleicht klang es etwas scharf: »Das war gerade eine Erfindung von mir.«
Die Frau sah mich mit einem Blick an, der vor Dankbarkeit geradezu glühte. Nach der Führung bot ich ihr an, sie außer der Reihe durch die Vatikanischen Museen zu führen.
Am nächsten Tag lotste ich sie mit großzügiger Geste an der Warteschlange vorbei durch den Eingang und direkt zur Sixtinischen Kapelle, wo noch wenig Besucher den Hals reckten. Es waren sogar noch Bodenspiegel frei, sie konnte ohne Genickbruch die Deckenfresken anstaunen. Ich genoss ihre Verwirrung über das Figurengewimmel hoch über unseren Köpfen und seitlich an den Wänden, eine überwältigende Inszenierung von Regisseur Michelangelo. Er hatte das gesamte Bildprogramm aus dem Kopf souverän in den Putz gedrückt. Die Weißblonde stand mitten in der Kapelle, ihr Täschchen hielt sie wie ein Mädchen mit beiden Händen vor dem Schoß und schaute mit offenem Mund rundum.
Ihr fiel auf, wie kräftig die Leiber gebaut waren, die sich auf Sockeln und in Giebeln rekelten. Papst Clemens VII., erzählte ich ihr, wollte ein auftrumpfendes Jüngstes Gericht mit einem zentralen Jesus als Richter sehen, quasi als reuiges Gegengewicht zu seiner expansionswütigen kirchenstaatlichen Politik.
Der Maler, soufflierte ich raunend, betrat die Sixtina, ein ordentliches Kirchenschiff, vor dem katholischen Erdkreis ausgewiesen als Erster Künstler. Es war von ihm gefordert, und nichts weniger verlangte er sich selbst ab, das Ende der Welt so gewaltig auffahren zu lassen, dass es bis zu seinem Eintreffen nicht noch einmal gemalt werden musste. Die muskelgeschwellten Körper hatten letztgültige Kraft aufzuwenden und nebenbei dem Maler in seinen Vorlieben zustatten zu kommen.





























