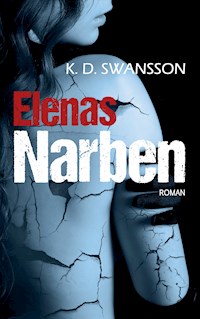
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Niger Delta explodiert eine Öl-Pipeline und fordert in einem Kinderhilfsdorf hunderte Todesopfer. Das Hamburger Magazin Globus schickt die unerfahrene Journalistin Elena zu dem Unglücksort. Während sie menschlich an dem Auftrag zu scheitern droht, landet sie journalistisch einen Volltreffer. Ihre Recherchen fördern zutage, dass es sich bei dem Unglück um einen gezielten Anschlag handelt. Der Attentäter soll direkt aus dem Vorstand der Londoner Hilfsorganisation kommen. Sein Motiv: Geldgier. Nach der Veröffentlichung von Elenas Artikel setzt eine unvergleichliche Medienhetze auf den mutmaßlichen Attentäter ein. Plötzlich meldet der Flüchtige sich per Email in der Hamburger Redaktion und verlangt ein geheimes Treffen mit Elena. Gegen den Willen ihres Chefredakteurs nimmt sie den Kontakt auf. Sie ahnt nicht, dass sie damit in eine Katastrophe schlittert. Bald selbst von der Justiz gejagt, gerät sie in einen mörderischen Strudel aus Gewalt, Intrigen und Verleumdung, in dem für sie nur eins zählt: überleben. Der einzige, der ihr jetzt noch helfen kann, ist der ehrgeizige FBI- Fahnder Gillian Scott. Doch dafür soll sie ihm ausliefern, was sie am meisten liebt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 819
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Im Niger Delta explodiert eine Öl-Pipeline und fordert in einem Kinderhilfsdorf hunderte Todesopfer. Das Hamburger Magazin Globus schickt die unerfahrene Journalistin Elena zu dem Unglücksort. Während sie menschlich an dem Auftrag zu scheitern droht, landet sie journalistisch einen Volltreffer. Ihre Recherchen fördern zutage, dass es sich bei dem Unglück um einen gezielten Anschlag handelt. Der Attentäter soll direkt aus dem Vorstand der Londoner Hilfsorganisation kommen. Sein Motiv: Geldgier. Nach der Veröffentlichung von Elenas Artikel setzt eine unvergleichliche Medienhetze und Jagd auf den mutmaßlichen Attentäter ein. Plötzlich meldet der Flüchtige sich per Email in der Hamburger Redaktion und verlangt ein geheimes Treffen mit Elena. Gegen den Willen ihres Chefredakteurs nimmt sie den Kontakt auf. Sie ahnt nicht, dass sie damit in eine Katastrophe schlittert. Bald selbst von der Justiz gejagt, gerät sie in einen mörderischen Strudel aus Gewalt, Intrigen und Verleumdung, in dem für sie nur eins zählt: überleben. Der einzige, der ihr jetzt noch helfen kann, ist der ehrgeizige FBI- Fahnder Gillian Scott. Doch dafür soll sie ihm ausliefern, was sie am meisten liebt.
„Wenig kann das Glück uns geben, denn ein Traum ist alles Leben.
Und die Träume- selbst ein Traum“ Pedro Calderón de la Barca, Das Leben ein Traum (1636)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil 2
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Teil 3
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Prolog
Es sollte ein Abend wie jeder andere werden. Die Sonne stand bereits tief. Mit ihr verschwand die schlimmste Glut des Tages hinter einem schwefelgelben Himmel. Die Luft legte sich wie ein feuchter Waschlappen über das Gesicht. Bald würde das Land von einem kräftigen Schauer überflutet werden, wie sie im Nigerdelta während der Regenzeit häufig vorkamen. Über Nacht würden sich die Löcher auf den Straßen mit Regen füllen und der Dorfplatz im Matsch versinken. Und mit Sonnenaufgang würde ein dichter Dunst aus den Sümpfen und Mangrovenwäldern den Horizont verschleiern.
Yetunde stellte die mit Hühnchen in Koriandersauce gefüllte Schüssel auf den Tisch, dazu den Reis und die Karaffe mit Wasser. Sie sah in die erwartungsvollen Gesichter der Kinder, die sich wie hungrige kleine Raubkatzen die Lippen leckten. Für diese Momente lebte sie.
Sie ahnte nichts. Wie viele hatte sie gelernt, jeden Gedanken an die Bedrohung, die Tag für Tag durch die rostigen Metallrohre an ihrem Dorf vorbeifloss, zu ignorieren. Ganz am Anfang, da hatten sie jeden Tag mit dem Schlimmsten gerechnet. Sie hatten Petitionen eingereicht und Anträge gestellt. In den zahlreichen Gutachten der Gegenseite wurde die Gefahrenstufe jedoch als minimal eingestuft. Und so hatten sie beschlossen, zu vertrauen. In einem Dorf voller Waisen gab es Probleme, die drängender waren, wie heute Abend dieser leere Stuhl neben ihr.
Die sieben Pflegekinder am Tisch brachten im Moment wenig Interesse für das fehlende Familienmitglied auf, angesichts des Duftes, der ihnen aus den Schüsseln in die Nase stieg. Sie rutschten hungrig auf ihren Stühlen hin und her. Hausvater Yoshua ließ sich bei seinem Dankgebet heute besonders viel Zeit.
Yetunde sah verstohlen aus dem Fenster auf den großen Dorfplatz, der staubtrocken im Zentrum der bunten, eingeschossigen Holzlehmhäuser lag. In seiner Mitte hockte ein Mädchen auf einem Fußball. Dort vertrieb es sich die Zeit damit, mit der einen Hand einer Ameise den Weg zu versperren und sich mit der anderen Sand über das krause Haar rieseln zu lassen. Neben ihr standen zwei fadenscheinige hellblaue Schuhe ordentlich aneinander gestellt. Das Mädchen war allein. Eigentlich sollte sie auf dem leeren Stuhl am Tisch sitzen und wie die anderen Kinder das Abendbrot einnehmen. Aber Rekwi war schwierig. Diesmal hatte sie ihre Turnschuhe in der Waschmaschine gekocht und sie dabei endgültig ramponiert. Die Schuhe waren das einzige intakte Kleidungsstück an ihr gewesen, als sie vor neun Monaten in das Dorf gekommen war. Inzwischen waren sie vorne aufgeschnitten, denn obwohl Rekwi längst aus ihnen herausgewachsen war, weigerte sie sich, anderes Schuhwerk zu tragen. Nur sauber mussten sie sein.
Yetunde sah auf. Am Tisch hatte sich Gekicher ausgebreitet. Nachdem das Gebet gesprochen und der erste Hunger gestillt war, hatte sich die allgemeine Aufmerksamkeit dem seltsamen Treiben auf dem Dorfplatz zugewendet. Aus den Wohnhäusern drangen vereinzelt Rufe und Gelächter. Rekwi fühlte sich dadurch anscheinend ermutigt, sich jetzt mit beiden Händen den Sand über den Kopf zu schaufeln. Yetunde ermahnte die Kinder, Rekwi nicht allzu viel Beachtung zu schenken, während sie selbst ihre Augen nicht von dem Mädchen ließ. Es würde noch lange dauern, bis die Kriegswaise aus dem Sudan ihre traumatischen Erlebnisse verarbeitet haben würde. Eines Tages würde sie das Dorf als erwachsener, gefestigter Mensch verlassen, in Schuhen, die passten.
Die Kinder verloren bald das Interesse an Rekwi und wandten sich dringlicheren Themen zu. Mit vollem Mund träumten sie von neuen Nintendos, MP3 Playern und Handys, derweil Yetundes Gedanken zu dem kaputten Geräteschuppen und dem altersschwachen Landrover wanderten, bis sie an den schwindenden Budgets hängenblieben, die in letzter Zeit in die Hilfsdörfer flossen, wenn überhaupt noch etwas kam. Die Kinder brauchten dringend neue Schulbücher, Kleidung und Zahnspangen, doch es wurde nur noch wenig Geld bereitgestellt. Gerüchte kursierten, wonach das Dorf sogar geschlossen werden sollte.
Der Lärm zurückgeschobener Stühle unterbrach ihre Gedanken. Marisa, die Älteste der Pflegegeschwister begann, das Geschirr zu spülen und bat Yetunde, ihr später bei den Hausaufgaben zu helfen. Yoshua half den kleineren Kindern, den Tisch zu säubern. Rekwi war es augenscheinlich langweilig geworden. Sie hatte ihre Schuhe wieder angezogen und schlenderte mit trotzig gesenktem Kopf, die Hände in den Hosentaschen, zum Haus zurück. Dabei ging sie auf Zehenspitzen, um die Berührung der Sohle mit dem Boden zu verhindern. Yetunde unterdrückte ein liebevolles Schmunzeln und ging zur Tür, um das Mädchen mit einer Strafpredigt zu empfangen.
Auf dem Weg dorthin geschah es. Die Detonation riss sie von den Beinen und warf sie auf den Rücken. Ein brutales Krachen ging durch ihren Körper, als sie mit dem Hinterkopf aufschlug. Über sich sah sie das Fensterglas zerspringen. Ein Schauer aus scharfen Kristallen ging auf sie nieder und zerschnitt ihre Haut an unzähligen Stellen. Der Schmerz machte sie stumm. Sie sah, wie die Wände des Hauses aufrissen, als hätte die Hand eines Riesen sie durchschlagen. Für einen unbestimmten Moment lang wurde die Welt um sie herum schwarz, und als sie wieder an Kontur gewann, hatte sie sich in ein loderndes Ungeheuer verwandelt. Sie hörte das Heulen der Flammen. Sie hörte die Kinder schreien. Rekwi, dachte sie, Rekwi ist draußen geblieben. Dann stürzte die Decke ein.
Teil 1
Kapitel 1
Die Nachrichtenagenturen überschlugen sich förmlich. Mit einem Piepton kündigte Outlook im Fünfminutentakt den Eingang einer neuen Meldung an. Sie alle verhießen nichts Gutes. Seit einer Woche wurde das Mediengeschehen von einem Ereignis beherrscht, das, begleitet von einer Flut aus Superlativen, die Weltsicht jedes halbwegs moralisch empfindenden Menschen aus den Angeln hob. Elena öffnete mit einem Mausklick die gerade eingegangenen Nachrichten. Vom größten Spendenbetrug aller Zeiten war die Rede, vom perfidesten Missbrauch menschlicher Güte.
Es fiel ihr schwer, sich dem spekulativen Sog zu entziehen, der selbst gutwillige Betrachter in einen Sumpf von Vorverurteilung hinunterzog. Und wie um ihre Objektivität noch weiter zu erschüttern, landete neben ihrer Kaffeetasse eine Zeitung auf dem Schreibtisch.
„Vom Chef“, sagte Susanne Steiner, die Kulturredakteurin, im Vorbeigehen. Sie warf die Worte ebenso knapp dahin wie die Gazette und hinterließ einen kühlen Lufthauch. Die Schreibtische der Redakteure befanden sich in einem großen, von Säulen unterteilten Raum, den sie mit 3 Grafikern, zwei Bildredakteuren, einer Redaktionsassistenz und einem Volontär teilten. Ein dunkelblauer Teppich aus dichten Fasern schluckte die Geräusche hämmernder Tastaturen und ständig klingelnder Telefone, das Surren der Rechner und Scanner, das Piepsen der Faxgeräte und die Gespräche der Journalisten, von denen Elena heute gemieden wurde, als existiere eine unsichtbare Bannmeile um ihren Schreibtisch. Sie sah der großen Frau nach, die ohne einen weiteren Kommentar eine Säule weiter zu ihrem eigenen Arbeitsplatz weiterzog und griff mit einem verstimmten Stirnrunzeln nach der Zeitung.
„SCHÜTZT ER DEN MÖRDER DIESER KINDER?" fragte die Headline des seriösen Sonntagsblatts in Boulevardmanier. Die Schlagzeile zog sich über ein verwackeltes Foto, das unbeholfen wie eine Amateuraufnahme wirkte. Darauf posierte eine vergnügte Schar dunkelhäutiger Kinder verschiedenen Alters mit einem großen, bärtigen Mann in einer Priestersoutane vor einem Holzhaus. Das Bild daneben zeigte denselben Mann in Zivilkleidung in einem zu eng sitzenden grauen Anzug, anscheinend auf einem Empfang oder einer Party. Auf diesem Foto hatte er den Arm besitzergreifend um die Hüfte einer jungen Frau gelegt und lachte breit in die Kamera. Beide hielten ein gefülltes Sektglas in der Hand. Mit der haselnussbraunen Löwenmähne und dem kräftigen Gesicht, dessen feine geplatzte Äderchen seinen Wangen eine vitale Rötung verliehen, hatte er weit mehr Ähnlichkeit mit einem Partylöwen als mit einem frommen Geistlichen. Im Hintergrund hatte die Kamera eine gut gelaunte Gesellschaft eingefangen unter der Elena auch den englischen Premierminister ausmachte. Ein kurzer Text dokumentierte die Fotos.
Der britische Anglikanerpriester Philipp Vandewski galt bisher als einer der außergewöhnlichsten Menschen, den diese schnelllebige, von Eigensucht und Profitgier geprägte Zeit hervorzubringen hat. Seit über 40 Jahren gilt er als eine Ikone der Barmherzigkeit, die jetzt vom erhabenen Thron der Philanthropie in den Schmutz gestürzt wird. Die Millionenschar seiner Anhänger fühlt sich missbraucht und betrogen. Wie viel wusste der Pater wirklich von den Machenschaften, die zu dem schrecklichen Unglück in Ebuto führten? Vielleicht finden wir die Antwort in seinem Leben. Lesen Sie den zweiten Teil der großen Biografie auf Seite 6.
Vom Chef also, dachte Elena unkonzentriert und blätterte zur besagten Seite. Hieß das, sie durfte bleiben? Mit gemischten Gefühlen überflog sie den zweiseitigen Artikel über Pater Vandewski, trank einen Schluck kalten Kaffee und wunderte sich. Warum hatte Jacobus ihr einen Bericht zukommen lassen, der außer längst bekannten Tatsachen keine verwertbaren Informationen enthielt und darüber hinaus auch noch schlecht geschrieben war? Um darauf hinzuweisen, wie mit dem Thema nicht umzugehen war? Als wenn sie eine Hilfestellung dieser Art nötig hätte. Sie fühlte schon wieder Ärger in sich hochkochen und rief sich sofort zur Ordnung. Objektivität bedeutete, zur Urteilsbildung jeden Tatbestand einer genauen Analyse zu unterziehen. So lautete einer der vielen Lehrsätze ihres Chefredakteurs, mit denen er ihr auf die Nerven ging, aber sie wusste, nach der gestrigen Auseinandersetzung würde sie gut daran tun, sich den ein oder anderen davon anzueignen. Falls es dafür nicht bereits zu spät war. Sie durchsuchte die Zeitung nach weiteren Kommentaren zu dem Spendenskandal, bis das Telefon ging.
Auf dem Display sah sie, dass der Anruf aus Jacobus Vorzimmer kam.
„Hallo Iris", sagte sie mit angespannten Schultern in den Hörer, „Jacobus will mich sprechen. In 15 Minuten, richtig?"
Zu Jacobus guten Eigenschaften zählte, dass er vorhersehbar war wie eine Kirchturmuhr.
„Ich empfehle Ihnen, heute besser pünktlich zu erscheinen, meine Liebe“.
Jacobus Sekretärin, die für gewöhnlich an chronisch guter Laune litt, klang bierernst.
Elena legte auf, warf einen Blick aus dem Fenster und versuchte, sich für das bevorstehende Gespräch zu wappnen. Sie kramte in ihrer Tasche nach einem Haarband und verarbeitete ihre langen dunklen Haare zu einem strengen Knoten, als wolle sie ihre Gedanken zusammenbinden.
Von ihrem Platz aus konnte sie den Himmel sehen. Er strahlte azurblau. Die Redaktionsräume lagen in der vierten Etage des Reeder-Hagen-Hauses, einem großen viktorianischen Bau in der Hamburger Altstadt, einst Sitz einer Hamburger Reeder-Dynastie. Sie war seit zweieinhalb Jahren Redakteurin beim Globus in Hamburg, die zweijährige Ausbildung als Volontärin mitgezählt. Das renommierte Monatsmagazin berichtete seit mehr als 20 Jahren fundiert über Politik, Kultur, und Wissenschaft. Globus war eine feste Größe auf dem Zeitschriftenmarkt, dennoch zeichnete sich in letzter Zeit ein leichter Abwärtstrend in den Leserzahlen ab. Ein Problem, für das sie eine Lösung anzubieten hatte. Wenn nur nicht alles so furchtbar schief gelaufen wäre.
Gestern Morgen hatte der Chefredakteur zum Entsetzen ihrer Kollegen entschieden, ihr die Vandewski-Story anzuvertrauen.
„Elena, für Sie habe ich ein spezielles Thema. Ich weiß, es wird Ihren Unwillen erregen, aber ich sage Ihnen gleich: es gibt darüber keine Diskussionen“. Mit diesen vielsagenden Worten hatte Heiner Jacobus die Redaktionskonferenz eingeleitet. Einige Redakteure feixten vor Freude. Endlich bekam Jacobus Liebling auch mal den Wind von vorne zu spüren. Die gute Laune dauerte jedoch nur so lange, bis sie begriffen, dass die Jüngste in ihrer Runde wieder einmal bevorzugt wurde. Die Vandewski-Affäre war eindeutig ein Thema für erfahrene Journalisten, nicht für einen Grünschnabel wie Elena di Sconti.
„Vandewski fällt in meine Sparte“, protestierte Thomas Luzerni. Er war für den Gesellschaftsbereich zuständig. „Ich dachte, Elena hat jetzt mit Wissenschaft ihr eigenes Ding."
„Moment mal. Noch bin ich für Kultur und Wissenschaft hauptverantwortlich“, warf die Steiner dazwischen. Die baumlange Redakteurin mit der dunklen Stimme war die Dienstälteste in Jacobus Team und hatte zähneknirschend hinnehmen müssen, dass die Neue sich in ihrem Ressort breit machte.
„Leute, Leute!" Jacobus hob die Hand. „Ich will, dass hier in Zukunft mehr Teamgeist einkehrt. Vandewski ist für eine Nachwuchsjournalistin genau das richtige, um sich daran abzuarbeiten. Außerdem", fügte er süffisant in Elenas Richtung hinzu „wird es höchste Zeit, dass Sie was von der großen weiten Welt sehen.“
Lukas Schneider, verantwortlich für den Politik- und Wirtschaftsteil lachte gutmütig. Luzerni sah vom anderen Ende des Konferenztisches säuerlich zu ihr herüber. Elena wusste, dass er darauf brannte, den Vandewski Skandal selber zu bearbeiten. In dieser Hinsicht stand sie ausnahmsweise mal auf seiner Seite. Nicht, weil sie ihn für besonders geeignet hielt, sondern weil sie die Story gar nicht haben wollte.
„Sie wissen genau, dass der Enthüllungs-Journalismus mir nicht liegt“, protestierte sie.
Jacobus wedelte ihren Einwand ungeduldig mit der Hand weg.
„Sie können sich ihr Thema nicht immer aussuchen. In diesem Beruf müssen Sie flexibel sein“, sagte er schulmeisterhaft.
Am Ende des Tisches sah sie den Schleimer Luzerni zustimmend nicken. Was dachte Jacobus sich eigentlich dabei, sie wie eine Schülerzeitungs-Redakteurin abzukanzeln. Keine zwei Monate war es her, dass sie mit ihrem Artikel über Präimplantationsdiagnostik den Henry Jourdan Preis für die beste europäische Nachwuchsjournalistin gewonnen hatte. Ein Glanz, der auch auf den Globus fiel.
„Aber ich habe keine Zeit dafür. Ich arbeite gerade an einer Serie, die meine ganze Zeit beansprucht“.
Das war unvorsichtig. Sie hatte sich fest vorgenommen, ihren Konzeptvorschlag zur Marktstabilisierung des Globus erst nach der Redaktionsrunde anzusprechen, denn Jacobus würde sein Magazin eher an intellektuellem Chauvinismus zugrunde gehen lassen, als von ihr in offener Runde Ratschläge entgegenzunehmen
„Ich hoffe, wir sprechen nicht schon wieder über dieses Femalismuszeug.“ Die Augen des Chefredakteurs wurden schmal. Schließlich glaubte er das leidige Thema seit Wochen ad acta.
„Die Femalismusforschung ist ein ernst zu nehmender Zweig der Wissenschaft, der den einseitigen Ergebnissen einer von Männer dominierten Wissenschaft neue Erkenntnisse entgegensetzt“, ereiferte sie sich, während einige ihrer Kollegen mit den Augen rollten.
Heiner Jacobus warf sich in seinem Sitz zurück. Das Leder knirschte.
„Das Thema ist vom Tisch“, winkte er ab. „Sie machen sich an die Vandewski Story. Bereiten Sie sich gründlich vor. Sie werden Kinderhilfsdörfer bereisen, Termine mit Gutachtern machen und sich ein Urteil über die Sicherheitsstandards dort bilden. Und vor allem mit den Betroffenen über Vandewski sprechen.“
So schnell ließ Elena di Sconti sich jedoch nicht abschütteln.
„Eine Serie über diese Forschungsergebnisse würde vor allem bei weiblichen Lesern auf großes Interesse stoßen“, beharrte sie, die Unterlagen auf ihrem Schoß fest entschlossen umklammernd. „Wenn wir den Leserschwund vom Globus aufhalten wollen, müssen wir unsere Zielgruppe erweitern. Ich habe sämtliche Statistiken der Medientrends ausgewertet und Marktforschungsanalysen zum Informationsbedürfnis deutscher Zeitungsleser durchforstet. Das Interesse an Forschung und Wissen war bei jungen Leserinnen nie größer.“
Jacobus Stirn hatte sich inzwischen dramatisch umwölkt. „Es wurden bereits Maßnahmen zur Verbesserung des Umsatzes beschlossen, das müsste auch bei Ihnen angekommen sein. Ihr Thema passt nicht zum Globus. Forschung aus weiblicher Sicht! Wir sind doch keine Frauenzeitschrift“, sagte er mit einem belustigten Blick in die Runde. Die Redakteure lachten beipflichtend. Nur Susanne Steiner schwieg.
Elena stieg das Blut ins Gesicht. Stevies Worte klangen in ihren Ohren nach wie ein Mantra. Du solltest schleunigst lernen, dich besser zu beherrschen. Sie hatte versprochen, es zu versuchen, nachdem sie ihm einen großen Deal fast ruiniert hatte. Aber jetzt war ein wirklich ungünstiger Moment dafür.
„Bei den Begründerinnen des Femalismus handelt es sich um Naturwissenschaftlerinnen von internationalem Ruf“, widersprach sie mit einem leichten Beben in der Stimme „und was ihre Maßnahmen betrifft - die sind meiner Meinung nach völlig unzureichend…“
„Jetzt reicht´s ", dröhnte Jacobus und schlug mit der Faust auf die Resopalplatte des Konferenztisches. Der goldene Montblanc Kugelschreiber auf seinen Unterlagen machte einen Hüpfer und rollte über den Tisch. „Wer macht hier eigentlich das Magazin? Sie oder ich? Ich wünsche keine neunmalkluge Einmischung in die Blattgestaltung. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und weiß, was ich tue. Die Diskussion ist beendet.“
Inzwischen konnte man das Moos in den Topfpflanzen auf der Fensterbank wachsen hören. Sie fühlte 13 Augenpaare wie Magnete an ihr kleben. Jacobus hatte zu schwitzen begonnen.
Die Ausdrucke mit den Analysen und den ausgearbeiteten Artikeln landeten vor Jacobus auf dem Tisch.
„Ihnen fehlt der Mut zur Innovation. Was Sie Erfahrung nennen, ist nichts anderes als Feigheit“, sagte sie giftig. Und verließ den Raum. Der lange Zopf wippte aufmüpfig hinter ihr her. Jacobus blieb einige Sekunden lang der Mund offen stehen. Niemals war ihm nie eine derartige Respektlosigkeit untergekommen. Es war ja nicht so, dass er einen offenen Meinungsaustausch nicht zu schätzen wusste. Meinungsfreiheit nach innen und außen- das gehörte zu den Grundprinzipien seiner Redaktionsleitung. Natürlich gab es eine Grenze, die nicht überschritten werden durfte. Die meisten, die hier arbeiten wollten, lernten schnell und hielten sich daran. Die Anderen- nun ja.
„Iris“, brüllte er durch die offene Tür über den Flur.
Jacobus Sekretärin, die mit einem Kopfschütteln verfolgt hatte, wie die di Sconti Türen schlagend die Redaktion verließ, schwenkte den Kopf in Richtung des Konferenzraums und schaute durch die offene Tür in das gerötete Gesicht des Chefredakteurs.
„Setzen Sie ein Schreiben auf. Der übliche Text."
„Der übliche Text für was, Chef?“
„Für eine Kündigung. Was sonst!“
Niemand hatte sich gewundert, dass sie heute Morgen trotzdem wieder zur Arbeit erschienen war. Streitigkeiten zwischen Elena di Sconti und Jacobus gehörten zum Tagesgeschäft.
„Es ist noch jemand drin.“ Iris deutete auf die Tür von Jacobus Büro.
„Ich glaube, diesmal macht er ernst“, erwiderte Elena, etwas Sorge im Blick.
„Das fürchte ich auch.“ Iris sah ihr tadelnd ins Gesicht, wobei sie sich allzu augenscheinlich bemühte, nicht auf die Narbe zu starren, die wie ein Kastenzeichen zwischen den fein geschwungenen Augenbrauen der jungen Frau saß. Verunsichert senkte Elena den Blick und zog automatisch den Ärmel ihrer Bluse über die rechte Hand.
Jacobus Tür öffnete sich und Mark Tetzlaff, sein Redaktionsleiter, kam heraus. „Die heilige Inquisition", grinste Iris verschwörerisch. Elena war nicht zum Lachen zumute. Jeder hier wusste, dass sie mit Tetzlaff bis aufs Blut verfeindet war. Immerzu zwang er sie, ihre Texte solange zu redigieren, bis sie stilistisch auf den seriösen Duktus des Globus zurechtgestutzt waren. Ihr Mut sank. Wenn Jacobus sich mit ihm in ihrer Personalangelegenheit beraten hatte, konnte sie am besten gleich ihre Sachen packen.
Im Büro des Chefredakteurs roch es wie in einer Arztpraxis, eine Folge der vielen Kannen Thymian-Tee, den Iris ihm mehrmals am Tag gegen seine chronische Bronchitis zusammenbraute. Auf einer Konsole unter dem Fenster knabberte ein kahlköpfiger Kanarienvogel an den Stangen seines großen Käfigs. Die Türen ließ Jacobus tagsüber offen stehen, aber der Vogel hatte noch nie Gebrauch von seiner Freiheit gemacht.
Jacobus thronte hinter seinem Schreibtisch, mit gefalteten Händen über einem umfangreichen Bauch. Er war seit 20 Jahren Herausgeber und Herz des Globus. Die Ausbildung von vielversprechenden Nachwuchsredakteuren überließ er keinem Geringeren als sich selbst. Von jährlich gut hundert Bewerbungen um ein Volontariat bekam alle zwei Jahre ein Anwärter die Chance Journalismus von der Pike auf zu lernen. Elena di Sconti hatte nicht nur das Glück, als Volontärin eingestellt zu werden, sie wurde nach ihrer Ausbildung auch in das Redaktionsteam mit aufgenommen. Seitdem hatte er sich mehr als einmal gefragt, ob dies die dümmste oder die klügste Entscheidung war, die er je getroffen hatte. Sie hatte seine Geduld von Anfang an auf eine harte Probe gestellt. Bei all ihrem Talent war sein jüngstes Redaktionsmitglied eigensinnig und aufsässig und allzu schnell kochte ihr Temperament über. Das brachte nicht nur sein Team durcheinander sondern untergrub auch seine Autorität, zumal sie ihn ständig zu Machtkämpfen herausforderte. Und dass seine Mitarbeiter wie die Waschweiber pausenlos hinter seinem Rücken darüber spekulierten, ob sie ihm wohl im Bett alle seine kleinen Zugeständnisse abluchste, war angesichts der Tatsache, dass sie mehr Zeit als jeder andere seiner Redakteure in seinem Büro verbrachte, nicht verwunderlich.
„Sie wollten mich sprechen“, unterbrach sie das ungemütliche Schweigen. Jacobus reichte ihr einen Umschlag über den Schreibtisch. Nervös zupfte sie an ihren Ärmel und nahm den dünnen Brief entgegen.
„Öffnen Sie.“
Er beobachtete, wie sie den Umschlag langsam aufriss und den Inhalt des Briefes überflog.
„Damit habe ich schon gerechnet“, sagte sie gefasst. Doch ihre Aussprache verriet sie. Sie war von einem melodischen Akzent gefärbt, den sie je nach Gemütszustand mehr oder weniger erfolgreich zu unterdrücken versuchte.
„Gut. Für Ihre weitere berufliche Zukunft ist es von Vorteil zu wissen, dass gewisse Handlungsweisen Konsequenzen nach sich ziehen. Jetzt zerreißen Sie ihn.“
Sie sah ihn perplex an.
„Sie sollen ihn zerreißen.“
Ritsch Ratsch.
„Heißt das, Sie wollen mich nicht mehr entlassen?“
Jacobus stand auf, stellte sich hinter seinen Schreibtischstuhl und starrte sie an. Es war ein Fehler, das wusste er.
Ja, es stimmte. Sie hatte das Gesicht eines Engels. Doch entgegen aller Gerüchte war es weder das, noch die langen Beine, noch die verteufelten Augen, hell wie Sterne, dem er nicht widerstehen konnte. Er war ein übergewichtiger Mittfünfziger mit Glatze und Tränensäcken, der sich ungern lächerlich machte. Sein sexuelles Interesse an Frauen, die gerade so alt wie seine eigene Tochter waren, belief sich auf null, mochten die Hohlköpfe denken, was sie wollten.
Es war ihr journalistisches Feuer. So, wie sie dort stand, in der festen Überzeugung mit ihrer Arbeit die Welt aus den Angeln heben zu können, erinnerte sie ihn an die kompromisslose Sprachverliebtheit seiner eigenen frühen Berufsjahre, an die Freiheit, mit Worten und Themen grenzenlos jonglieren zu können, an die Zeit, bevor er Verantwortung für dutzende Mitarbeiter übernommen hatte und die Erwartungshaltung einer stetig wachsenden Leserschaft sein Magazin auf einen Stil festlegte, der ihm inzwischen so solide und schwunglos wie eine in die Jahre gekommen Ehe erschien.
„Ich will hier eins klarstellen: das ist kein Freibrief für weitere Respektlosigkeiten. Noch so ein Ausfall und Sie sind draußen. Ab jetzt kümmern Sie sich um nichts anderes als um Vandewski. Ich will ein vollständiges, unvoreingenommenes Bild von den Vorkommnissen. Ist das klar?“
„Ist klar.“
„Gut.“ Jacobus setzte sich wieder hin und legte die Fingerspitzen aneinander. „Kommen wir jetzt zu Ihrer Wissenschaftsserie. Ich habe mir Ihren Artikel angesehen.“
In ihrem Gesicht breitete sich ein kaum zu übersehendes Leuchten aus.
„Oh, gut. Und? Wie finden Sie ihn?“
Was sollte er sagen? Sie hatte sich selbst übertroffen.
„Ganz passabel“, erwiderte Jacobus, um ihren Sieg nicht allzu triumphal ausfallen zu lassen. „Wir werden Ihre Serie auf fünf Folgen anlegen. Es wird jedoch nur einen Femalismus Artikel geben. Die restlichen Themenvorschläge erwarte ich, sobald Sie mit Vandewski durch sind.“
Er genoss es, sie für einige Sekunden sprachlos zu sehen.
„Und Sie sorgen dafür, dass er unverändert abgedruckt wird, ohne Tetzlaffs Eingriffe?“
Jacobus stieß ein unterdrücktes Schnaufen aus. Reiche einer Frau niemals den kleinen Finger.
„Ich werde mit ihm sprechen.“
Sie nickte großmütig. Die langen Wimpern warfen Schatten auf die widerspenstigen Sommersprossen ihrer Wangen.
Er bedeutete ihr mit einem Wink, dass sie gehen könne. „Schicken Sie Iris rein.“ Er brauchte jetzt dringend einen Thymiantee.
Kapitel 2
Berühmter als der Papst!
Die große Pater Vandweski-Biografie, Teil 2
Von unserer London-Korrespondentin Belinda Schumann
Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen, sagt ein Sprichwort. Philipp Vandewskis erste richtige Entscheidung, die er im zarten Alter von 10 Jahren traf, bestand darin, einem Knabenchor beizutreten, der in der St. Marys Gemeinde sonntags den Gottesdienst begleitete. Dort entwickelte er unter der Anleitung von Gordon Hickory, dem Chorleiter, eine außerordentliche Stimme. Dieser Umstand verhalf der bisher nur schwach besuchten Backsteinkirche am Rande des Londoner Stadtteils Whitechapel, wo sich immer noch der Bombenschutt aus dem zweiten Weltkrieg türmte, zu einem ungewöhnlichen Auftrieb. „Die Stimme" sprach sich herum. Im Laufe der Zeit drängten sich immer mehr Menschen auf den abgewetzten Holzbänken, wo sie unter zugigen, zersplitterten Kirchenfenstern ergriffen den Gesängen des Knaben lauschten, was auch der Kollekte zu Gute kam. Bald schon konnte das immer noch kriegsgeschädigte Dach geflickt und die Kirchenfenster restauriert werden.
Nach seiner Berufung zum Priester im Jahr 1959 übernahm Philipp Vandewski die St. Marys Gemeinde. Die Leitung des Chores lag in seiner Obhut. Im Gegensatz zu vielen begabten Jungen, die nach dem Stimmbruch ihre Gesangsstimme einbüßen, behielt Vandewski auch im Erwachsenenalter seine Begabung bei. Er ließ die Kirche um einen Anbau erweitern, der jedoch kaum ausreichte, die wachsenden Besucherströme aufzunehmen. Sie kamen aus ganz Europa, sogar aus Übersee, um den Sopranisten aus dem Londoner Elendsviertel zu hören. So hinterließ jeder Gottesdienst eine übermäßig gefüllte Kollekte, mit der Pater Vandewski seine Gemeinde aus dem sozialen Abseits holte. Jugendzentren und Sportplätze entstanden, Armenküchen wurden errichtet, Kindergärten und Schulen gefördert. Pater Vandewski, inzwischen 26 Jahre alt, musste eine Pressestelle in seiner Gemeinde einrichten, um die vielen Anfragen ausländischer Journalisten bearbeiten zu können.
Als eines Tages ein geschäftsmäßig gekleideter Besucher in der ersten Reihe der Kirchenbänke Platz nahm, war es für Pater Vandewski nicht mehr weit bis zur nächsten richtigen Entscheidung. Der erste Plattenvertrag besiegelte den kometenhaften Aufstieg des Paters. Kein Kontinent, keine Metropole, die ihn seitdem nicht einmal zu Gast hatte. Mehrmals im Jahr ging der Tenor auf Benefiz- Tourneen und ließ sich als strahlender Held der vom Schicksal Benachteiligten feiern, bis er sich vor sechs Jahren plötzlich von der Bühne zurückzog.
1965 errichtete der Pater das erste Charity-Waisendorf in seiner Heimatgemeinde in London. Es war der erste Baustein zu seinem Wohltätigkeitsimperium. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte folgten bis dato mehr als 200 weitere Einrichtungen in den verschiedensten Regionen der Welt. Die Charity Dörfer bieten Kindern und Jugendlichen, die durch Hungersnöte, Flutkatastrophen, Erdbeben oder Bürgerkrieg zu Waisen geworden sind, ein neues Zuhause und ein stabiles Umfeld mit einem normalen Alltag. Gut geschulte und sorgfältig ausgesuchte Pädagogen, die einen beständigen Teil dieser Kleinfamilien bilden, begleiten die Kinder wie Eltern bis zu ihrem Erwachsenwerden und darüber hinaus. Das Konzept der Charity-Dörfer findet weltweit Anerkennung und wird neben unzähligen anderen caritativen Projekten durch Spenden gefördert. So vergingen fast fünf Jahrzehnte richtiger Entscheidungen.
Bis Pater Vandewski dem falschen Menschen vertraute.
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: Das Geheimnis des Schattenmanns. Wer verbirgt sich hinter Immanuel Rodriguez?
Elena ließ die Zeitung auf den Schreibtisch sinken. Der Artikel war Mist. Ein Schulaufsatz hatte mehr Substanz. Wehmütig schielte sie auf den Stapel medizinischer Fachartikel, die neben ihrem Monitor lagen. Die entwicklungsfähigen Aspekte des Lebens fesselten sie weitaus mehr als die Schattenseiten menschlichen Daseins, vor denen sie am liebsten die Augen verschloss. Aber Jacobus Ansage war unmissverständlich gewesen und so richtete sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf das ungeliebte Thema und ging die Fakten durch.
Vor drei Wochen hatte die Explosion einer Öl-Pipeline unweit der nigerianischen Metropole Lagos ein Kinderhilfsdorf der Vandewski Charity Foundation fast vollständig ausgelöscht. Nur eine Handvoll Menschen war dem Inferno lebend entkommen, zum Teil schwerverletzt. 198 Menschen hatten den Tod gefunden, die meisten davon waren Kinder. Seitdem gingen die Bilder des zerstörten Dorfes um die Welt.
Wenige Tage nach der Katastrophe waren die ersten Fragen aufgetaucht: Wieso hatten die Häuser des Dorfes so schnell Feuer gefangen? Wieso hatte die Statik nicht standgehalten? Warum wurden die Löschtanks nicht rechtzeitig betätigt? Eine internationale Untersuchungskommission unter Leitung der britischen Polizeibehörde New Scotland Yard wurde gebildet. Seit Anfang der Woche war es amtlich: Von den hohen Sicherheitsstandards, derer sich die Stiftung rühmte, konnte im Kinderhilfsdorf in Ebuto nicht die Rede sein. Im Gegenteil, Pfusch am Bau und der Einsatz minderwertiger Baustoffe hatten das Dorf zu einem leichten Opfer der nahen Explosion werden lassen. Dabei handelte es sich um keinen Einzelfall. Nach vorläufigem Kenntnisstand befand sich jedes Dritte der bisher 30 eiligst untersuchten afrikanischen Kinderdörfer in einem schlechten baulichen Zustand. Die Geschäftsbücher der Stiftung belegten jedoch, dass offiziell in allen Fällen hochwertige Materialien beauftragt worden waren. Geradezu nahtlos in diese Ermittlungsergebnisse fügte sich der Umstand ein, dass ein Mitglied des Vorstandes und Leiter der Bausektion, ein Mann namens Immanuel Rodriguez, spurlos verschwunden war. Für die Polizeibehörde war die Frage, auf wessen Konten die unterschlagenen Gelder geflossen waren, insofern einfache Mathematik. Man sprach bereits von zweistelligen Millionenbeträgen, obwohl die Ermittler ihre Arbeit gerade erst aufgenommen hatten.
Und um den Skandal perfekt zu machen, hatte die Pressestelle der Vandewski Charity Foundation heute Morgen bekanntgegeben, dass auch Pater Vandewski nicht mehr in London weilte, sondern sich an einen nicht bekannten Ort in Klausur zurückgezogen habe.
Dieses Verhalten wird ihm seinen Heiligenschein kosten, dachte Elena. Trotz ihres Vorsatzes, unvoreingenommen an das Thema heranzugehen, konnte sie sich ihrer eigenen Enttäuschung nicht erwehren, als sie sich durch die Internetseiten der Vandewski Foundation navigierte. Erst wenige Tage vor dem Skandal hatte sie im Fernsehen ein Interview mit dem Pater gesehen und seine Persönlichkeit hatte sie tief beeindruckt. Obwohl Ideale wie Nächstenliebe oder Demut im konsumgeprägten dritten Jahrtausend nicht zu den primär erstrebenswerten Tugenden zählten, schien seine Lebensweise doch eine zeitlose Sehnsucht nach dem Guten im Menschen zu wecken. Anders war sein Erfolg nicht zu erklären. Dass der Pater jetzt in einen der größten Spendenskandale verwickelt sein sollte, stürzte viele seiner Anhänger in eine Sinnkrise. Das Forum der offiziellen Stiftungsseite war voller verzweifelter, ratloser, sogar suizidaler Kommentare. Seine Internetseite präsentierte den anglikanischen Priester nicht als einen der größten Tenöre seines Jahrhunderts, der er ohne Zweifel war, sondern als symbolische Vaterfigur für seine Kinderhilfsdörfer. Ein großer, kompakter Mann, der Güte ausstrahlte. Für seinen Platz auf der diplomatischen Weltbühne sprach eine Reihe von Aufnahmen, die Vandewski mit bedeutenden Personen zeigten: Beim Essen neben Nelson Mandela, im Gespräch mit dem Dalai Lama oder an der Seite der britischen Royals. Eine andere Bildleiste zeigte das bescheidene Gemeindehaus, in dem der Geistliche mit seiner Frau lebte. Es musste eine sehr spezielle Art von Freiheit sein, alles haben zu können, und nichts davon für sich zu wollen, dachte Elena.
Laut den Angaben der offiziellen Stiftungsseite hatte der Mann so gut wie nichts von seinen millionenschweren Einnahmen für sich behalten. Alles war in wohltätige Stiftungen der anglikanischen Kirche geflossen. Für die Zugwirkung dieser gelebten Selbstlosigkeit sprachen die gigantischen Summen der Spendengelder, die in den letzten vier Jahrzehnten auf das Konto der Vandewski Charity geflossen waren. Ihre Aufgabe sollte es nun sein, der Frage nachzugehen, welche Rolle Pater Vandewski bei den Geldunterschlagungen gespielt hatte, aber vor allem dem Mysterium Immanuel Rodriguez nachzuspüren, seinem angeblich engsten Vertrauten, von dem es hieß, dass ihn in der Londoner Charity Zentrale noch nie jemand zu Gesicht bekommen hatte. Jacobus glaubte tatsächlich, ihr mit dieser Story einen Riesengefallen zu tun, das hatte sie an seinem gönnerhaften Gesichtsausdruck gesehen. Vielleicht wartete er aber auch nur darauf, sie scheitern zu sehen.
„Das Böse wohnt in uns allen“, sagte jemand hinter ihr theatralisch. Elena drehte sich mit ihrem Schreibtischstuhl herum. Timo fuhr sich durch die zerzausten Haare.
„Ich hab gehört, du bist gestern gefeuert worden?“
„Wie du siehst, sitze ich immer noch hier.“
Timo grinste frech. „Hast den Alten wieder behext, was?“
„Halt´ die Klappe, Blödmann“, entgegnete sie unwirsch.
Timo beugte sich zum Bildschirm vor und nahm die Vandewski-Fotogalerie auf dem Bildschirm näher in Augenschein. „Wir haben meiner Oma vor ein paar Jahren ein Konzertticket gekauft. Gesalzene Preise, wenn du mich fragst.“
Timo war 25 und gab sich wie ein abgefeimter Profi. Meistens hing ihm das Hemd aus der Non–Fit-Jeans und die hellblonden Haare lagen wie nach einer durchzechten Nacht. Er kam frisch von der Kunsthochschule, wo er schon während seines Studium mit ungewöhnlichen Fotoreportagen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Dass er beim konservativen Globus gelandet war, war für alle eine Überraschung. Anscheinend wollte Jacobus seine etwas überalterte Redaktion mit jungem Nachwuchs auffrischen.
Er lehnte sich vor und betrachtete Vandewskis Konterfei auf dem Bildschirm, dabei schnüffelte er an ihrem Hals.
„Mann, du riechst wie ein Vanillepudding.“
„Steck deine Nase woanders rein, Timo. Ich habe zu tun.“ Sie schob ihn zur Seite.
„Was meinst du, ist was dran an den Gerüchten?“ fragte er, in keinster Weise beleidigt, und malte mit einem Marker zwei kleine rote Hörner auf Vandewskis Stirn.
„Es scheinen mehr als Gerüchte zu sein“, erwiderte Elena und ignorierte die Verunstaltung ihrer Ausdrucke, die sie gerade eben unter Fluchen dem ewig streikenden Drucker abgerungen hatte.
„Scotland Yard vermutet, dass er schon seit längerem von dem Betrug wusste und ihn vertuschen wollte.“
„Warum sollte Vandewski erst sein ganzes Vermögen für Wohltätigkeitszwecke hergeben und sich dann durch Geldunterschlagungen bereichern? Ergibt doch keinen Sinn.“ Timo rümpfte kritisch die Nase.
„Er soll die Gelder ja nicht selbst veruntreut haben“, klärte Elena ihn auf. „Sondern eines der Vorstandsmitglieder. Angeblich war er die treibende Kraft hinter den Betrügereien. Er heißt Rodriguez.“
„Ach der Schattenmann-Typ, der nie in der Öffentlichkeit erscheint. Hab von ihm gehört. Soll wohl ziemlich übel aussehen. Unfall oder so. Warum hat der Pater ihn nicht angezeigt? Jetzt steckt er selber in der Scheiße.“
„Es ist noch nicht geklärt, ob und warum Vandewski Rodriguez geschützt hat. Angeblich sollen sie ein sehr enges Verhältnis haben.“
„Was, echt jetzt? Der Pater ist gegen den Strich gebürstet?“
Elena zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Vandewski hat sich von Anfang an der Presse verweigert. Seine Pressestelle gibt nur das raus, was durch die Behörden ohnehin veröffentlicht wird.“
Verständlich, wenn man bedachte wie die Medien mit ihm umsprangen, seit die ersten Hinweise des Betruges aufgetaucht waren. Die Boulevardpresse ergötzte sich daran, die Ikone Vandewski zu demontieren als würde es eine geheime Befriedigung auslösen, einen Heiligen auf dem gleichen Niveau wie den Rest der Menschheit zu sehen. Dabei lagen der der Staatsanwaltschaft bisher keine handfesten Beweise für Vandewskis Mitwisserschaft vor. Dennoch hatte eine Vorverurteilung in den Medien längst stattgefunden. Elena sah sich das gestrige Titelfoto der Gazette mit Vandewski und der brünetten Frau, die er im Arm hielt genauer an. Wen interessierte es, dass es sich um seine Enkelin handelte, mit der er sich auf einem Benefiz-Konzert für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der iranischen Stadt Bakra hatte ablichten lassen. Auf dem Titel der Zeitung diente es dem Zweck, Vandewskis Image als treues Familienoberhaupt zu erschüttern. Wer seine Frau betrügt, betrügt auch die Spender. Und wenn sie ehrlich war, hatte das Bild bei ihr einen ähnlichen Eindruck erweckt.
„Der Kerl hat Dreck am Stecken“, meinte auch Timo und setzte sein Philip-Marlow-Gesicht auf, während er eine selbstgedrehte Zigarette zwischen den Lippen hängen ließ. „Wahrscheinlich hat er mit dem Schattenmann gepimpert. Jetzt wird er von ihm erpresst und muss schweigen. Wir sehen uns morgen früh. Ich hol dich ab.“
„Du holst mich ab? Wohin denn?“
„Hat Jacobus dir noch nichts gesagt? Iris hat für uns beide gebucht. Ich begleite dich. Oder willst du Aquarelle für deinen Artikel malen?“
„Ich kann selber fotografieren.“
„Oh, sie kann selber fotografieren“, äffte er sie mit tuntigem Tonfall nach und warf den Kopf nach hinten. „Aber das will keiner sehen. Außerdem meint Jacobus, dass jemand auf dich aufpassen muss. Also bis morgen, geh besser schon mal packen.“ Er zog an ihrem aufgelösten Haarknoten und schlenderte lässig davon.
„Auf mich aufpassen?!“ rief sie ihm hinterher „Das ist idiotisch. Ich kann selbst auf mich aufpassen.“ Er hob winkend die Hand ohne sich umzudrehen und verschwand im Treppenhaus.
Kapitel 3
Timo hatte sich neben ihr in seinem Sitz ausgestreckt und bereits geschlafen, noch bevor sie in der Luft waren. Ihr Nachbar zur Rechten machte sich ausgehungert über seine Rühreier und das pappige Weißbrot her, mit dem die blonde Stewardess ihn versorgt hatte.
„Das schlechte Frühstück hat Tradition bei British Airways“, sagte er mit vollem Mund und einem verständnisvollen Blick auf die Tüte Erdnüsse, mit der sie sich begnügte. Sein Oxford-Akzent wies ihn als waschechten Briten aus. „Ich persönlich halte das Essen bei Singapur Airlines für unübertroffen, wobei man bei den Asiaten ja auch nie weiß, was sie einem so ins Essen mischen." Er lachte herzhaft, als hätte er einen unheimlich guten Witz erzählt. „Eine gewisse Weltoffenheit im kulinarischen Bereich ist für Vielflieger wie mich allerdings unerlässlich.“ Er wischte sich mit der Serviette die fettigen Überreste des Bacons von den Lippen. „Natürlich nicht nur im kulinarischen Bereich. Ich informiere mich grundsätzlich über die Kultur und die politische und wirtschaftliche Situation des Landes, in das ich fliege. Man will ja keine Überraschungen erleben." Er zwinkerte ihr fröhlich zu. „Oh, entschuldigen Sie, ich bin David Esmond".
Elena schüttelte höflich die dargebotene Hand.
Es war ein sehr früher Flug und sie hätte es Timo gern gleich getan und geschlafen, nachdem sie die halbe Nacht im Hotel damit zugebracht hatte, die Ergebnisse ihrer bisherigen Recherchen zusammenzutragen. Sie waren auf dem Weg nach Lagos. Zuvor hatten sie sich in der Londoner Zentralverwaltung der Vandewski Charity Foundation umgesehen, weiter als bis zum Pressesprecher waren sie nicht vorgedrungen. Immerhin konnte sie ein Treffen mit einem der Vorstände arrangieren. Sie hieß Helen Miller und war zuständig für die pädagogischen Richtlinien der Foundation. Sie würde sie in Lagos abholen und zu dem Unglücksort Ebuto begleiten.
Zu gerne hätte Elena Stevie in London getroffen, aber ihr Zeitplan war eng gestrickt und die meiste Zeit verbrachten sie im Flugzeug. Jacobus wollte den Bericht über die Spendenaffäre unbedingt noch in der nächsten Ausgabe bringen.
„Darf ich fragen woher Sie kommen?“ fragte ihr geschwätziger Nachbar. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass er sie die ganze Zeit neugierig betrachtet hatte, nachdem sie mitten in der belanglosen Konversation in Gedanken verfallen war. Er hob verschmitzt die Hand. „Nein, warten Sie, lassen Sie mich raten. Das ist so eine Art Hobby von mir, wissen Sie. Vertreibt einem die Langeweile in der Luft. Ich schau mir meine Mitreisenden an und versuche zu erraten, was sie machen und woher sie kommen.“
Sie lehnte sich ergeben in ihrem Sitz zurück. Er würde sich ohnehin nicht davon abbringen lassen und als erstes würde er sie sicher auf ihre Narbe ansprechen. Sie überlegte, ob sie es riskieren konnte, statt der langweiligen Standardgeschichte mal eine ganz neue Variante zum Besten zu geben.
Er wiegte den Kopf von rechts nach links und sah sie abschätzend an. „Mitte Zwanzig. Italienischer Abstammung. Vielleicht spanisch. Nein- italienisch, ich bleibe dabei. Das höre ich an Ihrem reizenden kleinen Akzent. Ihre Augen sind außergewöhnlich, wenn ich das sagen darf. So strahlend. Und ich würde darauf wetten, dass Sie Ballett tanzen.“
Sie drehte erstaunt den Kopf zu ihm herum. Es stand ihr ja nicht auf der Stirn geschrieben, dass sie jede freie Minute ihrer spärlichen Freizeit damit verbrachte sich bei Polina Treschchenko, einer ehemaligen Solistin des Moskauer Staatsballetts, schinden zu lassen. Dabei war sie nur eine Amateurin, die mit anderen Tanzverrückten viermal in der Woche das kostspielige Privileg genoss, dass die lebende Legende einmal am Abend nach ihnen sah.
„Ich lag also richtig?" Mr Esmond strahlte sie glücklich an.
„Gar nicht schlecht. Wie haben sie das herausgefunden?“
„Nun ja- Sie sind mir bereits in der Abflughalle aufgefallen." Er wurde etwas verlegen und sah sie leutselig aus himmelblauen Augen an, in denen kleine rote Äderchen von viel Müdigkeit und zu langen Flügen zeugten. „Ihr Gang hat sie verraten. Wissen Sie, meine Nichte- seit 10 Jahren tanzt sie Ballett. Sie hat auch diesen schwebenden Gang und die Füße dabei so lustig nach außen gestellt.“
Nach außen gestellt? Elena schaute zweifelnd auf ihre Füße herunter.
„Und was machen Sie beruflich? Arbeiten Sie in der Modebranche?“ forschte Mr Esmond unbefangen weiter.
Elena schüttelte den Kopf. „Werbung“, erwiderte sie, erstaunt, wie leicht die Lügen ihr immer noch über die Lippen gingen. „Mein Fotograf und ich sind für ein Fotoshooting im Auftrag eines großen Kosmetik-Konzerns in Lagos unterwegs.“
„Aha...aha...verstehe.“ Mr Esmond nickte interessiert, während sich sein Kopf bereits mit der nächsten Frage beschäftigte.
„Und Sie wurden also in Italien geboren?“
Seine Neugier rief ein unangenehmes Magenkribbeln auf den Plan. Schon die Abfrage ihrer Personalien in der Staatsbibliothek reichte aus, um das Gefühl der Beklemmung wieder wachzurufen, verbunden mit der Gewissheit, ein falsches Wort könnte zum Verhängnis werden. Dabei war das alles längst vorbei. Sie führte ein normales Leben und hatte nichts zu verbergen. Zum Glück wartete Mr Esmond ihre Antwort gar nicht erst ab.
„Sind Sie verheiratet?"
Sein Blick fiel in ihren Ausschnitt auf das fein gearbeitete Medaillon, dass sie an einer silbernen Kette trug.
„Jetzt drehen wir den Spieß mal um, Mr Esmond. Sind Sie verheiratet?"
„Wenn Sie mich so fragen: nein", flüsterte er ihr verschwörerisch zu und ließ kichernd seinen Ehering in der Brusttasche seines blauen Hemdes verschwinden. „Nur ein kleiner Scherz. Ich würde meine Frau nie betrügen, wissen Sie. Die Ehe ist für mich ein Hort der Glückseligkeit", fuhr er munter fort und steckte sich den Ring wieder an.
„Ja sicher. Was führt Sie denn so nach Lagos?“ Mühsam unterdrückte sie ein Gähnen.
„Oh, ich fliege mit einem Charter noch ein Stück weiter, nach Ebuto, das ist 150 Kilometer von Lagos entfernt. Dort wartet mein nächster Auftrag auf mich. Ich bin Versicherungsgutachter. Eine böse Geschichte da unten. Fast 200 Tote. Sie haben sicher davon gehört.“
„Die explodierte Pipeline?“ rief sie, zu laut. Sie biss sich auf die Zunge und verfluchte sich selbst. Auf keinen Fall wollte sie sich als Journalistin zu erkennen geben. Mr Esmond schien ihre Aufregung jedoch nicht zu verwundern. Das Unglück hatte überall für viel Wirbel gesorgt. Elena sah zu Timo herüber. Sein Kopf hing in einem ungesunden 45 Grad Winkel zwischen Kopfstütze und Fenster. Wie konnte man so schlafen? Hauptsache er wachte nicht auf und verplapperte sich.
„In den Nachrichten hieß es, es war es ein Unfall. Die Unglücksstelle wurde doch bereits untersucht." Gezügelt ließ sie ihren Blick an Timo vorbei aus dem Fenster schweifen. Unter ihnen leuchteten weiße Wolkenberge im Licht der aufgehenden Sonne wie unter dem Fingerzeig Gottes auf einem barocken Gemälde.
„Nun, der Schaden der dort entstanden ist, ist immens hoch. Bei dem betroffenen Dorf handelt es sich um ein Kinderhilfsprojekt der Vandewski Charity, wie sie vielleicht wissen. Jetzt will die Organisation Naxoil, den Ölförderer verklagen. Sie behaupten, die Pipeline wäre nicht genügend gesichert gewesen. In diesem Fall müsste die Versicherung von Naxoil Millionen zahlen. Dabei pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass die Ausstattung in dem Kinderdorf den eigenen Sicherheitsstandards nicht gerecht wird und sämtliche Brandschutznormen auf kriminelle Weise missachtet wurden. Dämmelemente aus gepresstem Stroh! Das stellen sie sich bitte mal vor. So etwas brennt beim geringsten Funken wie Zunder. Da wurde nur billiges Zeug verbaut, über Jahre, in wer weiß wie vielen Dörfern, und Millionen eingespart! Wo die hin geflossen sind, wissen wir ja inzwischen. Und jetzt will man davon ablenken und den Ölförderer für die Katastrophe verantwortlich machen. Ein Skandal ist das.“
Mr Esmonds Gesicht hatte sich merklich gerötet. Das schien ihn sehr aufzuregen, doch falls er auf Verständnis hoffte, war er bei seiner Gesprächspartnerin an der falschen Adresse.
„Wenn Sie tatsächlich so gut über jedes Land, in das Sie reisen informiert sind, dann müssten Sie eigentlich wissen, wer für die Explosion wirklich verantwortlich ist“, konterte Elena heftig. „Öl- und Benzin sind in Nigeria Mangelware, obwohl das Land über eines der reichsten Erdölvorkommen der Welt verfügt. Pro Tag werden dort 2,5 Millionen Barrel exportiert. Und wer bereichert sich daran? Öl-Multis und korrupte Politiker, während die Menschen darauf angewiesen sind, die Pipelines anzuzapfen. Ein einziger Funke genügt und die Katastrophe ist da. Darüber hinaus wurde die Pipeline mitten durch bevölkertes Gebiet gebaut. Und jetzt will keiner die Verantwortung für die vielen Opfer übernehmen. Das ist ein Skandal Mr Esmond!“
„Ich weiß, was Sie meinen, meine Liebe“, sagte er beschwichtigend, ein wenig erstaunt über ihre Fachkenntnis. „Aber in diesem Fall ist ein Öldiebstahl als Ursache ausgeschlossen.“
„Ach. Und wieso?“
Timo bewegte sich grunzend in seinem Sitz und ließ den Kopf nach vorne sacken. Mr Esmond antwortete nicht sofort. Er schien mit sich zu ringen, ob er eine berufliche Indiskretion begehen oder das Ende der Konversation riskieren sollte. Ein ganzes Team von Versicherungsermittlern ging schon seit zwei Wochen im Niger Delta jeder Spur nach. Was sie in Erfahrung gebracht hatten, war hochbrisant. Jetzt lag es an ihm, den letzten Beweis zu erbringen. Seine Euphorie angesichts der Chance, möglicherweise noch vor der Polizei die wahren Verursacher dieser Katastrophe zu überführen, sprudelte über wie ein Springbrunnen. Und wer neben ihm saß, bekam ein paar Tropfen ab. Außerdem hatte er selten genug die Gelegenheit, sich mit einer bezaubernden jungen Frau so anregend zu unterhalten. Die meiste Zeit saß er neben einsilbigen Geschäftsleuten, die mit ernsten, müden Augen Daten in ihre Laptops hackten.
Vertraulich beugte er sich zu ihr herüber.
„Das ist aber noch streng geheim", sagte er leise und tippte mit dem Zeigefinger gegen seine Lippen. Auf den Sitz vor ihnen ließ ein kleiner Junge seinen imaginären Ferrari aufheulen. Elena nickte mit dem gebührenden Ernst und lehnte sich zu Mr Esmond herüber, um ihn besser verstehen zu können.
„Naxoil schwört Stein und Bein, dass zum Zeitpunkt der Explosion gar kein Öl durch die Pipeline geflossen ist. Die Zufuhr war abgestellt worden, nachdem es zu Zwischenfällen mit aufständischen Rebellen in der Gegend gekommen war.“
Sie reagierte angemessen überrascht. Denn eine Neuigkeit war es in der Tat. In den offiziellen Meldungen der nigerianischen Polizeibehörden hieß es bisher, ein Leck an der Pipeline habe die Katastrophe ausgelöst. Vermutlich infolge eines Öldiebstahls. Immerhin hatte es auch etliche Opfer direkt am Explosionsherd gegeben. Mr Esmond schien zufrieden. Genug gesprudelt.
„Was war dann der Grund für die Explosion?" wollte sie nun wissen.
Er hob die Schultern. „Um das herauszufinden, bin ich geschickt worden.“
„Vielleicht handelt es sich um ein Attentat gegen Naxoil“, dachte sie laut.
„Man wird sehen“, erwiderte Mr Esmond vage. Von plötzlicher Einsilbigkeit übermannt zog er sich tiefer in seinen Sitz zurück, gähnte demonstrativ und schloss die Augen. Elena betrachtete ihn aufgewühlt. Ausgerechnet jetzt bekam ihr bisher wichtigster Informant kalte Füße.
Bei ihren Recherchen hatte sie gelesen, dass es in den letzten Monaten im Niger Delta immer wieder zu bewaffneten Aufständen gekommen war, nachdem die Regierung ihre Zusage, die Bevölkerung am Ölreichtum profitieren zu lassen nicht eingehalten hatte. Dennoch erschien ihr ein terroristischer Akt unwahrscheinlich. Wenn man einen ausbeuterischen Öl-Multi treffen wollte, warum dann auf Kosten der eigenen Landsleute? Warum auf Kosten von Kindern, die im Dorf nebenan eine Zukunft bekamen? Die Leidtragenden wären die ohnehin schon Geschädigten. Andererseits war diese Logik kaum auf Terroristen anzuwenden, angesichts der vielen Unschuldigen, die weltweit bei Anschlägen ums Leben kamen. Mr Esmonds Theorie zu den Vorfällen interessierte sie brennend. Momentan bestand diese aus kurzen Schnarchern, die zwischen seinen Lippen hervor blubberten. Als sie von der Toilette zurückkam, stieß sie ihn sachte an und trat ihm absichtlich auf die Füße, und als das nicht half, überlegte sie, ob ein kleiner Mineralwasserunfall seine Aufmerksamkeit möglicherweise wieder auf ihr Gespräch lenken würde. Aber noch während sie darauf wartete, dass der Flugbegleiter mit den Getränken vorbei kam, wurde sie selbst von einer bleiernen Müdigkeit überfallen.
Ein Rütteln am Arm weckte sie. Sie sah in Timos hellwache Augen. Er war glänzender Laune. Blinzelnd sah Elena sich um und sprang ruckartig auf. Mr Esmond saß nicht mehr neben ihr und unter den restlichen Passagieren, die im Gang auf den Ausstieg warteten, war er soweit sie sehen konnte auch nicht. Er befand sich wahrscheinlich wie die meisten Fluggäste bereits in einem der Busse auf dem Weg zu den Gates.
„Warum hast du mich nicht eher geweckt. Jetzt ist er verschwunden“, fuhr sie Timo an.
Der setzte eine verständnislose Mine auf. „Wer ist verschwunden?“
„Mr Esmond!”
Sie erzählte ihm, was sie erfahren hatte.
„Los hinterher. Vielleicht holen wir ihn noch ein.“ Timo riss seine Kameraausrüstung aus dem Handgepäck und warf sie sich über die Schulter. Unter empörten Protestrufen der Wartenden drängelten sie sich hastig aus dem Flieger und stürmten die Gangway herunter. Timo sprang als erster in den bereits abfahrenden Bus, der gerade seine Türen schließen wollte. Bei dem Versuch Elena durch den Türspalt zu ziehen, riss er ihr fast den Arm aus. Sie landeten beide übereinander zwischen den Beinen einer genervten deutschen Diplomatengruppe. „Passen Sie doch auf!“ giftete eine korpulente Frau, die einen Schuh verlor, als sie ihren Fuß unter Timo hervorzog.
Timo reichte der Dame den Pumps hoch und lächelte entwaffnend. „Meine Freundin“, sagte er, ein wenig mit den Hüften kreisend „sie tut es so gern in der Öffentlichkeit.“
„Timo!“ Elena schubste ihn wütend von sich runter. Dieser alberne Kindskopf. Sie fühlte sich angestarrt wie ein Sangria saufender Mallorca-Tourist. Zum Glück bestand der überwiegende Teil der Passagiere aus afrikanischen und englischen Geschäftsleuten, die sich leise auf Englisch oder Yoruba unterhielten, ein nigerianischer Dialekt, den sie von ihrer afrikanischen Nachbarschaft zu Hause kannte. Sie wich den neugierigen Blicken aus und sah sich vergebens nach Mr Esmond um.
„Bei der Gepäckausgabe kriegen wir ihn“, meinte Timo zuversichtlich. Diese Hoffnung zerschlug sich ebenfalls.
Der Murtala Muhammed International Airport von Lagos war riesig. Sie hätten ebenso eine Stecknadel in einem Heuhaufen suchen können und wären dabei wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, wobei ihr Vorteil darin bestand, dass es hier weniger weiße Männer mit schütterem Haar und hellblauen Hemden gab, als auf einem europäischen Flughafen, aber immer noch genug.
Nach allen Seiten Ausschau haltend hasteten sie durch die Abfertigungshallen im Ausgangsbereich. Es war zwecklos. Mr Esmond war verschwunden- und die Story ihres Lebens wahrscheinlich mit ihm.
„Du bist mir eine schöne Reporterin. Lässt deine heiße Spur einfach verdampfen", klagte Timo, als sie durch die verdunkelten Glastüren des Flughafengebäudes traten. Tadelnd schüttelte er den Kopf und setzte sich seine L.A. Lakers Kappe auf das strohblonde Haar.
„Ich glaube, ich verdampfe auch gleich“, stöhnte Elena und kniff die Augen gegen die gleißende Sonne zusammen. Eine brüllend feuchte Hitze umgab sie schlagartig wie in einem Dampfkessel.
Helen Miller, die pädagogische Koordinationschefin der Dörfer empfing sie an dem verabredeten Treffpunkt vor dem Flughafen. „Willkommen in Nigeria", begrüßte sie sie lächelnd. Trotz der Hitze und der sportlichen Bekleidung wirkte sie sehr elegant in ihrem beigen Hosenanzug und ihr Händedruck war angenehm kühl, ihre rote Haarpracht schien dagegen in Flammen zu stehen.
„Sie haben sich leider einen sehr heißen Tag für ihren Besuch ausgesucht. Normalerweise klettert das Thermometer hier im September höchstens auf 28 Grad. Das Klima scheint auch in Nigeria verrückt zu spielen. Unser Wagen wartet da vorne", sagte sie und zeigte auf ein ausgedehntes Parkareal jenseits der Ankunftshalle. Mit selbstbewussten, weit ausholenden Schritten ging sie ihnen durch die eng parkenden Autoreihen voran.
„Heiß“, raunte Timo Elena ins Ohr, während sie versuchten, hinter ihr Schritt zu halten, und er meinte nicht das Wetter. Dass er „total auf Rothaarige über 40 abfuhr“, hatte er ihr während einem ihrer gemeinsamen Flüge der letzten Woche anvertraut. Etliche Wodka Tonics später ließ er es sich nicht nehmen, sie über seine sexuellen Vorlieben aufzuklären. Sie hatte sich die Kopfhörer über die Ohren gestülpt und sich in einen Schmachtfetzen mit dem langweiligen Richard Gere geflüchtet, aber Timo war bei seinem Lieblingsthema unerbittlich. „Hast du gewusst, dass Richard Gere mal mit einem Hamster im Arsch in eine Klinik eingeliefert worden ist?“ fragte er, ihren Kopfhörer lüpfend. Nur ein vorgetäuschter Übelkeitsanfall mit Griff zur Spucktüte hatte sie vor weiteren Details bewahrt.
Helen Miller, die beide von Timo begehrten Attribute besaß und zudem noch überaus attraktiv war, musste ihm wie ein Geschenk von Eros persönlich vorkommen, allerdings bezweifelte Elena, dass eine Frau wie Helen sich mit einem Milchgesicht wie Timo abgeben würde. Wie sie den Fotografen kannte, würde ihn das keinesfalls von dem Versuch abhalten, bei ihr zu landen. Helen drehte sich kurz zu ihnen um als hätte sie seine Worte gehört, was wegen des Flughafenlärms unmöglich war. Sie liefen eine ganze Weile durch sich stoßartig fortbewegende Reihen davonfahrender und ankommender Fahrzeuge, Taxen und Shuttle-Busse, deren Chromteile gleißend die brennende Sonne reflektierten. Endlich blieb Helen Miller vor einem alten, schlammbespritzen Landrover stehen, der mit laufendem Motor in einer Halteverbotszone wartete. „So, da wären wir", sagte sie und drehte sich beschwingt um, als wären sie nicht gerade einen halben Kilometer über blasenschlagenden Asphalt gelaufen. Ein zierlicher Mann in einem bunten Hemd stieg aus dem Wagen und ging ihnen entgegen.
„Henry, das sind Elena di Sconti und Timo Burkhard. Sie kommen vom Globus, einem deutschen Magazin und möchten über unsere Arbeit berichten", sagte Helen, als er vor ihnen stehen blieb. Er war nicht sehr viel größer als Elena.
„Wir sind im Moment alle traumatisiert von den Ereignissen. Ich hoffe, ich kann Ihnen trotzdem weiterhelfen", sagte er und streckte ihnen die Hand zum Gruß hin. Sein Name war Henry Lawinson. Trotz des freundlichen Lächelns wirkte er erschöpft. Tiefe Falten hatten sich in die ebenholzdunkle Haut seines Gesichts eingegraben. Der Blick seiner Augen schien nach innen gerichtet. Ein Niemandsland, an dem die Seele vor dem Entsetzen Zuflucht sucht. Dieser Ausdruck war ihr vertraut. Er war ihr lange Zeit in ihrem eigenen Spiegelbild begegnet. Beklommen schüttelte sie seine Hand. Die Erinnerung lugte hervor wie ein grausiges Gespenst, das seinen Kopf durch eine fest verschlossen geglaubte Tür steckte. Sie wusste nicht, ob Mr Lawinson diese kurze Schwäche bemerkt hatte. Jedenfalls hielt er ihre Hand länger als nötig fest, als suche er Trost in der flüchtig wahrgenommenen Seelenverwandtschaft.
„Mr Lawinson ist der Pädagogische Leiter unseres Dorfes in Ebuto“, sagte Helen und öffnete den Kofferraum für das Gepäck.
„Ich war, müsste man wohl besser sagen“, korrigierte er sie. „Im Moment gibt es kein Dorf mehr. Die Kinder, die überlebt haben, sind mit ihren Betreuern in einem anderen Dorf weiter im Norden untergebracht." Er hatte eine angenehme Art zu sprechen. Sein Englisch klang weich und fließend.
„Es tut mir sehr leid, was passiert ist", sagte Elena.
Er nickte. „Wir sind alle in Gottes Hand“, murmelte er, während er ihr die Tür aufhielt und sie auf den Rücksitz neben Timo einsteigen ließ.
„Wir befinden uns etwa 20 Kilometer nordwestlich von Lagos. Um nach Ebuto zu gelangen, müssen wir durch die Stadt fahren. Mit etwas Glück erreichen wir das Dorf in ungefähr 6 Stunden." Helen Miller drehte sich auf dem Beifahrersitz zu ihnen um, während Mr Lawinson den Wagen sicher durch das Verkehrschaos vor dem Flughafengelände steuerte. Die Frage, warum sie einen halben Tag für ein Ziel brauchen würden, dass nur 150 Kilometer von ihnen entfernt lag, erübrigte sich mit einem Blick aus dem Fenster. Kaum hatten sie das Flughafengelände verlassen, steckten sie schwitzend und japsend mitten in einer fünfspurigen Blechkarawane, die sich im Schritttempo der 10 Millionenstadt Lagos entgegen schob. Nach einer Stunde konnten sie in der Ferne die drei Brücken erkennen, die das Festland der Stadt mit seinen drei Inseln, Victoria Island, Ikoyi und Lagos Island verband, nach einer weiteren halben Stunde hatten sie die Metropole erreicht, was sich auf ihre Fortbewegungsgeschwindigkeit nur insofern auswirkte, als dass sie noch langsamer wurde.
„In dieser Stadt dauert die Rushhour 12 Stunden", sagte Mr Lawinson, der die ganze Zeit schweigend am Steuer gesessen hatte, mit resigniertem Blick auf das Verkehrschaos. Mit dem infernalischen Dauergehupe und dem Geschrei der Straßenhändler drangen auch stinkende Abgase, gemischt mit einer 90 prozentigen Luftfeuchtigkeit durch die halb geöffneten Fenster ihres betagten Gefährtes. Wobei sich der Landrover gegen die demolierten gelben VW-Busse, die zu tausenden als Taxis in der Stadt unterwegs waren, geradezu elegant ausmachte. Elenas romantische Vorstellungen von Afrika verblassten unter einer schwefelgelben Abgaswolke. Timo lehnte sich mit gezückter Kamera immer wieder weit aus dem Fenster, so dass ein Schwertransporter ihn fast zerteilt hätte, wenn ihn nicht ein ohrenbetäubendes Hupen gewarnt hätte, mit dem der Laster sich fauchend an ihnen vorbei schob. Für Timo war die Szenerie der Metropole ein motivisches El Dorado. Das gesamte Konsumleben der Einwohner schien am Straßenrand stattzufinden. Neben sorgfältig auf Packpapier drapierten Fleischstücken verscherbelten junge Nigerianer in bunten Hemden und T-Shirts von der Telefonkarte bis zum Kühlschrank alles, was man während einer mehrstündigen Fahrt durch die Stadt so aufnehmen konnte.
„Ich würde Ihnen raten, die Kamera lieber vor den Blicken anderer zu verbergen", rief Helen Timo durch den Verkehrslärm und das altersschwache Röhren ihres Landrovers über die Rücklehne ihres Sitzes zu. So etwas ist hier sehr begehrt und wird auch gern als Bestechungsobolus bei einer Straßenkontrolle einkassiert." Sie deutete auf einen martialisch aussehenden Uniformierten in Camouflage mit Maschinenpistole, der gerade einen weißen Autofahrer an die Seite winkte. Widerwillig packte Timo die Kamera ein. Er konnte es sich nicht leisten, sein Arbeitsgerät zu verlieren. Außerdem wollte er bei Helen sicher nicht durch unvernünftige Aktionen als Depp dastehen, mutmaßte Elena.
„Wenn wir in eine Straßenkontrolle geraten, verhalten Sie sich bitte ruhig und überlassen Mr Lawinson die Verhandlungen", bat Helen sie mit ernstem Blick. „Man weiß nie genau, mit wem man es zu tun hat.“
„Angeblich soll Lagos die gefährlichste Stadt Westafrikas sein", rief Elena.
Mr Lawinson drehte den Kopf zu ihr um. „Das stimmt leider", rief er über die Schulter zurück, „nirgendwo in Afrika ist die Kriminalitätsrate so hoch wie hier. In wenigen Jahren wird Lagos über 12 Millionen Einwohner haben und somit zu den zehn größten Städten der Welt zählen.“
Ein knatterndes Motorrad, das sich zwischen den Stoßstange an Stoßstange dahin rollenden Autos vorbei schlängelte übertönte ihn. Sie lehnte sich zurück. Es war unmöglich, sich in diesem Lärm vernünftig zu unterhalten. Langsam zuckelten sie dahin, durchgerüttelt von den Schlaglöchern der schlecht gewarteten Straßen, eingequetscht zwischen zerdepperten Automobilen, vorbei an Straßenhändlern und verrottenden Autowracks, die ungefähr alle 300 Meter am Straßenrand lagen. Die zerbeulten Autoleichen wirkten wie altersschwache Gäule, die bei einem letzten gnadenlosen Ritt das Letzte aus sich rausgeholt hatten, um dann einfach tot umzukippen.
Sie redeten kaum ein Wort miteinander. Hin und wieder wiesen Helen oder Mr Lawinson auf eine Sehenswürdigkeit oder ein bedeutsames gegenwärtiges oder historisches Gebäude hin. Die meiste Zeit der Fahrt klammerten sie sich an die Wasserflaschen, die Mr Lawinson ihnen mitgebracht hatte und starrten lethargisch auf den durch Abgasnebel verschleierten Großstadt-Moloch mit seinem gigantischen Gewirr aus Hochhäusern, Wellblechhütten, Märkten und Highways. Als sie die Stadt auf ruhigeren Straßen endlich verließen, senkte sich der Abend über das Land. Das rotviolette Licht bescherte ihnen noch einen letzten Ausblick auf eine hügelige, karge Landschaft, in denen der Niger sich dem Meer entgegen strebend immer wieder aufs Neue gabelte und verästelte.
Helen warf Mr Lawinson einen besorgten Blick zu.
„Es gefällt mir nicht, dass wir jetzt im Dunkeln weiterfahren müssen, Henry."
Mr Lawinson richtete seinen Blick angestrengt auf die mit Schlaglöchern übersäte Straße, die ins Nirgendwo zu führen schien.
„Es wird uns nichts anderes übrigbleiben.“
Sie waren alle erschöpft und durchgeschwitzt. Auch Helen hatte ihre taufrische Unbekümmertheit während der Höllenfahrt eingebüßt. Mr Lawinson hielt den Wagen an. Endlich konnten sie pinkeln gehen. Elena sog gierig die frische Luft ein, die merklich kälter geworden war. Es roch nach Mangrovenwäldern und erdigem Schlamm. Einen kurzen Regenguss hätte sie jetzt willkommen geheißen. Von ihrem fernen Hügel aus betrachtet lag die Stadt wie ein schnaufendes Ungeheuer hinter ihnen, das mit Millionen blinkender Augen seine Umgebung abscannte. Ein violetter Dunst wölbte sich über die Skyline des Banking Districts, der seine scharfkantigen Hochhäuser in den Himmel stieß. Timo schoss einige Fotos, bis Mr Lawinson sie zur Eile antrieb.
Schwankend nahm der alte Landrover seine Fahrt wieder auf. Timo lehnte sich aus dem Fenster. Frische Nachtluft strömte durch die geöffneten Fensterscheiben.
„Nachts wird es hier empfindlich kalt“, sagte Mr Lawinson, der im Rückspiegel gesehen hatte, wie Elena fröstelnd die Schultern hochzog. „Wir haben Temperaturunterschiede von mehr als 20 Grad.“ Er bastelte an dem Regulierknopf für die Heizung, die bald einen staubig riechenden Schwall Wärme im Wageninneren verbreitete, der sie angenehm schläfrig machte.





























