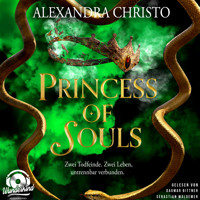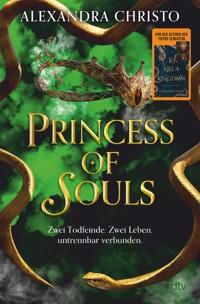8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Lied der Sirenen ist verführerisch und tödlich Lira ist die Tochter der Meereskönigin und dazu verdammt, einmal im Jahr einem Prinzen das Herz zu rauben. Als Lira einen Fehler begeht, verwandelt ihre Mutter sie zur Strafe in die Kreatur, die sie am meisten verabscheut – einen Menschen. Und sie stellt ihr ein Ultimatum: Bring mir das Herz von Prinz Elian oder bleib für immer ein Mensch. Elian ist der Thronerbe eines mächtigen Königreichs und das Meer ist der einzige Ort, an dem er sich wirklich zu Hause fühlt. Er jagt Sirenen, vor allem die eine, die bereits so vielen Prinzen das Leben genommen hat. Als er eine junge Frau aus dem Ozean fischt, ahnt er nicht, wen er da an Bord geholt hat. Das Unerwartete geschieht: die beiden verlieben sich ineinander – doch hat ihre Liebe eine Zukunft?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Alexandra Christo
Roman
Aus dem Englischen von Petra Koob-Pawis
Für die geliebten Menschen, denen es nicht vergönnt war, dies mitzuerleben.
EINS
Ich habe ein Herz für jedes Jahr meines Lebens.
Siebzehn liegen im Sand meines Schlafzimmers vergraben. Immer wieder wühle ich im Untergrund, um nachzusehen, ob sie noch da sind. Blutig und in der Tiefe verborgen. Ich zähle sie, um sicherzugehen, dass keines über Nacht gestohlen wurde. Die Sorge ist nicht unbegründet. Herzen bedeuten Macht, und wenn es etwas gibt, was mein Volk mehr schätzt als das Meer, dann ist es Macht.
Ich habe so einiges gehört: Geschichten von gestohlenen Herzen und harpunierten Frauen, die für ihren Verrat bestraft und zuhauf auf dem Grund des Ozeans zurückgelassen wurden. Dort litten sie furchtbare Qualen, bis ihr Blut am Ende zu Salzkristallen erstarrte und sie sich im Meerschaum auflösten. Das sind die Frauen, die uns unsere menschliche Beute wegnehmen wollen. Nixen, mehr Fisch als Fleisch, mit einem Oberkörper, der zu den üppigen Schuppen ihrer Flossen passt.
Nixen sind ganz anders als Sirenen. Ihre Haut ist blau und anstelle von Haaren haben sie Tentakel. Ihre kieferlosen Münder sind so groß wie kleine Boote, sodass sie einen Hai in einem Stück verschlingen können. Ihre Arme und tiefblauen Rücken sind von Zackenflossen überwuchert. Sie sind Fisch und Mensch zugleich, wenn auch ohne die Schönheit des einen wie des anderen.
Wie alle Monster sind sie durchaus fähig zu töten, aber im Gegensatz zu den Sirenen, die verführen und morden, erliegen die Meernixen der Faszination der Menschen. Sie rauben wertlosen Tand und folgen den Schiffen in der Hoffnung, dass Schätze über Bord fallen. Manchmal retten sie sogar Seeleuten das Leben und erfreuen sich daran. Das allein ist ihnen Lohn genug. Wenn sie die Herzen stehlen, die wir hüten, geht es ihnen dabei nicht um Macht. Sie glauben, sie müssten sich nur möglichst viele Menschenherzen einverleiben, um irgendwann selbst zu einem Menschen zu werden.
Ich hasse Nixen.
Meine Haare winden sich schlangengleich über meinen Rücken. Sie sind rot wie mein linkes Auge – doch nur mein linkes, denn das rechte Auge jeder echten Sirene hat die Farbe des Meeres, in dem sie geboren wurde. In meinem Fall ist es das große Meer von Diávolos. Sein Wasser hat die Farbe von Äpfeln und Smaragden. In diesem Ozean liegt das Königreich Keto.
Alle Sirenen sind berühmt für ihre Schönheit, doch das Haus Keto zeichnet sich durch eine ganz besondere Anmut aus. Unsere Wimpern bestehen aus Eisbergsplittern und das Blut der Seeleute verleiht unseren Lippen ihr einzigartiges Rot. Es ist beinahe verwunderlich, dass wir noch unseren Gesang brauchen, um Herzen zu stehlen.
»Wen hast du gewählt, Cousine?«, fragt Kahlia mich in Psáriin.
Sie sitzt auf dem Felsen neben mir und beobachtet das Schiff in der Ferne. Ihre Schuppen glänzen rotbraun und ihre blonden Haare reichen bis knapp über ihre Brüste, die von einem Band aus geflochtenem Seetang bedeckt sind.
»Mach dich nicht lächerlich«, erwidere ich. »Du weißt genau, wen.«
Gemächlich segelt das Schiff durch die ruhigen Gewässer von Adékaros, einem der vielen Menschenreiche, denen ich, meinem Schwur folgend, einen Prinzen rauben werde. Das Schiff ist kleiner als die meisten, und seine Holzplanken sind purpurn, was der Landesfarbe entspricht. Die Menschen sind alle so erpicht darauf, ihre Schätze zur Schau zu stellen, und genau das macht sie zur leichten Beute für Kreaturen wie Kahlia und mich. Wir können ein königliches Schiff schon von Weitem erkennen.
Diesmal ist es das einzige in der Flotte, das bemalt ist und von dessen Mast eine Tigerflagge weht. Auf diesem Schiff reist der Prinz von Adékaros. Eine leichter Fang für alle, denen der Sinn nach Jagd steht.
Die Sonne brennt auf meinen Rücken. Ihre Hitze legt sich über meinen Nacken und macht, dass meine Haare auf der nassen Haut kleben bleiben. Ich sehne mich nach dem eisigen Meer, dessen scharfe Kälte wie köstliche Messerstiche in meine Glieder fährt.
»Was für eine Schande«, seufzt Kahlia. »Er sieht aus wie ein Engel. So ein hübsches Gesicht.«
»Sein Herz ist noch viel hübscher.«
Kahlia lächelt boshaft. »Es ist schon eine Ewigkeit her, seit du zum letzten Mal getötet hast, Lira«, sagt sie scherzhaft. »Hast du denn gar keine Angst, aus der Übung zu sein?«
»Ein Jahr kann man schwerlich als Ewigkeit bezeichnen.«
»Kommt darauf an, wer zählt.«
Ich seufze. »Dann verrate mir, wer es ist, damit ich ihn umbringen und dieses Gespräch beenden kann.«
Kahlias Lächeln ist grausig. So grinst sie nur, wenn ich ganz besonders abscheulich bin. Denn das schätzen Sirenen untereinander am allermeisten. Je boshafter und grausamer wir sind, desto besser. Freundschaft und Familienbande sollen uns so fremd bleiben wie das Land dem Meer, das bringt man uns von klein auf bei. Unsere Treue gehört allein der Meereskönigin.
»Du bist heute ein bisschen herzlos, nicht wahr?«
»Wie könnte ich herzlos sein?«, entgegne ich. »Unter meinem Bett sind siebzehn vergraben.«
Kahlia schüttelt das Wasser aus ihren Haaren. »So viele Prinzen haben deine Lippen schon gekostet.«
Sie sagt es wie etwas, auf das man stolz sein kann. Kahlia ist noch jung und hat erst zwei Herzen geraubt. Keines davon war königlich, denn das ist allein mein Vorrecht, mein ureigenstes Privileg. Kahlias Bewunderung hat zum Teil damit zu tun. Sie fragt sich, ob die Lippen eines Prinzen anders schmecken als die eines gewöhnlichen Menschen. Aber ich kann ihr auf diese Frage keine Antwort geben, denn ich kenne nur den Geschmack von Prinzen.
Seit unsere Göttin Keto von den Menschen ermordet wurde, ist es bei uns Brauch, jedes Jahr im Monat unserer Geburt ein Herz zu stehlen. Damit feiern wir das Geschenk des Lebens, das Keto uns gegeben hat, und nehmen Rache an den Menschen für ihren gewaltsamen Tod. Als ich noch zu jung zum Jagen war, hat meine Mutter diese Pflicht für mich übernommen, so wie es Tradition bei uns ist. Sie hat mir stets einen Prinzen gebracht. Manche waren nicht älter als ich selbst. Andere waren alt und zerfurcht oder nachgeborene Kinder, die nie den Thron bestiegen hätten. Der König von Armonía hatte einst sechs Söhne und in meinen ersten Lebensjahren hat meine Mutter mir einen nach dem anderen zum Geburtstag geschenkt.
Als ich schließlich alt genug war, um selbst hinauszuziehen, kam es mir nie in den Sinn, auf königliches Blut zu verzichten und wie meine Artgenossen einfache Seeleute zu wählen. Man kann mir wahrhaftig nicht nachsagen, dass ich die Traditionen meiner Mutter nicht in Ehren halte.
»Hast du deine Muschel dabei?«, frage ich meine Cousine.
Kahlia streicht ihre Haare zurück und zeigt mir die orange Muschel, die sie sich um den Hals gebunden hat. Auch ich trage eine Muschel wie sie, allerdings ist meine von einem tiefen Blutrot. Sie sehen unscheinbar aus, aber mit ihnen können wir uns auf einfache Art verständigen. Wenn wir sie an unser Ohr halten, hören wir das Rauschen des Ozeans und die Gesänge aus dem Unterwasserpalast von Keto, den wir unser Zuhause nennen. Falls wir getrennt werden, kann Kahlia sich mithilfe der Muschel in der See von Diávolos orientieren. Wir sind sehr weit weg von unserem Königreich und haben fast eine Woche gebraucht, um hierherzuschwimmen. Kahlia ist erst vierzehn und bleibt am liebsten in der Nähe des Palasts, aber ich hielt es für an der Zeit, das zu ändern. Und da ich die Prinzessin bin, sind meine Launen für alle Gesetz.
»Wir werden uns schon nicht verlieren«, sagt Kahlia.
Bei allen meinen anderen Cousinen wäre es mir gleich, wenn sie sich in einem fremden Ozean verirren würden. Sie sind eine langweilige Sippe ohne Ehrgeiz und Vorstellungskraft. Nach dem Tod meiner Tante sind aus ihnen ehrfürchtige Dienerinnen meiner Mutter geworden. Was töricht ist, denn man soll die Meereskönigin nicht verehren. Man soll sie fürchten.
»Denk daran, dir nur einen Einzigen herauszupicken«, sage ich zu Kahlia. »Konzentriere dich ganz auf ihn.«
Kahlia nickt. »Welchen soll ich nehmen?«, fragt sie. »Wird sein Blut zu mir singen?«
»Die Einzigen, die singen, sind wir«, erwidere ich. »Unser Gesang wird alle verzaubern, und wenn du einen aussuchst, wird er sich so rettungslos in dich verlieben, dass er noch im Ertrinken deine Schönheit preist.«
»Für gewöhnlich bricht der Zauber im Sterben«, entgegnet Kahlia.
»Weil du für alle singst. In ihrem tiefsten Inneren wissen sie, dass dein Herz keinem von ihnen gehören wird. Du musst dich nach ihnen genauso sehr sehnen wie sie sich nach dir.«
»Aber sie sind grässlich«, wendet Kahlia ein. Sie klingt nicht ganz so überzeugt, wie sie mich glauben machen will. »Wer könnte allen Ernstes von uns erwarten, sie zu begehren?«
»Du hast es hier ja nicht mit einfachen Matrosen zu tun, sondern mit Königsangehörigen. Königtum bedeutet Macht. Und Macht ist immer begehrenswert.«
»Königsangehörige?«, wiederholt Kahlia atemlos. »Ich dachte …«
Sie beendet den Satz nicht. Sie dachte, ich würde alle Prinzen für mich beanspruchen und sie mit niemandem teilen. Und das stimmt sogar. Aber wo Prinzen sind, da sind auch Könige und Königinnen, und für die hatte ich noch nie etwas übrig. Regenten werden allzu leicht vom Thron gestoßen. Prinzen hingegen sind wie ein verheißungsvolles Versprechen. Sie sind die nächste Generation, die einmal die Macht in ihren Händen halten wird. Indem ich sie vernichte, vernichte ich die Zukunft – so, wie es meine Mutter mich gelehrt hat.
Ich ergreife Kahlias Hand. »Du kannst die Königin haben. Die Vergangenheit interessiert mich nicht.«
Kahlias Augen glänzen. Das rechte schimmert im vertrauten Saphirgrün der See von Diávolos, aber das linke – dessen Pupille so hellgelb ist, dass sie sich kaum vom Weiß des Augapfels abhebt – funkelt in seltener Freude. Wenn sie zu ihrem fünfzehnten Geburtstag ein königliches Herz raubt, wird sie das Wohlwollen meiner ewig zornigen Mutter erringen.
»Und du nimmst den Prinzen«, sagt Kahlia. »Den mit dem hübschen Gesicht.«
»Sein Gesicht ist nicht wichtig.« Ich lasse ihre Hand los. »Ich will nur sein Herz.«
»So viele Herzen«, säuselt sie sanft. »Bald wirst du keinen Platz mehr finden, um sie alle zu vergraben.«
Ich fahre mir mit der Zunge über die Lippen. »Kann sein«, sage ich. »Aber eine Prinzessin braucht nun mal einen Prinzen.«
ZWEI
Die Bordwand fühlt sich rau unter meinen langen Fingern an. Das Holz splittert und die Farbe ist rissig und blättert ab. Das Schiff durchpflügt das Wasser in einem abgehackten Rhythmus wie die Klinge eines stumpfen Messers, die drückt und stößt, bis sie schließlich schneidet. Überall hängt Unrat, der Gestank lässt mich die Nase rümpfen.
Es ist das Schiff eines verarmten Prinzen.
Die Königlichen sind nicht alle gleich. Manche tragen kostbare Gewänder und unglaublich große Juwelen, deren Gewicht den Träger doppelt so schnell auf den Meeresboden sinken lässt. Andere sind einfach gekleidet, mit nur einem oder zwei Ringen am Finger und einer Bronzekrone, die mit Gold übermalt ist. Aber das ist mir egal. Ein Prinz ist ein Prinz.
Kahlia und ich schwimmen Seite an Seite neben dem Schiff her, das die Wellen zerteilt. Wir können mühelos mithalten. Das Warten ist quälend, während wir auf unsere Beute lauern. Es dauert eine Weile, bis der Prinz endlich an Deck kommt und seinen Blick aufs Meer richtet. Er kann uns nicht sehen. Wir sind viel zu nah und schwimmen viel zu schnell. Kahlia sieht mich fragend an. Das Lächeln, mit dem ich ihren Blick erwidere, ist so unmissverständlich wie ein Nicken.
Wir tauchen aus der Gischt auf und öffnen unsere Lippen.
In vollkommenem Gleichklang singen wir in der Sprache von Midas. Sie ist unter den Menschen am gebräuchlichsten und jede Sirene kennt sie. Dabei kommt es auf die Worte gar nicht an. Es ist die Musik, die verzaubert. Unsere Stimmen dringen bis in den Himmel hinauf und kehren mit dem Wind zu uns zurück. Sie schwellen an wie der Gesang eines Chors, und während die eindringliche Melodie steigt und fällt, schmeichelt sie sich in die Herzen der Mannschaft, bis das Schiff immer langsamer wird und schließlich anhält.
»Hörst du das, Mutter?«, fragt der Prinz. Seine Stimme ist hell und verträumt.
Die Königin steht neben ihm an Deck. »Nein, ich –«
Ihre Stimme stockt, als die weiche Melodie nun auch sie in Bann schlägt. Der Gesang ist wie ein Befehl, alle Menschen auf dem Schiff halten inne und verharren, nur ihre Blicke huschen über das Wasser. Ich schaue den Prinzen an und singe sanft. Es dauert nicht lange und sein Blick trifft meinen.
»Bei den Göttern«, stößt er hervor. »Du bist es.«
Er lächelt und aus seinem linken Auge rinnt eine einzelne Träne.
Ich höre auf zu singen und summe nur noch leise.
»Du Liebe meines Lebens«, seufzt der Prinz. »Endlich habe ich dich gefunden.«
Er hält sich an den Webleinen fest und lehnt sich vor. Die Brust gegen die Reling gepresst, streckt er die Hand nach mir aus. Er trägt ein cremefarbenes Hemd. Die Schnüre an seiner Brust sind lose und die zerrissenen Ärmel sind an manchen Stellen von Motten zerfressen. Seine Krone ist aus dünnem Blattgold, sie wirkt zerbrechlich, als könnte sie bei jeder Bewegung zerspringen. Der junge Prinz sieht trostlos und arm aus.
Aber dann ist da noch sein Gesicht.
Weich und rund mit einer Haut wie poliertes Holz und Augen, die nur einen Hauch dunkler sind. Seine Haare kräuseln sich zu einem wunderschönen Durcheinander von Locken. Kahlia hat recht; er sieht aus wie ein Engel. Sein Herz wird eine wertvolle Trophäe sein.
»Du bist so wunderschön«, sagt die Königin und starrt Kahlia bewundernd an. »Ich weiß nicht, wie ich jemals Augen für jemand anderen als dich haben konnte.«
Kahlias Lächeln ist aufrichtig, als sie den Arm ausstreckt und der Königin winkt.
Ich wende mich wieder dem Prinzen zu, der verzweifelt versucht, meine Hand zu ergreifen. »Meine Geliebte«, fleht er. »Komm zu mir!«
Ich schüttle den Kopf und summe weiter. Das Heulen des Windes ist die Begleitmusik für mein Lied.
»Dann komme ich zu dir!«, ruft der Prinz. Als hätte er je eine Wahl gehabt.
Mit einem verzückten Lächeln stürzt er sich ins Meer. Keine Sekunde später spritzt das Wasser erneut auf, als die Königin sich meiner Cousine auf Gedeih und Verderb ausliefert. Das Platschen, mit dem sie in die Wellen eintauchen, reißt die Schiffsmannschaft aus ihrer Erstarrung. Lautes Geschrei bricht los. Alle an Deck beugen sich über die Reling, fünfzig Seeleute, die sich an Taue und Planken klammern und entsetzt das grausige Schauspiel im Meer mit ansehen. Keiner von ihnen wagt es, von Bord zu springen, um die Königsfamilie zu retten. Ich rieche ihre Furcht, in die sich Verwirrung mischt, weil unser Gesang plötzlich verstummt ist.
Ich schaue meinem Prinzen in die Augen und streiche über seine zarte Haut. Eine Hand an seine Wange, die andere auf seine magere Schulter gelegt, küsse ich ihn sanft. Meine Lippen berühren die seinen und im selben Moment ziehe ich ihn unter Wasser.
Als wir tief genug sind, ist der Kuss vorbei. Mein Lied ist lange verklungen, aber der Prinz ist immer noch in Liebe gefangen. Sogar als das Wasser in seine Lunge dringt und sein Mund sich im verzweifelten Ringen nach Luft öffnet, ist er so betört, dass er den Blick nicht von mir abwenden kann.
Noch im Ertrinken streicht er über seine Lippen.
Kahlias Königin aber schlägt wie wild um sich. Sie greift an ihre Kehle und stößt meine Cousine weg. Wütend packt Kahlia sie am Knöchel und hält sie fest. Mit verzerrtem Gesicht versucht die Königin sich loszureißen. Vergeblich. Der Griff einer Sirene ist unerbittlich.
Ich streichle meinen sterbenden Prinzen. Mein Geburtstag ist erst in zwei Wochen. Unser Ausflug war ein Geschenk für Kahlia. Ihr fünfzehntes Herz sollte ein königliches sein. Eigentlich darf ich nicht zwei Wochen zu früh auf Jagd gehen, ich breche damit die oberste Regel. Und doch haucht gerade ein Prinz vor meinen Augen sein Leben aus. Braune Haut, meeresblaue Lippen. Haare, die ihn umfließen wie schwarzer Seetang. Etwas an seiner Reinheit erinnert mich an meine allererste Jagd. An den kleinen Jungen, den meine Mutter dazu benutzt hat, mich zu dem Ungeheuer zu machen, das ich nun bin.
So ein hübsches Gesicht, denke ich.
Ich fahre mit dem Daumen über die Lippen des armen Prinzen und genieße den Anblick seines friedvollen Gesichts. Dann stoße ich einen durchdringenden Schrei aus. Es ist ein Laut, der Knochen splittern lässt und die Haut aufreißt. Ein Laut, der meine Mutter mit Stolz erfüllen würde.
In einer einzigen Bewegung stoße ich meine Faust durch die Brust des Prinzen und reiße sein Herz heraus.
DREI
Im Grunde genommen bin ich ein Mörder. Aber in meinen Augen ist das eine meiner besseren Eigenschaften.
Ich halte meinen Dolch ins Mondlicht und bewundere den Glanz des Blutes, bevor es vom Stahl aufgesogen wird und verschwindet. Die Waffe ist an meinem siebzehnten Geburtstag für mich geschmiedet worden. Für den Prinzen von Midas schicke es sich nicht, rostige Klingen am Gürtel zu tragen, hatte der König gesagt. Seither habe ich einen magischen Dolch, der das Blut der Opfer so rasch verschluckt, dass mir kaum Zeit bleibt, es zu bewundern. Was anscheinend schicklicher ist. Allerdings auch etwas theatralisch.
Ich betrachte das tote Ding an Deck.
Die Saad ist ein mächtiges Schiff, doppelt so lang wie ein normales. Es könnte eine Mannschaft von achtzig Matrosen vertragen, aber es sind nur vierzig an Bord, weil es mir bei meinen Leuten vor allem auf Treue ankommt. Alte schwarze Laternen schmücken das Heck und das Bugspriet ist lang und spitz wie eine Klinge. Die Saad ist viel mehr als nur ein Schiff. Sie ist eine Waffe. Das Holz ist mitternachtsblau gestrichen. Die Segel schimmern elfenbeinfarben wie die Haut der Königin und das Deck glänzt bronzen wie die Haut des Königs.
Auf diesem Deck liegt jetzt der blutige Leichnam einer Sirene.
»Müsste sie nicht schmelzen?«
Die Frage kommt von Kolton Torik, meinem ersten Maat. Torik ist Anfang vierzig, hat einen makellos weißen Schnurrbart und ist gut vier Zoll größer als ich. Seine Arme haben den Umfang meiner Beine, er ist ein wahres Kraftpaket. An warmen Sommertagen wie diesem trägt er auf Kniehöhe abgeschnittene Hosen und ein weißes Hemd unter einer schwarzen Weste, die von einer roten Schärpe zusammengehalten wird.
»Mir wird ganz mulmig, wenn ich es ansehe«, sagt Torik. »Obenrum könnte man es glatt für einen Menschen halten.«
»Der Anblick gefällt dir, was?«
Torik läuft rot an und wendet den Blick von den nackten Brüsten der Sirene ab.
Ich weiß natürlich, was er meint, aber irgendwo in den Weiten des Meeres ist mir das Gefühl der Bestürzung abhandengekommen. Ich kann weder die Flossen noch die blutroten Lippen ausblenden und auch nicht die Augen, die zwei unterschiedliche Farben haben. Männer wie Torik – gute Männer – sehen, was diese Kreaturen sein könnten: Frauen und Mädchen, Mütter und Töchter. Aber ich sehe nur, was sie sind: Scheusale und Ungeheuer, Bestien und Teufelinnen.
Ich bin kein guter Mann. Schon lange nicht mehr.
Vor unseren Augen beginnt die Haut der Sirene zu schmelzen. Ihre Haare verwandeln sich in grünen Seetang und ihre Schuppen zerfließen. Ihr Blut wird schäumend zu Gischt. Eine Minute später ist auch davon nichts mehr übrig.
Ich bin froh darüber. Wenn eine Sirene stirbt, wird sie wieder Teil des Meeres. Dadurch bleibt uns erspart, Leichen zu verbrennen oder verwesende Körper über Bord werfen zu müssen. Ich bin vielleicht kein guter Mensch, aber so abgebrüht bin ich nun auch nicht, dass es mir auf diese Art nicht lieber wäre.
»Was jetzt, Cap?«, fragt Kye, mein Steuermann, und steckt sein Schwert zurück in die Scheide. Dann stellt er sich neben Madrid, meine zweite Maatin. Wie üblich ist Kye ganz in Schwarz gekleidet, in zusammengeflicktem Leder und mit Handschuhen, die seine Fingerspitzen frei lassen. Sein hellbraunes Haar ist an den Schläfen abrasiert und in der Mitte zu einem hohen Kamm frisiert wie bei den meisten Männern aus Omorfiá, wo gutes Aussehen wichtiger ist als alles andere – in Kyes Fall moralische Grundsätze mit eingeschlossen. Zum Glück für ihn – und womöglich für uns alle – weiß Madrid, wie man Leuten Anstand einbläut. Für eine geübte Mörderin hat sie bemerkenswert strenge Moralprinzipien. Die Beziehung zwischen den beiden hat Kye immer davor bewahrt, endgültig auf die schiefe Bahn zu geraten.
Grinsend schaue ich Kye von der Seite an. Ich mag es, wenn er mich Cap nennt. Captain. Alles ist besser als mein Gebieter. Mein Prinz. Eure Königliche Hoheit Sir Elian Midas. Keiner der vielen Ehrentitel, die mir katzbuckelnde Untertanen zwischen endlosen Verbeugungen in die Ohren säuseln, passt auch nur annähernd so gut zu mir wie Cap. Denn im Grunde bin ich mehr Pirat als Prinz.
Seit meinem fünfzehnten Geburtstag ist das so, und in den letzten vier Jahren ist mir der Ozean vertrauter geworden als alles andere. In Midas sehnt sich mein Körper ständig nach Schlaf. Dort muss ich allen den Prinzen vorspielen, und das erschöpft mich. Die Gespräche mit den Höflingen, die mich als einen der Ihren betrachten, sind so ermüdend, dass mir die Augen zufallen. An Bord der Saad hingegen schlafe ich nur selten. Hier verfliegt jede Müdigkeit. Auf dem Schiff rauscht mein Blut und rast mein Puls, als würden Blitze durch meine Adern jagen. Ich bin immer hellwach und in fieberhafter Aufregung. Während der Rest meiner Mannschaft schläft, liege ich an Deck und zähle die Sterne.
Ich erkenne Formen in ihnen und spinne Geschichten daraus. Sie handeln von all den Orten, an denen ich schon war oder irgendwann sein werde. Von Meeren und Ozeanen, die ich entdecken will. Von Männern, die ich anheuern werde. Von Teufeln, die ich besiegen muss. Der Nervenkitzel hört nie auf, auch wenn im Meer der Tod lauert. Wenn der vertraute Gesang meine Seele berührt und mich für einen Augenblick an die Liebe glauben lässt, macht der Reiz dieser Gefahr mich nur umso gieriger.
Als Elian Midas, Kronprinz und Thronerbe des Reichs, bin ich ein echter Langweiler. Meine Gespräche drehen sich um Staatsangelegenheiten und Besitztümer und um die Fragen, an welchen Bällen ich teilnehme, welche Dame das hübscheste Kleid trägt und ob eine unter ihnen ist, für die ich mich erwärmen könnte. Jedes Mal, wenn ich im Hafen von Midas anlege und in diese Rolle schlüpfen muss, kommt es mir wie pure Zeitverschwendung vor. Ein Monat, eine Woche, ein Tag – unwiederbringlich verloren. Eine verpasste Gelegenheit. Ein Leben, das ich nicht retten konnte. Ein weiterer Königssohn, den ich den Fängen jener Sirene überlassen habe, die man Fluch der Prinzen nennt.
Aber als Elian, Captain der Saad, bin ich ein anderer Mensch. Wenn das Schiff vor einer Insel anlegt, die ich mir als nächsten Halt ausgesucht habe, und meine Mannschaft bei mir ist, kann ich so sein, wie ich bin. Ich kann trinken, bis mir schwindlig wird, und mit Frauen scherzen, deren Haut von unzähligen Berührungen glüht. Frauen, die nach Rosen und Gerste duften und die losprusten, wenn sie hören, dass ich ein Prinz bin, und mir lachend sagen, dass ich trotzdem meine Zeche bezahlen muss.
»Cap?«, fragt Kye noch mal. »Und was jetzt?«
Ich springe die Stufen zum Vorderdeck hinauf, ziehe das goldene Teleskop aus meiner Gürtelschlaufe und drücke es an mein mit Kohle schwarz umrandetes Auge. Unter dem Bugspriet erstreckt sich der Ozean. Meile um Meile bis in die Unendlichkeit. Wohin man auch schaut, nichts als klares Wasser. Ich fahre mir über die Lippen, denn ich lechze nach mehr.
In meinen Adern fließt königliches Blut, aber die Sehnsucht nach dem Abenteuer ist stärker. Für den Prinzen von Midas, hatte mein Vater gesagt, schicke es sich nicht, rostige Klingen am Gürtel zu tragen oder auf das offene Meer hinauszusegeln und monatelang wegzubleiben. Es zieme sich nicht, mit neunzehn Jahren immer noch keine passende Frau gefunden zu haben oder Dreispitze zu tragen und locker geschnürte Lumpen statt goldgewirkter Gewänder.
Es gehöre sich nicht, als Pirat auf Sirenenjagd zu gehen, statt als Prinz meine Pflichten zu erfüllen.
Seufzend drehe ich mich zum Bug. Auch hier erstreckt sich der weite Ozean, aber in der Ferne, für das Auge nicht sichtbar, liegt das Land. Die Insel Midas. Die Heimat.
Ich lasse den Blick über meine Mannschaft gleiten. Vierzig Matrosen und Krieger, die meine Mission ehrenwert und mutig finden. Sie denken anders über mich als die Höflinge, die in mir einen jungen Prinzen sehen, dem die Abenteuerlust ausgetrieben werden muss. Die Männer und Frauen auf dem Schiff sehen in mir einen Anführer, dem sie ihre uneingeschränkte Treue geschworen haben.
»Also gut, ihr wilder Haufen von Sirenentötern«, rufe ich ihnen zu. »Lasst unsere Dame nach Backbord segeln.«
Die Mannschaft jubelt. Ich werde dafür sorgen, dass sie in Midas so viel essen und trinken können, wie sie wollen. Sie sollen volle Bäuche und herrlich seidene Bettlaken haben – mehr Luxus, als sie es von der Saad oder den Hafenwirtshäusern kennen, in denen wir auf Landgang übernachten.
»Meine Familie wird wissen wollen, wie es uns ergangen ist«, sage ich zu ihnen. »Wir segeln nach Hause.«
Stampfendes Fußgetrappel folgt meinen Worten. Die Ankündigung löst Begeisterungsstürme aus. Ich bemühe mich, ein fröhliches Gesicht zu machen. Ich werde meine Gefühle nicht zeigen. Denn so kennen meine Leute mich: nie beunruhigt, nie erzürnt, nie verzagt. Immer Herr meines Lebens und meines Schicksals.
Das Schiff schwenkt hart nach Steuerbord und schlägt einen weiten Bogen, während meine Matrosen geschäftig übers Deck eilen und es kaum erwarten können, nach Midas zurückzukehren. Nicht alle von ihnen sind dort geboren. Einige stammen aus benachbarten Königreichen wie Armonía oder Adékaros – Länder, derer sie überdrüssig geworden oder in denen nach dem Tod ihrer Prinzen Unruhen ausgebrochen sind. Sie kommen von überallher und sind nirgendwo zu Hause. Aber sie nennen Midas ihre Heimat, weil es auch meine ist. Doch das ist eine Lüge – für sie genauso wie für mich. Meine Mannschaft ist meine Familie, und obwohl ich es nie laut aussprechen würde – und es vielleicht auch gar nicht aussprechen muss –, ist die Saad mein wahres Zuhause.
Die Insel, die wir ansteuern, ist nur ein Zwischenhalt.
VIER
In Midas glitzert das Meer golden. Zumindest hat man diesen Eindruck. Tatsächlich ist das Wasser genauso blau wie in jedem anderen Meer. Aber Licht bringt Erscheinungen hervor. Unerklärliche Dinge. Licht kann lügen.
Das Schloss erhebt sich hoch über der Insel. Es ist die größte aller Pyramiden und aus purem Gold gemacht. Jeder Stein, jeder Ziegel fängt das Sonnenlicht ein und gibt es tausendfach zurück. Am Horizont reihen sich hohe Statuen, und die Häuser der Unterstadt haben alle die gleiche Farbe. Straßen und Pflastersteine schimmern gelb. Wenn die Sonnenstrahlen aufs Wasser treffen und reflektiert werden, erstrahlt das Meer in einem unvergleichlichen Glanz. Nur in den dunkelsten Stunden der Nacht kommt das wahre Blau der Midasanischen See zum Vorschein.
Als Prinz von Midas müsste ich Gold in meinem Blut haben. Jedes Land der hundert Königreiche hat seine eigenen Mythen und Geschichten, die sich um ihr Königshaus ranken: Die Herrscherfamilie von Págos wurde von den Göttern aus Schnee und Eis gemeißelt. Haare wie Milch und Lippen so blau wie der Himmel sind ihr Geschenk, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Fürsten von Eidýllio stammen vom Gott der Liebe ab; jeder, den sie berühren, findet einen Seelenverwandten für sich. Und die Monarchen von Midas sind aus reinem Gold geschmiedet.
Der Legende nach blutet meine Familie kostbare Reichtümer. Mein Blut ist schon oft geflossen. Schon mehr als einmal haben sich die Klauen einer Sirene in meine Arme gebohrt. Ich habe mehr Blut vergossen als jeder andere Prinz und ich kann versichern, dass es nie golden war.
Meine Mannschaft weiß das. Denn meine Getreuen sind auch diejenigen, die meine Wunden säubern und mich wieder zusammenflicken. Trotzdem spinnen sie die Legende weiter – sie lachen und nicken vielsagend, sobald die Rede auf goldenes Blut kommt. Niemals würden sie das Geheimnis meiner Gewöhnlichkeit preisgeben.
»Natürlich«, sagt Madrid zu jedem, der sie fragt. »Der Captain besteht aus den reinsten Sonnenstrahlen. Ihn bluten zu sehen ist, als würde man den Göttern in die Augen blicken.«
Kye beugt sich dann vor und senkt seine Stimme wie jemand, der alle meine Geheimisse kennt: »Nachdem er mit einer Frau zusammen war, weint sie eine Woche lang Tränen aus flüssigem Metall. Zum einen, weil sie sich so schrecklich nach seiner Berührung sehnt, zum anderen, weil sie sich damit ihren Stolz zurückkaufen kann.«
»Ja«, stimmt Torik stets zu. »Außerdem scheißt er Regenbögen.«
Ich bleibe noch eine Weile auf dem Vorderdeck der Saad, die im Hafen von Midas vor Anker gegangen ist. Nach so vielen Wochen auf See beunruhigt mich der Gedanke, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. So ist es immer. Noch unwohler fühle ich mich bei der Vorstellung, dass ich mein wahres Ich auf der Saad zurücklassen muss, wenn ich mich auf den Weg zur Pyramide und zu meiner Familie mache. Ich bin fast ein Jahr lang unterwegs gewesen, aber obwohl ich sie vermisst habe, kommt mir die Zeit viel zu kurz vor.
Kye steht neben mir. Der Rest der Mannschaft ist schon an Land gegangen, aber er weicht mir nicht von der Seite, solange ich ihn nicht dazu auffordere. Er ist mein Steuermann, bester Freund und Leibwächter. Letzteres würde er jedoch nie zugeben, obwohl mein Vater ihm ein wahres Vermögen dafür bezahlt hat. Schon damals kannte Kye mich lange genug, um sich davor zu hüten, mich retten zu wollen, und zugleich war er lange genug mein Freund, um es dennoch immer wieder aufs Neue zu tun.
Was ihn nicht daran hinderte, das Geld von meinem Vater anzunehmen. So, wie er sich oft Dinge nimmt, nur weil er es kann. Das liegt daran, dass er der Sohn eines Diplomaten ist. Wenn Kye seinen Vater schon enttäuscht, indem er sich meiner Sirenenjagd anschließt, statt sein Leben in den Dienst der Politik zu stellen, dann will er wenigstens keine halben Sachen machen. Er widmet sich seiner Aufgabe mit Leib und Seele. Schließlich hat sein Vater die Drohung, ihn zu enterben, längst wahr gemacht.
Um mich herum schimmert alles. Gebäude und Straßen, ja sogar der Hafen. Zur Feier meiner Rückkehr schweben am Himmel Hunderte von kleinen goldenen Laternen. Der Berater meines Vaters stammt aus dem Land der Wahrsager und Propheten, daher weiß er im Voraus, wann ich komme. Bei meiner Ankunft tanzen immer flackernde Lichter am Himmel und funkeln mit den Sternen um die Wette.
Ich nehme den vertrauten Duft meiner Heimat in mich auf. Midas riecht nach Früchten. Nach Butterbirnen und gelbfleischigen Pfirsichen mit der cremigen Beschaffenheit von Honig und der Likörsüße von Aprikosen. Und dazwischen mischt sich der flüchtige Geruch von Süßholz und Kautabak, der von der Saad kommt und von mir.
»Elian.« Kye legt den Arm um meine Schultern. »Wenn wir heute Abend noch etwas zu essen haben wollen, sollten wir los. Du weißt genau, dass die Gierhälse alles wegfuttern, wenn sie können.«
Mein Lachen klingt eher wie ein Seufzen.
Ich nehme meinen Hut ab. Meine Schiffskleidung habe ich bereits gegen die einzigen respektablen Kleider eingetauscht, die ich an Bord habe. Ein cremefarbenes Hemd mit Knöpfen statt Schnüren, dazu eine mitternachtsblaue Hose mit goldenem Gürtel. Nicht unbedingt angemessen für einen Prinzen, aber auch keine Piratenkluft. Ich habe sogar den Wappenring meiner Familie von der dünnen Halskette genommen und über meinen Daumen gestreift.
»Also gut.« Ich hänge den Hut über das Steuerruder. »Bringen wir es hinter uns.«
»Es wird schon nicht so schlimm werden.« Kye stellt seinen Kragen hoch. »Vielleicht findest du ja noch Gefallen an den Verbeugungen. Womöglich gibst du die Seefahrt auf und lässt uns alle im goldenen Land stranden.« Er zerzaust mein Haar. »Wäre gar nicht mal so übel«, sagt er. »Ich mag Gold ganz gern.«
»Ein wahrer Pirat.« Ich versetze ihm spielerisch einen Stoß. »Aber das kannst du dir schön aus dem Kopf schlagen. Wir gehen zum Palast, überstehen den Ball, den sie zu meinen Ehren veranstalten werden, und bevor die Woche um ist, stechen wir wieder in See.«
»Ein Ball?« Kyes Augenbrauen schießen in die Höhe. »Welche Ehre, mein Gebieter.« Die Hand auf den Bauch gelegt, verbeugt er sich tief.
Ich versetze ihm noch einen Stoß, diesmal etwas fester. »Bei allen Göttern«, seufze ich. »Lass das.«
Er verbeugt sich wieder, prustet aber fast los. »Ganz wie Ihr wünscht, Hoheit.«
Meine Familie erwartet mich im Thronsaal. Er ist mit schwebenden Kugeln aus Gold geschmückt. Fahnen mit dem Wappen von Midas zieren die Wände. Auf einem großen Tisch türmen sich Juwelen und Geschenke. Gaben des Volks für den heimgekehrten Prinzen.
Nachdem ich Kye in den Speisesaal geschickt habe, bleibe ich an der Tür stehen und betrachte meine Familie. Ich bin noch nicht so weit, ihnen entgegenzutreten.
»Nicht, dass ich es ihm nicht gönnen würde«, sagt meine Schwester.
Amara ist sechzehn. Ihre Augen haben die Farbe von grünem Molokhia und ihre Haare sind so schwarz wie meine, aber mit Gold und Edelsteinen durchflochten.
»Allerdings bezweifle ich, dass er es haben möchte.« Amara hält ein goldenes Armband in Form eines Blatts hoch, um es dem König und der Königin zu zeigen. »Mal ehrlich«, sagt sie. »Könnt ihr euch vorstellen, dass Elian so etwas trägt? Ich tue ihm nur einen Gefallen.«
»Nennt man Diebstahl neuerdings Gefallen?«, fragt die Königin. Als sie sich zu ihrem Mann umdreht, schwingen die schmalen Zöpfchen an ihren Schläfen hin und her. »Sollen wir sie nach Kléftes zu all den anderen Dieben schicken?«
»Das würde ich im Traum nicht wagen«, erwidert der König. »Wie ich meine kleine Dämonin kenne, stiehlt sie den Wappenring und Kléftes sieht dies als Kriegserklärung an.«
»Unsinn«, sage ich und betrete den Raum. »Sie wäre klug genug, sich gleich die Königskrone zu schnappen.«
»Elian!«
Amara eilt auf mich zu und wirft sich mir um den Hals. Ich reiße sie von den Füßen, als ich ihre stürmische Umarmung erwidere. Ich freue mich genauso sehr über unser Wiedersehen wie sie.
»Da bist du ja endlich!«, ruft sie, als ich sie wieder abgesetzt habe.
Mit gespielter Empörung blicke ich sie an. »Kaum bin ich fünf Minuten da, schon willst du mich ausrauben.«
Amara knufft mich in den Bauch. »Nur ein kleines bisschen.«
Mein Vater erhebt sich vom Thron. Seine bronzene Haut lässt seine strahlend weißen Zähne noch heller blitzen. »Mein Sohn.«
Er nimmt mich in die Arme und klopft mir auf den Rücken. Meine Mutter tritt zu uns heran. Sie ist zierlich und reicht meinem Vater gerade mal bis an die Schulter. Ihre Gesichtszüge sind zart und anmutig, ihr Haar ist kinnlang geschnitten. Sie hat die grünen Augen einer Katze, die sie noch durch schwarze, lang gezogene Lidstriche betont.
Der König ist in jeder Hinsicht das Gegenteil von ihr. Er ist groß und muskulös. Sein Kinnbart ist mit Perlen verziert. Das Braun seiner Augen passt zu seiner Haut und sein Kiefer ist kantig. Die Symbole von Midas, die sein Gesicht schmücken, zeichnen ihn als Krieger aus.
Meine Mutter lächelt. »Wir dachten schon, du hättest uns vielleicht vergessen.«
»Wenn, dann nur kurz.« Ich küsse ihre Wange. »Als wir im Hafen angelegt haben, seid ihr mir wieder eingefallen. Ich habe die Pyramide gesehen und gedacht: Oh, dort lebt meine Familie. Ich erinnere mich an ihre Gesichter. Hoffentlich schenken sie mir ein Armband als Willkommensgruß.« Ich grinse Amara an und sie knufft mich.
»Hast du schon etwas gegessen?«, fragt mich meine Mutter. »Im Bankettsaal gibt es ein Festmahl. Ich glaube, deine Freunde haben sich bereits dort versammelt.«
Mein Vater knurrt. »Zweifellos vertilgen sie alles außer dem Besteck.«
»Wenn du wolltest, dass sie das Besteck essen, hättest du es aus Käse schnitzen lassen sollen.«
»Also wirklich, Elian.« Meine Mutter gibt mir einen Klaps auf die Schulter, dann streicht sie mir das Haar aus der Stirn. »Du siehst müde aus«, sagt sie.
Ich nehme ihre Hand und küsse sie. »Mir geht es gut. So sieht man aus, wenn man seine Nächte auf einem Schiff verbringt.«
Ich bin mir ganz sicher, dass die Müdigkeit mich erst befallen hat, als ich die Saad verlassen und den Fuß auf das goldbemalte Pflaster von Midas gesetzt habe. Nur ein Schritt, und schon ist alles Leben aus mir entwichen.
»Du solltest mehr als ein paar Nächte im Jahr in deinem eigenen Bett schlafen«, sagt mein Vater.
»Radames«, unterbricht ihn meine Mutter tadelnd. »Fang nicht wieder davon an!«
»Ich unterhalte mich nur mit meinem Sohn! Da draußen gibt es nichts als den Ozean.«
»Und Sirenen«, entgegne ich.
»Ha!« Sein Lachen klingt wie ein Bellen. »Und es ist allein deine Aufgabe, sie aufzuspüren, nicht wahr? Wenn du nicht aufpasst, ergeht es uns bald wie Adékaros.«
»Was soll das heißen?«, frage ich stirnrunzelnd.
»Am Ende wird deine Schwester den Thron besteigen müssen.«
»Dann gibt es ja keinen Grund zur Sorge.« Ich lege den Arm um Amara. »Sie gibt sicherlich eine bessere Königin ab als ich.«
Amara unterdrückt ein Lachen.
»Sie ist sechzehn«, weist mich mein Vater zurecht. »Ein Kind sollte sein Leben genießen dürfen und nicht gezwungen sein, sich um ein ganzes Königreich zu kümmern.«
»Aha.« Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Sie darf das, aber ich nicht?«
»Du bist der Ältere.«
»Ach ja?« Ich gebe mich kurz nachdenklich. »Dabei strahle ich doch so viel Jugendlichkeit aus.«
Mein Vater öffnet den Mund, um etwas zu erwidern, aber meine Mutter legt ihm beschwichtigend die Hand auf die Schulter. »Radames«, sagt sie. »Ich denke, Elian braucht dringend etwas Schlaf. Morgen findet der Ball statt. Er hat einen anstrengenden Tag vor sich und sieht sehr erschöpft aus.«
Ich ringe mir ein gequältes Lächeln ab und verbeuge mich kurz. »Ganz wie Ihr meint«, sage ich und wende mich zum Gehen.
Mein Vater hat nie verstanden, wie wichtig es ist, was ich tue. Bei jeder Rückkehr gebe ich mich der Hoffnung hin, dass er ein einziges Mal seine Liebe zu mir über die Liebe zu seinem Königreich stellt. Aber wenn er um meine Sicherheit fürchtet, dann geht es ihm vor allem um die Krone. Er hat zu viele Jahre damit verbracht, das Volk auf mich als den zukünftigen Herrscher einzustimmen, und ist nicht gewillt, daran etwas zu ändern.
»Elian!«, ruft Amara hinter mir her.
Ich achte nicht auf sie, sondern verlasse mit großen, schnellen Schritten den Saal. Zorn wallt in mir hoch. Ich könnte meinen Vater nur stolz machen, indem ich alles aufgebe, was mir wichtig ist.
»Elian«, sagt meine Schwester entschlossen. »Eine Prinzessin darf nicht rennen. Und wenn doch, dann werde ich es verbieten lassen, falls ich je Königin werde.«
Widerwillig bleibe ich stehen und drehe mich zu ihr um. Sie seufzt erleichtert und lehnt sich gegen die Wand. Sie hat ihre Schuhe ausgezogen und ist jetzt noch kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich muss unwillkürlich lächeln. Sie macht ein finsteres Gesicht und versetzt mir einen Schlag gegen den Arm. Ich zucke zusammen und strecke die Hände nach ihr aus.
»Du machst ihn wütend«, sagt sie und nimmt meinen Arm.
»Aber erst, nachdem er mich wütend gemacht hat.«
»Mit deinem Eifer für Wortgefechte wirst du auf dem diplomatischen Parkett sicher eine gute Figur abgeben.«
Ich schüttle den Kopf. »Nicht, wenn du den Thron besteigst.«
»Dann kriege ich wenigstens das Armband.« Sie sieht mir ins Gesicht. »Wie war die Reise? Wie viele Sirenen hat der große Pirat denn erlegt?«
Sie sagt es mit einem schiefen Lächeln, denn sie weiß genau, dass ich nichts von meiner Zeit auf der Saad erzähle. Ich lasse meine Schwester an vielem teilhaben, aber niemals daran. Ich möchte, dass Amara mich als Held sieht und nicht als jemand, der tötet. Mörder sind viel zu oft Schurken.
»Fast keine«, antworte ich. »Ich war bis oben hin voll mit Rum, daher habe ich kaum einen Gedanken an sie verschwendet.«
»Du bist wirklich ein Lügner«, sagt Amara. »Und mit wirklich meine ich wirklich schlecht.«
Wir sind vor ihren Gemächern angelangt und bleiben stehen. »Und du bist wirklich neugierig«, erwidere ich. »Das kenne ich gar nicht von dir.«
Amara geht über meine Bemerkung hinweg. »Willst du nicht noch in den Bankettsaal zu deinen Freunden?«, fragt sie.
Ich schüttle den Kopf. Die Palastwachen werden dafür sorgen, dass meine Seeleute bequeme Betten für die Nacht haben, und ich bin viel zu müde, um noch länger ein Lächeln aufzusetzen.
»Ich gehe schlafen«, sage ich zu ihr. »Ganz wie die Königin es befohlen hat.«
Amara nickt, dann stellt sie sich auf die Zehenspitzen und drückt mir einen Kuss auf die Wange. »Bis morgen«, sagt sie. »Über deine Heldentaten kann ich einfach Kye befragen. Ich glaube nicht, dass er als Diplomatensohn eine Prinzessin belügen würde.« Mit einem frechen Grinsen dreht sie sich um und verschwindet durch die Tür.
Ich bleibe noch einen Augenblick stehen.
Die Vorstellung, dass meine Schwester mit meiner Mannschaft Geschichten austauscht, gefällt mir nicht, aber zumindest kann ich mir bei Kye sicher sein, dass seine Schilderungen nicht allzu blutrünstig ausfallen. Er hat sehr viel Fantasie, aber er ist nicht dumm. Er weiß genau, dass ich mich nicht so benehme, wie ein Prinz es tun sollte, denn er benimmt sich auch nicht wie ein Diplomatensohn. Das ist mein größtes Geheimnis. Man kennt mich als Sirenenjäger und die Leute bei Hof reden mit Wohlwollen und einem Anflug von Belustigung über mich: Ach, Prinz Elian versucht uns alle zu retten. Wenn sie wüssten! Die schrecklichen, unerträglichen Schreie der Sirenen. Die Leichen der Frauen an Deck, bevor sie zu Gischt zerfließen. Wenn sie das einmal mit eigenen Augen sehen würden, stünde ich nicht länger in ihrer Gunst. Ich wäre nicht mehr ihr Prinz, aber sooft ich mich auch danach sehne, über meine Erlebnisse zu sprechen, bin ich doch klug genug, mein Geheimnis für mich zu behalten.
FÜNF
Der Palast von Keto liegt inmitten der See von Diávolos. Dort leben seit jeher unsere Königinnen. Die Menschen haben für jeden Fleck der Erde einen König oder eine Königin. Aber der Ozean kennt nur eine Herrscherin. Nur eine Königin. Das ist meine Mutter. Eines Tages werde ich es sein.
Eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft. Nicht dass meine Mutter zu alt zum Regieren wäre. Das Leben einer Sirene kann hundert Jahre dauern. Wir altern jedoch nur um wenige Jahrzehnte. Das führt dazu, dass Töchter bald wie ihre Mütter aussehen und Mütter wie Schwestern, sodass man kaum sagen kann, wie alt eine Sirene ist. Das ist ein weiterer Grund, warum es bei uns Brauch ist, Herzen zu sammeln. Das Alter einer Sirene ist nicht an ihrem Gesicht abzulesen, sondern zeigt sich daran, wie viele Leben sie schon geraubt hat.
Es ist das erste Mal, dass ich gegen diese Tradition verstoßen habe, und meine Mutter ist außer sich vor Zorn. Sie hat sich drohend vor mir aufgebaut, ganz die herrschsüchtige Tyrannin. Sie macht nicht den Eindruck, als müsste sie in ein paar Jahren abdanken.
Es ist Tradition, dass die Meereskönigin ihre Krone ablegt, sobald sie sechzig Herzen hat. Ich weiß genau, wie viele meine Mutter in ihrem Tresor unter den Palastgärten aufbewahrt. Früher ließ sie jedes Jahr stolz die Zahl ihrer wachsenden Sammlung verkünden. Doch nach dem fünfzigsten Herz verzichtete sie darauf. Sie zählte nicht mehr oder hörte zumindest auf, darüber zu sprechen. Aber ich habe im Stillen weitergemacht. Jedes Jahr habe ich die Herzen meiner Mutter gezählt wie meine eigenen. Daher weiß ich, dass die Krone in drei Jahren mir gehören wird.
»Wie viele hast du jetzt, Lira?«, fragt die Meereskönigin und blickt drohend auf mich herab.
Wiederstrebend neige ich den Kopf. Kahlia ist dicht hinter mir. Ich muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie es mir gleichtut.
»Achtzehn«, antworte ich.
»Achtzehn«, wiederholt die Königin nachdenklich. »Wie seltsam, dass du achtzehn Herzen hast, obwohl dein Geburtstag erst in zwei Wochen ist.«
»Ich weiß, aber –«
»Lass mich dir sagen, was ich weiß.« Die Königin nimmt auf ihrem Knochenthron Platz. »Ich weiß, dass du deine Cousine begleiten solltest, wenn sie ihr fünfzehntes Herz raubt, aber anscheinend war das zu viel verlangt.«
»Eigentlich nicht«, sage ich. »Ich habe sie ja begleitet.«
»Und bei der Gelegenheit hast du dir ein kleines Andenken mitgenommen.«
Sie schlingt ihre Tentakel um meine Taille und zieht mich zu sich heran. Ich spüre, wie meine Rippen unter ihrem eisernen Griff knirschen.
Jede Königin ist früher eine Sirene gewesen. Aber die Magie der Krone beraubt sie ihrer Flossen und verleiht ihr stattdessen mächtige Tentakel, die so stark sind wie ganze Armeen. Ihr Leib nimmt die Gestalt eines Tintenfischs an, und aus dieser Verwandlung bezieht sie ihre unbeugsamen, majestätischen Kräfte, mit denen sie die Meere ihrem Willen unterwerfen kann. Sie ist Meereskönigin und Meereshexe in einem.
Ich habe meine Mutter nicht gekannt, als sie noch eine Sirene war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie je wie alle anderen ausgesehen hat. Ihr Oberkörper ist von uralten roten Symbolen und Zeichen bedeckt, die sich bis über ihre herrlichen Wangenknochen erstrecken. Das Schwarz und Scharlachrot ihrer Tentakel fließen ineinander wie Blut, das sich mit Tinte vermischt, und ihre Augen sind längst zu roten Kristallsteinen geworden.
Ihre Krone ist ein prunkvoller Kopfschmuck, der über ihrer Stirn in spitze Hörner mündet und sich über ihren Rücken fortsetzt wie lange Gliedmaßen, die hinter ihr im Wasser treiben.
»Dafür werde ich an meinem Geburtstag nicht jagen«, versichere ich ihr atemlos.
»Oh doch, das wirst du.« Die Königin streicht über ihren schwarzen Dreizack. Auf der mittleren Zacke schimmert ein Kristall, so blutrot wie ihre Augen. »Der heutige Tag ist nicht passiert. Denn du würdest mir nie den Gehorsam verweigern oder mich in sonst irgendeiner Weise hintergehen. Nicht wahr, Lira?«
Sie quetscht meine Rippen noch etwas fester.
»Natürlich nicht, Mutter.«
»Und du?« Die Königin fixiert Kahlia, während ich mich bemühe, möglichst gelassen zu wirken. Wenn meine Mutter die Sorge in meinen Augen sähe, wäre das nur eine weitere Schwäche, die sie ausnutzen kann.
Kahlia schwimmt zu ihr. Sie hat ihr Haar mit einem Band aus Seetang zurückgebunden. Unter ihren Fingernägeln klebt immer noch die Haut der adékarosinischen Königin. Meine Cousine beugt den Kopf in einer ehrerbietigen Geste. Aber ich weiß es besser. Kahlia kann der Meereskönigin nicht in die Augen blicken, denn wenn sie es täte, würde meine Mutter sofort erkennen, was sie von ihr hält.
»Ich dachte, sie wollte ihn nur töten«, sagt Kahlia. »Ich wusste nicht, dass sie auch auf sein Herz aus war.«
Das ist eine Lüge und ich bin froh darüber.
»Was bist du nur für ein einfältiges Ding, dass du deine eigene Cousine nicht kennst.« Meine Mutter mustert sie mit gierigem Blick. »Ich weiß nicht, ob ich mir eine Strafe ausdenken kann, die grässlich genug ist, um deiner unglaublichen Dummheit gerecht zu werden.«
Ich kralle die Hand in den Tentakel, der meine Taille umschlingt. »Wie auch immer ihre Strafe aussieht«, sage ich. »Ich nehme sie auf mich.«
Das starre Lächeln meiner Mutter bekommt einen Riss und ich weiß, dass ihr all die Gründe durch den Kopf gehen, warum dies mich zu einer unwürdigen Tochter macht. Aber ich kann nicht anders. In einem Meer von Sirenen, die nur auf sich selbst schauen, ist es für mich fast schon zur Selbstverständlichkeit geworden, Kahlia zu beschützen. Seit dem Tag, an dem wir beide mit ansehen mussten, wie ihre Mutter starb. Im Lauf der Jahre hat meine Mutter alles darangesetzt, aus Kahlia und mir vollendete Nachfolgerinnen von Keto zu schaffen. Sie hat uns wie Juwelen geschliffen, bis wir so geformt waren, dass sie Gefallen an uns fand. In Kahlia spiegelt sich meine eigene Kindheit, die ich am liebsten vergessen würde.
Kahlia ist wie ich. Vielleicht ähnelt sie mir sogar etwas zu sehr. Für die Meereskönigin ist das Grund genug, sie zu hassen, und das erweckt wiederum in mir den Wunsch, auf sie aufzupassen. Ich bin immer an ihrer Seite und verteidige sie gegen die Grausamkeiten meiner Mutter. Meine Cousine zu schützen ist keine bewusste Entscheidung mehr, sondern fast schon zu einem Reflex geworden.
»Wie fürsorglich von dir«, sagt die Meereskönigin mit einem verächtlichen Lächeln. »Liegt es an den vielen Herzen, die du gestohlen hast? Hat ihre Menschlichkeit etwa auf dich abgefärbt?«
»Mutter –«
»So eine unverbrüchliche Treue zu jemand anderem als deiner Königin«, seufzt sie. »Ich frage mich, ob du dich auch den Menschen gegenüber so verhältst. Sag mir, Lira, weinst du um ihre gebrochenen Herzen?«
Sie lockert ihren Griff und stößt mich angewidert von sich. Ich hasse, wie ich mich verändere, sobald sie in der Nähe ist: ein blasses Abbild meiner selbst, unwürdig, die Krone zu erben. In ihren Augen bin ich eine Versagerin. Egal wie viele Prinzen ich erjage, im Töten werde ich ihr nie ebenbürtig sein.
Ich bin nicht kalt genug für den Ozean, der mir das Leben geschenkt hat.
»Nun gib es schon her, damit wir es hinter uns bringen können«, fordert mich die Königin ungeduldig auf.
»Gib es her?«, wiederhole ich stirnrunzelnd.
Die Königin streckt die Hand aus. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«
Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, dass sie vom Herz des Prinzen spricht.
»Aber …« Ich schüttle den Kopf. »Es gehört mir.«
Ich höre mich an wie ein störrisches Kind.
Die Lippen der Meereskönigin kräuseln sich. »Du wirst es mir geben«, sagt sie. »Und zwar sofort.«
Als ich ihren Gesichtsausdruck sehe, drehe ich mich um und schwimme wortlos zu meinem Schlafgemach. Dort liegt das Prinzenherz neben siebzehn weiteren begraben. Behutsam durchwühle ich die frische Schicht von Meereskies und hole das Herz hervor. Es ist sand- und blutverkrustet und fühlt sich immer noch warm an. Ich halte mich nicht damit auf, über den Schmerz nachzudenken, den mir dieser Verlust bereiten wird, sondern kehre zu meiner Mutter zurück und biete es ihr dar.
Die Meereskönigin streckt einen Tentakel aus und greift sich das Herz. Eine Weile lang hält sie meinen Blick fest, nimmt jede meiner Gefühlsregungen wahr. Sie kostet den Moment aus. Dann drückt sie zu.
Das Herz explodiert in einer grässlichen Fontäne aus Blut und Fleisch. Kleine Teilchen treiben wie Ozeanstaub im Wasser. Einige lösen sich auf. Andere sinken schwebend wie Federn auf den Meeresgrund.
Ein scharfes Stechen durchzuckt meine Brust, in der ein wilder Strudel tobt, als die Magie des Herzens mich verlässt. Die Schockwellen sind so stark, dass die Fächer meiner Flosse sich in einer Muschel verfangen und aufreißen. Mein Blut strömt ins Wasser und vermischt sich mit dem des Prinzen.
Sirenenblut ist ganz anders als Menschenblut. Zum einen ist es kalt. Zum anderen brennt es. Menschenblut fließt und tropft und sammelt sich zu Pfützen, das Blut einer Sirene wirft Blasen und brodelt und lässt Haut zerschmelzen.
Ich sinke auf den Meeresgrund und kralle die Hände so tief in den Sand, dass meine Finger auf Fels stoßen und ein Fingernagel absplittert. Ich ringe nach Atem, schlucke Wasser und huste es würgend wieder aus. Ich habe das Gefühl zu ertrinken. Bei dem Gedanken muss ich fast lachen.
Wenn eine Sirene ein Menschenherz raubt, entsteht eine ganz besondere Verbindung. Es ist ein uralter Zauber, der nicht leicht zu brechen ist. Wenn wir uns Herzen nehmen, geht ihre Macht auf uns über und wir verleiben uns die Jugend und Lebenskraft ein. Als mir das Herz des adékarosinischen Prinzen entrissen wird, fließt seine Macht ins Meer und löst sich vor meinen Augen in nichts auf.
Zitternd erhebe ich mich. Meine Glieder sind schwer wie Eisen und meine Flosse pocht. Der wunderschöne rote Seetang, den ich um meine Brüste geschlungen habe, hat sich gelockert und ist nach unten gerutscht. Kahlia wendet sich ab, damit meine Mutter ihren Schmerz nicht sieht.
»Wunderbar«, sagt die Königin. »Und nun kommt die Strafe.«
Jetzt muss ich doch lachen. Meine Kehle ist rau. Ich fühle mich schwächer als jemals zuvor.
»War das noch nicht die Strafe?«, keuche ich. »Du hast mir gewaltsam einen Teil meiner Macht entrissen.«
»Oh doch, es war sogar eine sehr passende Strafe«, erwidert die Meereskönigin. »Ich hätte mir keine bessere Lektion für dich einfallen lassen können.«
»Was willst du dann noch?«
Sie lächelt und entblößt ihre elfenbeinernen Fangzähne. »Es fehlt noch Kahlias Strafe«, antwortet sie. »Die du ja unbedingt übernehmen willst.«
Meine Brust wird ganz eng. Ich erkenne das Angst einflößende Glitzern in den Augen meiner Mutter, denn ich habe diesen Blick von ihr geerbt. Ich hasse es, diesen Blick bei ihr zu sehen, denn ich weiß, was er bedeutet.
»Es wird mir schon das Richtige für dich einfallen.« Die Königin fährt mit der Zunge über ihre Zähne. »Ich werde dir eine wertvolle Lehre von der Macht der Geduld erteilen.«
Ich unterdrücke ein spöttisches Grinsen, denn ich weiß, dass ich es bitter bereuen würde. »Spann mich nicht auf die Folter.«
Die Meereskönigin sieht mich vielsagend an. »Du hast Schmerz immer genossen«, sagt sie.
Aus dem Mund meiner Mutter ist das fast ein Lob, daher zwinge ich mich zu einem klebrig süßen Lächeln und sage: »Schmerz tut nicht immer weh.«
Die Meereskönigin sieht mich herablassend an. »Tatsächlich?« Ihre Augenbrauen schießen in die Höhe und mein Hochmut gerät ins Wanken. »Wenn das so ist, muss ich dir wohl die Gelegenheit geben, so viel Schmerz auf dich zu nehmen, wie es dir beliebt, wenn du an deinem Geburtstag dein nächstes Herz stiehlst.«
Ich schaue sie argwöhnisch an. »Ich verstehe nicht.«
»Nur diesmal«, fährt die Königin fort, »wirst du statt der Prinzen, die du so gekonnt in die Falle lockst, eine andere Beute erjagen.« Sie klingt unbarmherziger, als ich es je könnte. »Dein achtzehntes Herz wird das eines Matrosen sein. Und wie jedes Jahr wirst du zur Feier deiner Geburt vor dem ganzen Königreich deine Trophäe präsentieren.«
Ich starre meine Mutter an und beiße mir so fest auf die Zunge, dass meine Zähne sich fast berühren.
Sie will mich nicht bestrafen, sie will mich demütigen. Sie will dem Volk, dessen Furcht und Treue ich mir erworben habe, vor Augen führen, dass ich nichts Besonderes bin. Eine Sirene wie jede andere. Dass ich es nicht würdig bin, die Krone zu tragen.
Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, so zu sein, wie meine Mutter es will – nämlich die Schlimmste von allen. Ich habe alles unternommen, um zu beweisen, dass ich den Dreizack verdiene. Ich wurde zum Fluch der Prinzen – ein Titel, unter dem mich die ganze Welt kennt. Um unser Königreich und meiner Mutter willen bin ich erbarmungslos geworden. Und diese Erbarmungslosigkeit hat jeder Meereskreatur gezeigt, dass ich eine Herrscherin sein kann. Jetzt will mir meine Mutter genau dies wegnehmen. Nicht nur meinen Namen, sondern auch das Vertrauen der Meere in mich. Wenn ich nicht mehr der Fluch der Prinzen bin, dann bin ich nichts. Nur eine Prinzessin, die eine Krone erbt, statt sie zu verdienen.
SECHS
»Ich kann mich nicht erinnern, wann ich dich das letzte Mal so gesehen habe.«
»Wie denn?«
»So zurechtgemacht.«
»Zurechtgemacht?«, wiederhole ich und streiche meinen Kragen glatt.
»So gut aussehend«, sagt Madrid.
Ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Sehe ich denn sonst etwa nicht gut aus?«
»Normalerweise bist du nicht so sauber«, antwortet sie. »Und deine Haare sind auch nicht so …«
»Zurechtgemacht?«
Madrid krempelt ihre Ärmel hoch. »Wie die eines Prinzen.«
Ich ziehe eine Grimasse und blicke in den Spiegel. Meine Haare sind glatt zurückgekämmt und ich bin von Kopf bis Fuß so sauber geschrubbt, dass alle Spuren des Ozeans verschwunden sind. Ich trage ein elegantes weißes Hemd mit hochgeknöpftem Kragen und darüber eine tiefgoldene Jacke, die sich auf meiner Haut wie Seide anfühlt. Was wohl daran liegt, dass sie aus Seide ist. Der Ring mit dem Familienwappen schneidet in meinen Daumen ein und von all dem Gold, das ich heute trage, funkelt dieses Schmuckstück am hellsten.
»Du siehst aus wie immer«, sage ich zu Madrid. »Nur die Schlammspritzer fehlen.« Sie streckt mir die Zunge heraus und bindet ihr mitternachtsdunkles Haar mit einem Tuch zurück, sodass man die Tätowierung der Kléftesi an ihrer Schläfe sehen kann. Es ist das Brandzeichen der Kinder, die auf Sklavenschiffen fortgebracht wurden, um sich als Auftragsmörder zu verdingen. Als ich Madrid zum ersten Mal begegnet bin, hatte sie sich gerade mit einer geladenen Pistole ihre Freiheit erkauft.
Kye und Torik warten an der Tür. Torik mit seinen ausgefransten Hosen und Kye mit den prägnanten Wangenknochen und einem Lächeln, dem alle auf den Leim gehen. Ihre Gesichter mögen sauber sein, aber sonst sind sie so wie immer. Sie sind unfähig, sich zu verbiegen, und darum beneide ich sie.
»Kommt mit«, sagt Kye und verschränkt seine Finger mit denen von Madrid. Für dieses Zeichen der Zuneigung erntet er von ihr einen finsteren Blick – die beiden verstehen sich besser aufs Kämpfen als aufs Lieben –, und Madrid macht sich von ihm los, um sich mit der Hand durchs Haar zu fahren.
»Du fühlst dich im Wirtshaus viel wohler als hier«, sagt Madrid.
Sie hat recht. Der Rest meiner Mannschaft ist bereits auf dem Weg zur Goldenen Gans – die Taschen voller Gold, um sich zu betrinken, bis die Sonne aufgeht. Nur meine drei engsten Vertrauten sind bei mir geblieben.
»Es ist ein Ball zu meinen Ehren«, sage ich zu ihnen. »Und es wäre nicht sehr ehrenwert, wenn ich mich dort nicht blicken lasse.«
»Vielleicht würde es keinem auffallen.« Madrids zurückgebundenes Haar schwingt hin und her, während sie das sagt.
»Das muntert mich nicht gerade auf.«
Kye knufft sie und sie stößt ihn heftiger als nötig zurück. »Lass das!«, faucht sie ihn an.
»Nur wenn du ihn nicht noch weiter aufstachelst«, erwidert Kye. »Lass den Prinzen dieses eine Mal Prinz sein. Ich brauche dringend etwas zu trinken. Außerdem habe ich das Gefühl, diesen makellosen Raum zu beschmutzen, nur indem ich hier herumstehe.«
Ich nicke. »Ja, ich komme mir auch schon ganz bedürftig vor, wenn ich dich ansehe.«
Kye schnappt sich ein golddurchwirktes Kissen vom nächstbesten Sofa und schleudert es auf mich, zielt dabei aber so erbärmlich schlecht, dass es neben meinen Füßen landet. Ich verpasse dem Kissen einen Tritt und bemühe mich, einen strafenden Blick aufzusetzen.
»Ich will nur hoffen, dass du im Messerwerfen besser bist.«
»Bisher hat sich noch keine Sirene beschwert«, erwidert er. »Ist es wirklich in Ordnung, wenn wir gehen?«
Ich betrachte den Prinzen, der mir aus dem Spiegel entgegenblickt. Perfekt und glatt und fast ohne jedes Funkeln in den Augen. Als wäre ich unberührbar und mir dessen nur allzu bewusst. Madrid hat recht, ich sehe aus wie ein Prinz. Mit anderen Worten: Ich sehe aus wie ein Lackaffe.
Ich streiche noch einmal über meinen Kragen. »Ja, es ist in Ordnung.«
Der Ballsaal glänzt wie eine Sonne. Überall glitzert und funkelt es. Wenn ich zu lange auf eine Stelle blicke, fängt mein Kopf an wild zu pochen.
»Wie lange werdet Ihr an Land bleiben?«
Nadir Pasha, einer unserer höchsten Würdenträger, schwenkt einen Goldkelch mit Branntwein. Im Vergleich zu den anderen Pashas – Würdenträger aus Politik und Militär –, mit denen ich heute Abend müßige Konversation betrieben habe, ist er nicht ganz so öde. Daher hebe ich ihn mir bei den Gesprächsrunden bei Hof immer bis zum Schluss auf. Nichts liegt ihm ferner, als über Staatsangelegenheiten zu sprechen – erst recht nicht, wenn die Branntweingläser so gut gefüllt sind wie hier.
»Nur ein paar Tage«, antworte ich.
»Immer auf der Suche nach Abenteuer!«, ruft Nadir aus und genehmigt sich einen großen Schluck. »Was für ein Vergnügen es doch ist, jung zu sein!«
Halina, seine Frau, streicht ihr smaragdgrünes Kleid glatt. »In der Tat.«
»Womit ich nicht behaupten will, dass du oder ich uns noch daran erinnern könnten«, seufzt Pasha.
»Es fällt schwer, das zu glauben.« Ich führe Halinas Hand an meine Lippen. »Ihr strahlt heller als jede goldbestickte Tapisserie.«
Mein Kompliment ist fadenscheinig und leicht zu durchschauen, aber dennoch knickst Halina vor mir. »Vielen Dank, Mylord.«
»Es ist bewundernswert, wie ernst Ihr Eure Pflichten nehmt«, sagt Nadir. »Man erzählt sich, dass Ihr unglaublich viele Sprachen beherrscht. Das wird bei zukünftigen Verhandlungen mit benachbarten Königreichen zweifellos von Vorteil sein. Wie viele Sprachen sind es inzwischen?«
»Fünfzehn«, antworte ich. »In meinen jungen Jahren habe ich mir vorgenommen, alle Sprachen der hundert Königreiche zu erlernen. Ich fürchte, ich bin grandios gescheitert.«
»Wozu soll das auch gut sein?«, wundert sich Halina. »Es gibt kaum jemanden, der nicht Midasan spricht. Wir sind die Mitte der Welt, Hoheit. Wenn sich jemand nicht die Mühe macht, unsere Sprache zu erlernen, lohnt es sich auch nicht, mit ihm zu reden.«
»Sehr richtig«, stimmt Nadir schroff zu. »Aber eigentlich habe ich eine andere Sprache gemeint, Hoheit. Die Sprache der anderen, die verbotene Sprache.« Er senkt seine Stimme und beugt sich so weit vor, dass sein Schnurrbart mein Ohr kitzelt. »Psáriin.«
Die Sprache des Meeres.
»Nadir!«, zischt Halina erschrocken und versetzt ihrem Mann einen Schlag gegen die Schulter. »Wie kannst du so etwas sagen?« Sie wendet sich an mich. »Verzeiht, wenn wir Euch beleidigt haben, Herr«, sagt sie. »Mein Mann wollte nicht andeuten, dass Ihr Eure Zunge mit einer solchen Sprache besudelt. Er hat mehr Branntwein genossen, als ihm guttut. Die Gläser fassen mehr, als man meint.«